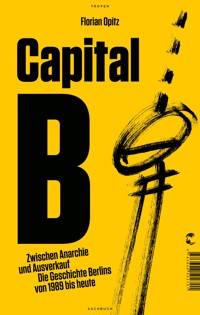
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Guten Morgen, Berlin, Du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau.« Peter Fox Kaum eine Stadt hat so viel erlebt wie Berlin von '89 bis heute. Mehr als drei Jahrzehnte Licht und Schatten, mehr als drei Jahrzehnte »arm, aber sexy«. Eine weltweit gefeierte Sub- und Clubkultur auf der einen Seite, politische Skandale, Gentrifizierung und Ausverkauf auf der anderen. In Capital B wird diese einzigartige Stadtgeschichte von denen erzählt, die sie geprägt haben: Größen der Musikwelt wie Peter Fox, Kool Savas oder Sookee. Pionieren der Techno- und Clubkultur von Loveparade über den Tresor bis zur Bar 25 wie u. a. Danielle de Picciotto und Dimitri Hegemann. Den Regierenden Eberhard Diepgen, Klaus Wowereit und Franziska Giffey, skandalumwitterten Politikern wie Klaus Rüdiger Landowsky und Thilo Sarrazin. Hausbesetzern und Aktivisten wie Andrej Holm und Pamela Schobeß, Unternehmern, Clan-Mitgliedern uvm. Der preisgekrönte Filmemacher und Autor Florian Opitz erschafft mit Capital B eine rasante Nachwendegeschichte, die die Mechanismen der Macht ebenso offenlegt wie die Möglichkeiten von Kollektiven und Kultur. Mit zahlreichen Fotos von Ben De Biel, Harald Hauswald u. a. Der Mauerfall im November 1989 bot die historische Chance, eine Stadt von Null auf neu zu denken. Capital B erzählt von dieser besonderen Zeit und davon, wie Berlin von einer eher provinziellen Großstadt zu jener Weltmetropole geworden ist, die heute zwar Boomtown ist und doch unregierbar zu sein scheint. Eine Geschichte, die so inspirierend wie dramatisch ist: Der Sommer der Anarchie und der Anfang der Technoszene, die legendären Hausbesetzungen, das Massenphänomen Love Parade, der brachiale Neubau des Potsdamer Platzes, der Berliner Bankenskandal, das Desaster um den Flughafenneubau. Und schließlich und immer stärker die Gentrifizierung und der Ausverkauf der Stadt. Spannend, vielstimmig und mit großer Tiefe geht Capital B der Frage nach: Berlin, was hat Dich bloß so ruiniert? Ein Buch wie eine Nacht im Berghain und gleichzeitig eine Liebeserklärung an die widerspenstigen Bürger dieser Stadt. Pressestimmen zur gleichnamigen, preisgekrönten Doku-Serie: »... ein Meilenstein des dokumentarischen Fernsehens!« EPD Medien »ein ARTE-Meisterwerk« DWDL »Große Kunst [...] eine multiperspektivische Stadtsoziologie [...] so kunstvoll montiert, dass daraus die neue Symphonie einer Großstadt wird.« Süddeutsche Zeitung »Staunen. Staunen, dass so etwas noch produziert und gesendet wird im Fernsehen [...] ›Capital B‹ [...] stellt die Frage, auf die es ankommt.« Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung »Guckbefehl für alle, denen Berlin etwas bedeutet.« taz »Schon nach wenigen Minuten [...] hängt man am Haken und würde alle Teile am liebsten durchbingen. Die fünf Folgen [...] verfügen über einen ausgeprägten Beat, der die Zeit wie im Flug vergehen lässt. Virtuos verbinden der Regisseur Florian Opitz und seine Mitstreiter*innen die verschiedenen Perspektiven.« Kino Zeit »So dicht, so bildreich und so kontrastreich. Ein Pflichtprogramm für alle, die das Berlin von heute verstehen wollen« Berliner Zeitung »eine großartige Serie« Die Zeit »Aufwändig recherchiert [...] zeigt erstmals das große Bild.« Der Spiegel »Kocht selbst die abgebrühtesten Berliner nochmal weich.« Tagesspiegel »Es ist eindrucksvoll, wie es der Serie gelingt, bei aller Komplexität der Vorgänge elegant Verbindungen zwischen dem Oben und Unten zu schaffen« Die Zeit »Die Mischung ist es, die ›Capital B‹ so sehenswert macht« Freitag »Florian Opitz ist einer der besten Dokumentarfilmer Deutschlands. Zu sagen, dass Florian Opitz' neue Doku-Serie ›Capital B – Wem gehört Berlin?‹ von der Kritik gelobt wurde, ist eine grandiose Untertreibung. Die Reaktionen sind hymnisch. Taz, Süddeutsche Zeitung, FAZ, auch der SPIEGEL sind hingerissen.« Juan Moreno in Der Spiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Florian Opitz
Capital B
Zwischen Anarchie und Ausverkauf
Die Geschichte Berlins von 1989 bis heute
Tropen Sachbuch
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Tropen
www.tropen.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70 178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Ariane Spanier Design, Berlin
unter Verwendung einer Illustration von © Ariane Spanier Design, Berlin
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-50270-1
E-Book ISBN 978-3-608-12386-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
1
Sommer der Anarchie 1989–1990
Die Nacht, die alles verändert
Alles neu
Stadtpolitik – Wer die Hosen anhat
Willkommen im Goldenen Westen
Uns gehört die Stadt – Der Wilde Osten
Herausforderungen
Die Ursuppe des Techno
Rot-Grün im Dauerstress
Leerstand, Brachen und besetzte Häuser
Streit um den Potsdamer Platz
Sommer der Anarchie
Hausbesetzungen
Einheitstaumel, Nationalismus und Widerstand
Der Traum ist aus – Die Räumung der Mainzer Strasse
Das Ende von Rot-Grün
2
Größenwahn 1990–1995
Die alte Garde ist zurück – Grosse Koalition für Berlin
Loveparade
Metropolenträume
Baseballschlägerjahre
DT64 – Power from the Eastside
Filetgrundstücke
Opfer
Leipziger Straße 126a
Bonn oder Berlin?
Das Gemetzel – Abbau Ost
Die Stimme des Ostens wird abgewickelt
Tresor
Plötzlich unerwünscht – Migranten in Berlin
NOlympia 2000
Größenwahn im neuen Zentrum
3
Absturz 1995–2001
High Society verzweifelt gesucht
Hoch gepokert
Loveparade und Wohnzimmerbars
Der Prenzlberg – Ein Kiez verändert sein Gesicht
Kreuzberg auf dem Weg zum Ghetto?
Tief gefallen
Der große Ausverkauf
Der Bankenskandal
»Ich bin schwul – und das ist auch gut so«
Der Tote im Grunewald
Folgen des Grössenwahns
Vom Hof gejagt – Das Ende der Großen Koalition
4
Arm, aber sexy 2001–2008
Der Neue
Das Milliardenloch und der Kettenhund
Harter Sound für eine harte Stadt
In der Schuldenfalle
Vom Underground zur Musikhauptstadt
Party am Spreeufer
Sparen, bis es quietscht
»Arm, aber sexy« – Die Erfindung des neuen Berlin
Easyjetset
Bar25
Neukölln – Der »Problembezirk«
Der neue Berliner Flughafen
Alles wird verscherbelt
Sarrazins Hartz-IV-Menü
Zurück zum Beton
Noch eine Bankenkrise
5
Die Stadt als Beute 2009–2024
Die Finanzkrise trifft Berlin
Hipstermetropole
Betongold
Sarrazin zündelt
Alle lieben Wowi
Gentrifizierung und Verdrängung
Immer wieder Neukölln
Kotti & Co – Die Stadt wehrt sich
Desaster im märkischen Sand
Tempelhofer Feld
Wowi sagt Goodbye
Stolperstart für Rot-Rot-Grün – Die »Affäre Holm«
Clans von Neukölln
Biotop in der Betonwüste
Mietenwahnsinn und Widerstand
Und wem gehört jetzt die Stadt?
Tafelteil
Epilog
Dank
Personen
Vorwort
1990 bin ich zum ersten Mal in Berlin gewesen. Auf einer Jugendreise aus der badischen Provinz. Ich war 16, die Mauer war gerade gefallen und noch war völlig unklar, wohin sich diese Stadt entwickeln würde, die aus zwei völlig disparaten Teilen bestand: dem eingemauerten West-Berlin und Ost-Berlin, der ehemaligen Hauptstadt der DDR. Die Stadt faszinierte mich sofort. Und diese Faszination hat bis heute nicht nachgelassen.
16 Jahre später, nach unzähligen Besuchen bei Freunden, die es nach Berlin verschlagen hatte und die – das erinnere ich bis heute besonders – von Besuch zu Besuch größere und tollere Wohnungen zu haben schienen, bin ich dann selbst nach Berlin gezogen. Nicht wegen der billigen Wohnungen. Nicht wegen der Partys in der Stadt. Der Liebe wegen.
Eine Wohnung habe ich bereits am ersten Abend gefunden, 80 Quadratmeter für 320 Euro Miete, und das in Kreuzberg, mittendrin. Das war 2006 noch der Normalfall in Berlin. Auch wenn es schon den gentrifizierten Prenzlauer Berg gab, waren immer noch genügend Viertel zum Ausweichen da.
Eines fiel mir nach meiner Ankunft in Berlin sofort auf: Kein Ort, an dem ich bis dahin gelebt hatte, veränderte sich so rasend schnell. Berlin war im permanenten Wandel und ist es bis heute. Ob zum Guten oder zum Schlechten, das ist die große Frage.
Noch einmal zwölf Jahre vorgespult. Es ist das Jahr 2018. Inzwischen war ich Vater dreier Berliner Jungs geworden und hatte noch nirgendwo so lange gelebt wie hier. Berlin war wegen einer grandios vermasselten und ewig unfertigen Flughafen-Großbaustelle zum Gespött der ganzen Welt geworden und inzwischen sprach man im In- und Ausland von einer failed city, einer gescheiterten Stadt. Aus der Utopie des Sommers 1990 schien eine Dystopie geworden zu sein.
Gleichzeitig erlebte ein Genre in Deutschland große Erfolge, das bis dahin ein verstaubtes Nischendasein im deutschen Bildungsfernsehen fristete: die Dokuserie. Dank Netflix wurde es quasi über Nacht überaus populär. Eine Entwicklung, die ich mit großem Interesse verfolgte, bot sie uns Dokumentarfilmern und Dokumentarfilmerinnen doch die Möglichkeit, endlich auch epische Geschichten für ein großes Publikum erzählen zu können. Und genau das wollten wir, mein Kollege David Bernet und ich.
Also begaben wir uns auf die Suche nach einer solchen Geschichte. Es dauerte nicht lange. Der Stoff für eine wirklich epische Geschichte mit viel Drama lag buchstäblich direkt vor unserer Haustür: die Geschichte Berlins seit dem Mauerfall. Wir wollten von den verschlungenen Wegen erzählen, wie Berlin zu dem wurde, was es heute ist: eine pulsierende Weltmetropole, in die es Künstler:innen,Kreative, Freigeister und Dissident:innen aus der ganzen Welt zieht. Von den großen politischen Skandalen, den gescheiterten Träumen, den Konflikten und Verbrechen, die sich auf dem Weg dorthin ereignet haben. Und natürlich von den Menschen, die diese Zeit geprägt haben, im Guten wie im Schlechten. Ein fantastischer und wahrhaft epischer Stoff, davon waren wir gleich überzeugt.
Über Berlin wurde schon oft geschrieben, von Berlin Alexanderplatz (1929) über Herr Lehmann (2001) bis zur monumentalen Gesamtdarstellung Berlin – Biographie einer großen Stadt (2019). Auch im Film wurde Berlin oft thematisiert, wiederholt sogar meisterhaft, von Berlin – Die Sinfonie der Großstadt (1927) über Der Himmel über Berlin (1987) und 24 h Berlin – Ein Tag im Leben (2009) bis zu B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979–1989 (2015), einem Kinodokumentarfilm über die Berliner Musikkultur der Vorwendejahre. Viel ist außerdem schon über das Leben im geteilten Berlin nachgedacht und berichtet worden und darüber, wie es zum Mauerfall gekommen ist.
Doch was direkt nach dem Mauerfall in Berlin geschehen ist, welche Chancen und Hoffnungen für viele mit der nun offenen Stadt verbunden waren, wie diese Chancen genutzt oder vergeigt wurden, welche Skandale diese Stadt auf diesem Weg produziert und wer die Stadt besonders geprägt hat, das schien verschüttet und vergessen: ein blinder Fleck im kollektiven Gedächtnis. Bei der Recherche zu Capital B fiel mir auf, dass diese Stadt, die so übervoll an Geschichte ist, gleichzeitig geradezu geschichtsvergessen war, was die Zeit nach dem Mauerfall bis heute angeht. Es war damals dazu keine einzige übergreifende historische Darstellung im Buchhandel zu finden.
Ja, wir erinnern uns vielleicht noch an Techno und Hausbesetzung Anfang der 90er, Tresor, E-Werk und Loveparade und so. Aber wie hieß noch mal der damalige Regierende Bürgermeister? Der Prenzlauer Berg war plötzlich voller Schwaben, schick, teuer und irgendwie langweilig geworden, klar. Aber sonst? Wie kam es dazu und was hätte auch ganz anders kommen können?
Capital B legt die verschütteten Erinnerungen frei und versucht, historische Zusammenhänge aufzuzeigen. Denn vieles, worüber wir heute staunen oder uns ärgern, lässt sich durch den Blick in die jüngste Geschichte dieser Stadt richtig verstehen.
Für Capital B haben wir fünf Jahre recherchiert, mehr als 40 lange Interviews und unzählige Hintergrundgespräche mit entscheidenden Protagonist:innen aus 35 Jahren Stadtgeschichte geführt, tausende Fotos aus unterschiedlichsten Quellen gesichtet, 4000 Stunden Film- und Video-Archivmaterial und ein umfangreiches Pressearchiv zusammengetragen, um die faszinierende Geschichte der deutschen Hauptstadt von 1989 bis heute wie ein riesiges Puzzle rekonstruieren und aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln erzählen zu können: Berlins Weg von der eher provinziellen, vor allem für Künstler:innen und Aussteiger:innen interessanten Mauerstadt, zur gehypten Metropole, die am eigenen Erfolg zu ersticken droht.
Entstanden ist eine Oral History Berlins nach dem Mauerfall. Denn wer könnte die Geschichte der Stadt besser erzählen als diejenigen, die sie geschrieben und geprägt haben?
Zu Wort kommen prominente Verantwortliche aus Politik und Wirtschaft wie die ehemaligen Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) und Klaus Wowereit (SPD), Klaus-Rüdiger Landowsky (CDU), lange der »Strippenzieher der Berliner Politik« und die »graue Eminenz«, Renate Künast und Wolfgang Wieland, beide langjährige Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus, Thilo Sarrazin, ehemaliger SPD-Finanzsenator und höchst umstrittener Buchautor, sowie die Immobilienunternehmer Roland Ernst und Jürgen Leibfried, um nur einige zu nennen.
Aber die Geschichte Berlins nur auf Politik und Wirtschaft zu reduzieren, wäre ein unverzeihlicher Fehler, denn kaum eine Metropole der Welt wurde und wird so stark von der Subkultur und der Zivilgesellschaft geprägt wie Berlin. Und daher sollte eine Geschichte Berlins nicht ohne die starken Stimmen derjenigen erzählt werden, die Berlin mindestens so stark geprägt haben wie ihre Politiker:innen, Bürgermeister:innen und Immobilienmogule. Stellvertretend für die Subkultur und die Zivilgesellschaft blicken u. a. die Technopionier:innen Danielle de Picciotto, Johnnie Stieler und Dimitri Hegemann, die Rapper:innen Kool Savas und Sookee, der Musiker Peter Fox, die Autor:innen Marion Brasch, Alexander Osang und Güner Balci sowie Clanmitglied, Musiker und Schauspieler Mohamed Chahrour aus internationaler, Ost-Berliner und migrantischer Perspektive auf die Zeitläufte der Stadt.
Capital B ist eine Collage der Erinnerungen unserer Zeitzeug:innen aus ganz unterschiedlichen Milieus, ergänzt durch Presse-, Radio- und TV-Berichte, die die Erinnerungen unserer Protagonist:innen in die Diskurse der Zeit einbetten. Denn es gibt sie ja ohnehin nicht, die eine allgemeingültige Geschichte Berlins. Jedes Milieu dieser Stadt erzählt die Geschichte Berlins anders und aus ihrer jeweiligen besonderen und sehr subjektiven Perspektive.
Am Anfang von Capital B erleben wir die Stadt nach dem Mauerfall als verfallenes Paradies und Eldorado für Abenteurer aller Art. Ein Paradies, in dem für einen kurzen Moment der Geschichte alles möglich schien und so wild wie möglich geträumt werden durfte, auch wenn die Träume unserer Protagonist:innen kaum unterschiedlicher hätten sein können. In einer Hälfte der Stadt gab es schließlich keine Autoritäten mehr, die sich zuständig fühlten. Doch eines gab es im Überfluss: Raum. Raum für Abenteuer, Raum für Kultur, Raum für Projekte und Ateliers, Raum zum Wohnen. Aber auch Raum für Geschäfte und Spekulationen.
Wie passt dieses Berlin von 1990 zu dem, das wir heute vor uns sehen? Eine Metropole mit knapp vier Millionen Einwohner:innen, in die es zwar Millionen Menschen aus aller Welt zieht, in der aber seit Jahren Wohnungsnot und Mietwucher die großen Themen für die Bürger:innen sind. Eine Stadt, in der Millionen Quadratmeter Büroimmobilien leer stehen, aber für diejenigen, die sie zu dem gemacht hat, was sie heute ist, kein Platz mehr ist. Sie können sich schlicht nicht mehr leisten, hier zu leben. Davon, was dazwischen passiert und vielfach in Vergessenheit geraten ist, handelt dieses Buch.
In diesem Dazwischen erleben wir 35 Jahre Machtpolitik, Korruption, die Entstehung verschiedener Jugend- und Subkulturen, Häuserkampf und Kriminalität sowie den Aufstieg und Fall machthungriger Politiker und gieriger Unternehmer. Doch Capital B erzählt auch davon, wie die Bürger:innen Berlins sich seit drei Jahrzehnten wehren: gegen den Ausverkauf ihrer Stadt, ihre Verdrängung und dagegen, dass Berlin das gleiche Schicksal erleidet wie zuvor schon London, New York und Paris, nämlich zu einem langweiligen Biotop für Reiche und Investoren zu werden.
Capital B beginnt mit den Hausbesetzungen der Wendezeit, die der West-Berliner Momper-Senat als erste Amtshandlung nach der Vereinigung räumen lässt – mit einer Brutalität, die man eigentlich eher der DDR zugetraut hätte. Und sie endet im Heute, im Jahr 2025. Wie 1990 regiert wieder eine Große Koalition aus CDU und SPD.
Und nun? Hat die Politik aus der Geschichte gelernt? Begreift sie die gemachten Erfahrungen als Chance und bezieht die bewegte und engagierte Zivilgesellschaft der Stadt in ihre Entscheidungen mit ein? Oder macht sie die gleichen Fehler wieder und wieder? »Fehler zu machen, ist menschlich. Fehler zu wiederholen, ist schmerzlich. Dieselben Fehler immer wieder zu machen, ist dämlich«, lautet ein bekanntes Bonmot. Der Mauerfall im November 1989 bot dem geteilten Berlin die einmalige historische Chance, eine Stadt von null auf neu zu denken und aufzubauen. Alles schien möglich. Wurde diese Chance genutzt? Ist das Berlin von heute eine Erfolgsgeschichte oder eher eine failed city? Oder gar beides zugleich? Davon können Sie sich in diesem Buch selbst ein Bild machen.
1
Sommer der Anarchie 1989–1990
Die Nacht, die alles verändert
Alexander »Sandy« Kaltenborn · Als am 9. November die Mauer fiel, hab ich gerade in den USA gelebt. Ich war 19 Jahre, Punk aus dem Ruhrgebiet, und lebte seit einem Dreivierteljahr in einer WG im damals noch alternativen und migrantischen Mission District in San Francisco. Ein paar Wochen davor hatte ich auf der Straße einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher gefunden. Der lief am 9. November natürlich ununterbrochen in meinem WG-Zimmer. Es gab ständig Live-Schalten vom Brandenburger Tor und vom Grenzübergang an der Bornholmer Straße und ich sah, wie sich die Menschen in den Armen lagen und heulten und nicht glauben konnten, dass die Mauer jetzt gefallen war. Ich hab mir das ganz alleine in meinem WG-Zimmer in San Francisco angeschaut.
Danielle de Picciotto · Ich bin 1987 von New York nach Berlin gezogen und ausgerechnet an diesem Abend bin ich zum ersten Mal, seitdem ich hierhingezogen war, für ein paar Tage nicht in Berlin gewesen. Darüber ärgere ich mich heute noch. Ich war mit ein paar Freundinnen zu einer Ausstellung und Modenschau in Graz eingeladen. Nach der Show saßen wir am späten Abend in einer Wohnung, als plötzlich das Telefon nonstop klingelte. Ich nahm den Hörer ab, damals noch auf so einem alten grauen Telefon mit Wählscheibe, und Motte, mein damaliger Freund, war dran. Er schrie heulend: »Danielle, die Mauer … die Mauer ist gefallen, von überall kommen die Ost-Berliner zu uns in den Westen. Ich kann jetzt einfach nach Hamburg laufen und keiner hält mich auf!« Motte war wirklich überwältigt. Er ist ein Jahr vor dem Mauerbau in West-Berlin geboren, er kannte nichts als das geteilte Berlin. Meine Freundinnen und ich saßen dann stumm vor dem Fernseher, bis eine von ihnen sagte: »Die Stadt, die wir vor ein paar Tagen verlassen haben, wird es bei unserer Rückkehr nicht mehr geben.« Und sie hatte recht.
Alexander »Sandy« Kaltenborn · Ich hab mir das also auf meinem kleinen Fernseher angeschaut und war auf der einen Seite ganz gerührt. Das war bizarr, weil ich nicht zu der Generation gehöre, für die der Mauerbau so was Wichtiges war. Aber trotzdem hat mich das berührt. Gleichzeitig wusste ich nicht so genau, wovon: Waren das die US-amerikanischen Nachrichten in diesem unnachahmlichen pathetischen Style, in denen immer wieder das Wort »Freiheit« betont wurde? »Freiheit für die armen vom Kommunismus unterdrückten DDR-Bürger.« Oder war es eine Rührung, die aus mir als deutscher Staatsbürger herauswollte? Das konnte ich nicht so richtig klar benennen. Irgendwann wurde mir das Ganze jedenfalls zu bunt. Immer wieder der gleiche Text: »Der freie Westen triumphiert. Der Kapitalismus hat gesiegt. Der Eiserne Vorhang ist gefallen. Die vom Kommunismus unterdrückten DDR-Bürger sind jetzt frei. Das Reich des Bösen ist besiegt.« Das Wort »Freiheit« wurde gefühlt fünfzehnmal pro Minute gesagt. Ich hab mir das ’ne Weile angeguckt. Dieses Triumphgeschrei, diese Propaganda-Dauerschleife hat irgendwas mit mir gemacht. Ich bin dann zu meinem kleinen Fernsehgerät und habe – das klingt jetzt ein bisschen komisch und peinlich, aber das war irgendwie eine Übersprungshandlung, die ich bis heute nicht wirklich erklären kann – den Fernseher genommen und ihn die Treppe von unserer Wohnung zur Straße hinuntergeschmissen. Und dann mit einem Hammer, den ich mir noch aus der Wohnung mitgenommen hatte, reingeschlagen. Dann war Stille. Und während wahrscheinlich Hunderttausende in Deutschland und in Berlin auf der Straße feierten, stand ich in San Francisco allein auf der Straße. Neben dem kaputten Fernseher. Das ist das Bild, das ich mit dem Mauerfall verbinde.
Johnnie Stieler · Ich saß am Abend des 9. November im Audimax der Leipziger Uni. Wir haben damals versucht, mit anderen Studentengruppen eine von der SED unabhängige Studentenvertretung zu gründen. Wir saßen da, wo ich sonst immer marxistisch-leninistischen Soziologie-Vorlesungen lauschen durfte, und haben diskutiert.
Plötzlich kam ein Unimitarbeiter reingestürmt. Einer, von dem wir wussten, dass er dem Ministerium für Staatssicherheit, sagen wir mal, recht nahestand. Er wedelte mit einem Telex und faselte was von Maueröffnung und Regelungen zur Reisefreiheit. Da begann natürlich sofort eine gewisse Unruhe. Und als dann noch andere Leute reinkamen und sagten »Mensch Leute, die Mauer ist offen!«, da haben wir die Diskussion natürlich gleich abgebrochen und sind mit einem mit sechs Leuten vollgestopften Trabbi Richtung Berlin gefahren. Als wir ankamen, sind die anderen sofort zu den bekannten Grenzübergängen nach West-Berlin. Ich selbst bin aber erst mal nach Hause gegangen. Ick hab nicht sofort rüberjemacht in den Westen. Wollte ich irgendwie nicht. Musste erst mal klarkommen. Rüberjemacht hab ich erst am nächsten Tag.
Alexander »Sandy« Kaltenborn · Nach diesem unkontrollierten Gefühlsausbruch, der meine amerikanischen Mitbewohner dann doch etwas überrascht hat, hab ich mich erst mal in die WG-Küche gesetzt, mir einen Tee gemacht und versucht, zu begreifen, was da eigentlich genau passiert ist. Berlin war schon vor dem Mauerfall eine Sehnsuchtsstadt für mich gewesen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich will mal nach Berlin, weil ich da atmen kann. Und ich glaube, an diesem Abend hab ich dann den Entschluss gefasst: Vielleicht sollte ich da jetzt wirklich mal hin.
Danielle de Picciotto · Auf dem Rückweg aus Graz war dann alles komplett anders als auf dem Hinweg. Als ich losgefahren war, musste ich noch über die Transitstrecke durch die zwei schwerbewachten Grenzen. Da wurde man von den DDR-Grenzern immer komplett durchsucht, bedroht und angeschrien. Man musste alles auspacken, alle Bücher zeigen, alle CDs vorspielen. Das dauerte manchmal Stunden. Zurück bin ich 14 Stunden über Nacht gefahren und morgens an der Grenze zu West-Berlin angekommen. Und eigentlich hab ich da wieder einen vollbesetzten Grenzposten, strenge Durchsuchungen und die üblichen Schikanen erwartet. Aber da war niemand. Ich konnte es nicht fassen. Wirklich niemand. Die Grenzbeamten, die ein paar Tage zuvor noch Durchreisende angeschrien, ausgezogen und bedroht haben, waren verschwunden.
Ich bin aber trotzdem erst mal stehen geblieben, weil ich Angst hatte. Ich hab mich gefragt: Was mache ich denn jetzt? Denn normalerweise war es ja so: Wenn man gefahren wäre, wäre man erschossen worden. Ich hab dann eine halbe Stunde gewartet, weil ich dachte, vielleicht kommt ja noch jemand. Und dann bin ich ganz, ganz langsam im Schritttempo losgefahren. So langsam, wie es überhaupt nur geht und hab gehofft, dass keiner kommt. Ich hatte einfach so eine große Angst vor diesen Grenzposten mit ihren Maschinengewehren. Es kam aber keiner. Und als ich dann nach West-Berlin reinkam, es war so 6 oder 7 Uhr morgens, war es so, als ob die ganze Stadt tagelang gefeiert hätte und jetzt mit Kater im Bett lag. Überall waren Autos falsch geparkt und überall lag unglaublich viel Müll rum. Es war wirklich surreal. Kein Mensch war zu sehen. Es war totenstill und total unordentlich.
Johnnie Stieler · Ich musste das irgendwie erst mal verarbeiten. Ich hab mich natürlich schon gefreut über die Maueröffnung, aber ich war auch skeptisch. Die Maueröffnung war die Maueröffnung. Okay! War schon irgendwie super, die Möglichkeit woanders hinzufahren, Dinge zu erleben. Das war genial … Aber mir war völlig klar, dass der Hammer kommt … Und der Hammer kam.
Alles neu
Alexander »Sandy« Kaltenborn · Mir war schnell klar: Meine Zeit in San Francisco geht zu Ende. Ich muss jetzt nach Berlin. Dahin, wo es schon immer all die hingezogen hat, die anders leben wollen. Alle, die ein bisschen links, alternativ, rebellisch waren und sich eine andere Welt bauen wollten, wollten damals nach West-Berlin. Alle, die irgendwas im Kopf hatten oder irgendein Problem mit der Bundeswehr oder irgendwas Verrücktes machen wollten. Berlin war einfach das Zentrum der Alternativbewegung, der aktivistischen, radikalen Linken, der Kunst- und Kreativszene, der Musikszene in Deutschland. Und deswegen war mir klar: Da muss ich jetzt auch hin.
Leute wie mich zog es vor allem nach Schöneberg und nach Kreuzberg, das damals am Rande West-Berlins direkt an der Mauer lag und ganz schön heruntergekommen war. Ich bin dann nach Kreuzberg gezogen, weil da eine Freundin von mir gewohnt hat. Nach Kreuzberg 61, wie man damals gesagt hat. Also nicht das richtige, sondern das Möchtegern-Kreuzberg vielleicht. So genannt wegen der alten Postleitzahl dieses Teils von Kreuzberg. 1000 Berlin 61. Da gab es damals ein linkes studentisches Wohnprojekt in einer dieser alten Fabriketagen und da bin ich erst mal untergekommen. Als ich da angekommen bin, war ich super aufgeregt. Von dieser Fabriketage aus hab ich dann angefangen, die Stadt zu erkunden. Ich bin wochenlang durch Berlin gestreift, hab erst mal die nähere Umgebung Kreuzbergs erkundet. Das war schon faszinierend genug. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Direkt an der Mauer, auf der Kreuzberger Seite, hatten ein paar Aussteiger, Punks und Künstler diverse Bauwagenplätze errichtet. Brennende Öltonnen und ausgebrannte Autowracks standen neben improvisierten Gemüsegärten, riesige Schweißkunstwerke neben meterhohen Graffitis. Es fühlte sich ein bisschen an wie in einem Endzeitfilm. Und es war toll.
Danielle de Picciotto · Motte und ich wohnten direkt an der Mauer in der Nähe des Springer-Gebäudes in Kreuzberg, eine Gegend, die man damals »World’s End« nannte, das Ende der Welt. Von unserem Küchenfenster aus hatte man direkten Blick auf die Mauer und den dahinterliegenden Todesstreifen, wo wir sofort Veränderungen beobachten konnten. Schon ein paar Tage nach dem 9. November stellten zwei Kreuzberge Spontis eine Leiter an die Mauer, kletterten hoch und riefen den DDR-Grenzern etwas zu. Und die gaben nicht etwa Warnschüsse ab, sondern kamen dann auch mit einer Leiter, kletterten auf ihrer Seite hoch und unterhielten sich lachend mit den Spontis. Ich war sprachlos. Bald darauf wurden vor unseren Augen Stücke aus der Mauer herausgerissen und es wurde ein Weg geteert. Die alten Übergänge reichten eben nicht mehr aus. Gleichzeitig wurden aber Zäune aufgestellt, wohl damit es irgendwie noch etwas von einem offiziellen Grenzposten hatte. Denn es wusste ja keiner so richtig, wie es weitergeht. Einmal sah ich von unserer Seite einen Hund auf den Todesstreifen laufen. Ich bin total erschrocken, weil ich dachte, dass gleich eine Tretmine oder die Selbstschussanlagen losgehen würden. Aber es passierte nichts. Es ist schwer zu beschreiben, was da in einem vorgegangen ist. Aber wenn man jahrelang auf eine Betonmauer geglotzt hat und es den Tod bedeutet hätte, wenn man da draufgeklettert wäre, muss man sich erst mal dran gewöhnen, wenn das von einem auf den anderen Tag nicht mehr so ist.
Alexander »Sandy« Kaltenborn · Inzwischen gab es überall in der Stadt kleine Löcher und Durchbrüche in der Mauer und neue inoffizielle und offizielle Übergänge. Der ehemalige Todesstreifen zwischen dem alten Arbeiterbezirk Kreuzberg auf West-Berliner Seite und den Ost-Berliner Bezirken Mitte beziehungsweise Friedrichshain war bereits von Selbstschussanlagen geräumt. Aber man dachte natürlich dran, dass da noch kurz zuvor schwer bewaffnete DDR-Grenztruppen patrouilliert waren und sich zwei Systeme unversöhnlich gegenübergestanden hatten. Aber auf einmal spazierten da neugierige Berliner und Berlinerinnen, die mal die jeweils andere Seite ihrer fast 30 Jahre lang geteilten Stadt erkunden wollten, mit ihren Kindern und Hunden und Mauerfall-Touristen aus der ganzen Welt über den Todesstreifen und kletterten auf die verwaisten Wachtürme der DDR-Grenztruppen. Jetzt patrouillierten da keine Soldaten mehr, sondern nur noch die Feldhasen.
Also es war immer noch ein bisschen Endzeitstimmung und gleichzeitig aber auch Aufbruchsstimmung. Man hat gemerkt, es liegt etwas in der Luft. Es hat sich ein unglaublicher Möglichkeitsraum aufgetan. Man hat sich am Anfang eines Zeitenumbruchs befunden, aber gleichzeitig war dieses West-Berlin gefühlt immer noch das Ende der westlichen Welt.
Nach ein paar Tagen hab ich mich dann auch mal in den Osten rübergewagt. Über die Spree nach Friedrichshain. Erst kurz zuvor ist die Oberbaumbrücke, die vor dem Mauerbau eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen Friedrichshain und dem West-Berliner Kreuzberg und während der Teilung ein Grenzübergang für Fußgänger war, wieder ohne Kontrolle für den Fahrradverkehr geöffnet worden. Die Oberbaumbrücke war für mich immer so ein Zwischenraum. Es gab sozusagen das Leben in Friedrichshain im Osten und es gab das Leben in Kreuzberg im Westen. Und dann gab es diese Brücke ohne Autos dazwischen. Und das war eigentlich immer wunderschön, weil da konnte man einfach abends noch ein Bier trinken, hat seine Leute getroffen. Die Leute waren mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Es war ganz einfach ein informeller, toller Stadtraum, der um diese und auf dieser Brücke entstanden ist. Ich habe da sehr viel Zeit verbracht.
Ich bin dann fast täglich mit dem Fahrrad zwischen Kreuzberg und Friedrichshain, also zwischen Westen und Osten hin- und hergefahren. Die DDR gabs ja noch. Und da hat man schon gemerkt: Ost-Berlin ist grauer und dunkler. Die Häuser hatten alle seit Jahrzehnten keinen Anstrich mehr gesehen. Die Straßenbeleuchtung war sehr reduziert. Und abseits des Alexanderplatzes gab es ja kaum Leuchtreklamen, geschweige denn Werbeplakate oder so. Berlin war damals einfach dunkel, aufgewühlt, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Wenn man im Osten durch die Straßen gegangen ist, konnte man an den Häusern noch den Krieg ablesen. Die Fassaden hatten überall noch Einschusslöcher. Und natürlich sah man überall Trabbis und Wartburgs, die dann aber recht rasch aus dem Straßenbild verschwanden. In den Wintermonaten war die Stadt immer besonders grau und sehr miefig durch die ganzen Kohlenheizungen. Es lag da sprichwörtlich ein Grauschleier über der Stadt.
Ost-Berlin war für mich wie ein Freiluftmuseum des Kommunismus. Man ist damals immer so ein bisschen durch die Straßen geschweift oder mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Man hatte immer so einen Blick: Wo geht was? Wo kann man rein? Wo findet man was? Jetzt gar nicht klauen oder so, sondern es gab einfach so viele Sachen, die am Straßenrand rumlagen. Man hat jeden Tag Sachen gefunden, die man fürs Wohnen brauchen konnte oder für Installationen oder fürs Bauen im besetzten Haus: Man war Sammler und Jäger.
Stadtpolitik – Wer die Hosen anhat
Eberhard Diepgen · Zu dem Zeitpunkt, als man auf der Mauer tanzen konnte, was ja auch die Bilder machte, die in die Geschichte eingingen, war ich nicht mehr Regierender Bürgermeister. Ich war ein gutes halbes Jahr zuvor, im März 1989, abgewählt worden. Bürgermeister West-Berlins während des Mauerfalls war mein Nachfolger und Vorgänger: Walter Momper.
Renate Künast · Walter Momper, der Mann mit dem roten Schal, diesem beseelten Lächeln und der Halbglatze. Es gibt kaum ein Fernsehbild oder Pressefoto aus der Zeit des Mauerfalls, auf dem er nicht zu sehen ist. Wann immer über Berlin, den Mauerfall und die Wende berichtet wurde, tauchte neben Bundeskanzler Helmut Kohl auch Walter Momper, der Regierende Bürgermeister von West-Berlin, triumphierend im Bild auf.
Mit Mompers SPD zusammen haben wir zu der Zeit in Berlin regiert. Wir hatten gerade mal acht Monate vor dem Mauerfall eine rot-grüne Koalition gebildet. Ich war damals Fraktionsvorsitzende der Grünen, die sich in Berlin noch »Alternative Liste« nannten. Momper und die SPD hatten im Januar 1989 die Wahlen in West-Berlin gegen die lange regierende, von Eberhard Diepgen angeführte CDU gewonnen, die von Bau- und Korruptionsaffären arg gebeutelt war. Eine rot-grüne Koalition war damals in West-Berlin ein absolutes Novum und für Konservative wie Diepgen der Untergang des Abendlandes. Deshalb beobachtete man uns ohnehin schon argwöhnisch. Und jetzt kam da auch noch der Mauerfall. Ausgerechnet da regierte in Berlin diese gehasste rot-grüne Koalition von »vaterlandslosen Gesellen«, »Hausbesetzerfreunden« und »Kriegsdienstverweigerern« unter Walter Momper. Das war ein Albtraum für die CDU und für Eberhard Diepgen ganz persönlich.
Eberhard Diepgen · Aber da, wo es drauf ankam, die Stadt zu gestalten, die Weichenstellung für das Zusammenwachsen von Berlin, dafür, welche Stärken Berlins nach der langen Teilung ausgebaut werden sollten, das war dann später meine Aufgabe nach dieser, sagen wir mal, kurzen Zwischenphase. Ich bin dann ja bald wieder gewählt worden. Aber die Aufgabe danach, diese Stadt zusammenzufügen, einen Beitrag dann für Weiterentwicklung in Deutschland zu leisten, das war, vereinfacht ausgedrückt, eigentlich viel bedeutsamer als Mompers Tanz auf der Mauer.
Renate Künast · Nach dem Fall der Mauer hat Eberhard Diepgen gelitten. Und je schneller der Fortgang war und das Tempo der Geschichte, desto blasser wurde er. Er war einfach zutiefst frustriert, dass zu diesem Zeitpunkt eine rot-grüne Regierung die Geschäfte bestimmt, ein Walter Momper diese Tausenden schönen Fotos hat und mit seinem roten Schal sozusagen weltweit gesendet wird und er nur zuschauen und das nicht beeinflussen konnte. Darunter hat er sichtbar für alle extrem gelitten. Die ganze CDU und vorneweg Eberhard Diepgen.
Willkommen im Goldenen Westen
Johnnie Stieler · Am 10. November hab ick dann mal rüberjemacht, wa. Und da hab ich dann festgestellt, dass es genauso war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nix »goldener Westen«. Den goldenen Westen hab ich später kennengelernt. Paris, New York und so. Aber doch nicht West-Berlin. Pah! West-Berlin war halt so eine eingemauerte Stadt mit so Günter-Pfitzmann-Gestalten. Die sahen alle aus wie bei Drei Damen vom Grill und so. Es war wirklich ein Schrecken. Mit so gelb-schwarzen Hahnentritt-Jacketts und Schnurrbärten und … Es war wirklich furchtbar provinziell. Und der Ku’damm? Lächerlich! Ein paar Jahre später bin ich in Paris gewesen und noch später das erste Mal am Atlantik. Da ist Westen gewesen. Aber West-Berlin? Das war wirklich so ’ne miefige, kleine, provinzielle Enklave von Leuten, die es woanders zu nüscht gebracht hatten.
Danielle de Picciotto · Plötzlich waren die eher leisen und leeren Stadtteile voll. Vor den Banken in West-Berlin bildeten sich lange Schlangen, denn den Ostlern war ein Begrüßungsgeld von 100 D-Mark versprochen worden. Das gab es zwar schon vor dem Mauerfall, aber da kamen ja immer nur einzelne Menschen rüber. Jetzt waren es plötzlich Hunderttausende pro Tag.
ARD, Tagesthemen: Bericht aus Bonn, 11.12.1989
Sprecher: Am Anfang verteilte der Regierende Bürgermeister noch persönlich Begrüßungsgeld an die Gäste aus der DDR. Inzwischen hat die Stadt 400 Millionen Mark ausgezahlt.
Marion Brasch · Nachdem ich mir das Begrüßungsgeld abgeholt hatte, bin ich erst mal zu einem Plattenladen nach Kreuzberg in die Bergmannstraße gefahren und habe mir von dem Begrüßungsgeld eine Elvis-Costello-CD gekauft. Ich fuhr glücklich nach Hause und legte sie in meinen CD-Player, aber sie spielte nicht, sie war kaputt. Ich bin dann zurück in den Plattenladen und der Typ vom Plattenladen hat gesagt »Tja, tut mir leid« und sie mir nicht umgetauscht. Und da war ich echt bedient und hab mir gedacht: Dankeschön, lieber Westen. Verkauft hier den blöden Ossis eine kaputte CD und nehmt sie nicht mal zurück … Ich war so sauer und dachte: Okay, das ist jetzt also der Kapitalismus und der »goldene Westen«. Schönen Dank auch!
Andrej Holm · Ich hab es nicht übers Herz gebracht. Ich hab mich geweigert, dieses Begrüßungsgeld anzunehmen. Als DDR-Bürger empfand ich das als so starke Demütigung, dass du deinen DDR-Ausweis zeigen und einen Stempel in deinen Pass machen lassen musstest, der deutlich machte: Der hat sein Begrüßungsgeld schon bekommen. Also das klingt jetzt wieder total verknöchert und betonmäßig, aber du lässt dir doch deine Unabhängigkeit nicht für 100 Westmark abkaufen. Also ich konnte das nicht.
Johnnie Stieler · Ich hab gleich mehrfach Begrüßungsgeld genommen. In der Commerzbank am Halleschen Ufer, wo ich mein erstes Begrüßungsgeld abgeholt habe, hat eben so ein schnurrbärtiger Hahnentritt-Jackett-Träger am Schalter immer hinten in den Pass einen Stempel reingemacht. Aber der Pass hatte ja mehrere leere Seiten für Visa hinten drin. Und da hab ich gemerkt: Hups, die kann man ja abschneiden! Geh ich eben noch mal hin. Das hab ich dann natürlich auch gemacht und mir insgesamt sechsmal Begrüßungsgeld abgeholt und das dann für den größten Quatsch ausgegeben. ’n schickes Essen in einem edlen Restaurant am Savignyplatz zum Beispiel. Das war fantastisch.
Uns gehört die Stadt – Der Wilde Osten
Alexander »Sandy« Kaltenborn · Mein Fokus, als ich nach Berlin gekommen bin, war ganz stark: Was macht die aktivistische Szene in dieser Situation? Die war so ein Milieu für sich. Meine Freundinnen und Freunde waren alle irgendwie in verschiedenen subkulturellen, aktivistischen Szenen unterwegs. Eine Freundin hat zum Beispiel in einer Wagenburg gewohnt, in Kreuzberg am Mauerstreifen. Es gab damals ’ne Menge solcher besetzten Plätze, wo Leute Bauwagen aufgestellt und ausgebaut haben und so ein bisschen cyberpunkmäßig mit Schrauben und Schrott irgendwelche verrückten Gebilde gebaut haben. Durch meine Freunde war ich sehr schnell in dieser ganzen Subkultur, die plötzlich unheimlich vibrierend und lebendig war. Es gab ständig Konzerte, Partys und überall illegale Kneipen. Man hatte das Gefühl, man kann alles machen.
Berlin war damals einfach dunkel, Berlin war dreckig, Berlin war Kohlenstaub, war abgeranzt, war billig, war zugänglich, war kreativ, war lebendig und auch ein bisschen verwegen. Und das hat mir schon sehr gefallen. Ich war dann schnell Teil der linksradikalen Szene. Wir waren diese Leute, die gerne Kapuzenpullis trugen und schwarze Sachen. Für mich passte das damals alles zusammen. Man war in diesem rebellischen, dunklen, klandestinen Lebensgefühl drin. Und gleichzeitig gab es sozusagen diese große weltgeschichtliche Eruption nach dem Mauerfall. Also das Grundgefühl war: Möglichkeitsräume, Aufbruchsstimmung. Überall waren Räume, die Leute kurz vor mir aufgemacht hatten, sei es durch Besetzungen, sei es durch Wagenburgen oder eben Brachflächen, die irgendwie bespielt wurden. Und dieses In-der-Stadt-Sein, sie zu erleben und mit dem eigenen Körper zu spüren, wenn man zum Beispiel auf einer Brachfläche liegt oder ein Lagerfeuer macht, abends Bier trinkt usw. Diese Art der Aneignung macht auch was mit deinem Körper. Ich konnte das förmlich körperlich spüren. Das Gefühl war sehr präsent. Und es gab ja niemanden mehr, der sich im Osten traute, uns etwas zu verbieten. Die staatlichen Institutionen hatten sich aufgelöst und die Volkspolizei war angesichts von so viel Freiheit total verunsichert. Die normalen Bürger in Ost-Berlin beobachteten unser Treiben allerdings mit gemischten Gefühlen: Manche fanden das sympathisch, andere fühlten sich durch uns sicherlich auch bedroht.
Sender Freies Berlin (SFB), Berliner Abendschau: Straßenumfrage Hausbesetzer, 1.5.1990
Alte Frau: Wir ham hier friedlich jelebt und wat ham wa jetzt? Vermummte Idioten kieken ausm Fenster. Det is ’ne Sauerei is det. Abends machen se Remmidemmi uff der Straße. Wie bei de Zijeunern sieht det aus hier, wie in so ’ner Pennerjegend.
Älterer Handwerker: Die Häuser hier stehen ja schon über vier Jahre leer. Die brauchen sich doch nicht wundern, wenn hier jetzt Leute einziehen.
Alexander »Sandy« Kaltenborn · Besonders die unsanierten Altbauten hatten eine magische Anziehungskraft auf uns. Die Stimmung war einfach: Hier geht was, das ist jetzt unsere Spielwiese und wir können hier gestalten. Es war ein großer Abenteuerspielplatz!
Man konnte eigentlich in jedes Haus rein, hat die Tür aufgemacht, ist ins Treppenhaus rein, in den Hinterhof. Hat mal geguckt. Wie sieht es hier aus? Und wenn man Lust und Zeit hatte, ist man dann einfach auch rein ins Treppenhaus, bis nach ganz oben und dann, mit ein bisschen Glück, war der Dachboden offen oder man hat einfach einen krummen Draht genommen und dann die nächste Tür aufgemacht. Und dann steht da eine Leiter und, schwupps, ist man auf dem Dach. Es hat damals keinen interessiert. Das war ja alles noch Volkseigentum der DDR.
Und die Berliner Traufhöhe hat den Vorteil, dass man eigentlich von überall, also von jedem Dach, einen tollen Blick hat. Wir haben oft auf den Dächern geschlafen, Matratzen da hochgeschleppt und abends Wein getrunken und Sonnenuntergang geguckt. Und ein paar Straßen weiter waren auch Leute, mit denen wir befreundet waren. Man hat sich dann abends getroffen und rübergewunken und das war schon so ein Gefühl: Uns gehört die Stadt.
Herausforderungen
Eberhard Diepgen · Alle, die verantwortlich waren, wussten natürlich sofort, als die Mauer geöffnet wurde, dass das die Stadt vor erhebliche Herausforderungen stellen wird. Es gab in Deutschland ja zwei Einigungsprozesse. Einmal den Einigungsprozess zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Und dann den Einigungsprozess zwischen Berlin, Ostteil der Stadt, also der Hauptstadt der DDR, und Berlin-West. Also hier in Berlin standen wir vor einer doppelten Herausforderung, weil die Mauer ja mitten durch unsere Stadt ging und wir quasi zwei völlig getrennte Städte zu einer verschmelzen mussten.
Renate Künast · Noch nie in der Geschichte musste eine jahrzehntelang durch eine Mauer geteilte Stadt quasi über Nacht wieder zusammengebaut werden. Die DDR-Regierung hatte ja mit deutscher Gründlichkeit seit 1961 die absolute Teilung der Stadt vollstreckt. S- und U-Bahnstrecken, Straßen und Brücken, sogar die Telefonleitungen und die Kanalisation waren komplett gekappt worden und seit 28 Jahren unterbrochen. Bis auf acht Grenzübergänge gab es keinen Durchlass mehr zwischen Ost- und West-Berlin. Und jetzt wollen plötzlich Hunderttausende Menschen auf einmal auf die jeweils andere Seite des Eisernen Vorhangs.
ARD, Tagesthemen: Bericht aus Bonn, 11.12.1989
Sprecher: Die Berliner Verkehrsbetriebe, Busse, U- und S-Bahnen sind völlig überlastet. Die Überstunden der Fahrer kaum mehr zählbar. 300 000 Besucher täglich aus Ost-Berlin und der DDR. Das hält die Stadt so nicht mehr aus. Der Senat und die Verkehrsbetriebe müssen, um den Zustrom zu bewältigen, alles anmieten, was Räder hat. Nur ein Beispiel von vielen Belastungen, die Berlin verkraften muss.
Eberhard Diepgen · Es traf uns ja völlig unvorbereitet. Niemand hatte einen Plan dafür in der Tasche. Das fing beim öffentlichen Personennahverkehr an und ging bis zu den Fragen: Mit welchem Geld können die Ostdeutschen eigentlich hier im Westen einkaufen? Wie baue ich denn am besten die S-Bahn wieder zusammen? Wie ist es mit der Kanalisation?
Renate Künast · Es war alles so turbulent. Es war so ziemlich die turbulenteste Zeit meines Lebens. Es war jeden zweiten Tag alles anders. Alles! Wir waren häufig schlicht überfordert, kamen kaum noch zum Schlafen. Das war eine Zeit, die ein Wahnsinnstempo hatte. Viele sind ja, auch in den Vormonaten über Ungarn, aus der DDR einfach in den Westen gegangen. Und die alle hatten jetzt Anspruch auf einen westdeutschen Pass und damit auf alle Sozialleistungen, die einem Bürger der Bundesrepublik zustanden. So stand es im Gesetz. So hatten wir das in der BRD bis dahin geregelt, als die Zahl der Übersiedler noch überschaubar war.
Wir mussten jetzt erst einmal zusehen, dass wir das alles in gewisse Bahnen gelenkt kriegen. In Ost-Berlin funktionierten ja viele Dinge nicht mehr, weil die Leute nicht mehr da beziehungsweise in den Westen abgehauen waren. Teilweise fuhren Busse und Bahnen nicht mehr. Jetzt ging es also erst einmal um Nachbarschaftshilfe. Und das hieß zum Beispiel, dass wir West-Berliner Busfahrer von der BVG zu Westlöhnen nach Ost-Berlin schickten, um dort Buslinien zu fahren. Obwohl das ja immer noch ein anderer Staat war. Weil wir gedacht haben, es kann nicht sein, dass jetzt im Osten auch noch die Infrastruktur zusammenbricht, wenn dort so viele abhauen. Dann hauen ja am Ende alle ab.
Nach dem 9. November gab es immer wieder Streit zwischen uns und der SPD unter Walter Momper. Denn für meine Begriffe ist es ziemlich mit ihm durchgegangen. Es war die helle Begeisterung bei ihm. Zu Recht! Aber da war auch ein Mangel an Realismus. Wir fragten uns oft, ob man nicht an manchen Stellen etwas entschleunigen muss, um die Dinge in Ruhe und richtig zu organisieren und zu regeln. Aber wir haben oft das Gefühl gehabt, dass Momper die Vereinigung der beiden Teile Berlins am liebsten sofort und vor der deutschen Einheit gemacht hätte. Darüber fabulierte er jedenfalls immer wieder: »Dann machen wir halt die Berliner Einheit vor den anderen.« Und da mussten wir ihn regelrecht zurückpfeifen und haben gesagt: »Du bist verrückt, das geht schief. Lass uns lieber gute Nachbarschaftshilfe machen, im Fernsehen bist du ja eh jeden Tag.« Aber Momper dachte längst in anderen Kategorien.
SFB, Berliner Abendschau: Rede von Walter Momper im West-Berliner Abgeordnetenhaus, 1.2.1990
Walter Momper: Wer die Stadtpolitik für die nächsten Jahre und Jahrzehnte entwirft, darf nicht mehr länger für eine Insel planen. Die Durchbrüche der Mauer öffnen wieder die alten Lebensadern. In unserer Stadt wächst wieder zusammen, was zusammengehört. Wir beginnen wieder in den Kategorien einer Region zu denken. Wir beginnen wieder ein neues Lebensgefühl zu entwickeln, denn wir sind jetzt wieder Teil des größten Ballungsraumes in Europa zwischen dem Ruhrgebiet und Moskau!
Renate Künast · Aber bis auf Weiteres bestand Berlin ja erst einmal aus zwei Einzelstädten mit zwei politischen Systemen, zwei Stadtregierungen, zwei komplett getrennten Verkehrsbetrieben und Verkehrsnetzen, mit nur ganz wenigen offiziellen Telefonleitungen zwischen dem Ost- und dem Westteil der Stadt. Es war auch ein Berlin mit ganz unterschiedlichen Regeln. Und mit zwei Polizeien.
WDR, ZAK, 28.9.1990
Sprecher: Eine Sorge geht um bei den Polizeibeamten im Revier Alexanderplatz: Dass sie neben ihren West-Berliner Kollegen vorerst noch in Vopo-Uniformen patrouillieren müssen. Als Polizisten zweiter Klasse, vor denen die Bevölkerung keinen Respekt mehr hat.
Renate Künast · Das war ein total kurioses Bild, man hat immer Doppelstreifen losgeschickt. Das gehörte dann auch zu diesem Berlin: Die Doppelstreife, bei der du immer sofort gesehen hast, wer der Ossi und wer der Wessi ist. Der West-Berliner Polizist mit seiner braunen Lederjacke und der Ost-Berliner Vopo mit seinem stets ein bisschen zu groß ausgefallenen grauen Uniformhemd oder grünen Anzug. Der eine lief mit breiter Brust, fast stolzierend durch die Gegend und der andere war ein bisschen verunsichert und suchend. Schnell geschult in westdeutschem Polizeirecht gingen die jetzt immer als Tandem durch die Stadt.
Die Ursuppe des Techno
Johnnie Stieler · Ich hab natürlich schon vor dem Mauerfall sehr viel Westradio gehört, klar. Es gab im Osten nicht viel zu tun und Berlin war eine gesegnete Stadt, was das Radio anging. Für Radiowellen war die Mauer ja durchlässig. Und wir haben das Radio aufgesaugt. Auf AFN, dem Soldatensender der Amis, konnte man freitags The Juice hören, eine Funk-Sendung, David Rodigan, den Reggae-Papst und Barry Graves. Es gab den RIAS, und vom SFBSFBeat mit Monika Dietl und, last but not least, John Peel auf BFBS, dem britischen Soldatensender. Die Radio-DJs waren wirklich richtig wichtige Figuren für uns. Sie waren unser Tor zur Welt. Da kam immer neues Zeug. Das hat mich schwer begeistert. Mit unseren Radiorekordern vom Typ RFT-Stern vom Kombinat Rundfunk- und Fernsehtechnik haben wir bei jeder neuen Sendung dagesessen und versucht sie aufzunehmen. Und diese DJs haben damals wirklich alles gespielt, die abgefahrensten Sachen aus ganz unterschiedlichen Richtungen: Hip-Hop, P-Funk, Reggae und vieles anderes. Und eben Acid House. Das war für uns wie eine Musikuniversität. Wir waren zwar mit den Füßen im Osten gewesen, in diesem Rattenkäfig. Aber mit den Ohren waren wir in der Welt. Also so richtig weit in der Welt. Und Monika Dietl, die Moderatorin und DJane, die wir sehr verehrt haben, hat ein paar Tage nach dem Mauerfall beim Jugendsender Radio 4U vom SFB verkündet: »Ein UFO ist gelandet, die letzte Party im alten UFO in der Köpenicker Straße 6. Kommt dahin.« Und da wollte ich natürlich hin.
Dimitri Hegemann ·





























