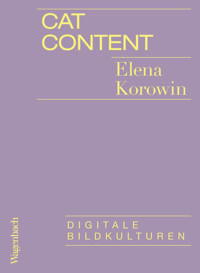
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kaum etwas wird in den Sozialen Medien so zuverlässig geliked und weiterverbreitet wie niedliche Katzenbilder. Allerdings sind Katzen nicht erst seit gestern »spirit animals« des Fortschritts. Vielmehr findet hier eine jahrtausendealte Kulturgeschichte ihre konsequente Fortsetzung. Memes, Videos und Blogs mit Katze erzählen viel über Menschen und ihre Bedürfnisse; das Tier spielt meist lediglich als Spiegel eine Rolle. Elena Korowin geht der Omnipräsenz der Katze in digitalen Räumen auf den Grund und zeigt, dass ein Internet ohne Katzen zwar möglich, aber sinnlos ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 62
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kaum etwas wird in den Sozialen Medien so zuverlässig geklickt wie niedliche Katzenbilder. Elena Korowin rekonstruiert die reiche Kulturgeschichte der Katzendarstellungen, analysiert Gründe für Katzen-Liebe und Katzen-Hass im Internet und zeigt, warum der »Awww«-Reflex nicht nur harmlos ist.
Elena Korowin
CAT CONTENT
Die Geschichte des digitalen Katzenkults
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
DIGITALE BILDKULTUREN
Durch die Digitalisierung haben Bilder einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren. Dass sie sich einfacher und variabler denn je herstellen und so schnell wie nie verbreiten und teilen lassen, führt nicht nur zur vielbeschworenen »Bilderflut«, sondern verleiht Bildern auch zusätzliche Funktionen. Erstmals können sich Menschen mit Bildern genauso selbstverständlich austauschen wie mit gesprochener oder geschriebener Sprache. Der schon vor Jahren proklamierte »Iconic Turn« ist Realität geworden.
Die Reihe DIGITALE BILDKULTUREN widmet sich den wichtigsten neuen Formen und Verwendungsweisen von Bildern und ordnet sie kulturgeschichtlich ein. Selfies, Meme, Fake-Bilder oder Bildproteste haben Vorläufer in der analogen Welt. Doch konnten sie nur aus der Logik und Infrastruktur der digitalen Medien heraus entstehen. Nun geht es darum, Kriterien für den Umgang mit diesen Bildphänomenen zu finden und ästhetische, kulturelle sowie soziopolitische Zusammenhänge herzustellen.
Die Bände der Reihe werden ergänzt durch die Website www.digitale-bildkulturen.de. Dort wird weiterführendes und jeweils aktualisiertes Material zu den einzelnen Bildphänomenen gesammelt und ein Glossar zu den Schlüsselbegriffen der DIGITALEN BILDKULTUREN bereitgestellt.
Herausgegeben von
Annekathrin Kohout und Wolfgang Ullrich
»Die Menschheit lässt sich grob in zwei Gruppen einteilen: in Katzenliebhaber und in vom Leben Benachteiligte.« (Francesco Petrarca)
0 | Die Catokalypse
Wir schreiben das Jahr 2017. In den Räumen einer traditionsreichen Universität wird eine Konferenz zum Thema »Auswärtige Kulturpolitik« abgehalten. Hochdekorierte Professor:innen und Kulturpolitiker:innen sprechen, während mein Blick auf das Handy meiner Sitznachbarin fällt. Ich sehe, wie zwei Katzenbabys gebürstet werden. Zehn Minuten später überprüfe ich die Lage, nun spielt ein anderes Katzenkind mit einem Wollknäuel. Die Katzeninhalte im Internet, die mit dem Scheinanglizismus Cat Content bezeichnet werden, sind zum Inbegriff der Prokrastination geworden.1 Er kommt mitunter auch zur Verwendung, wenn gar keine Katze mehr im Spiel ist. Gemeint ist dann jegliche Art des Online-Zeitvertreibs.
Drollige Katzenvideos stehen heute synonym für Belanglosigkeit im digitalen Raum.2 Die mediale Omnipräsenz der Katze scheint mit simplen Erklärungen abgetan, etwa dass Katzen das beliebteste und am meisten verbreitete Haustier sind.3 Die Videos mäandern in ihrer Funktion zwischen bloßem Zeitvertreib und therapeutischer Wirkung, kurzum sie machen vermeintlich glücklicher.4 Der Medienforscher Frank Schwab stellt fest, dass Bilder von Katzen in unserem Gehirn ähnliche Emotionen auslösen wie Süßigkeiten. Wenn putzige Kätzchen medial in allerlei Formen zur Verfügung stehen, können sie dosiert werden und funktionieren wie Bonbons für unsere Synapsen. In der Psychologie wird dies als »Mood-Management« bezeichnet.5 Damit könnte die Frage nach dem Erfolg der Katze im Internet als beantwortet gelten und es gäbe keinen Bedarf mehr, Cat Content zu untersuchen. Doch Katzeninhalte sind nicht nur ›cute‹ und allgegenwärtig, hinter ihnen stehen eine ganze Historie und eine Tradition, die bis ins Heute reichen. Dazu gehört nicht zuletzt die projektive Assoziation der Katze mit dem Weiblichen, im positiven und negativen Sinn. Die Eigenschaften anmutig, widerspenstig, schön und unabhängig werden Katzen und Frauen gleichermaßen zugeschrieben und finden sich auch im digitalen Raum wieder, wo sie grundlegende kulturgeschichtliche Problematiken von Autonomie, Kontrolle und Subversion spiegeln. Dabei entspinnt sich die Geschichte der Katzen im Internet zwischen den Gegensätzen von Distinktion und Mainstream, zwischen Otaku-Kultur (ein aus dem Japanischen übernommener Begriff, der ein von Nerds mit spleeniger Hingabe kultiviertes Universum beschreibt) und Büro-Humor, zwischen Niedlichkeit und Aggression.
1 | Awww-Reflex
»Baby-Igel sind auch süß, wohl niedlicher, aber sie konkurrieren nicht mit Pornos im Internet … Etwas konkurriert mit Pornos, und das sind Katzen.«6 Dieses Gerücht hält sich hartnäckig, denn Katzen scheinen, wie Pornografie, die Bedürfnisse von Internetuser:innen zu bedienen, und zwar auf vielfältige Weise. Cat Content gibt es für jeden Geschmack, ob witzig, gefährlich, rührend oder süß. Die Tiere sind facettenreich und legen häufig ein für den Menschen unerklärliches Verhalten an den Tag, das eine niedliche Seltsamkeit (cute weirdo) suggeriert und dafür prädestiniert ist, in Internetblogs und Sozialen Medien geteilt zu werden.7 Die Proportionen von Katzenköpfen entsprechen dem Kindchenschemaund triggern in unserem Gehirn den »Awww«-Reflex.8 Die Katze mit ihrer vielschichtigen Mimik und fantastischen physischen Möglichkeiten bietet Projektionsfläche für diverse Narrative. Das digitale Zeitalter hat die Fluktuation dieser Motive ins Unendliche potenziert und die Katze zu einem perfekten Avatar gemacht. Nun scheint es, als würde jeden Tag eine neuere, seltsamere, niedlichere Katze geboren werden, der eine ruhmreiche Zukunft bevorsteht.9
Mit Katzen lässt sich erfolgreiche Werbung gestalten – ›Catvertisement‹ hat die Domäne des Katzenfutters hinter sich gelassen und wird beispielsweise im Kulturbereich vermehrt genutzt. Am Internationalen Tag der Katze, dem 8. August, breitete sich 2023 Cat Content explosiv in allen Sozialen Medien aus – noch mehr als sonst: Namhafte Museen wie das Met in New York, das Rijksmuseum in Amsterdam und andere bewarben Katzenmotive ihrer Sammlungen. Immer wieder versuchen Museen, die traditionell eher für klassische – und negativ gedeutet: verstaubte – Bildung stehen, mit popkulturellen Thematiken neue Besucherschichten anzulocken, während Medientheoretiker:innen ihre Leserschaft vor der seichten Welt der Internet-Katzen warnen.10(# 1)
# 1 Werbekampagne der Wiener Museen kommentiert von Maya Pontone auf Hyperallergic
Die Zeit warb für ein Gewinnspiel in den Sozialen Medien, bei dem die Herausforderung darin bestand, ein künstlich erzeugtes Bild von einer üblichen Katzenfotografie zu unterscheiden. In der Geschichte der Entwicklung von KI-Programmen spielten Katzendarstellungen eine signifikante Rolle: So war das erste von Künstlicher Intelligenz eigenständig erfundene Konzept das der Katze, nachdem ein neuronales Netzwerk, bestehend aus 16 000 Computerprozessoren mit 10 Millionen unterschiedlichen YouTube-Thumbnails gefüttert worden ist.11(# 2)
# 2 Story auf Instagram von Die Zeit
Außerhalb des Internets sind die Konsument:innen ähnlich massiv von Cat Content umzingelt, überall tummeln sich Katzen als Kitsch-, Souvenir-, Bastel- und Dekoartikel. Sie machen Yoga, tragen Strickpullover, erklären uns die Welt und schaffen Kunst.12 Es gibt unzählige Bildbände mit malenden, ruhenden, tanzenden Katzen für jeden Geschmack und Charakter; außerdem Comics, Filme und Cartoons. Jim Davis hatte ursprünglich einen Comic über eine Mücke (»Gnorm Gnat«) geschaffen, bis er nach ausbleibender Resonanz dazu überredet wurde, den Kater »Garfield« als Protagonisten zu wählen – dessen Erfolgsgeschichte seit 1978 gibt den beratenden Stimmen recht.13 Es scheint, als sei die Katze wie eine Lingua franca, die alle Grenzen von Klasse, Gender und Geografie überschreitet. Sie ist zudem eine perfekte Projektionsfläche für menschliche Begierden und Bedürfnisse. Mit »Garfield« können sich die Leser:innen identifizieren, weil er zynisches Mittelmaß repräsentiert und jedem Laster erlegen ist.14 Hier stellt sich die Frage, ob Menschen ein Stück weit wie Katzen sein wollen oder Katzen menschlicher gedacht werden, als sie sind.
2 | Prä-digitaler Anthropomorphismus und Katzenkult
Die Zuschreibung menschlicher Verhaltensweisen an Tiere findet sich in nahezu allen Religionen. Der britische Philosoph John Gray spricht in seinem Glücksratgeber Katzen und der Sinn des Lebens (2022) von der Domestizierung des Menschen durch die Katze, weil das Tier sich aus Bequemlichkeit dem Menschen angeschlossen habe und trotz Nähe ein hohes Maß an Autonomie behalte.15 Die Katze zeichnet sich durch ein ambivalentes Verhalten zwischen Anschmiegsamkeit und Aggression aus. Diese und viele weitere Eigenschaften ließen sie zu einem beliebten Charakter für verschiedenste Geschichten werden. Fasziniert und erschrocken von dem geheimnisvollen Tier haben Menschen seit Anbeginn





























