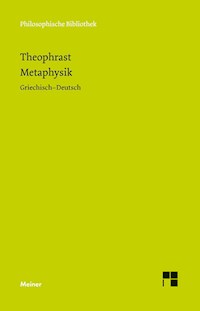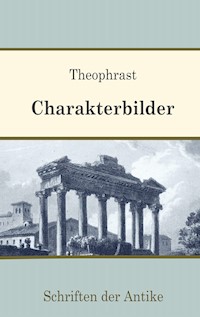
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Schriften der Antike
- Sprache: Deutsch
Heute so modern wie vor über 2300 Jahren: Die "Charakterbilder" des attischen Philosophen Theophrast. In treffend-scharfen kurzen Beschreibungen zeichnet Theophrast in seinem Werk 30 Menschentypen, wie sie uns auch heute überall begegnen - ein kleines psychologisches Meisterwerk, welches beweist, daß sich zwar die Zeiten ändern, der Mensch jedoch nicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 85
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Vorwort Theophrasts an Polykles
Der arge Schelm
Der Schmeichler
Das Plappermaul
Der Bäurische
Der Liebesdiener
Der Verworfene
Der Schwätzer
Der Entenjäger
Der Unverschämte
Der Knauser
Der Freche
Der Taktlose
Der Übereifrige
Der Zerstreute
Der Mürrische
Der Abergläubische
Der Niezufriedene
Der Mißtrauische
Der Unflätige
Der Unausstehliche
Der Eitle
Der Unnoble
Der Prahler
Der Hochmütige
Der Feige
Der Aristokrat in der Republik
Der alte Geck
Die Lästerzunge
Der Lumpenprotektor
Der schmutzige Geizhals
Anhang
Über das Heiraten
Erläuterungen zu den Charakteren
Erläuterungen zum Anhang
Einleitung.
Theophrastos wurde geboren zu Eresos, einem Städtchen auf der Westküste der Insel Lesbos, gegen 380 v. Chr. Seine philosophischen Studien machte er in dem damaligen Zentrum aller Geistesbildung, in Athen, das er auch später fast nie mehr verließ. Plato und Aristoteles waren hier seine Lehrer. Mit dem letzteren namentlich verband ihn bald dauernd das innigste Band des Vertrauens und der Liebe. Einen glänzenden Beweis dafür gab Aristoteles, indem er diesen Schüler nicht nur zu seinem Nachfolger im philosophischen Lehramt designierte, sondern ihn sogar zum Vormund seines Sohnes und zum Erben seiner kostbaren Bibliothek testamentarisch einsetzte. Nach seines großen Lehrers Tode wirkte Theophrast als Haupt der peripatetischen Schule ganz in dessen Geiste fort; eine sehr große Menge Schüler, darunter selbst Männer klangvollen Namens wie Demetrios Phalereus u. a. strömte zu ihm nach Athen. Bald drang sein Ruf auch über die Grenzen Griechenlands hinaus und sogar die Herrscher von Makedonien, Antipater und Kassander und König Ptolemäus von Ägypten traten zu ihm in freundschaftliche Beziehungen. Er starb in sehr hohem Alter (gegen 290 v. Chr.) tief betrauert in ganz Griechenland und vor allem in Athen, wo er sein ganzes Leben lang einer der populärsten Männer gewesen war.
Seine Herzensgüte und feine Bildung wissen die Zeitgenossen zu rühmen; von der Anmut und dem süßen Wohlklang seiner Sprache (Cicero sagt: divinus loquendi nitor) soll er den Namen „Theophrastos“, d. h. der göttliche Redner, statt seines ursprünglichen „Tyrtamos“ erhalten haben. Von dem Umfang seiner Kenntnisse auch auf den allerverschiedensten Gebieten menschlichen Wissens – ganz im Anschluß an die großartige Tätigkeit seines Lehrers – zeugen seine überaus zahlreichen Schriften, deren Diogenes Laertius noch gegen 200 kannte, die uns aber leider nur in dürftigen Fragmenten erhalten sind. Von der Tiefe und Selbständigkeit seiner Forschungen geben den klarsten Beweis seine auf uns gekommenen umfangreichen Werke: „Über Geschichte und Physiologie der Pflanzen“ und seine Schrift: „Über die Steine“, durch welche er der wissenschaftliche Begründer der Botanik und Mineralogie geworden ist. Bekannter aber noch als durch diese Bücher, wenigstens mehr genannt auch in Kreisen, die dem Philosophen sonst fernstehen, wurde Theophrasts Name schon im Altertum als der des Verfassers der kleinen Schrift: „Ηϑιχοί Xαραχιηες.“ Mit diesen 30 Charakterbildern, die übrigens, wie H. Sauppe klar nachgewiesen hat, ursprünglich umfangreicheren Abhandlungen der Tugenden und Laster – an denen ja die Literatur sokratischer Moralphilosophie reich ist – eingewebt waren, hat der athenische Philosoph, wenn nicht selbst eine eigene Literaturgattung begründet, so doch zu der Entwicklung und Ausbildung dieser mimischen Darstellung allgemeiner Charaktere unendlich viel beigetragen. Die Schrift wird freilich in der Gestalt, in der sie uns heute vorliegt, von dem Gelehrten immer nur, wie richtig gesagt ist, als die „unter und übereinander liegenden Trümmer von Mauern und Säulenschäften eines eingestürzten Tempels“ angesehen werden können. Es ist gar nicht unmöglich, daß diese Sittengemälde nur noch zum kleinsten Teil von der Hand des Meisters selbst herrühren und im übrigen nur stark interpolierte Paraphrasen ursprünglich theophrasteischer Schilderungen sind; wenn man auch freilich mit weit mehr Wahrscheinlichkeit sie als echte populäre Exzerpte aus größeren philosophischen Schriften Theoprasts anzusehen berechtigt sein wird.
Aber trotz aller seither oft genug beklagten Lükkenhaftigkeit bieten uns doch diese 30 Skizzen des interessanten Stoffes noch überaus viel. Durchweg erkennt man in der Zeichnung den Griffel des geistreichen, feingebildeten und menschenkundigen Beobachters. Nicht ganze Szenen aus dem Leben der behandelten Charaktere malt er uns in den Bildern vollständig aus; er reiht vielmehr nur lose verschiedene Züge, scheinbar flüchtig, aneinander. Aber diese einzelnen Züge sind der menschlichen Natur und dem Leben abgelauscht, sehr sorgfältig gesammelt und mit vielem Geschick so gestellt, daß sie jeden Charakter vollständig im klarsten Lichte erscheinen lassen, ohne daß etwa ihre Überfülle den Gesamteindruck abschwächen könnte. Ein Hauch feiner Ironie liegt über dem Ganzen. Der Ausdruck ist durchweg einfach und bisweilen fast allzu bündig. Ein kompetenter Beurteiler dieser Bilder, La Bruyère, der berühmte Verfasser der „Caractères“ (1687) und selbst Übersetzer Theophrasts sagt in seinem einleitenden, sehr lesenswerten „discours“: „Ist das Werk auch nur ein einfaches Fragment, so bleibt es dennoch ein kostbarer Rest des Altertums, ein Denkmal von dem scharfen Geist und dem klaren Urteil dieses hochbetagten Philosophen. In der Tat, es hat stets für ein Meisterwerk in seiner Art gegolten: fast nirgends kann man attischen Geschmack klarer erkennen und griechische Eleganz mehr zutage treten sehen: man hat es deshalb ein goldenes Büchlein genannt.“ – Aber auch ganz abgesehen von der künstlerischen Schönheit, die der französische Philosoph hier besonders betont, gibt es wohl noch einen anderen und wichtigeren Grund, weshalb das Büchlein wertvoll bleiben wird für alle Zeiten. Diejenigen nämlich, deren Sitten uns Theophrast in seinen Charakterbildern malt, waren doch seine Zeitgenossen, die Athener, und seit der Zeit, da er von diesem Volke von Athen seine Schilderungen entworfen, sind bis heute 22 Jahrhunderte verflossen: und doch – wenn wir jetzt diese Zeichnungen vor Augen halten, müssen wir nicht mit Staunen unser eigenes Porträt darin erkennen? Werden wir nicht die Züge auch unserer Zeitgenossen, unserer Freunde und Feinde in ihnen sehen? Woher diese überraschende, so vollständige Ähnlichkeit mit Menschen, die durch so viele Jahrhunderte von uns geschieden sind? Nun, der griechische Philosoph hat hier eben nicht nur Athener skizziert, er ist durch die Schale auf den Kern gedrungen und hat, nur unter der Maske des Atheners, den Menschen gezeichnet, den Menschen allein ohne Rücksicht auf Nationalität, Alter, Geschlecht, Beruf. So bestätigt sich auch hier die Wahrheit des alten Erfahrungssatzes, daß wohl Klima und Sitten eines Landes die Menschen im Äußern beeinflussen können, daß sie aber im Grunde nach Herz und Leidenschaften sich alle gleich bleiben – zu jeder Zeit und unter jeder Zone. Was jene und uns trennt sind nur zeitliche und örtliche, nicht geistige Abstände; nur Unterschiede der Sprache, nicht der Gedanken; nur Ungleichheiten der Sitten, nicht der Handlungen.
Aus dem Gesagten ergibt sich auch der Zweck, den Theophrast mit diesen Skizzen allgemein menschlicher Verirrungen verfolgte. Derselbe ist keineswegs, wie einige Editoren (so zuletzt noch Dr. Schnitzer1), zu modern denkend annehmen, in erster Linie ein ästhetischer, sondern vielmehr vor allem ein ernster didaktischer und paränetischer gewesen. Das Büchlein ist eben bestimmt, dem Menschen einen moralischen Spiegel „scharf und ohne Fehl im Glas“ vorzuhalten, aus dem er sein Abbild zurückempfängt, durchaus nicht geschmeichelt, nur mit seinen wahren wohlgetroffenen Zügen. Dies Porträt aber soll nach der Absicht des athenischen Moralphilosophen ihm zurufen: „Erkenne dich selbst! – So bist du, doch so sollst du nicht sein!“ Wir haben zunächst nur die abstrakte Regel der Moral – personifiziert in einem lebenden Bilde. Freilich ist diese strenge Züchtigung menschlicher Fehler und Schwächen in eine originelle, pikante Form gekleidet, die den Leser belustigen muß, aber es ist doch immer festzuhalten, daß dies nur ein Mittel ist, durch dessen Anwendung es dem Meister so schön gelingt Nutzen mit Anmut zu verbinden, indem er nach Horazʼs bekanntem Wort: „Ergötzen zugleich und Belehrung bietet dem Leser.“ – Zu allen den bisher angeführten Vorzügen unserer Charakterbilder kommt noch „zuletzt doch nicht als letzter“, daß uns dieselben einen so wertvollen tiefen Einblick in das derzeitige öffentliche und vorzüglich in das private Leben der freien Athener gestatten, daß – man mit vollem Recht – nicht Bedenken getragen hat, sie in dieser Hinsicht den Komödien des Aristophanes an die Seite zu stellen.
Eingehenderer Ausführungen über den Inhalt der Schrift im einzelnen enthalte ich mich hier. Der Leser wird aus dem klar übersetzten Texte alles, was ich dazu sagen könnte, selbst herausfinden. Ich schließe mit dem Wunsche, daß dies kleine Werk, welches wohl verdient auch außerhalb der engeren philologischen Grenzen bekannt zu werden, sich in weiteren Kreisen immer mehr Freunde erwerben möge.
Bei der folgenden Übertragung sind die bisherigen deutschen Übersetzungen, von denen übrigens selbst die besten vorhandenen (C. F. Schnitzer, 1869; Wilhelm Binder, 1865) noch hier und da nicht genügend erklärte Stellen enthalten, meist gebührend berücksichtigt worden. In den „Erläuterungen“ habe ich mich auf die zum Verständnis des Textes notwendigsten Angaben beschränken müssen.
Berlin. Dr. Max Oberbreyer.
1 Schnitzer kommt in Folge seiner Annahme in die Lage, in jedem Bilde zuerst das komische und Lächerliche als eigentliches Wesen heraussuchen zu müssen, was ihm denn natürlich doch in vielen Fällen (so z. B. bei VI, XI. XIX, XXIV, XXX) trotz aller Künstelei gar nicht recht gelingen will.
Charakterbilder
Vorwort Theophrasts an Polykles.
Schon früher habe ich darüber nachgedacht und mich gewundert und werde vielleicht nie aufhören mich zu wundern, wie es doch kommt, daß trotz des gleichen Klimas in Griechenland und trotz der gleichmäßigen Erziehung aller Griechen die Verschiedenheit der Charaktere doch eine so große ist. Nachdem ich nun, mein lieber Polykles, 99 Jahre alt geworden bin und so lange Zeit hindurch die menschliche Natur beobachtet, mit vielen und verschiedenen Charakteren verkehrt und die guten und schlechten Menschen sorgfältig miteinander verglichen habe, hielt ich es für meine Pflicht, die beiderseitigen Eigentümlichkeiten derselben darzustellen. Ich will dir daher im allgemeinen beschreiben, sowohl wieviel Arten Charaktere es bei ihnen gibt, als auch wie sich diese im alltäglichen Umgange zeigen. Ich bin nämlich der Ansicht, mein teurer Polykles, daß es zur Veredlung unserer Söhne beitragen werde, wenn man ihnen solche Denkmale hinterläßt, nach deren Muster sie sich im Umgange nur an die Tugendhaftesten anschließen werden, in der Absicht hinter ihnen nicht zurückzubleiben.