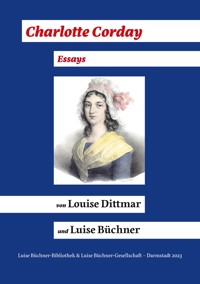
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Keine andere Frauengestalt der Französischen Revolution hat in den letzten zweihundert Jahren die Gemüter stärker bewegt, als die Marat-Mörderin Charlotte Corday. Über ihren Charakter, ihre Verbindungen zu den Girondisten und die Beweggründe, die zur Mordtat führten, wird bis zur Gegenwart sowohl in der Geschichtswissenschaft als auch in der erzählenden Literatur gerätselt und diskutiert. Was sind die Gründe für diese außergewöhnliche Prominenz einer historischen Frauenfigur? Solche große Aufmerksamkeit hat die Nachwelt nämlich weder der legendären Madame Roland noch der Feministin Olympe de Gouges zuteilwerden lassen. Beide wurden wegen ihrer Gegnerschaft zu der Jakobinischen Diktatur im gleichen Jahr wie Charlotte Corday (1793) hingerichtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Agnes Schmidt
Vorwort
Luise Dittmar
Charlotte Corday (1845)
Charlotte Corday (1849)
Luise Büchner
Charlotte Corday (1865)
Weiterführende Literatur
Abbildungsnachweise
Vorwort
Agnes Schmidt
Keine andere Frauengestalt der Französischen Revolution hat in den letzten zweihundert Jahren die Gemüter stärker bewegt, als die Marat-Mörderin Charlotte Corday. Über ihren Charakter, ihre Verbindungen zu den Girondisten und die Beweggründe, die zur Mordtat führten, wird bis zur Gegenwart sowohl in der Geschichtswissenschaft als auch in der erzählenden Literatur gerätselt und diskutiert. Was sind die Gründe für diese außergewöhnliche Prominenz einer historischen Frauenfigur? Solche große Aufmerksamkeit hat die Nachwelt nämlich weder der legendären Madame Roland noch der Feministin Olympe de Gouges zuteilwerden lassen. Beide wurden wegen ihrer Gegnerschaft zu der Jakobinischen Diktatur im gleichen Jahr wie Charlotte Corday (1793) hingerichtet. Olympe de Gouges, die Verfasserin der Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, einer revolutionären Schrift, in der die Autorin klar und deutlich die politische Teilhabe der Frauen im Staat forderte, wurde von der Geschichtsschreibung fast gänzlich vergessen. Erst 1970, mit Beginn der modernen Frauenbewegung, gewannen ihre Schriften an Bedeutung zurück. Madame Rolands Memoiren, die während ihrer Haft entstanden, sind ein zwar noch heute viel gelesenes, authentisches Dokument über die politischen Ereignisse in Frankreich zwischen 1789 und 1793, ihr Name ist jedoch nur einem Fachpublikum bekannt. Mit Recht müssen wir also fragen, woher die anhaltende Faszination für Charlotte Corday kommt, und warum inspiriert ihre Lebensgeschichte AutorInnen und KünstlerInnen immer wieder zu neuen literarischen und künstlerischen Werken?
Der Hauptgrund dürfte darin liegen, dass Charlotte mit ihrer wohlüberlegten Tat das Frauenbild ihrer Zeit und weit darüber hinaus von Grund auf erschütterte. Traditionell gehörten Wagemut, Kühnheit und Sendungsbewusstsein Jahrhunderte lang zu den Attributen der Männer. Frauen durften zwar für eine Person oder Sache schwärmen, aber nicht selbstständig in das Rad der Geschichte eingreifen. Es ist allgemein bekannt, dass die Überschreitung des althergebrachten Rollenverständnisses der Geschlechter die Öffentlichkeit stets faszinierte, denken wir nur an die Geschichte der biblischen Judith als Retterin ihres Volkes oder an die französische Nationalheilige Jeanne d’Arc im ausgehenden Mittelalter, die ihrem König im Krieg gegen die Engländer zum Sieg verhalf. Beide handelten politisch und opferten sich für ein höheres Ziel.
Auch Charlotte wollte durch den Mord an Marat, in dessen Gestalt sie einen blutrünstigen Gegner der gemäßigten Girondisten und einen Feind der Revolution sah, Frankreich vor Chaos und Anarchie retten. Zu ihrer Bekanntheit trug sicher auch bei, dass sie ihre Motivation zur Tat selbstbewusst erklärte: Nicht nur im Verhör, sondern auch in ihrem Vermächtnis an die Franzosen und mehreren Briefen aus dem Gefängnis, die unmittelbar nach ihrer Hinrichtung veröffentlicht wurden. Bereits im Herbst 1793 erschien die deutsche Übersetzung dieses Materials in der Hamburger Zeitschrift Minerva, die von Johann Wilhelm von Archenholz herausgegeben wurde. Berühmte Autoren wie Jean Paul und Friedrich Gottlieb Klopstock ließen sich von Charlottes Geschichte inspirieren und veröffentlichten sogleich Jubelschriften über sie und ihre Tat. Die meisten dieser Schriften billigten den Mord an Marat, manche wie Jean Pauls Corday-Darstellung grenzt sogar an eine Heiligsprechung der jungen Französin. Aber es gab auch kritische Stimmen. Ein anonymer Autor der Straßburger jakobinerfreundlichen Zeitschrift Argos bezeichnete Charlotte als Ungeheuer, »die an dem gutgläubigen Marat einen Meuchelmord verübt hat.« Laut eines Artikels in den Berliner Politische Annalen mordete Charlotte Corday aus weiblicher Eitelkeit und Schwärmerei, sie sei deshalb verabscheuungswürdiger als Marat. Und im berühmten Weimarer Journal des Luxus und der Moden warnte der unbekannte Autor das weibliche Publikum, »aus der allgemeinen Corday-Euphorie falsche Schlüsse zu ziehen« und die Tat nachzuahmen! Mehrmals weist der Autor darauf hin, dass Charlotte Corday unweiblich gehandelt und eine Tat begangen habe, die nur Männern vorbehalten sei. Aus diesen und ähnlichen Bemerkungen kann man ersehen, welches Unbehagen das politische Handeln einer Frau auslöste, besonders in Deutschland.
Die Warnungen vor einem »Corday-Kult« hatten allerdings wenig Erfolg, vielmehr eroberte die Geschichte der Marat-Mörderin schnell die literarische Öffentlichkeit, 1804 verfasste die Hamburger Schriftstellerin Engel Christine Westphalen sogar eine Tragödie in 5 Akten mit Chören über Charlotte Corday, die auf mehreren Bühnen mit Erfolg gespielt wurde. Weitere Veröffentlichungen, Romane, Oden und Aufsätze folgten, die die Buchhandlungen regelrecht überschwemmten. Im Bestand der öffentlichen Bibliotheken befinden sich heute noch zahlreiche Bücher aus dem 19. Jahrhundert über Charlotte Cordays Leben und Mordtat und in kaum einem Sammelwerk über historische Frauen fehlt ihr Name.
In Darmstadt, wo sich Georg Büchner und sein Freund Carl Minnigerode in den 1830er Jahren mit »Bonjour citoyen« begrüßten, waren die Französische Revolution und ihre Ereignisse besonders präsent. Nach einem Bericht von Georg Büchners Bruder Wilhelm gehörte es in der Familie zur Gewohnheit, abends aus der Zeitschrift Unsere Zeit vorzulesen. Die Artikel dieser seit 1826 monatlich mehrmals erschienenen Hefte enthielten viele Schilderungen aus der Zeit der Französischen Revolution. Für Georg Büchners Revolutionsdrama Dantons Tod war dieses Sammelwerk eines der Hauptquellen nebst zahlreichen Büchern aus der Darmstädter Hofbibliothek, die er Ende 1834 zum Verfassen seines Dramas nachweislich ausgeliehen hatte. Ähnlich großes Interesse für die Geschichte der Französische Revolution herrschte vermutlich auch in vielen anderen Darmstädter Familien, deren ältere Mitglieder die Ereignisse zwischen 1789 und 1815 noch als AugenzeugInnen erlebten. Es ist also kein Zufall, dass gleich zwei Darmstädterinnen unabhängig voneinander den Corday-Stoff bearbeiteten: Die Philosophin und Vortragsrednerin Louise Dittmar (1807–1884) und die Frauenrechtlerin und Verfasserin zahlreicher literarischer Werke Luise Büchner (1821–1877).
Louise Dittmars Essay erschien im Frühjahr 1849 in ihrer kurzlebigen Zeitschrift Soziale Reform im Leipziger Verlag von Otto Wigand. Die einzelnen Hefte dieser Zeitschrift sind zwar heute nicht mehr auffindbar, die in ihr enthaltenen Artikel wurden jedoch von dem Verleger noch im selben Jahr in einem Sammelband mit dem Titel Das Wesen der Ehe herausgegeben. Dieses Werk enthält neben dem titelgebenden Aufsatz von Dittmar auch ihren Corday-Artikel. Louise Dittmars Vorhaben, über die Marat-Mörderin zu schreiben, hat die Darmstädter Philosophin bereits 1845 in ihrem Buch Skizzen und Briefe kurz angekündigt: Sie beabsichtige, schrieb sie dort, ein Portrait der Französin aus Frauensicht zu verfassen, das die Männer vermutlich »belächeln würden. Ich würde ihnen aber entgegnen, dass es eine Wissenschaft gibt, die sie noch studieren müssen: das ist die der weiblichen Seele.«
Ihren Plan setzte Louise Dittmar vier Jahre später um und verfasste einen philosophischen Text, der nicht nur Charlotte Cordays Leben und ihren Entschluss zur Mordtat rekonstruierte, sondern eine Art »Glaubensbekenntnis« der Autorin darlegte: ihre klare Haltung zu der Einführung der allgemeinen Menschenrechte und zur Demokratie vor dem Hintergrund der Revolutionen von 1848/49. Wie gründlich sich Louise Dittmar mit der Ideengeschichte der Aufklärung, die zur Französischen Revolution geführt hatte, beschäftigte, zeigen die Hinweise auf ihre Lektüren. Sie ist vertraut mit den Schriften von Montesquieu, Rousseau und Mirabeau und betrachtet das Werk des angloamerikanischen Philosophen und Politikers Thomas Paine über Die Rechte des Menschen als Grundlagentext für alle weitere gesellschaftliche Entwicklung.1
Inspiriert durch die Ideen der genannten Autoren entstand aus der Feder der Darmstädterin ein brillantes Essay, dessen Sprache und logische Argumentation die Leserschaft auch heute noch beeindruckt. »Die Französische Revolution ist der lang verkündete Weltbrand, […] gigantisch kämpften die neuentstandenen Riesen gegen die alte Weltherrschaft, Felsblöcke schleuderten die Zyklopen gegen die hinterlistig sie beraubenden Räuber und Lügner«, so beginnt Dittmar ihren Artikel über Charlotte Corday. Und in diesem Kampf gegen die alte Weltordnung tauchen »edeldenkende[n] Geister [auf], die sich selbstvergessend nur das Allgemeine, das Heil des Ganzen im Herzen trugen.« Zu diesen Geistern gehöre auch Charlotte Corday. Wie andere Autoren bewundert auch Louise Dittmar die entschlossene Handlung und Kühnheit der jungen Französin, die mit dem Mord an Marat »Hunderttausenden das Leben retten wollte«. Vor allem hebt sie die politische Motivation der Tat hervor, um zu zeigen, dass auch eine Frau Kraft und Mut hat, eine heroische Tat zu planen und durchzuführen. Charlotte Cordays »erhabenes Opfer« war nach ihrer Meinung zwar »unpraktisch für ihre Zeit«, »doch für die Nachwelt ein Vermächtnis […], durch welches wir im Räderwerk des Lebens das Triebrad der Entwicklung sehen, die pochenden Menschenrechte, die den Zeiger immer vorwärtstreiben«.
Für Louise Dittmar war die Deklaration der Menschenrechte das wichtigste Ereignis der Französischen Revolution. Es war ihr jedoch bewusst, dass die Umsetzung der in der Deklaration verfassten Rechte Zeit braucht: »Eine reifere Erfahrung, eine entwickeltere Zeit würde Charlotten gelehrt haben, dass die Herstellung der Menschrechte nicht das Werk Eines Tages, Eines Gedankens, Eines Opfers ist, und dass die Französische Revolution kaum das Fußgestell derselben war.«
Louise Dittmars Auffassung über Charlotte Cordays Charakter und Tat gefiel nicht allen ZeitgenossInnen: In der von Louise Otto herausgegebenen Frauen-Zeitung meldete im Herbst 1849 ein mit E. W. gekennzeichneter Artikel nicht nur, dass Louise Dittmars Zeitschrift Soziale Reform mit dem vierten Heft »eingegangen« sei, sondern der Autor kritisierte den Aufsatz über Charlotte Corday scharf. Der Verfasser (!) würde diese »Meuchelmörderin« als Heldin darstellen und das Bild von Marat verzerren: »Marat war der unerbittliche Verteidiger des unterdrückten Volkes, der furchtbarste Feind der aristokratischen Meuchelmörder und Raubritter, er musste zuerst der Wut dieser Herren zu Opfer fallen.« Und weiter: »Wenn man solche Lügen-Gewebe abdruckt«, würde man »für die Monarchie und ihre Helfershelfer werben«. Hinter dem Namenskürzel steckte der Buchhändler Emil (Ottokar) Weller, einer der Leipziger Korrespondenten der Neuen Rheinischen Zeitung von Karl Marx. Weller hat wohl Louise Dittmars Kritik über die Französische Revolution, die 1793 in eine anarchistische und terroristische Richtung abdriftete, gründlich missverstanden. Die Darmstädter Autorin urteilte in ihrem Essay nicht über Marats Rolle in der Revolution, sondern beschrieb, wie Charlotte Corday Marats hetzerische Schriften und die allgemeine Unordnung im Frühjahr 1793 wahrnahm und sich aus innerer Notwendigkeit zum Handeln entschloss. Bereits in ihrer Ankündigung von 1845 stellte Louise Dittmar klar: »Charlotte Cordays Tat war eine letzte Missgeburt barbarischer Zustände, die gleich Uranus ihre eigenen Kinder verschlingt und damit einem besseren Zeitalter Raum gibt.« Bei Georg Büchner klingt der Satz aus dem Mund von Danton so: »Die Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre eigenen Kinder.« Ähnlich äußerte sich bereits Madame Roland, die vor ihrer Hinrichtung den viel zitierten Ausspruch tat: »Oh Freiheit, welche Verbrechen begeht man in deinem Namen!«
1865, vierzehn Jahre nach dem Erscheinen von Louise Dittmars Corday-Essay veröffentlichte die Darmstädter Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Luise Büchner einen längeren Aufsatz über die Marat-Mörderin in der Stuttgarter Zeitschrift Morgenblatt für gebildete Leser. Unmittelbarer Anstoß für ihre Beschäftigung mit dem Cordaystoff gab vermutlich ihre Reise in die normannische Stadt Caen im Sommer 1864, wo Charlotte Corday aufgewachsen und ihren Mordplan entwickelt hatte. In Caen lebte Luise Büchners jüngerer Bruder Alexander, der an der Universität Caen vergleichende Literaturwissenschaft lehrte. Auf dem Weg dorthin recherchierte die Darmstädter Schriftstellerin für ihren Essay in Pariser Archiven und Museen. In Versailles sah sie das berühmte Portrait der Marat-Mörderin, das Johann Jakob Hauer, ein Maler aus Deutschland, kurz vor der Hinrichtung von ihr zeichnete. Das Bild gilt heute als das einzige authentisches Portrait der Französin.2
Luise Büchners Aufsatz über Charlotte Corday ist, wie sie selbst schreibt, eine Zusammenfassung der neueren Forschungsergebnisse französischer Autoren über die Mordtat, ergänzt mit eigenen Kommentaren. Sie schildert mit offenkundiger Sympathie »die tötende Priesterin« als ruhige, edle Gestalt, die tragischerweise geglaubt habe, mit einer Einzeltat Frankreich retten zu können. Dass eine Frau im Namen der Gerechtigkeit Gewalt anwendet, missfällt allerdings der Darmstädter Autorin, da Gewaltausübung und Töten dem weiblichen Charakter grundsätzlich zuwider sprächen. Warum die junge Französin aus Caen keinen anderen Weg gefunden habe, um ihrem Land zu helfen, fragt sie. Luise Büchner kann angesichts der nach dem Mord an Marat folgenden Schreckenszeit den Tod von Charlotte Corday nicht wirklich bedauern, da sie mit ihrer Tat ja niemandem geholfen hatte. Im Gegenteil, der Terror steigerte sich nach Marats Tod ins Unermessliche und die Zahl der Opfer stieg in die Tausende. Wie hätte die junge Frau auch weiterleben können, fragt Luise Büchner, »da ihre berühmte Zeitgenossin, Madame Roland, von der man sagte, dass sie der Kopf von der Revolution gewesen und Charlotte deren Arm, sich heiß nach dem Tod gesehnt und die Guillotine als ihre Befreierin begrüßte, weil sie es müde war, in einer so traurigen Zeit zu leben«.
Die Bearbeitung des gleichen historischen Stoffes durch die beiden Darmstädterinnen zeigt deutlich wie unterschiedlich historische Ereignisse interpretiert werden können. Beide Texte zeigen aber auch die enormen literarischen und historischen Kenntnisse der Autorinnen sowie ihre sprachliche Brillanz, diese zu beschreiben.
Geschichtskenntnis war sowohl für Louise Dittmar als auch für Luise Büchner das wichtigste Element einer geistigen Bildung. »Das Leben bliebe ein ewiges Chaos ohne die Geschichte«, schreibt Louise Dittmar und sieht als Historikerin ihre Aufgabe darin, die Taten von »großen Menschen« aus ihrer Zeit heraus zu ordnen und zu erklären. Ihr Text ist poetischer als der von Luise Büchner, die eher nüchtern die Fakten wiedergibt. Die Frauenrechtlerin Büchner setzte sich auch praktisch für einen qualifizierten Geschichtsunterricht in Mädchenschulen ein und veranstaltete Geschichtsvorlesungen für Frauen und Mädchen in ihrer Wohnung, um den mangelhaften Lehrplan der Mädchenschulen ihrer Zeit zu ergänzen. Aus dieser Tätigkeit heraus entwickelte sie bei der Darstellung historischer Ereignisse ein methodisches Vorgehen, das Mitte des 19. Jahrhunderts nur von wenigen Historikern praktiziert wurde: Strenge Trennung von Legenden und Fakten und Erklärung der Zusammenhänge in einer verständlichen Sprache.
Historische Werke von »Frauenhand« waren im 19. Jahrhundert an sich schon eine Seltenheit. Dass es zwei Frauen waren, die Ereignisse der Vergangenheit und aufklärerische Ideen für ein breiteres Publikum hochprofessionell bearbeiteten, zeugt davon, dass der Kampf für den Zugang zu einer höheren Frauenbildung im 19. Jahrhundert allmählich Früchte trug. Dass es zwei Frauen aus Darmstadt waren, darunter die Namensgeberin der Luise-Büchner-Gesellschaft, freut uns besonders.
1Paines Buch erschien bereits 1792 in deutscher Übersetzung mit einem Vorwort des Weltumseglers und Mainzer Jakobiners Georg Forster. Die Übersetzerin war Meta Folker-Liebeskind, die Schwester von Georg Wedekind, der an der Seite von Georg Forster 1792 den Mainzer Jakobinerklub gründete und seit 1808 als Leibarzt des Großherzogs in Darmstadt lebte.
2Vgl.: Luise Büchners Reisebericht erschien in Fortsetzungen in der Neuen Frankfurter Zeitung 1865/66. Ein Teil der Artikel erschien 1878 auch in den von ihrem Bruder Ludwig herausgegebenen Nachgelassenen belletristischen und vermischten Schriften.
Luise Dittmar
Charlotte Corday (1845)
Aus: Skizzen und Briefe aus der Gegenwart, Darmstadt, C.W. Leske 1845.
Wäre ich ein Dichter, ich würde Charlotte Corday nicht nach beliebten verbrauchten Regeln als ein Wesen darstellen, das aus gekränkter Liebe Rache nimmt, noch als eine Abart ihres Geschlechts, oder gleich einer Jungfrau von Orleans, träumerisch und verzückt. Ich würde sie als mitten im Leben stehend schildern, mit allen Vorzügen ihres Geschlechtes geschmückt, mit allen Banden ans Leben gefesselt, nur von der Macht der Idee getrieben, ihr Leben dieser zum Opfer bringen lassen. Ich würde sie im Geist ihrer Zeit vorausgeeilt sehen, erfüllt mit Bildern einer nahen glänzenden Zukunft, ihre Tat selbst als eine letzte Missgeburt barbarischer Zustände betrachten lassen, die gleich Uranus ihre eigenen Kinder, die Barbarei, verschlingt und damit einem besseren Zeitalter Raum gibt.
Wie würden mich die Männer ob dieser Schilderung belächeln! Ich würde ihnen aber entgegnen, dass es eine Wissenschaft gibt, die sie noch studieren müssen: das ist die der weiblichen Seele.
Französische Revolution 1789, historische Postkarte
Louise Dittmar
Charlotte Corday (1849)
I. Die Revolution
Die Französische Revolution ist der lang verkündete Weltbrand. Alle Mächte, welche das Weltall zusammenhalten, waren gelöst; es wogten und strömten die aus Polen getriebenen Elemente3 gegeneinander und suchten sich mit grasser Wut zu zermalmen. Gigantisch kämpften die neuerstandenen Riesen gegen die alte Weltherrschaft, Felsblöcke schleuderten die Zyklopen gegen die hinterlistig sie beraubenden Räuber und Lügner.
Die Sonne stürzte herab, diese Welt in ewige Finsternis zu hüllen, und als sie krachend in den Feuerschlünden zusammenbrach, da spaltete sich die Erde, ein Meer von Blut umfasste die Feuerbrände und das Verderben kühlte sich im glühenden Blutmeer.
Die Französische Revolution war die blutige Rache eines Volkes, das seit Jahrhunderten seiner besten Kräfte beraubt, in welchen die Tyrannei seiner Herrschaft, die Frivolität seines Adels und seiner Geistlichkeit schwelgte. Elend, Missachtung und Bedrückung waren in den alten Feudalzuständen, besonders in der alles verschlingenden Priesterkaste, den Adelsprivilegien, den unfreien Handels- und Verkehrsverhältnissen auf die Spitze getrieben.
Die allgemeine Gesunkenheit des Volks und die niederträchtige Selbstsucht der höheren Stände, die Erschlaffung mehrerer Jahrhunderte machten eine Revolution auf weltlichem Gebiet so notwendig, wie zu Luthers Zeit auf geistigem. Die Finanznot gab hier wie überall nur den Ausschlag. Sie war der Anlass, der die ersten Artikel hervorrief. Die Finanznot war nicht zufällig, sondern eine notwendige Folge jener gesetzlich bestehenden Missstände, die aus früheren Verhältnissen hervorgegangen, nun zum Verderben des ganzen Volks aufrechterhalten wurden. Ohne eine Grundreform, ohne eine völlige Umwandlung der Verfassung musste daher diese finanzielle Krisis immer wieder erscheinen. Der ganze Zustand glich dem einer durch Dampf getriebenen Maschine, deren Kessel bei zunehmendem Einheizen die Flüssigkeit verdampfte, ohne durch neue ersetzt zu werden. So musste der Kessel springen, denn jede teilweise Abhülfe war ein Tropfen auf glühendes Eisen. Hätte sich das alte Frankreich auch nicht dem Bankrott übergeben, es musste doch zu Grunde gehen. Die Titanen und himmelstürmenden Giganten der Revolution, die Zyklopen und hundertarmigen Riesen, die sich in Mirabeau,4 den Girondisten,5 in Danton,6 Robespierre7 und Marat8 ewige Denkmale setzten und die herkulischen Anstrengungen einer neuen Weltordnung bekunden, sie holten ihre Feuerbrände und Blutströme nicht aus verschütteten Goldminen, aus den Tiefen eines Vulkans schleuderten sie sie empor, aus dem unterirdischen Toben einer zerstörten Menschlichkeit. Die rächende Nemesis folgt dem Verbrecher durch Jahrhunderte, bis sie ihn ereilt; aber sie trifft den Schuldigen nicht immer in der Person, sondern in der Idee. Der schuldlose Ludwig XVI.9 büßte auf dem Schafott, was seine Vorgänger auf den Dünger warfen, die menschliche Berechtigung; und damit wurde der Boden gedüngt, auf welchem eine Guillotine emporstieg. Die Toten wurden gerichtet in diesem unglücklichen Ludwig.
So stürzte die Willkür in einem räuberischen Adel und einer heuchlerischen Geistlichkeit. Doch nicht nur im Erschlagenen zeigt sich die rächende Gottheit, sie entfesselt dazu auch gerade die Kräfte, die sie am ärgsten geknechtet sieht. Höhnend hatte die Willkür der Bestie ein markloses, ein zertretenes Dasein vor die Füße geworfen, und die Bestie erhaschte den Augenblick und zerriss den Frevler mitten in dem Netz, womit er sie noch enger umschlingen wollte.





























