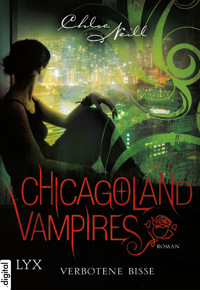9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chicagoland-Vampires-Reihe
- Sprache: Deutsch
Überall in Chicago kommt es zu Protesten gegen die Vampire. Eine mit Molotow-Cocktails bewaffnete Splittergruppe richtet große Verwüstungen an. Die Vampirin Merit und ihre Verbündeten müssen herausfinden, wer hinter den Angriffen steht, um die endgültige Zerstörung der Stadt zu verhindern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Kapitel Eins - Die Winter-Hüterin
Kapitel Zwei - Der Abendstern
Kapitel Drei - Trommelwirbel
Kapitel Vier - Sweet and Lowdown
Kapitel Fünf - Pour le mérite
Kapitel Sechs - Auch wir vergossen Blut für Chicago
Kapitel Sieben - Noch einmal stürmt, noch einmal
Kapitel Acht - Wie gute Nachbarn sind Vampire immer füreinander da
Kapitel Neun - Die »Real Housewives« von Wrigleyville
Kapitel Zehn - Die Pyjamaparty
Kapitel Elf - Mein Bräutigam, mein Vater und ich
Kapitel Zwölf - Stiller Schmerz
Kapitel Dreizehn - Emporkömmling unter großen Nationen
Kapitel Vierzehn - Zunehmende Schmerzen
Kapitel Fünfzehn - Jeffs »House of Fun«
Kapitel Sechzehn - Ein Einbruch unter Freunden
Kapitel Siebzehn - Die Hölle selbst
Kapitel Achtzehn - Vampirnachrichten werden immer gedruckt
Kapitel Neunzehn - Supergute Tage oder die sonderbare Welt der Vampire
Kapitel Zwanzig - Vampire, versammelt euch!
Die Autorin
Die Romane von Chloe Neill bei LYX
Impressum
Chloe Neill
Chicagoland
Vampires
Sehnsuchtsbisse
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Marcel Bülles
Zu diesem Buch
In Chicago kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Vampiren und Menschen. Mit Baseballschlägern und Molotowcocktails bewaffnet, greift eine Gruppe von Vampirgegnern die Unsterblichen und deren Einrichtungen an, und auch vampirfreundliche Menschen bleiben nicht von dem Terror verschont. Die Lage gerät mehr und mehr außer Kontrolle, zumal von Seiten der Politiker diese Angriffe gebilligt werden. Als wäre dies nicht schon schlimm genug, wird Haus Cadogan vom Greenwich Presidium auf die »schwarze Liste« gesetzt: Sie werden jetzt nicht nur von ihren menschlichen Gegnern, sondern auch von allen anderen Vampiren als Feind betrachtet und geächtet. Merit, Hüterin des Hauses Cadogan, und ihr Geliebter Ethan beschließen, denjenigen ausfindig zu machen, der hinter den gezielten Angriffen steckt. Dabei bringen sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Familie in Gefahr, denn ihr Gegner ist stärker und einflussreicher, als sie je gedacht hätten – und sein Spiel hat gerade erst begonnen …
Für Jeremy, der mich manchmal gewinnen und üblicherweise schreiben lässt und der immer seine Zimtschnecke mit mir teilt.
Du bist der Beste.
Unser Schicksal liegt nicht in den Sternen, sondern in unseren eigenen Händen.
Nach William Shakespeare
Kapitel Eins
Die Winter-Hüterin
Anfang Februar
Chicago, Illinois
Ich starrte auf das elegante Stahlschwert, dessen rasiermesserscharfe Klinge nur Zentimeter von meinem Gesicht entfernt war, und versuchte nicht zusammenzuzucken. Ich war bis aufs Äußerste angespannt, meine schweißnassen Finger schlossen sich um den Griff meines uralten Katana. Mein Blick huschte zwischen der Waffe, die drohend auf mich gerichtet war, und dem Mann, der sie führte, hin und her.
»Nervös, Hüterin?«, fragte der blonde Vampir, der nicht nur eine, sondern zwei der alten Samuraiklingen in den Händen hielt.
Ich befeuchtete die Lippen, packte das Schwert fester und versuchte mich von meinem äußerst gut aussehenden Gegenüber – nackter, schweißnasser Oberkörper, atemberaubend grüne Augen, goldene, schulterlange Haare – nicht ablenken zu lassen.
Versuchte. Ihn. Fertigzumachen.
»Überhaupt nicht, Sullivan.« Ich zwinkerte ihm zu. Als er verblüfft die Augen aufriss, nutzte ich die Gelegenheit und griff an. Ich ging in die Knie und setzte meinen Schwertgriff ein, um Ethans rechte Hand wegzuschlagen, was ihn eine seiner beiden Klingen kostete.
Nun ja, leider nur eine.
Mein Gegenüber war Ethan Sullivan, ein vierhundert Jahre alter Vampir und Meister des Hauses Cadogan, eines der drei Vampirhäuser in Chicago. Er war der Vampir, der mich nach einem brutalen Angriff in einer Frühlingsnacht gerettet hatte, indem er mich wandelte.
Und nun war er der Vampir, der mich zu dem machte, was ich war.
Ich war die achtundzwanzigjährige, ehemalige Doktorandin, die er zu einer unsterblichen Kriegerin ausgebildet hatte … und ich liebte es, ihm zu zeigen, was er sich damit eingebrockt hatte.
Heute sollte ich lernen, nicht nur mit einem Katana, sondern gleich mit zwei dieser sanft geschwungenen Klingen zu kämpfen. Vampire liebten Katanas, sie zogen sie Handfeuerwaffen jederzeit vor. Das lag vor allem daran, dass Vampire als Spezies nicht nur uralt, sondern vor allem recht überheblich waren. Sie glaubten fest an die Überlegenheit der Katanas, nachdem ein Samurai, der einst Europa bereist hatte, ihnen den Kampf mit diesen Klingen beigebracht hatte.
Geschichte hin oder her – zwei Klingen gleichzeitig zu schwingen war auf jeden Fall eine komplizierte Angelegenheit. Das Katana war eine elegante Waffe, was bedeutete, damit auch elegant zu kämpfen – sowohl tänzerische Bewegungen als auch Stärke und Geschicklichkeit in den Kampf einzubringen. Das war mit zwei Schwertern gar nicht so einfach, denn ich musste mein Gleichgewicht wiederherstellen … um nicht über meine eigene Waffe zu stolpern.
Zu meiner großen Freude hatte selbst Ethan damit seine Schwierigkeiten. Missmutig nahm er das Schwert wieder auf, das er auf die Tatamimatten des Sparringsraums fallen gelassen hatte.
Die Vampire, die von der Galerie aus unseren Übungskampf mit großer Begeisterung verfolgten, bejubelten ihren Helden und Meister des Hauses, der sich auf den nächsten Durchgang vorbereitete.
Und sie waren nicht die Einzigen, die uns zusahen.
Da mein früherer Schwertkampflehrer und guter Freund Catcher Bell an den heutigen Feierlichkeiten nicht teilnehmen konnte, weil er als Hexenmeister anderweitig beschäftigt war, hatten wir einen Ersatz finden müssen. Der jedoch schien von unseren ersten Versuchen überhaupt nicht beeindruckt zu sein.
»Das war verdammt plump«, sagte der Vampir vor uns.
Unser Lehrer war der Hauptmann der Wachen des Hauses Grey, einem von insgesamt drei Vampirhäusern in Chicago. Jonah war groß gewachsen, gut aussehend und hatte rotbraune Haare. Außerdem war er mein Partner in der Roten Garde, einer Geheimorganisation, die gegründet worden war, um die Häuser und das Greenwich Presidium im Auge zu behalten. Das Greenwich Presidium war das Gremium, dem die nordamerikanischen und westeuropäischen Häuser unterstellt waren. Streng genommen gehörten wir dem GP gar nicht mehr an. Wir waren aus diesem Zusammenschluss der Häuser ausgetreten, weil sich unsere Anführer in Tyrannen verwandelt hatten – aber es bestand kein Zweifel daran, dass sie uns das Leben immer noch schwer machen konnten. Die Wächter zu bewachen war in meinen Augen immer eine gute Idee.
Ethan hatte meine Mitgliedschaft in der Roten Garde zwar akzeptiert, aber meine Partnerschaft mit Jonah bereitete ihm dennoch Kopfzerbrechen. Seiner Ansicht nach hatte meine Loyalität nur einem männlichen Vampir zu gelten – ihm. Jedenfalls hatten sie, was mich anging, eine Übereinkunft erzielt, nachdem sie sich bei einem Sparringskampf grün und blau geschlagen hatten. Enge Freunde waren sie allerdings immer noch nicht. Ethan blickte nach Jonahs Kommentar finster drein.
»Es war nicht plump«, sagte er. »Es war ungeschickt.«
»Nein, es handelte sich lediglich um das Ergebnis strategischer Überlegungen meiner Wenigkeit«, zog ich ihn auf.
»Du hattest Glück«, widersprach mir Jonah. »Und es sah nicht besonders elegant aus. Ihr müsst euch beide eure Katanas als eine Verlängerung eures Körpers vorstellen. Ich weiß, es fühlt sich zuerst unbeholfen an, aber ihr gewöhnt euch schon daran. Noch mal.«
Ich lockerte mein mittlerweile schmerzendes linkes Handgelenk. Vampire verfügten über übermenschliche Kräfte, aber wir trainierten bereits seit einer Stunde, und Jonah hatte uns nicht gerade viele Pausen zugestanden.
»Gibt es ein Problem?«, fragte Jonah.
»Meine Hand schmerzt, ist aber nicht schlimm.«
»Das wird schon wieder. Noch mal von vorn.«
Ich warf ihm einen bösen Blick zu. Ich war ja nicht davon ausgegangen, dass mein Partner in der Roten Garde solche Trainingsstunden auf die leichte Schulter nehmen würde. Schließlich musste er dafür sorgen, dass die Wachen des Hauses Grey jederzeit einsatzbereit waren. Aber ich war auch nicht davon ausgegangen, dass er den knallharten Mistkerl raushängen lassen würde.
»Noch mal von vorne«, wiederholte Jonah nachdrücklicher.
»Soll ich ihn vielleicht daran erinnern, dass ich ein Meister bin?«, fragte Ethan leise neben mir, während er die Schwerter langsam kreisen ließ und sich leicht hüpfend auf die nächste Runde vorbereitete.
Jonah musste wirklich verdammt gute Ohren haben. »Du bist Meister des Hauses Cadogan«, sagte er, »aber die doppelten Schwerter hast du noch nicht gemeistert. Noch mal von vorn.«
Die Zuschauer grölten gut gelaunt und forderten uns wie Jonah zum Kampf auf.
»Zwei Katanas sind schwieriger zu führen als eins«, murmelte Ethan.
Das gilt auch für Vampire, dachte ich nur. Vor allem für männliche Vampire.
Eine Stunde und einen Duschgang später kehrten wir in unsere Räume im zweiten Stock des Hauses zurück – in die Wohnung, die nun unser gemeinsames Zuhause war.
Mein Arbeitspensum hatte ich zwar für heute erfüllt, aber dennoch würde ich in wenigen Minuten in die kalte Februarnacht aufbrechen. Und da ich hoffte, besser aussehen zu können als eine verschwitzte Vampirin, stand ich in Ethans begehbarem Kleiderschrank zwischen seinen Anzügen und zerbrach mir den Kopf, was ich anziehen sollte.
»Knöchel- oder kniehoch?«, fragte ich.
Ethan lehnte lässig an der Wand, einen Fuß vor den anderen gesetzt, und sah mich amüsiert an. »Ist es wirklich so wichtig, was du anziehst?«
Ich warf ihm einen strengen Blick zu.
»Hüterin, du bist eine intelligente Frau, hast ein vernünftiges Ehrgefühl, eine hervorragende Herkunft und einen Master –«
»Fast schon einen Doktor.«
»Fast schon einen Doktor«, räumte er ein, »und dennoch machst du dir Gedanken über deine Schuhe. Du gehst ja nicht zu einem Date.«
Womit er recht hatte, denn Ethan und ich lebten immerhin schon seit fast zwei Monaten zusammen. Ich hatte den Schlüssel, um das zu beweisen, auch wenn ich mich immer noch an den Gedanken gewöhnen musste, dass ich im Penthouse von Cadogan genauso zu Hause war wie er.
Aber ob es sich nun um ein Date handelte oder nicht – den Wunsch einer Chicagoerin nach guten Winterschuhen abzutun war nicht besonders klug. Niemand hier mochte Erfrierungen.
»Ich weiß, dass ich nicht zu einem Date gehe. Es fühlt sich einfach … wichtig an.«
Ich setzte mich zum fünften oder sechsten Mal auf den Polsterhocker, um meine knöchelhohen Stiefel – hübsch, aber nicht warm – gegen kniehohe Lederstiefel einzutauschen. Ich zog sie über die Jeans, die ich mit einem Shirt und Pullover kombiniert hatte. Die Stiefel waren aus dunkelbraunem Leder und passten wie angegossen. Für lange, dunkle Winternächte waren sie genau das Richtige.
Als ich sie angezogen hatte, stand ich auf und drehte mich vor dem Standspiegel in Ethans begehbarem Kleiderschrank.
»Es ist wichtig«, pflichtete mir Ethan bei und betrachtete mein Spiegelbild. »Sie war dir sehr lange eine sehr gute Freundin. Ihr versucht herauszufinden, ob eure Freundschaft nach allem, was passiert ist, noch eine Zukunft hat.«
»Ich weiß. Es fühlt sich immer noch seltsam an. Und es macht mich immer noch nervös.«
Die Frau, über die wir sprachen, war Mallory Carmichael. Früher war sie meine beste Freundin und Mitbewohnerin gewesen. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir herausgefunden, dass sie über magische Kräfte verfügt, die sie in eine echte böse Hexe verwandelt hatten. Jetzt versuchte sie all das, was sie verbockt hatte, wiedergutzumachen. Im Augenblick büßte sie für ihre Sünden, indem sie ohne jegliche Magie leben und schwere körperliche Arbeit im Auftrag des Anführers des zentral-nordamerikanischen Formwandlerrudels verrichten musste. Sie schien sich langsam wieder in den Griff zu bekommen, aber weder Ethan noch ich waren da wirklich sicher.
»Du wirkst nervös«, bestätigte Ethan.
Ich seufzte. »Das ist mir keine große Hilfe. Ich hatte eher an etwas in Richtung Kompliment gedacht. So was wie: ›Merit, du wirkst überhaupt nicht nervös, im Gegenteil. Du siehst bezaubernd aus.‹.«
»Das ist eine Falle«, sagte er und schüttelte den Kopf.
Ich begegnete seinem Blick im Spiel. »Das ist keine Falle.«
»Es ist eine Falle«, beharrte Ethan grinsend, »denn es gibt keine Erwiderung darauf, die du mir wirklich abnehmen würdest.«
Ich sah ihn zweifelnd an. »Versuch’s doch mal.«
Ethan, der in seinem eng anliegenden schwarzen Anzug einfach teuflisch gut aussah, trat hinter mich, schob mir sanft die langen dunklen Haare aus dem Nacken und küsste mich, was mir einen wohligen Schauer über den Rücken laufen ließ.
»Hüterin, du bist in jedem Raum, den du betrittst, die schönste Frau, egal, was du anhast. Und vor allem, wenn du – vorzugsweise – gar nichts anhast.«
Wie schafften es Männer bloß, ein wunderschönes Kompliment so anzüglich klingen zu lassen? Aber es war dennoch ein Kompliment, und niemand machte sie besser als Ethan Sullivan.
»Danke.«
»Gern geschehen.« Er sah auf seine große, zweifellos teure Uhr. »Ich muss in ein paar Minuten telefonieren. Und du solltest dich besser auf den Weg machen.«
Sein zweifelnder Ton ließ mich empört schnauben. »Mein treues Gefährt wird mich dort pünktlich abliefern.« Das war ziemlich großspurig, wenn man bedachte, dass ich mit einem uralten Volvo im Februar durch Chicago fahren wollte. Viel Aussicht auf Erfolg hatte ich da nicht.
»Jetzt klingst du schon wie Jeff«, sagte Ethan.
Jeff Christopher war ein Freund und Kollege, ein liebenswerter Nerd und Formwandler. Ich hatte ihn über meinen Großvater kennengelernt, der bis vor Kurzem der städtische Ansprechpartner für alle Übernatürlichen gewesen war. Jeff war außerdem ein Computerspezialist und Rollenspieler – erst neulich hatte ich ihn in Waldläufermontur erlebt –, weshalb auch zu ihm die Bezeichnung »treuer Gefährte« gut passte.
»Jeff hat uns schon mehrfach den Arsch gerettet«, betonte ich.
»Dessen bin ich mir bewusst, Hüterin. Aber du musst zugeben, dass er das auf seine Weise tut.«
»Tut er. Auch wenn es bei ihm oft haarig wird. Oh, wo wir gerade davon reden, du hast deine verlorene Wette noch nicht beglichen.«
»Du hast die Wette nicht gewonnen, Hüterin.«
»Ich habe geraten, dass Jeff ein Puma ist.«
»Und wie ich schon mehrfach betont habe, ist Jeff kein Puma.«
Ich warf ihm einen spöttischen Blick zu. »Er ist auch kein Murmeltier, und das hattest du geraten. Ich bin viel näher dran, und daher habe ich gewonnen.«
»Näher dran zählt nicht. Ein klares Unentschieden.«
Ich verdrehte die Augen. Ich würde meinen Standpunkt nicht so leicht aufgeben, aber ich hatte im Augenblick keine Zeit, ihm die Grundlagen biologischer Klassifikationsschemata beizubringen.
»Wie auch immer, haarig ist mal eine nette Abwechslung zu langweiligem Blutsauger.«
»Vampire sind nicht langweilig«, sagte Ethan, schob die Hände in die Taschen und sah mich gelangweilt an.
»Du schon, aber du machst die Dinge eben auf deine Weise.«
Ethan hob eine Augenbraue, womit er häufig ganz unterschiedliche Emotionen zum Ausdruck brachte – zum Beispiel Zweifel, Herrschsucht oder Verruchtheit, um nur einige zu nennen.
»Dir ist schon klar, Hüterin, dass du eine von uns bist?«
Ich ließ meine Augen silbern werden, was bei Vampiren bedeutete, dass sie starke Gefühle empfanden. Damit zeigte ich ihm, wie sehr ich ihm ähnelte – und wie viel mir das bedeutete. »Daran zweifle ich nie. Wie auch immer«, fuhr ich fort und wechselte das Thema, »worum geht es in deinem Telefonat?«
»Darius. Es gibt das Gerücht, dass er nicht mehr stark genug ist, um das GP zusammenzuhalten. Morgan und Scott wollen mit mir darüber reden.«
»Nur weil Darius entführt wurde?«, fragte ich. Darius West war der Anführer des Greenwich Presidium. Obwohl wir praktisch als Abtrünnige galten, weil wir aus dem GP ausgetreten waren, pflegte Ethan auch weiterhin gute Beziehungen zu Scott Grey und Morgan Greer, den Meistern von Haus Grey und Haus Navarre. Was vermutlich auch daran lag, dass wir Darius erst kürzlich das Leben gerettet hatten. Ein Attentäter, den der neue städtische Ansprechpartner für die Übernatürlichen, John McKetrick, angeheuert hatte, war durch uns an seinem Auftrag gescheitert.
»Genau deswegen«, antwortete Ethan. »Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die anderen Mitglieder des GP froh, dass wir ihn gerettet haben, aber es bereitet ihnen Kopfschmerzen, dass er überhaupt in diese Lage geraten ist.«
Das GP bestand aus Vampiren, die für ihre außergewöhnlichen Kräfte bekannt waren, aber Großmut gehörte anscheinend nicht zu ihren besonderen Fähigkeiten.
»Es wundert mich nicht, dass sie an seinen Fähigkeiten zweifeln«, sagte ich, nahm einen kurzen kamelhaarfarbenen Trenchcoat von seinem Kleiderbügel und schlüpfte hinein. Ethan hatte ihn mir geschenkt, denn er war der Meinung, dass die dünne Lederjacke, die ich sonst bei meinen Ausflügen als Hüterin trug, für den Februar zu dünn war. Er musste mich nicht mit Geschenken überhäufen – er hatte mich ja schon rumgekriegt –, aber der Mantel war wirklich warm und passte hervorragend. Warum also diskutieren?
»Du passt auf dich auf, ja?«, fragte Ethan. Eine Sorgenfalte legte sich auf seine Stirn.
»Mach ich. Aber wir wollen eigentlich nur eine Pizza essen gehen. Außerdem weiß Luc, wo er mich finden kann. Falls die Zombie-Apokalypse dann doch stattfindet.«
Ich unterstand einer etwas komplizierten Befehlskette. Ich war die Hüterin dieses Hauses, eine Art Soldatin, die für Cadogan und alles, was es ausmachte, eintrat. Aber ich war keine Wächterin, nicht im eigentlichen Sinne, was bedeutete, dass Luc, der Hauptmann der Wachen, nicht wirklich mein Chef war. Ethan aber auch nicht, denn genau genommen besaß ich die Befugnis, mich über ihn hinwegzusetzen, wenn er nicht im Interesse des Hauses handelte. Doch zumindest in praktischer Hinsicht war Luc mein Vorgesetzter, weshalb ich ihn in meine abendlichen Pläne eingeweiht hatte.
»Ich weiß«, sagte Ethan. »Und ich weiß, dass du mal einen Abend für dich brauchst. Wir haben in letzter Zeit ziemlich hart gearbeitet.«
»Nun ja, ich habe die ganze Zeit McKetrick im Auge behalten, und du –« Ich warf ihm einen schrägen Blick zu. »Was hast du noch mal gemacht?«
»Ich leite dieses Haus voller Vampire«, sagte er trocken.
»Ach ja«, erwiderte ich mit einem kurzen Nicken. »Du leitest dieses Haus voller Vampire.«
Er grinste leicht und strich dann eine dunkle Haarsträhne hinter mein Ohr. »Jetzt mal im Ernst, wir sollten uns auch mal Zeit für uns nehmen.«
Ich lächelte ihn verschmitzt an, denn diesen Vorschlag hatte ich bereits erwartet.
»Da stimme ich dir voll und ganz zu«, sagte ich. »Und deswegen habe ich uns für Freitag im Tuscan Terrace, Chicagos bestem italienischen Restaurant, einen Tisch reserviert. Hausgemachte Pasta. Köstlicher Champagner. Trüffel. Diese kleinen Häppchen zum Nachtisch, die fast noch besser sind als Mallocakes. Wir lassen es uns richtig gut gehen.«
Das Tuscan Terrace war ein Restaurant der alten Art, in dem die Bedienung praktisch nur italienisch sprach, die Räumlichkeiten recht dunkel gehalten waren und die Privatsphäre als heilig galt. Das Essen war fantastisch und unglaublich teuer, weshalb man dort nur zu besonderen Anlässen hinging.
Ethan runzelte die Stirn. »Was gibt es denn zu feiern?«
»Weißt du nicht, was Freitag ist?«
Er sah mich mit großen Augen an, wie ein Reh, das ins Autoscheinwerferlicht blickte. Offensichtlich hatte ich ihn verwirrt.
»Freitag ist der vierzehnte Februar, Valentinstag.«
Ich war so oft Single gewesen, dass der Valentinstag für mich praktisch keine Rolle spielte. Natürlich hatte ich schon leicht verblühte Rosen in einer Vase oder eine herzförmige Schokoladenschachtel aus dem Supermarkt geschenkt bekommen. Aber das war eben relativ selten vorgekommen.
Diese Beziehung nun war echt, was für mich bedeutete, dass ich zum ersten Mal den Valentinstag wirklich zelebrieren konnte. Nicht wegen rosafarbener Rosen oder Schokolade mit Nugatfüllung, sondern wegen uns. Weil ich jemanden gefunden hatte, der mich besser und stärker machte, und weil er, so hoffte ich, durch mich ebenso stärker und besser wurde. Das musste gefeiert und wertgeschätzt werden. Dafür mussten wir dankbar sein.
Dafür brauchten wir Kellner im Smoking und zierliche Champagnerflöten.
»Du meinst den Tag des heiligen Valentins«, sagte Ethan leise lachend. »Ich bin überrascht, dass du einen so blutigen Tag in der Geschichte Chicagos feierlich begehen möchtest.«
Er spielte auf das Valentinstag-Massaker im Jahr 1929 an, als Al Capone mehrere Männer in einer Garage in Lincoln Park erschießen ließ.
»Du weißt genau, dass ich das nicht meine.« Ich zupfte einen Fussel von seinem Revers. »Wie du schon gesagt hast, sollten wir uns auch mal Zeit für uns nehmen, nur wir beide. Ein paar Minuten Ruhe und Frieden außerhalb des Hauses, wo es keine Rolle spielt, dass wir Vampire sind.«
»Das klingt durchaus verlockend«, gab Ethan zu. »Damit fordern wir zwar das Schicksal heraus, aber verlockend ist es dennoch. Ich freue mich schon darauf.«
Er schenkte mir ein anzügliches Lächeln, denn offensichtlich freute er sich weniger auf das gemeinsame Abendessen, sondern mehr darauf, was seiner Meinung nach anschließend passieren würde.
Da uns diese Gedanken nicht dabei halfen, unseren abendlichen Pflichten nachzukommen, gab ich ihm schnell einen Kuss. »Ich muss los.«
Ethan machte ein langes Gesicht. Als ich meine Hand auf seine Brust legte, konnte ich spüren, wie sein Herz schlug – regelmäßig und kräftig.
»Ich werde vorsichtig sein«, versprach ich ihm. »Ich habe mein Schwert dabei und mein Telefon. Außerdem esse ich heute mit einer der mächtigsten Hexenmeisterinnen der Welt zu Abend.
Er sah mich ausdruckslos an. »Ich weiß«, sagte er. »Genau das bereitet mir ja Kopfschmerzen.«
Kapitel Zwei
Der Abendstern
Die Nachtluft war kalt und beißend, aber erfrischend, im Gegensatz zu den Straßen und Bürgersteigen, die von einer dreckigen Eisschicht überzogen waren, die monatelang nicht wegtauen würde. Ich hielt auf meinen Wagen zu, den ich auf dem Bürgersteig geparkt hatte. Ich war drei Mal um den Block gefahren, bis ich diesen Platz gefunden hatte, und dabei hatte ich den Menschen zugewinkt, die seit Neuestem den Zaun um unser Haus bewachten.
Heute war das Tor verschlossen. In den zehn Monaten meines Vampirdaseins hatte ich das nur selten erlebt. Aber in letzter Zeit waren wir zu vielen Angriffen ausgesetzt gewesen – durch Übernatürliche, die das GP angeheuert hatte, oder auch durch McKetricks Attentäter –, sodass wir unsere Sicherheitsmaßnahmen verschärft hatten.
Als sie mich kommen sahen, öffnete einer der bewaffneten Menschen das Tor gerade weit genug, damit ich das Anwesen verlassen konnte.
Die Wache tippte sich kurz an ihre schwarze Baseballmütze, als ich das Tor durchschritt, und schloss die schweren Flügel hinter mir wieder. Haus Cadogan war wieder einmal vor der Welt da draußen geschützt.
Ich stieg in meinen Wagen und jagte die Heizung bis zum Anschlag hoch, auch wenn das erst mal nicht half. Meine neue Winterjacke war wirklich warm, aber es war trotzdem Februar in Chicago. Als die Lüftung das Geräusch einer Karte von sich gab, die sich in den Speichen eines Fahrrads verfangen hat, drehte ich die Heizung wieder runter. Besser, eine schlecht funktionierende als gar keine Heizung zu haben.
Da ich das Haus nun verlassen hatte, fühlte ich mich sicher, um Jonah anzurufen und Neuigkeiten über unser Haus und das GP zu erfahren. Da Ethan der einzige Vampir in Cadogan war, der von meiner Mitgliedschaft in der Roten Garde wusste, und unser Training nicht gerade im kleinen Rahmen stattgefunden hatte, wollte ich unsere Gespräche im Haus auf ein Minimum reduzieren.
Ich stellte mein hübsches, neues Smartphone – der Ersatz für unsere alten Pieper – auf Lautsprecher und wählte Jonahs Nummer.
Er nahm beim ersten Klingeln ab. Im Hintergrund waren laute Geräusche zu hören. »Jonah.«
»Ich bin’s, Merit. Was gibt’s Neues?«
»Wir haben uns erst vor einer Stunde gesehen. Also nichts. Dir ist langweilig, und du fährst durch die Gegend, richtig?«
»Mir ist nicht langweilig. Ich habe nur stets ein großes Interesse an deinen Gedanken und deinem überragenden Wissen. Und ein Sparringsraum voller Vampire ist nicht gerade der ideale Ort für ein ruhiges Gespräch.«
»Ich hab auch noch was anderes zu tun im Leben, weißt du.«
»Ach, wirklich?«, fragte ich verschmitzt. »Das kommt jetzt überraschend.«
»Tatsächlich habe ich heute Abend ein Date.«
Ich blinzelte. Zugegebenermaßen war ich darüber etwas sprachlos. Ich liebte Ethan über alles, aber ich und Jonah hatten als Partner in der Roten Garde eine ganz besondere Beziehung, die ebenso auf Vertrauen und Vertrautheit basierte. Der Gedanke an die Möglichkeit, dass sich in dieses Bild noch eine andere Frau einfügen konnte, war seltsam.
Aber damit würde ich leben. »Wer ist die Glückliche?«
»Eine Abtrünnige«, sagte er. »Noah hat sie mir vorgestellt. Ich weiß nicht genau, ob das irgendwohin führt, aber ich mag ihre Art. Und ihr Aussehen.«
»Und ich fände es gut, wenn du die Details für dich behältst.«
»Merit«, sagte er in neckendem Ton, »bist du etwa eifersüchtig?«
Nein, nicht wirklich. Ich war einfach nur baff. Aber das würde ich ihm ganz bestimmt nicht auf die Nase binden. »Nicht im Geringsten. Du musst dich nur nicht in Details verlieren. Sei vorsichtig.«
»Geht klar. Und dasselbe gilt für dich.«
»Mir wird schon nichts zustoßen, aber für den Fall, dass …«
»Möchtest du, dass ich dich retten komme, weil du sonst von Ethan ein ›Ich habe es dir ja gesagt‹ zu hören bekommst?«
»Ich muss nicht gerettet werden. Aber ja, bitte.«
Er lachte leise. »Vielleicht haben wir ja Glück, und du erwischst McKetrick dabei, wie er ein Auto aufbricht oder so etwas in der Art. Ihn wegen so was hinter Gitter zu bringen wäre zwar nicht gerade befriedigend, aber immerhin etwas.«
Damit sprach er mir aus dem Herzen. McKetrick tat so, als ob er nichts anderes als ein typischer Büroangestellter wäre, aber in Wirklichkeit hasste er uns Vampire und setzte alles daran, uns zu schaden. Er war für vier Morde verantwortlich, doch wir hatten nicht den geringsten Beweis dafür. Und was noch schlimmer war – wir wussten nicht, was er als Nächstes plante.
»Wir haben nichts herausgefunden«, sagte ich. »Vielleicht hat Michael Donovan ja gelogen, als er sagte, McKetrick habe ihn angeheuert.« Michael Donovan, ein Vampir, war der Attentäter gewesen, den McKetrick auf uns angesetzt hatte.
»Dass wir ihn nicht erwischt haben, bedeutet nicht, dass er nichts damit zu tun hat«, stellte Jonah klar. »Wenn er clever ist, dann verhält er sich in nächster Zeit erst mal unauffällig.«
»Oder heckt schon wieder fleißig Pläne aus.«
»Das werden wir erst erfahren, wenn er wieder aktiv wird«, sagte Jonah und räusperte sich geräuschvoll. »Wenn du schneller an Informationen kommen willst, könnten wir sein Haus verwanzen.«
Diesen Vorschlag hatte ich sowohl von ihm als auch von Luc mehrfach gehört. Sie waren davon überzeugt, in McKetricks Haus in Lincoln Park eindringen und unbemerkt wieder herauskommen zu können. Da McKetrick als städtischer Beamter einen festen Terminplan hatte, war die Idee gar nicht mal so schlecht. Aber welches Risiko würden wir damit eingehen? Ethan und Noah, der Anführer der Roten Garde, waren beide zu der Schlussfolgerung gelangt, dass das Risiko zu groß war.
»Wir sind nicht die CIA«, erinnerte ich ihn. »Und wenn wir dabei erwischt werden, dann wird das unser Watergate. Es ist einfach zu riskant.«
»Also warten wir weiter«, sagte Jonah. »Was fantastisch ist, weil du ja so geduldig bist.«
Das war ich überhaupt nicht, und das wusste er genau. »Er wird sich nicht ewig ruhig verhalten. Das lässt sein Stolz nicht zu.«
Die Fahrzeuge vor mir fuhren mittlerweile im Schritttempo. Ich redete mit Jonah zwar gerne über übernatürliches Chaos, aber ich kannte den Verkehr in Chicago zu gut, als dass ich gleichzeitig telefonieren und unfallfrei an meinen Zielort gelangen konnte. »Jonah, ich muss Schluss machen. Der Verkehr ist wieder mal furchtbar. Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn es irgendwas Spannendes über Mallory zu berichten gibt.«
»Mach das«, sagte er. »Aber wenn bei mir irgendwas Spannendes geschieht, schweige ich wie ein wahrer Gentleman.«
Ich dankte dem Herrn auch für die kleinen Geschenke.
Ich verbrachte den gesamten Weg von Hyde Park nach Wicker Park, das nordwestlich davon lag, in zäh fließendem Verkehr, der in dem Viertel selbst auch nicht besser wurde. Selbst im dunklen Februar war auf der Division Street, der Haupteinkaufsstraße von Wicker Park, die Hölle los. Die Leute zogen von Bar zu Bar und von Restaurant zu Restaurant, wobei sie immer wieder über gefrorene, mit Streusand überzogene und vom Winterdienst aufgetürmte Schneehügel klettern mussten.
Wer in Chicago lebte, verbrachte etwa ein Viertel seiner Zeit mit der Parkplatzsuche, aber ich hatte schließlich Glück und fand ein Eckchen für meinen Volvo.
Nachdem ich den Motor abgestellt hatte, blickte ich kurz auf mein Katana auf dem Beifahrersitz. Mir gefiel der Gedanke gar nicht, es im Wagen zurückzulassen, aber ich bezweifelte, dass es im Mekka der Deep Dish Pizza, wo ich hinwollte, gestattet war.
»Ich kann dich immer noch holen«, flüsterte ich und schob es zwischen die Mittelkonsole und den Beifahrersitz, damit es nicht sofort ins Auge fiel. Ich atmete noch einmal tief durch, stieg aus und schloss den Wagen ab.
Der gefrorene Schnee knirschte unter meinen Stiefeln, als ich zu Saul’s hinüberging, meinem Lieblingspizzaladen in Chicago und der ganzen Welt. Ich hatte einige Zeit in New York gelebt und mit eigenen Augen gesehen, wie sehr die New Yorker ihre labberigen Pizzas liebten, doch nachvollziehen konnte ich das nicht.
Über der Tür hingen von einem roten Lederband mehrere Glöckchen, die anfingen zu klingeln, als ich die Tür öffnete. Ein eiskalter Windhauch schlich sich mit mir in den Raum. Ich machte die Tür so schnell wie möglich wieder zu und wich instinktiv vor dem bösen Blick des Mannes hinter der Theke zurück.
»Willst du, dass wir hier alle erfrieren?«
Ich ging über das abgenutzte Linoleum zu ihm hinüber. Es stammte aus den Siebzigern, wo man vermutlich noch geglaubt hatte, dass Holzmaserungsimitat eine Pizzeria typisch italienisch wirken lasse.
»Wenn ich das wollte«, sagte ich zu ihm, »würdest du das schon merken.« Ich stützte meine Ellbogen auf die Theke und sah ihn aufmerksam an. Er war schon älter, Ende sechzig, mit kräftigem schwarzen Haar und verschmitzt funkelnden Augen. Auf seinem grauen Sweatshirt stand in verblichenen roten Buchstaben SAUL’S PIZZA.
Er war der Einzige in dem kleinen Raum, in dem Bestellungen entgegengenommen und abgeholt werden konnten. Ein Durchgang führte zu einem kleinen Hinterzimmer, wo sich die Gäste zum Essen auch hinsetzen konnten.
Er zog seine buschigen Augenbrauen missbilligend zusammen. »Du hast eine ziemlich große Klappe.«
»Hatte ich schon immer«, sagte ich mit einem breiten Grinsen. »Schön dich zu sehen, Saul. Wie läuft das Geschäft?«
Sein Gesicht hellte sich auf. »Die Leute bestellen in letzter Zeit nicht mehr so häufig doppelten Speck und Rahmkäse«, antwortete er und musterte mich. »Siehst gut aus, Kleine.«
Meine Augenwinkel zuckten, ein untrügliches Zeichen dafür, dass mich die Erinnerung an mein früheres Leben zu Tränen rührte. Aber ich riss mich zusammen. »Siehst auch gut aus.«
»Manche Dinge ändern sich halt nie.«
Ich sah mich im Restaurant um. Die Innendekoration wirkte reichlich angestaubt, das Tagesmenü wurde mit austauschbaren Plastikbuchstaben präsentiert. An einer Wand standen Plastikstühle mit Metallbeinen, von denen keiner zum anderen passte. Auf der Theke hatten Tausende Hände, Ellbogen, Kreditkarten und Pizzaschachteln ihre Spuren hinterlassen. Es roch nach Staub, Plastik und Knoblauch.
»Wirklich nicht?«, fragte ich mit zweifelnder Stimme und breitem Grinsen. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Poster von Der Unbeugsame da hängt, seit der Film rausgekommen ist.«
Sauls Augen verengten sich zu Schlitzen. Ich hatte mich wie immer auf wirklich dünnes Eis begeben. »Der Unbeugsame ist ein absoluter Klassiker, du kleine Besserwisserin. Er wurde für fünf –«
»Oscars nominiert, ich weiß.« Ich lächelte – es war schön, meinen alten Spitznamen aus seinem Mund zu hören und unser altes Streitgespräch zu führen – und deutete in Richtung Hinterzimmer. »Ist unsere blauhaarige Schönheit schon da?«
»Sie sitzt an deinem Tisch«, sagte er und warf einen kurzen Blick auf die Wanduhr hinter sich. »Die Pizza ist in zehn Minuten fertig.«
»Vielen Dank, Saul. Schön, wieder hier zu sein.«
»Hättest auch schon früher vorbeischauen können«, knurrte er und ging zurück in die Küche.
Mallory Delancey Carmichal, die erst vor Kurzem als Hexenmeisterin identifiziert worden war und sich dann direkt in Verruf gebracht hatte, saß auf einem anatomisch geformten Doppelsitz aus Plastik. Sie trug eine Häkelmütze mit Ohrenschützern und einer ausdrucksstarken Bommel. Sie hatte sich die Mütze tief in die Stirn gezogen, aber ihr langer, geflochtener, blauer Zopf, der an den Spitzen ein sattes Indigo aufwies, lag über ihrer Schulter. Über ihrer Bluse trug sie einen dünnen Pulli, dessen Glockenärmel bis an ihre Fingerspitzen reichten, und darüber eine Jacke.
Sie sah auf, als ich hereinkam, und ich war unheimlich erleichtert, dass sie immer mehr wie ihr früheres Ich aussah. Mallory hatte rosafarbene Wangen und ein klassisch geschnittenes Gesicht. Ihre Augen waren groß und blau und ihre Lippen perfekt geformt.
Ich war froh, dass sie einen Platz für uns ergattert hatte, da das Restaurant brechend voll war. Ich setzte mich ihr gegenüber, zog meine Handschuhe aus und legte sie auf den Sitz neben mich.
»Ganz schön kalt draußen.«
»Bitterkalt«, pflichtete sie mir bei. »Deine Jacke gefällt mir.«
»Danke«, sagte ich, knöpfte sie auf und legte sie auf den wachsenden Stapel. »War ein Geschenk.« Und da ich besonders stolz auf meine Stiefel war, streckte ich ein Bein aus und gab mit ihnen an.
»Wahnsinn!«, sagte Mallory leise und ließ einen Finger über das Leder gleiten. »Wenn er dir so ein Zeug kauft, hoffe ich doch sehr, dass du mit ihm schläfst.«
Sie sah mich wieder an und grinste – und für einen Augenblick erkannte ich die alte Mallory. Selten hatte ich mich so erleichtert gefühlt.
»Er hat sie nicht gekauft, aber er hat auch keinen Grund zur Beschwerde.« Ich räusperte mich, um mich innerlich auf das Geständnis vorzubereiten, das ich ihr noch nicht gemacht hatte. »Ich weiß ja nicht, ob du das schon gehört hast, aber wir wohnen zusammen. Ich bin in sein Apartment gezogen.«
Sie sah mich mit großen Augen an. »Und ich dachte, wir würden zu Beginn erst mal so was Belangloses wie ›Wie geht’s deiner Familie?‹ austauschen.« Sie hielt kurz inne, sah auf den Tisch und dann wieder mich an. »Ihr wohnt zusammen?«
Ich nickte und wartete darauf, wie sie damit umgehen würde. Ehrlich gesagt machte mich ihr Zögern nervös. Sie war von Anfang an dabei gewesen. Sie war dabei gewesen, als ich mich das erste Mal mit Ethan angelegt hatte. Sie verstand unsere Beziehung – und unsere Probleme – so gut wie kaum ein anderer.
Nach einem Augenblick verschränkte sie die Hände und sah mich besorgt an. »Glaubst du nicht, dass das zu schnell geht?«
»Ich bin nur eine Etage höher gezogen.«
»Ja, in die Suite des Meisters. Was das vampirische Gegenstück zu einem Penthouse ist.«
»Und zehn Mal so groß und viel luxuriöser als mein altes Zimmer«, warf ich ein. »Egal, was du über unsere Beziehung denkst – du solltest mir weder feinste Bettwäsche noch den Aufdeckservice missgönnen.«
Mallory sah mich misstrauisch an. »Darth Sullivan bekommt doch keinen Aufdeckservice.«
»Aber sicher«, sagte ich. »Mit Getränken und Trüffeln.«
»Mein Gott, wie … Sullivan«, sagte sie sichtlich amüsiert. »Bitte versteh das nicht falsch. Ich mag Sullivan. Ich glaube, dass er in gewisser Weise gut für dich ist. Zwischen euch hat es auf jeden Fall gefunkt. Deutlich.«
»So deutlich, dass aus der Liebe auch leicht hätte Hass werden können«, stimmte ich ihr zu.
»Ich glaube, du hast ihn eine Zeit lang gehasst«, sagte Mallory. »Und Liebe und Hass sind nun mal starke Gefühle. Die Kehrseiten derselben Medaille. Es ist bloß, dass er so … na ja …«
»Langweilig ist?«, warf ich ein und dachte dabei an das Gespräch, das ich erst vor Kurzem geführt hatte.
»Alt«, sagte sie. »Vierhundert Jahre, oder? Ich möchte nur nicht, dass ihr die Dinge überstürzt.«
»Machen wir nicht«, beruhigte ich sie. »Wir sind zum ersten Mal auf derselben Wellenlänge, was unsere Beziehung angeht. Was ist mit dir? Wie läuft’s mit Catcher?«
Catcher, Mallorys Freund, war in ihr Haus gezogen, kurz bevor ich in Haus Cadogan eingezogen war, aber aufgrund ihrer Eskapaden in jüngster Vergangenheit lief es zwischen ihnen nicht sonderlich gut. Was ich nur zu gut verstehen konnte, denn sie hatte ihn als Hexenmeisterin verraten.
»Es geht langsam voran«, sagte sie mit leiser Stimme und spielte mit einem ihrer Glockenärmel. Ihre Hände zeigten noch die Spuren ihres Versuchs, mächtige schwarze Magie zu wirken.
Vor ein paar Wochen noch hätte ich nicht nachgehakt, um nur ja keine unangenehmen Themen anzuschneiden. Aber wenn wir uns langsam wieder annähern wollten, dann konnten wir es uns nicht mehr erlauben, die schwierigen Themen auszuklammern.
»Ich brauche da schon etwas genauere Informationen«, sagte ich.
Sie zuckte mit den Achseln, aber über ihr Gesicht huschte ein flüchtiges Lächeln. »Wir reden miteinander, wir treffen uns. Ich würde nicht behaupten, dass wir wieder da sind, wo wir mal waren – er vertraut mir immer noch nicht, was ich nur zu gut verstehen kann –, aber ich glaube, es geht voran.«
Mein Beschützerinstinkt meldete sich. Mallory hatte ganz offensichtlich ihre Probleme, aber mir lag etwas an ihr. »Er geht dir doch nicht auf die Nerven, oder?«
Mallory sah mich ausdruckslos an. »Wir reden hier von Catcher. Er nervt andauernd. Aber nicht so, wie du denkst. Er ist jetzt total fürsorglich. Meldet sich andauernd, fragt nach, ob ich auch genügend zu essen kriege und vernünftig schlafe.«
»Er macht sich halt Sorgen um dich«, sagte ich.
»Und«, fügte sie hinzu, wobei sie das Wort in die Länge zog, »er fühlt sich schuldig, dass er sich nicht eingemischt hat. Von solchen Dingen lässt er in der Regel die Finger. Ich meine das jetzt nicht in Bezug auf unsere Beziehung. Da legt er gerne Hand an, wenn du verstehst, was ich meine.«
»Ich verstehe nicht, was du meinst«, erwiderte ich und bedeutete ihr weiterzusprechen.
»Ich glaube, dass er sich ein wenig dafür hasst, nicht erkannt zu haben, was ich getan habe.«
Um ganz ehrlich zu sein, war ihm eine Menge nicht aufgefallen. Mallory hatte ihre dunklen Zauber gewirkt, als sie eigentlich für die Aufnahmeprüfung des Verbandes Vereinigter Hexenmeister und Hexer hätte lernen sollen, die Gewerkschaft der Hexenmeister. Sie hatte genau vor seiner Nase, im Keller des Hauses, in dem sie gemeinsam wohnten, eine ziemliche magische Verwüstung angerichtet.
»Darüber bin ich auch noch immer überrascht«, gestand ich offen. »Ich kann mir auch nicht erklären, wie er das hat übersehen können.«
»Na ja«, sagte sie kleinlaut, »warum sollte er auch davon ausgehen, dass seine Freundin den Untergang Chicagos plant?«
Er hätte davon ausgehen können, als Chicago im wahrsten Sinne des Wortes zusammenzufallen schien, aber hinterher war man immer schlauer.
»Okay«, sagte ich. »Er bemuttert dich also. Hast du schon mit ihm darüber geredet?«
Saul kam herein und hielt in einem riesigen Ofenhandschuh eine runde Pfanne, die nach – oh Wunder – Rahmkäse und Frühstücksspeck duftete. Er stellte die Pizza auf einem Untersetzer ab und servierte uns beiden, wie er es immer machte, unser erstes Stück.
Mir lief sofort das Wasser im Mund zusammen.
»Vielen Dank, Saul«, sagte Mallory und betrachtete mich amüsiert. »Du solltest deine Fangzähne mal wieder einfahren.«
Ich bedeckte meinen Mund mit der Hand und sah mich um, in der Hoffnung, dass sonst niemand die Zähne bemerkt hatte. Es ergab wirklich keinen Sinn, zusätzliche Aufmerksamkeit auf mich und meine Spezies zu ziehen.
»Danke«, sagte ich und biss genüsslich in mein Pizzastück, nachdem ich mir sicher war, dass ich meinen Körper wieder unter Kontrolle hatte. Die Leute hier wollten sicherlich nicht einer fangzahnbewehrten Irren beim Verschlingen einer Pizza zusehen. Der Geschmack war einfach himmlisch. Seit meiner Wandlung zur Vampirin hatte ich mir schon Pizza von Saul’s kommen lassen, aber das war nichts im Vergleich zu einer frischen Pizza aus dem Ofen.
»Ich bin gerade dabei, Catcher darauf anzusprechen«, nahm Mallory den Gesprächsfaden wieder auf. »Ich muss das allerdings vorsichtig angehen, denn wie du weißt, habe ich es fast hinbekommen, Chicago zu zerstören. Ich will das auf keinen Fall verharmlosen. Ich weiß, was ich angerichtet habe, und jetzt versuche ich mit den Folgen zu leben. Ich versuche mich komplett zu ändern, um meine Talente für Sachen einzusetzen, die nichts mit purem Egoismus zu tun haben.«
Mit dieser Aussage konnte ich etwas anfangen. »Das höre ich gerne. Wie steht’s mit Gabriel und den anderen?«
Gabriel Keene war der Anführer des Zentral-Nordamerika-Rudels und der Mann, der Mallorys magische Entziehungskur überhaupt erst möglich gemacht hatte.
»Mit Gabriel ist alles in Ordnung. Er verbringt eine Menge Zeit mit Tanya und Connor, denn er will die wichtigen Momente mit Connor nicht verpassen. Und Berna spielt immer noch meine Mutter.« Berna war mit Gabriel verwandt und die Barkeeperin im Klein und Rot, der Kneipe des Rudels im Ukrainian Village.
»Wie lange bleibst du noch bei ihnen?«
»Das weiß ich nicht. Sie expandieren gerade mit ihrem Catering-Service und brauchen deshalb jede Hand. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob sie darüber nachgedacht haben, wie es mit mir weitergehen soll.« Sie räusperte sich geräuschvoll. »Und darüber wollte ich eigentlich mit dir sprechen.«
»Worüber?«, fragte ich und schnitt mir mit der Seite meiner Gabel ein weiteres Stück Pizza ab.
»Über das, was ich tun soll, wenn ich meine Zauberkräfte wieder einsetzen darf«, erklärte sie. »Ich brauche eine sinnvolle Aufgabe. Eine Art Mission. Und ich dachte mir, na ja, vielleicht könnte ich ja euch helfen.«
Meine Gabel verharrte auf halbem Weg zu meinem Mund. »Uns helfen?«
»Haus Cadogan helfen. Ich muss etwas Gutes tun, Merit«, fuhr sie fort, bevor ich reagieren konnte. Was gut war, weil ich keine Ahnung hatte, was ich darauf sagen sollte. »Ich muss irgendjemandem helfen. Ich muss das, was ich angerichtet habe, wiedergutmachen. Und ehrlich gesagt könntet ihr eine Menge Hilfe gebrauchen.«
Damit hatte sie nicht ganz unrecht, und ich stimmte mit ihr auch darin überein, dass sie Pläne für die Zeit nach ihrer Entziehungskur schmieden sollte. Aber ich war mir nicht sicher, ob sie sich mit Haus Cadogan das richtige Ziel dafür ausgesucht hatte.
»Was genau hast du dir denn vorgestellt?«, hakte ich nach.
»Nun, ich dachte mir, ich könnte mich dem Haus anschließen – als eine Art magische Beraterin. Ich könnte euch bei der Einsatzplanung helfen. Dich bei deinen Missionen begleiten. Das habe ich doch schon mal getan, bei den Tates. Und das hat ziemlich gut funktioniert.«
Sie hatte uns bei den Tates geholfen – zwei gefallenen Engeln, die Mallory auf Chicago losgelassen hatte. Aber wir hatten sie hauptsächlich deswegen gebeten, uns zu helfen, weil sie das Problem überhaupt erst verursacht hatte und daher auch wusste, was zu tun war.
Ich wollte sie nicht entmutigen und schon gar nicht ihren Genesungsprozess behindern, aber ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Ethan dazu Ja sagen würde. Eine solche Kooperation mit dem Haus käme für ihn nicht infrage, vor allem in Anbetracht der Tatsache, was sie dem Haus angetan hatte.
Doch bevor ich antworten konnte, ließ eine laute Explosion das Restaurant erzittern.
Angst erfasste mich, und mein Herz raste, doch bevor ich mich bewegen konnte, war ein weiterer ohrenbetäubender Knall zu hören, der meinen Körper erzittern ließ und mir eine Gänsehaut verpasste.
Eine Vase fiel von einem der Regale auf der anderen Seite des Raums und zersprang auf dem Boden in tausend Stücke. Irgendjemand schrie überrascht auf. Fast alle sprangen von ihren Stühlen und rannten zu den Fenstern.
Aus der Dunkelheit drang nun ein anderes Geräusch, ein rhythmischer Klang. Ich konnte es nicht identifizieren, aber es klang auch nicht wie ein rein zufälliges Geräusch. Und da war noch etwas da draußen – etwas, was ich nur zu leicht erkannte.
Stahl.
Ich konnte Schusswaffen und Schwerter spüren, eine Gabe, die ich besaß, weil ich mein Katana mit meinem Blut temperiert hatte. Und es machte mich wirklich nervös, dass ich den Stahl da draußen hier drinnen spüren konnte, denn das bedeutete, dass es dort eine Menge davon gab.
Mallorys Augen, die sich zu Schlitzen verengt hatten, richteten sich auf mich. »Was meinst du, was das war?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich und ließ meine Gabel sinken. Ich hatte plötzlich keinen Hunger mehr. »Aber ich glaube, wir sollten es herausfinden.«
Kapitel Drei
Trommelwirbel
Mallory legte das Geld auf den Tisch und folgte mir durch die Menge der anderen Gäste hindurch zum Eingang des Restaurants. Auf dem Weg dorthin zog ich meinen Mantel an und steckte mir die Handschuhe in die Taschen.
Saul stand mit seinen Angestellten am Vorderfenster und starrte in die Dunkelheit. Er sah erst zur Seite, als ich neben ihm stand.
»Was in aller Welt war das?«, fragte er.
»Das weiß ich nicht. Aber ich werde es herausfinden. Bleibt hier drin und verschließt die Tür, bis ich Genaueres weiß.«
»Ich werde nicht hierbleiben, während du dich in Gefahr begibst.«
»Mir ist schon Schlimmeres passiert«, entgegnete ich. »Mach dir keine Sorgen. Ich bin unsterblich, du aber nicht.« Ich legte eine Hand auf seinen Arm und sah ihn bittend an. »Ich kümmere mich darum, okay?«
Saul betrachtete mich einen Augenblick und trat schließlich zur Seite, um mich vorbeizulassen.
Aber ich war nicht die Einzige auf dem Weg nach draußen – Mallory war direkt hinter mir.
Ich hielt sie mit erhobener Hand zurück. »Was glaubst du, wo du hingehst?«
»Ich komme mit dir«, erwiderte sie wie ein trotziger Teenager. »Wie wir schon festgestellt haben, verfüge ich über gewisse Fähigkeiten.«
Ich sah mich um, wohl wissend, dass wir uns nicht am richtigen Ort befanden, um über ihre Fähigkeiten zu diskutieren, geschweige denn sie den Anwesenden vorzuführen.
»Du solltest deine gewissen Fähigkeiten aber im Moment nicht anwenden«, flüsterte ich, »und ich habe keine Lust, einen Krieg mit dem Rudel heraufzubeschwören, weil ich dir das erlaubt habe.« Wir hatten schon genügend Schwierigkeiten in Chicago zwischen den verschiedenen Spezies.
Mallory beugte sich zu mir. »Und ich werde bestimmt nicht zusehen, wie du dich allein in Schwierigkeiten begibst.«
»Wir wissen noch nicht, ob es sich um Schwierigkeiten handelt.«
»Du weißt es«, widersprach sie mir. »Der ganze Raum ist von deiner Magie erfüllt. Du weißt etwas über das, was da draußen vorgeht. Du hast nur noch nichts gesagt.«
Ich hatte die Waffen noch nicht erwähnt, weil ich das von hier aus noch nicht bestätigen konnte. Zumindest nicht hundertprozentig. Ich sah sie einen Moment lang an und wog meine Möglichkeiten gegeneinander ab: sie als Unterstützung mitzunehmen und möglicherweise Gabriels Zorn auf mich zu ziehen oder sie hier drin zu lassen und ihren Zorn auf mich zu ziehen.
»Mal ganz davon abgesehen, dass mich jemand zur Bar zurückbringen muss«, sagte sie, »habe ich noch eine Stunde Zeit, bevor Catcher mich abholen kommt. Er und Gabriel wären sicherlich nicht begeistert von dem Gedanken, dass ich hier drin auf dich warte, wenn es da draußen Ärger gibt.«
Dummerweise hatte sie damit recht. Die beiden würden mich auf kleiner Flamme rösten, wenn sie verletzt würde. »Na gut. Du kommst mit. Aber du tust nichts, bevor ich es dir nicht sage.«
Sie salutierte zackig, und wir huschten nach draußen. Saul zog die Tür hinter uns sofort wieder zu und verriegelte sie.
Ich verschaffte mir einen schnellen Überblick und versuchte den Ursprung des Krachs auszumachen. Doch abgesehen von den zahlreichen Menschen, die besorgt aus ihren Fenstern und Türeingängen starrten, war nichts zu sehen. Rauch hing in der Luft, also mussten wir ganz in der Nähe der Quelle sein, aber nicht nahe genug. Was immer es auch war, es näherte sich uns. Der rhythmische Lärm, den ich nun als Trommelwirbel ausmachen konnte, wurde immer lauter, und ich spürte den Stahl immer stärker.
Zwei Polizeifahrzeuge fuhren mit heulenden Sirenen und Blaulicht an uns vorbei.
»Was ist los?«, fragte Mallory.
»Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass sie Waffen bei sich tragen.« Waffen, aber kein Anzeichen darauf, was uns bevorstand, bedeutete, dass ich Unterstützung brauchte. Wenn nötig konnte ich mutig sein, aber das hieß nicht, dass ich es übertreiben musste.
Ich holte mein Handy heraus und wählte die Nummer der Operationszentrale des Hauses Cadogan, in der die Wachen (einschließlich meiner Wenigkeit) Pläne schmiedeten und Untersuchungen durchführten.
Luc ging beim ersten Klingeln ran. »Hüterin? Was gibt’s Schönes?«
»Ich bin bei Saul’s in Wicker Park. Wir haben gerade zwei richtig laute Explosionen gehört. Ich kann nichts sehen, aber es riecht nach Rauch. Sie haben vermutlich Waffen bei sich. Könnt ihr irgendetwas herausfinden?«
Ich hörte ein Klicken und dann hektisches Getippe – ich war auf Lautsprecher geschaltet worden, sodass die Hintergrundgeräusche gut vernehmbar waren.
»Wir loggen uns gerade in den Polizeifunk ein. Bist du allein?«
»Mallory ist bei mir. Und ich glaube, ich muss sie hier schnellstens wegbringen.«
»Kein Widerspruch von unserer Seite, Hüterin.«
»Merit, hier spricht Lindsey.« Lindsey war eine der Hauswachen, außerdem mit Luc liiert und meine beste fangzahnbewehrte Freundin. »Im Polizeifunk sprechen sie über die Explosionen. Sie scheinen zu glauben, dass jemand mithilfe von Molotowcocktails ein paar Propangastanks in die Luft gejagt hat.«
»Wer wirft denn in Wicker Park mit Molotowcocktails?«, fragte ich. Mallory sah mich mit großen Augen an.
Aus Haus Cadogan kam keine Antwort. Ich konnte im Hintergrund den Polizeifunk hören, aber nicht verstehen, was genau dort gesagt wurde. Sie schienen sich die Berichte anzuhören.
Währenddessen wurde das Trommeln noch lauter und mein Puls pochte zunehmend in meinen Ohren.
»Leute, ich brauche langsam eine Ansage.«
»Die Polizei berichtet über Unruhen«, sagte Luc. »Ein paar Blocks westlich von euch ist ein Feuer ausgebrochen, und eine Gruppe Randalierer bewegt sich in Richtung Osten.«
Das erklärte den rhythmischen Krach. »Ich glaube, sie trommeln und singen dazu. Ich kann hören, wie sie näher kommen. Was war denn das Angriffsziel?«
»Ich schau gerade nach«, sagte Luc. »Oh Scheiße.«
»Was denn?«
»Sie haben Bryant Industries angegriffen.
Ich runzelte die Stirn. »Der Name sagt mir nichts.«
»Das ist die Firma, die in Chicago ›Lebenssaft‹ vertreibt. Jeder dieser Lieferanten befindet sich in Privatbesitz. Und dieser hier nennt sich ›Bryant Industries‹, um nicht aufzufallen.«
Die meisten amerikanischen Vampire verzichteten darauf, direkt von Menschen oder Vampiren zu trinken, um sich besser in die Gemeinschaft einzufügen, und verließen sich stattdessen auf Blutlieferungen in medizinischen Plastikbeuteln mit dem Namen »Lebenssaft«.
Wie wahrscheinlich war es in diesen stürmischen Zeiten, dass ein paar Randalierer rein zufällig einen Lebenssaftlieferanten angriffen?
»Diese Aufrührer hassen Vampire«, lautete daher meine Schlussfolgerung. Mit einem Mal hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl.
»Das ist ziemlich wahrscheinlich«, stimmte Luc mir zu. »Und sie sind auf dem Weg zu euch, Hüterin. Ich glaube, das wäre der richtige Zeitpunkt, sich höflich zu verabschieden und Mallory in Sicherheit zu bringen. Das Klein und Rot ist näher als das Haus. Vielleicht könnt ihr dort unterkommen, bis wir sicher sind, dass die Luft wieder rein ist?«
Ich sah zum Türeingang zurück. »Luc, ich kann Saul nicht einfach ungeschützt zurücklassen, vor allem nicht, wenn die Randalierer auf dem Weg hierher sind. Was, wenn sie das Restaurant angreifen?«
»Sie hassen Vampire, Merit. Für Saul stellen sie vermutlich keine Gefahr dar, außer sie finden heraus, dass du da bist. Wenn sie glauben, dass er Vampire beschützt, dann werden sie ihn auf jeden Fall angreifen. Du bringst ihn eher in Gefahr, wenn du dableibst.«
Seine Worte trafen mich tief, schnürten mir die Kehle zu. Ich war der Feind, weil ich biologisch gesehen ein anderes Wesen war. Und das bedeutete, dass ich für jeden in meiner Nähe eine Gefahr darstellte.
»Luc –«, sagte ich, aber er fiel mir ins Wort.
»Du kannst Saul nicht beschützen, Merit. Geht zu deinem Wagen und verschwindet.«
Mist. »Luc, ruf meinen Großvater an. Er hat noch ein paar Freunde bei der Polizei. Vielleicht kann er einen Streifenwagen zu Saul schicken lassen.«
»Gute Idee«, sagte er. »Ich rufe ihn sofort an, wenn du mir versprichst, dass du deinen Hintern ins Klein und Rot bewegst.«
»Bin schon auf dem Weg«, versprach ich ihm. Ich legte auf, nahm mir aber noch kurz die Zeit, um Jonah zu warnen. Der Text war kurz und deutlich: UNRUHENINWICKERPARK. LEBENSSAFTANGEGRIFFEN. PASSAUF.
Mein Handy summte nur wenige Augenblicke später, daher ging ich davon aus, dass Jonah mir direkt geantwortet hatte. Stattdessen aber las ich nur die wirklich ärgerliche Mitteilung, dass meine Nachricht nicht versendet werden konnte.
Ich steckte mein Handy wieder ein. Um meine technischen Probleme würde ich mich später kümmern, stattdessen hoffte ich, dass Jonah die Nachricht irgendwie doch noch erhalten würde.
Dann sah ich zu Mallory hinüber. Sie wirkte angespannt, aber ihr Blick war klar, und sie schien ihre Zauberkräfte unter Kontrolle halten zu können.
»Wie viel hast du mitbekommen?«
»Genug, um zu wissen, dass wir uns beeilen sollten.«
Ich nickte und musste wegen des sich nähernden Trommellärms und Gesangs lauter sprechen. »Mein Auto steht nur zwei Blocks von hier entfernt, aber ich habe mein Katana im Auto gelassen. Sie sind vermutlich auf der Jagd nach Übernatürlichen, also werden wir einfach so tun, als ob wir nur zwei Mädels wären, die sich einen schönen Abend in der Stadt machen. Wir gehen zum Wagen, steigen ein und fahren so schnell wie möglich zur Bar.«
»Und wenn sie dich erkennen?«
Mein Vater, Joshua Merit – eigentlich war Merit mein Nachname –, galt hier in Chicago als einer der größten Immobilienmogule. Daher hatten es die meisten Pressevertreter als berichtenswert erachtet, dass ich zum Vampir gewandelt worden war. Mein Foto war mehrfach in den Zeitungen gewesen, weshalb ich nicht gerade unbekannt war.
»Hoffen wir einfach, dass das nicht passiert«, antwortete ich. Und wenn doch, dann würde ich mich nicht kampflos geschlagen geben. Und das würde ein Kampf werden, der sich gewaschen hatte.
Ich brachte Saul kurz auf den neuesten Stand und versprach ihm, dass er bald Hilfe bekommen würde. Er wirkte nicht überzeugt … bis ich ihm mitteilte, dass die Unruhen den Vampiren galten und damit auch mir.
»Ich möchte nicht, dass sie wegen mir deinen Laden zertrümmern«, sagte ich. Saul nickte leicht beschämt und verriegelte dann wieder die Tür.
Ich wusste, dass ich kein Mensch war. Meine Gene, meine Fangzähne und meine Gier nach Blut trennten mich von ihnen. Das war einer dieser Momente, in dem ich mir dieses Unterschieds schmerzlich bewusst wurde.
Ich sah Mallory an, die mir zunickte und dann breit grinste. »Du hast gesagt, wir wären Mädels, die einfach nur ein bisschen Spaß in der Stadt haben wollen. Na, dann lass uns mal losziehen.«
»Valley Girls in Chicago?«
»Heute Abend auf jeden Fall.«
Wir machten uns auf den Weg zum Auto. Wir mieden die Division Street und rannten stattdessen vom Restaurant aus hinüber in die Gasse auf der anderen Straßenseite. Dann liefen wir durch die Dunkelheit bis an ihr anderes Ende und spähten hinaus, um den Ursprung des Lärms auszumachen.
Dutzende Menschen, insgesamt vielleicht vierzig oder fünfzig, marschierten mitten auf der Division Street entlang. Ein Mob. Einige von ihnen waren jung genug, um sie nach ihrem Ausweis zu fragen, andere Mitte vierzig. Doch sie alle schienen von ihrer Sache äußerst überzeugt, was sie lauthals kundtaten.
»Chicago gehört uns!«, schrien sie gemeinsam. »Raus mit den Vampiren! Chicago gehört uns! Raus mit den Vampiren!«
Sie wiederholten diese Worte wie ein hasserfülltes Mantra, brüllten sie den anderen Menschen auf der Straße entgegen, während sie gleichzeitig mit ihren Baseball- und Eishockeyschlägern herumfuchtelten. Auf ihrem Weg schlugen sie Autofenster ein und zertrümmerten die Straßenbeleuchtung.
Sie waren moderne Dorfbewohner mit Fackeln, und ich war Frankensteins Monster.
»Was für ein Haufen Arschlöcher«, murmelte Mallory.
»Bin ausnahmsweise deiner Meinung«, sagte ich. »Und wir müssen machen, dass wir hier wegkommen.« Da ich nur unsere Flucht im Kopf hatte, sah ich mich nach meinem Volvo um. Er war unbeschädigt; es fehlten weder Spiegel noch Fenster. Allerdings mussten wir dem Pöbel irgendwie ausweichen, um zu ihm zu kommen.
»Partygirls?«, erinnerte ich Mallory. Mallory nickte, und ich hakte mich bei ihr ein. Ich setzte mein menschlichstes Gesicht auf, und wir gingen Arm in Arm zu meinem Wagen, einfach nur zwei Mädels auf dem Nachhauseweg von einer Party.
Ich musste mich wahnsinnig zusammenreißen, um nicht bei jedem Geräusch zerbrechenden Glases oder bei jeder Hasstirade gegen Vampire zusammenzuzucken, und hielt meinen Blick auf unser Ziel gerichtet. Mein Puls verlangsamte sich aber nicht. Es waren einfach zu viele Menschen, um sie allein zu besiegen, vor allem nicht ohne meine Waffe – gut, da gab es noch die blauhaarige Frau neben mir, aber die war in jedem Fall tabu.
Je mehr Schaufenster die Randalierer zerstörten, umso mehr Alarme wurden ausgelöst. Als wir das Ende des Straßenblocks erreicht hatten – es waren nur noch ein paar Dutzend Schritte bis zum Auto –, brachten wir uns eilig hinter der Ecke in Sicherheit. Unsere Herzen rasten, da der Mob immer näher kam.
Bedauerlicherweise wurde dadurch das Raubtier in mir zum Leben erweckt – und es verspürte große Lust, sein Glück bei den Menschen zu versuchen. Den jammernden, gehässigen Menschen.
»Ich muss dir was Witziges erzählen«, sagte Mallory, die ihren Rücken gegen die Gebäudewand presste und ihren Arm um mich schlang. »Es war einmal vor langer, langer Zeit, da versuchte ich mit meiner besten Freundin zu Abend zu essen, und die Apokalypse brach aus.«
»Wie wahr«, flüsterte ich, während die Nacht von den Geräuschen zunehmender Gewalt erfüllt wurde.
»Merit«, sagte sie. »Schau dir das an.«
Mein Blick folgte ihrem zur anderen Straßenseite, wo zwei Jugendliche von zwei Randalierern aufgehalten worden waren, die sich von dem Pöbel abgesondert hatten.
Die Jungs wirkten ziemlich jung und unbeholfen. Der eine war ein Strich in der Landschaft, der andere eher stämmig. Sie trugen schlecht sitzende Klamotten, die für eine solch kalte Nacht definitiv zu dünn waren, aber das war wohl gerade nicht ihre größte Sorge.
Die Randalierer, die sie nicht nur um ein, zwei Köpfe überragten, sondern auch über viel mehr Muskelmasse verfügten, schienen die beiden zu bedrohen. Der größere der Schläger hatte eine Igelfrisur und trug um seinen Hals ein riesiges, goldglänzendes Dollarzeichen. Sein Freund, der knapp zehn Zentimeter kleiner war, trug eine Bomberjacke, auf deren Rückseite ein großer Drachen gestickt war, und eine Baseballmütze der Cubs.
Was ich als Beleidigung der Cubs empfand.
Der etwas stämmigere Junge musste etwas gesagt haben, was den Schlägern nicht gefiel, denn die beiden schubsten ihn jetzt und er stolperte einige Schritte zurück.
»Merit, wir müssen ihnen helfen.«
Ich hätte ihnen gerne geholfen, aber meine wichtigste Aufgabe war es, ihr zu helfen. Ich konnte spüren, wie sich Magie um sie herum sammelte und einen Weg an die Oberfläche suchte. Würde sich diese Magie erst einmal einen Weg bahnen, würde ich sie nicht mehr aufhalten können.
»Mallory, ich muss dich hier wegbringen, bevor was Schlimmes passiert.«
Sie sah mich ausdruckslos an. »Bevor ich ausraste?«
»Um ehrlich zu sein, ja.«
»Caroline Evelyn Merit. Ich werde nicht ausrasten.«
Das sagte sie. Aber ihre Erfolgsbilanz sah nicht gut aus. Wir waren mit den Formwandlern ein Bündnis eingegangen, aber das konnte sich jederzeit wieder ändern. Ich wollte nicht dafür verantwortlich sein, dass sie es wieder lösten.
Ich sah sehnsüchtig in Richtung Wagen.
»Ich verstehe dich ja«, sagte ich, »aber ich habe meine Pflichten. In diesem Augenblick stehst du ganz oben auf der Liste.«
»Halt die Klappe«, sagte sie. »Dir gefällt es doch, die knallharte Vampirin zu spielen.«
Ohne jede Vorwarnung gab sie einen ohrenbetäubenden Pfiff von sich. »Ey, ihr Wichser! Warum legt ihr euch nicht mit Leuten an, die es mit euch aufnehmen können?«
Die Blicke der vier richteten sich auf uns.
»Mallory Delancey Carmichael«, fluchte ich und schluckte schwer, während mir das Herz in die Hose rutschte. Ich war vielleicht eine Vampirin, aber die Typen waren wesentlich größer und massiver gebaut als ich. Und sie waren von wesentlich mehr Hass erfüllt.
Der Kerl mit der Igelfrisur starrte uns verächtlich an. »Hast du irgendein Problem, du Schlampe?«
Diese Frage sorgte dafür, dass meine Ängste mit einem Mal wie weggeblasen waren. Ethan-Sullivan-mäßig zog ich eine Augenbraue in die Höhe.
»Was hat der gerade gesagt?«
»Das hat er nicht wirklich, oder?«, flüsterte Mallory mir zu. »Tritt ihm in den Arsch.«
Sie konnte das ja leicht sagen, denn sie selbst durfte ja nichts anstellen, und ich hatte dafür die Verantwortung. Aber jetzt war es für einen Rückzug zu spät. Dafür hatte sie gesorgt.
Ich fügte mich in mein Schicksal, lockerte die Schultern, atmete tief durch, um mich zu beruhigen, und nahm die Haltung einer echten Vampirin an. »Behalte den Rest der Leute im Auge, und sag mir Bescheid, wenn sie uns den Weg zum Auto abschneiden wollen. Wir können es nicht allein mit dem gesamten Pöbel aufnehmen.«
Mallory nickte.
Ich schlenderte gemütlich zu ihnen hinüber, wodurch sie ihren Blick nur auf mich richteten.
»Ähm. Hast du mich eben Schlampe genannt?«
Igelfrisur und Drachenbomber sahen sich an und lachten. Dann klatschten sie sich ab, als ob sie sich mit der Verwendung dieses zweisilbigen Wortes einen Preis verdient hätten.
»Habe ich«, sagte Igelfrisur. »Und was willst du dagegen tun?«
Ich überhörte seine Frage und sah zu den Jungs hinüber. »Belästigen euch diese Männer?«
»Sie mögen Vampire«, sagte Drachenbomber, als ob das ihr Verhalten nicht nur erklärte, sondern vor allem auch rechtfertigte.
Ehrlich gesagt sahen die Jungs nicht so aus, als ob ihnen viel an Vampiren läge. Sie wirkten sehr ängstlich und wollten vermutlich nichts anderes, als möglichst schnell hier wegzukommen.
»Wir glauben halt, dass alle Leute eine faire Chance bekommen sollten«, sagte der etwas stämmigere Junge und kratzte sich dabei nervös am Arm.
Ich konnte mir nicht vorstellen, wie viel Mut dazugehörte, diese Worte vor zwei solchen Schlägern auszusprechen. Am liebsten hätte ich ihn umarmt. Aber deswegen war ich nicht hergekommen.
»Fick dich«, sagte Igelfrisur.
»Ja, fick dich«, pflichtete ihm Drachenbomber bei.
Aber der Junge hatte nicht nur den Mut gefunden, seine Meinung zu sagen, sondern sich auch zu wehren. Er würde jetzt keinen Rückzieher machen.
»Du weißt, dass du ein Arschloch bist, oder?« Er spielte nervös an seiner Jacke. »Glaubst du, es macht dich zu einem starken Mann, wenn du mich zusammenschlägst? Wohl kaum. Das macht dich nur zu einem Idioten. Schlagt mich doch zusammen, wenn ihr euch dann besser fühlt. Wenigstens weiß ich, wer ich bin. Ihr wisst einen Scheißdreck.«