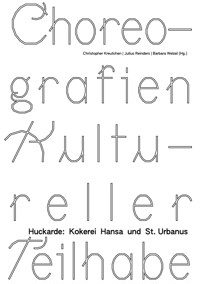
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wissenschaft und Kunst vor Ort. Diese Choreografie führt verschiedene Erkenntnismethoden in ihrer Eigenlogik an einem Ort zusammen und bringt sie in ein Gespräch. Zugleich kontrastiert und miteinander in Dialog gesetzt werden in diesem Projekt zwei Erinnerungsorte, der eine - die Kokerei Hansa - außer Gebrauch gefallen und grundstürzenden Transformationen unterworfen, der andere - die Kirche St. Urbanus - ein Ort, an dem sich gegenwärtiges kirchliches Leben und die kulturelle Erinnerung an vergangene Epochen, Bekenntnis und säkulares Denkmal durchdringen. An diesen spezifischen Erinnerungsorten treffen sich Stadt- und Raumplanung, Bildungswissenschaften, Kunstgeschichte und Kulturelle Bildung sowie Künstlerisches Arbeiten nicht im strengen Sinn zu einem interdisziplinären Programm. Vielmehr gilt es vorort, Reichweiten von Disziplinen zu kartieren. Ziel ist es, Kontaktzonen und unterschiedliche wissenschaftliche Zuständigkeiten zu verstehen - und doch zugleich gemeinsam auf Erkenntnissuche zu gehen. Mit dieser Publikation werden die Erträge als Beitrag zur Arbeit am Bild des Ruhrgebiets, an seiner Weiterentwicklung sowie als Choreografien der Partizipation vorgestellt - und können vielleicht ihrerseits zu Exkursionen und Bildexperimenten sowie zur mitgestaltenden Partizipation anstiften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Barbara Welzel Doppelt im Visier: Kokerei Hansa und St. Urbanus
Marita Pfeiffer Die Industriedenkmalstiftung - ihre Arbeit auf der Kokerei Hansa und was sie so besonders macht
Offene Türen – St. Urbanus, Huckarde Pfarrer Michael Ortwald
Barbara Welzel Exkursion zur St. Urbanus-Kirche in Huckarde
Renée Tribble Zukünfte. Planungen und Möglichkeiten in Huckarde-Nord
Felix Kutzera Neue Wege der Qualitätssicherung: Interdisziplinarität und Austausch in Städtebau und Denkmalpflege
Sarah Hübscher und Johanna Ufkes Narrative des Verstehenlernens. Lernen vor Ort zwischen Global Citizenship Education und Historischem Lernen
Christopher Kreutchen Eine Frage von Perspektiven_ graphisches Storytelling als Erschließungsstrategien
Julius Reinders Zeichnen in Huckarde
Künstlerische Forschungen vor Ort
Barbara Welzel Doppelt im Visier: Kokerei Hansa und St. Urbanus
Das Bild der erst seit etwa einem Jahrhundert Ruhrgebiet genannten Region wird bekanntlich sehr weitgehend noch immer durch ein Imaginarium von Industrie und De-Industrialisierung bestimmt. Die Umcodierung von industriellen Produktionsstätten in Industriedenkmale hat bildmächtige Erinnerungsorte geschaffen – etwa das Industriedenkmal der Kokerei Hansa in Dortmund Huckarde.1 Die Bildstrategien der Fotografien von Bernd und Hilla Becher waren wichtige Agenten in diesem Prozess.2 In seiner Einseitigkeit und zeitlichen Verengung auf nicht einmal 150 Jahre verstellt dieses Bild – Image – allerdings den Horizont. Ausgeblendet bleibt beispielsweise sehr weitgehend die Bildungs- und Wissenschaftsregion, die – neben den bedeutenden Aufbrüchen seit den 1960er Jahren – ihrerseits auf eine mehr als 1000-jährige Geschichte zurückblicken kann.3 Und auch die reiche Kulturtradition der Region steht im Schatten einer einseitigen Wahrnehmung.4 Herausragender Ort für Bildung und Kultur war seit der Christianisierung der Region – neben dem Kloster Werden – das Frauenstift Essen, zu dem die Kirche St. Urbanus und das Dorf Huckarde bis 1803 gehörten.5 Zukunftsgestaltung – zu der ganz konkret die Stadt- und Raumplanung gehören und ebenso die Vorbereitungen für die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 mit ihrem Motto „Wie wollen wir morgen leben?“ – bedarf daher nicht zuletzt der Arbeit an den Narrativen und an den Bildern.
Doppelt im Visier. Zugleich kontrastiert und miteinander in Dialog gesetzt werden zwei Erinnerungsorte, der eine – die Kokerei Hansa – außer Gebrauch gefallen und grundstürzenden Transformationen unterworfen, der andere – die Kirche St. Urbanus – ein Ort, an dem sich gegenwärtiges kirchliches Leben und die kulturelle Erinnerung an vergangene Epochen, Bekenntnis und säkulares Denkmal durchdringen.6 Kirchen sind keine Museen im eigentlichen Sinn des Wortes, sie werden nicht besucht, um aus dem Gebrauch genommene Objekte zu besichtigen. In ihnen finden Gottesdienste statt, sie sind weiterhin „in Betrieb“. Seit dem 19. Jahrhundert sind Kirchen, die Gebäude und ihre Ausstattungen, doppelt codierte Orte. Sie sind Gotteshäuser. Und sie sind zugleich Kulturdenkmale. Dieser Kulturbegriff ist ein säkularer, der besagt, dass diese Monumente neben ihrer Bekenntnisfunktion im christlichen Glauben Erbe aller Menschen sind. Die Anerkennung als „Denkmal“ bedeutet für die Besitzer:innen, also bei den Kirchen für die Gemeinden, immer auch ein Stück Souveränitätsverzicht. In den Kirchengebäuden und ihren Ausstattungen sind Geschichte und Kultur Europas aufsuchbar für alle Menschen. Für eine historische verankerte Topographie sind sie unverzichtbar.
Doppelt im Visier: Wissenschaft und Kunst vor Ort.
Diese Choreografie führt verschiedene Erkenntnismethoden in ihrer Eigenlogik an einem Ort zusammen und bringt sie in ein Gespräch. Ausgangspunkt waren die Studiengänge des Lehramts Kunst an der Technischen Universität Dortmund und die Suche nach einer Möglichkeit, die disziplinär weit auseinanderliegenden Bereiche des Künstlerischen Arbeitens und der Kunstwissenschaft in einen Austausch und ein gemeinsames Tun zu bringen, die die jeweiligen professionellen Standards wahren kann.7 Längst wurde dieser Ansatz ausgeweitet. Hochschuldidaktisch weiterentwickelt wurden die „Diversitätsdialoge in Studium und Lehre“8.
Es geht bei einer Begegnung beispielsweise zwischen Fotografie und Physik9 nicht um Interdisziplinarität im „klassischen“ Sinne; auch in diesem Projekt zur Kokerei Hansa und zu St. Urbanus in Huckarde treffen sich Stadt- und Raumplanung, Bildungswissenschaften, Kunstgeschichte und Kulturelle Bildung sowie Künstlerisches Arbeiten nicht im strengen Sinn zu einem interdisziplinären Programm. Vielmehr gilt es, Reichweiten von Disziplinen zu kartieren, sie in ihren differenten epistemischen Zugriffen, in ihren – etwa bis in die Zitierweisen – heterogenen habituellen Ausprägungen kennenzulernen. Ziel ist es, Kontaktzonen und unterschiedliche wissenschaftliche Zuständigkeiten zu verstehen – und doch zugleich gemeinsam auf Erkenntnissuche zu gehen.
Choreografien Kultureller Teilhabe. Die Vielstimmigkeit der Zugangsweisen ist ein Leitmotiv der Konvention von Faro, dem „Rahmenübereinkommen über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft“, aus dem Jahr 2005 des Europarats.10 Die Diversitätsdialoge erweisen sich vor dieser Folie als eine Choreografie kultureller Teilhabe. Folgerichtig waren sie eine zentrale Methode für die Arbeitsgruppe „Kulturelle Teilhabe“ in DoProfiL (Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung), dem Projekt der Technischen Universität Dortmund in der Qualitätsoffensive Lehrerbildung.11
Doppelt im Visier: Kokerei Hansa und St. Urbanus. Das Projekt hat im Sommersemester 2023 diesen methodischen Zugriff erneut im Kontext der Lehrer:innenbildung – im Dialog zwischen Kunstwissenschaft und Kunstdidaktik12 sowie Künstlerischem Arbeiten13 – durchgespielt und zugleich – auch das ist eine These zu einer gelingenden Lehrer:innenbildung und ebenso zu ihrem Nutzen für andere Wissenschaften – in Dialog gebracht mit weiteren Disziplinen, namentlich den Bildungswissenschaften14 und der Raumplanung15. Unternommen wurden wissenschaftliche und künstlerische Erkundungen. Räume für zahlreiche Gespräche und Begegnungen wurden eröffnet. Mit dieser Publikation werden die Erträge als Beitrag zur Arbeit am Bild der Region, an ihrer Weiterentwicklung sowie als Choreografien der Partizipation vorgestellt – und können vielleicht ihrerseits zu Exkursionen und Bildexperimenten sowie zur mitgestaltenden Partizipation anstiften.
1 Vgl. den Beitrag von Marita Pfeiffer in diesem Band, hier auch weitere Referenzen.
2 Stellvertretend: Bernd und Hilla Becher: Hochöfen. München 2002; dies.: Gasbehälter. München 2002; dies.: Industrielandschaften, München 2008; dies.: Bergwerke und Hütten – zur Ausstellung im Josef Albers Museum Bottrop. München 2010; vgl. auch Barbara Welzel: Kunstgeschichte vor Ort: St. Johann in Brechten als Erinnerungsort des Ruhrgebiets und Europas. In: Thomas Schilp/Barbara Welzel (Hg.): St. Johannes in Brechten als Erinnerungsort des Ruhrgebiets (Dortmunder Mittelalter-Forschungen 14). Bielefeld 2011, S. 12–21.
3 Stefan Berger: Strukturwandel und Bildung. Die Herausbildung eines Wissensregimes im Ruhrgebiet. In: Hans Jürgen Lechtreck/ Wolfgang Sonne/Barbara Welzel (Hg.): Bildung@Stadt_Bauten_Ruhr. Dortmund 2022, S. 44–67.
4 Stellvertretend sei hier für die Moderne genannt: Hans-Jürgen Lechtreck/Wolfgang Sonne/Barbara Welzel (Hg.): Kultur@Stadt_Bauten_Ruhr. Dortmund 2020.
5 Vgl. die Beiträge von Michael Ortwald und, mit weiteren Referenzen, von Barbara Welzel in diesem Band.
6 Vgl. Barbara Welzel: Urban Art History. Cultural Heritage, Flâneurs, and Points of Presence. In: Jens Martin Gurr/Denis Hardt/Rolf Parr (Hg.): Metropolitan Research: Methods and Approaches. Bielefeld 2022, S. 89-109; dies.: Kirchen als kulturelles Erbe: Anders-Orte und diskursive Ermöglichungsräume. In: Claudia Gärtner/Britta Konz/ Andreas Zeising (Hg.): Begegnungsräume // Kontaktzonen (verorten. Räume kultureller Teilhabe). Bielefeld 2022, S. 51–60.
7 Pilotprojekt war: Bettina van Haaren/Barbara Welzel (Hg.): Doppelt im Visier. Kunst und Wissenschaft vor Ort in der Immanuelkirche in Dortmund-Marten und in der Zeche Zollern II/IV in Dortmund-Bövinghausen. (Dortmunder Schriften zur Kunst/Kataloge und Essays 6) Norderstedt 2009. Seither wurde diese Choreografie immer wieder weiterentwickelt; Meilensteine waren Klaus-Peter Busse und Barbara Welzel et al.: Stadtspäher in Hagen. Baukultur in Schule und Universität. Hg. von der Wüstenrot Stiftung, Ludwigsburg 2013; dies.: Stadtspäher im Dortmunder U. Baukultur in Schule und Universität. Hg. von der Wüstenrot Stiftung. Ludwigsburg 2014; Christopher Kreutchen/Barbara Welzel (Hg.): Gartenspäher in Schwetzingen. Oberhausen 2020, ein Projekt, an dem sich auch Sarah Hübscher und Julius Reinders beteiligt haben.
8 Barbara Welzel: Diversitätsdialoge in Studium und Lehre an der TU Dortmund, in: journal hochschuldidaktik 23, Sept. 2012, S. 8–13; dies.: Kulturelles Erbe inklusiv: Diversitätsdialoge an der Hochschule. In: Cordula Meier/Karoline Spelsberg-Papazoglou (Hg.): Heidi – Diversität in Kunst, Wissenschaft und Institutionen. Bielefeld 2020, S.235–245.
9 Zuletzt etwa Jörg Debus/Niklas Gliesmann/Timo Klos/Barbara Welzel (Hg.): 2x – Physik und Kunst zwischen Zeit und Raum. (Dortmunder Schriften zur Kunst/Kataloge und Essays 61) Dortmund 2023.
10https://rm.coe.int/1680083746(29.9.2023); vgl. stellvertretend Gabi Dolff-Bonekämper: Die Faro-Konvention. In: Kreutchen/Welzel 2020 (wie Anm. 7), S. 64–67.
11 Stephan Hußmann/Barbara Welzel (Hg.): DoProfiL – Das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Münster 2018, hier bes. das Kapitel: Janieta Bartz et al.: Auf dem Weg zur Neuverortung: Sprache, Objektkultur und Religion im transkulturellen Deutschland, S. 179-193; Stephan Hußmann/Barbara Welzel (Hg.): DoProfiL 2.0 – Das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Münster 2023, bes. das Kapitel Barbara Welzel/Christopher Kreutchen et al.: Kulturelle Teilhabe, S. 51—84. Vgl. in diesem Kontext auch Barbara Mertins: Diversitätsdialoge im Licht des Schwellenkonzepts. In: Alexander Gurdon/Sarah Hübscher/ Christopher Kreutchen (Hg.): Resonanzen // Interventionen (verorten - Räume kultureller Teilhabe). Bielefeld 2022, S. 90–97.
12 Vgl. den Beitrag von Christopher Kreutchen in diesem Band.
13 Vgl. den Beitrag von Julius Reinders und die dokumentierten künstlerischen Arbeiten in diesem Band.
14 Vgl. den Beitrag von Sarah Hübscher und Johanna Ufkes in diesem Band.
15 Vgl. die Beiträge von Felix Kutzera und Renée Tribble in diesem Band.
Marita Pfeiffer Die Industriedenkmalstiftung ‒ ihre Arbeit auf der Kokerei Hansa und was sie so besonders macht
Warum existiert die Kokerei Hansa in Dortmund noch, obwohl sie bereits vor mehr als dreißig Jahren stillgelegt wurde? Besucher:innen machen sich darüber zumeist kaum Gedanken. Vielmehr sind sie – angesichts der imposanten Industriebauten und technischen Anlagen einerseits und der sich auf dem Gelände immer weiter ausbreitenden Industrienatur andererseits – zunächst geneigt, Fragen nach der historischen Bedeutung oder den derzeitigen Nutzungen nachzugehen. Was ist das?
Wozu diente die Anlage? Wer hat hier gearbeitet?
Wie kommen die Bäume hier hin? Was findet hier heute statt? Weil all diese vor Ort aufkommenden Fragen unmittelbar mit der Bewahrung des Denkmals verknüpft sind, lohnt es sich, die Geschichte des Erhalts und der Vermittlung der Kokerei Hansa und die damit verbundenen Aufgaben in den Blick zu nehmen.
Am 12. Dezember 1992 wurde die Kokerei Hansa geschlossen. Die damalige Eigentümerin, die Ruhrkohle AG (jetzt RAG Aktiengesellschaft), sah sich laut Bundesberggesetz zum Abbruch und zur Sanierung des Geländes verpflichtet. Aufgrund des hohen Zeugniswerts der Anlage für die Verbundwirtschaft der späten 1920er Jahre legten Denkmalpfleger:innen Widerspruch ein. Weil kein neuer Eigentümer in Sicht war, hätte die Ruhrkohle AG entsprechend dem nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetz ein Übernahmeverlangen an die Stadt Dortmund stellen können. Ob diese die Bewahrung der Kokerei hätte schultern können, ist mehr als fraglich.
Modelle zum Erhalt von großdimensionierten Anlagen gab es bereits seit der Gründung der Industriemuseen im Rheinland und in Westfalen in den 1970er Jahren mit insgesamt 15 dezentralen Standorten. In Dortmund zählt in diesem Kontext die Zeche Zollern zu den Musterbeispielen nicht nur der Industriearchitektur, sondern auch der Industriedenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen.
Nachdem im Mai 1969 die im Jugendstil erbaute Maschinenhalle der Zeche Zollern in der Zeitschrift „Bauwelt“ als „Entdeckung des Jahres“ vorgestellt worden war, hatte sich in der Bevölkerung Unmut gegen den Abriss geregt. Bürger:innen engagierten sich mit einem Schreiben an die damalige Landesregierung, „ein Stück der überlieferten Industrielandschaft zu erhalten“. Die daraus folgende Erfolgsgeschichte der Industriedenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen ist hinlänglich bekannt. Das Land Nordrhein-Westfalen verabschiedete verschiedene Programme zur Bewahrung von Bauwerken, die für die Technik- und Wirtschaftsgeschichte des Landes charakteristisch sind, und stellte – erstmals in der Bundesrepublik Deutschland – Sondermittel zur Bewahrung von technikund wirtschaftsgeschichtlich relevanten Denkmalen in den Landeshaushalt ein.
Eine Schlüsselrolle kam zunächst den neu gegründeten Fachämtern für Industriedenkmalpflege bei den Landschaftsverbänden im Rheinland und in Westfalen zu. Ihre Hauptaufgabe bestand darin,, sich einen Überblick über die Bauten der Industrie und Technik in Nordrhein-Westfalen zu verschaffen, sie zu erforschen und zu inventarisieren.
Im Jahr 1980 wurde das Denkmalschutzgesetz des Landes NRW verabschiedet. Mit der Berücksichtigung der „Entwicklung der Produktion und Arbeitsverhältnisse“ enthielt es die in der Bundesrepublik weitreichendste Formulierung zum Schutz des industriellen Erbes.
Ausdruck der intensiven Befassung mit dem industriellen Erbe ist eine Flut von Veröffentlichungen in den 1980er und 1990er Jahren. Dabei setzt die Publikation „Bauten der Industrie und Technik“ von Axel Föhl im Jahr 1994 einen Markstein, indem sie dezidierte Erläuterungen zur Frage „Was ist ein Denkmal der Industrie- und Technikgeschichte?“e n th ielt, bis heutige gültige Kriterien formulierte und Maßstäbe der Bewertung von Industriedenkmalen setzte.16
Einen erheblichen Aufschwung erhielt die Industriedenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen durch die Internationale Bauausstellung (IBA) Emscher Park (1989–1999) mit ihrem Programm zur Begleitung und Bewältigung des Strukturwandels von der Schwerindustrie zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft. Ein Schwerpunkt war die Umnutzung des industriellen Erbes. Dabei war es ein besonderes Verdienst der IBA, die Themen der Industriegeschichte und der Bewahrung von großmaßstäblichen Bauten der Schwerindustrie in die Öffentlichkeit zu vermitteln. Das beredsamste Beispiel ist das Hüttenwerk Meiderich, das zum Landschaftspark Duisburg-Nord umgenutzt wurde und sich heute großer Beliebtheit durch die Stadtbevölkerung erfreut und ein touristischer Ankerpunkt geworden ist.
Empfehlung: Weg zur Reparaturgesellschaft
Im Bereich der Wissenschaft wurde insbesondere in den 1990er Jahren die „bisher praktizierte Strategie ständiger Erneuerung“ aus ökonomischen und ökologischen Gründen zunehmend in Frage gestellt. Die Einführung von Uta Hassler und Michael Petzet zur Tagung „Das Denkmal als Altlast“17 auf der Kokerei Hansa im Jahr 1995 spiegelt die – bis heute immer noch erstaunlich aktuellen – Fragenstellungen jener Zeit: „In einem nicht nur kurzfristige Vermarktungsstrategien berücksichtigenden Bilanzrahmen, der die Herstellung, die Nutzung, den Unterhalt und die Beseitigung von Gebäuden einbezieht, würden sich der Erhalt des vorhandenen Baubestands und seiner Teile und die kontinuierliche Nutzung bebauter Flächen jedenfalls vielfach günstiger darstellen als der ständige Austausch bestehender Gebäude durch neue. Schon aus ökonomischen Gründen würde sich die in der Denkmalpflege häufig auftretende Frage nach der Zumutbarkeit des Erhalts bestehender Gebäude nicht mehr stellen. Mit der Masse vorhandener Altbauten böten sich weitaus umfassendere Interventionsmöglichkeiten für ein aus ökologischer Sicht notwendiges Ressourcenmanagement, als sie durch Einflussnahme auf die Neubautätigkeit je erreicht werden könnten. In diesem Sinne stellen die vorhandenen Gebäude nicht nur kulturelle Werte, sondern auch wichtige materielle und energetische Ressourcen dar.“18





























