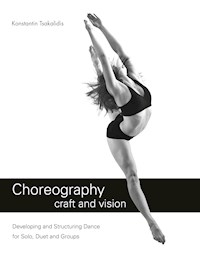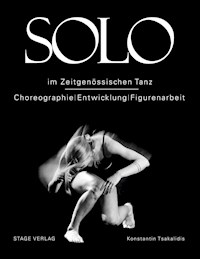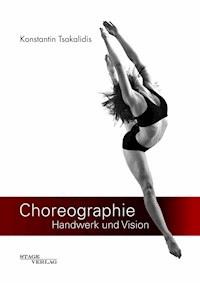
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Fachbuch bietet einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Zugänge, mit denen sich eine zeitgenössische Choreographie entwickeln lässt, und stellt praxisnahe dramaturgische sowie choreographische Methoden vor, mit denen sich Tänze erfolgreich erarbeiten und analysieren lassen. Aus dem Inhalt: Thema – Struktur – Dramaturgie – Stückaufbau Thematische Entwicklung von Bewegung Arrangement, Komposition und räumliche Gesetze Manipulation und Bewegungsqualität Musik – Bewegung – Pädagogik Abstraktion – Schauspiel – Tanz Bühnenbild, Film und Beleuchtung Kompositorische Variationen und Rhythmik Mit 120 Studien und Übungen. Dieses Buch ermöglicht es Ihnen, einen tieferen Einblick in den choreographischen Prozess zu gewinnen und ein differenziertes Verständnis für die Welt des Tanzes zu entwickeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Choreographie.
Choreographie ist zu 80 Prozent Handwerk!
Dieses Handwerk lässt sich auf alle Tanzstile gleichermaßen übertragen und anwenden!
Choreographie ist zu einem großen Teil vom tänzerischen Können unabhängig!
Tanz.
Der Tanz kann wie die Musik die Bewegung der Seele erfassen und dort Zwischenräume beleuchten, die sonst im Menschen unsichtbar verborgen bleiben. Er kann diese Zwischenräume vergrößern, bis sie sichtbar werden - er kann eine Ausdrucksform des Himmels auf der Erde sein. Seine Substanz ist eine Mischung aus Wissenschaft und Nonverbalem, das sich in keiner Abhandlung definieren lässt. Im Tanz wohnt ein unergründbares Geheimnis, dem wir uns im Augenblick der Bewegung annähern können, es aber nicht zwangsläufig tun. Es liegt ein innerer Kern im Wesen des Tanzes, von dem seine Faszination ausgeht, den wir, indem wir ihn umkreisen, emotional lokalisieren können. Tanzen ist die Suche nach diesem inneren Kern, dem Geheimnis näher zu kommen - im Moment der Bewegung.
Kurse für Choreographie:
www.choreographie-kurs.de
Impressum
Verlag:
STAGE VERLAG KONSTANZ
Schneckenburgstr. 11
78467 Konstanz
Fax 07531 8029353
www.choreo-book.com
Tänzerin auf dem Cover: Verena Sommerer
Fotografie: Rolf Wrobel und Alf Ruge
Gestaltung: Alf Ruge
www.alf-ruge.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, für Vorträge und Unterricht nur mit schriftlicher Genehmigung.
Copyright (2012). Alle Rechte bei Konstantin Tsakalidis.
published by: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
ISBN 978-3-8442-3111-3
Dank
An die Tänzerinnen und Tänzer, die in diesem Buch auf Fotos zu sehen sind:
Laura Jaeggi, Ronny Kistler, Verena Sommerer, Laura Stecher, Ariane Brandt, Greta Bebenroth, Vit Bartak, Stephane Le Breton, Zaida Ballesteros, Annika Wiessner, Jeröme Gosset, Doriane Locatelli, Yasha Wang, Kizzy Garcia Vale, Jan Sandro Berner, Leia Salte, Montserat Ventura, Clair Dunn, Tony Halvorstad, Susana Beverly, Kate Black, Rowena Kinzett, Mahako Teriganari, Winfried Haas, Sabine Fichter, Sabine Jordan, Irka Plonski, Annegret Thiemann und viele andere.
An meine Lehrer am Laban Center in London, bei denen ich viel über die Technik des Choreographierens lernte. An die Lehrer der Tanzwerkstatt Konstanz, die in ihre Tanzstudenten viel Geduld und Liebe investierten. An Erwin Schumann und die Züricher Lehrer, bei denen ich das Existenzielle im Tanz entdeckte. An die Lehrer in den Tausenden von Klassen und Workshops der freien Szene, an denen ich teilnahm. An die Regisseure und Choreographen, mit denen ich gearbeitet habe. An die vielen Schüler und Studenten, die mir ihr Vertrauen entgegenbrachten, um die Studien und Übungen in diesem Buch zu entwickeln. An Jeanette Neustadt für die Korrektur der ersten Fassung. An Dr. Christiana Rosenberg-Ahlhaus für die Durchsicht der zweiten Fassung. An Werner Nater für die unzähligen Stunden, in denen er in Afrika über der dritten Fassung saß. An meine Lektorin, Frau Bärbel Philipp. An meinen Grafikdesigner Alf Ruge.
An meine Frau Luise, die mir in meinen Stücken und während der Arbeit an diesem Buch immer wieder ihre Aufmerksamkeit schenkte und mit Geduld und achtsamer Unterstützung meine Arbeit mitträgt.
Studien
Mit welchen Parametern entsteht welche Intensität in der Bewegung?
Bezug zwischen Vorlage und Interpretation
Verbindungsszenen
Die Spannung zwischen dem Zuschauer und dem Bühnenraum
Richtungen zwischen den Tänzern in Bezug zu den Zuschauern
Fokus I
Fokus II
Fokus III
Fokus IV
Auflösung einer literarischen Vorlage
verschiedene Richtungen
Einsatz und Akzent der Musik
Musikinterpretation
Umsetzen von Wendepunkten und dynamischen Zeiteinheiten
Die dritte Dimension bei Wendepunkten und dynamischen Zeiteinheiten
Manipulationsparameter über Beziehungsaspekte durch Impulse von außen, mit oder ohne Kontakt
Manipulationsparameter aus der Entwicklung neuer Übergänge
Manipulationsparameter aus der Dimensionierung
Manipulationsparameter aus der Zergliederung
Manipulationsparameter aus der Bewegungsessenz
Efforts in Materialien
Manipulationen aus getrennten Elementen
Übertragungen innerhalb des Körpers
Manipulationen durch „Frei und gebunden“
Manipulationen über energetische Veränderungen durch Sounds und Atmung
Manipulationen mit Raumparametern innerhalb der Kinesphäre
Das Übersetzen der Bewegungssegmente in andere Raumbereiche
Die Einflüsse der räumlichen Veränderung auf eine Choreographie
Manipulationen über Tempo und Rhythmus
Komplementärelemente aus der choreographischen Idee
Accumulation
Verbindungen zwischen Thema und Bewegung über Synonyme
Thema und Aufbau
Aufbau eines thematischen Settings
Erarbeiten Sie einen choreographischen Zugang zu einem Thema anhand der Visualisierung
Abstraktionen und Elementarkomponenten
ABA-Struktur und Canon
Das Potenzial „Raum"
Raumwirkungen
Schwerpunkte im Raum innerhalb verschiedener Arrangements
Bilder in Landschaften
Verbindung und Isolierung des Beziehungsaspektes mit der Raumebene
Räumliche Spannung durch Bezüge zwischen Raum, Richtung und Level
Bewegungsstudie zur Thematik „Nähe - Distanz"
Zwischenraum
Räumliche Bezüge innerhalb des Arrangements
Inseln und Wege der Aufmerksamkeit innerhalb des Arrangements
Das lebende Klettergerüst
Transformieren von Bewegungsmaterial
Raumkompositionen
Synchronität im Verhältnis zur Dynamik
Oppositionen aus Attributen
Ein Stück entsteht aus einer Geste
Von Symmetrie zu Asymmetrie
Verdichten und Entschlacken
Positionen in einen Bewegungsfluss legen
Neue Wege in bekannte Positionen
Phrasierungen über verschiedene Parameter
Minidramen
Film
Bühnenbild
Übungen
I Körperräume
Hören
Partnerarbeit – geteilte Aufmerksamkeit
Die verschiedene Kreise der Aufmerksamkeit
Geleitete Improvisation – Komposition – Gruppenübung
Innere Räume – Gedankenreise im Stehen
Visualisierung
Subtext „Mama“
Räumliche Spannung durch Bezüge zwischen Raum, Richtung und Level
Räumliche Spannungen zwischen Relationen und Dominanten – statisch
Räumliche Spannung durch Bewegungsqualität und Geschwindigkeit
Unterschiedliche Bezüge in Aktion und Reaktion
Übung zu Struktur und dramatischem Bogen
Geschichte
Erzählung
Gesten
Bild
Gedicht
Geschichte
Farben
Musik
Impulse
Impulse mit einem Handtuch
Spiegeln
Rolling Point
Hindernisse
Gewicht aufnehmen
Aufnehmen - Umlenken
Unterstützen
Knotenpunkte
Connection
Schnipsen
Kraft und Release
Bälle - Trio
Leichtigkeit und Schwere
Rollen und Gleiten
Chinesische Schriftzeichen - weiterführend als Partner- oder Trioarbeit
Wellen
Twister
Führungswechsel
Kollektive Entscheidungen und Reaktionen
Kreisgehen
Verhältnisse zwischen Beat und Tanz
Tänzerische Bearbeitung einer Komposition anhand einer grafischen Umsetzung
Definition einer Musik zu einer Aussage und isoliertes Erarbeiten eines Tanzes
Strukturen aus der Musikkomposition werden in den Tanz übertragen
Die Musik spielt mit der Choreographie
Dialog: Musiker - Tänzer
Sounds
Vokale
Bodypercussion
Vokale Rhythmen
Vokale Rhythmen brechen die Bewegungsrhythmen
Rhythmische Transformationen
Rhythmische Struktur
Rhythmische Beobachtungen und Übertragungen
Brüche
Akzente und innere Impulse
Impulse
Zweidimensionale Rhythmen in 3-D
Musicaltexte und komplementäre Elemente
0 Einleitung
Sehr viele Choreographen sind Autodidakten. Viele kommen über Umwege zum Tanz, umgehen die Tanzausbildung und steigen direkt als Choreograph ein. In Tanzausbildungen findet sich oft wenig fundierte choreographische Technik, die den Studenten beigebracht wird. Der an der Choreographie interessierte Tanzstudent erhält allenfalls die Möglichkeit, seine Arbeit zur Diskussion zu stellen. Auf eine Methodik zur Erarbeitung des Stückes wird häufig nicht eingegangen, einfach deshalb, weil diese Methodik auch bei vielen Pädagogen fehlt. Die detaillierte Auseinandersetzung mit den Komponenten, die ein Stück bestehen oder fallen lassen, wird nicht selten schmerzlich vermisst.
Innerhalb des Studiengangs „Choreographie" der an mehreren Hochschulen angeboten wird, werden viele der hier abgehandelten Themen in der Praxis und in der Theorie behandelt. Die Hochschulen unterscheiden sich nach der Art und Weise, wie sie das Thema „Choreographie" aufschlüsseln und welche Schwerpunkte sie dem Studium geben, zum Teil erheblich.
Das hier vorliegende Buch richtet sich an Tänzer, Choreographen, Regisseure, Performer und Lehrer. Es bietet einen umfassenden Einblick in verschiedene Zugänge, mit denen sich eine zeitgenössische Choreographie entwickeln lässt, und stellt choreographische Werkzeuge vor, mit denen sich Tänze bearbeiten und analysieren lassen. Damit wird ein Überblick über die Methoden geschaffen, die in einem Tanzstück oder in einer Tanzeinlage im Theater zur Anwendung kommen, um eine Idee in eine Vorstellung auf der Bühne zu verwandeln.
Grundsätzliche Überlegungen zum strukturellen Aufbau eines Stückes werden ebenso besprochen wie das Entwickeln von Bewegungen zu einem Thema. Behandelt werden auch stückinterne Komponenten, wie Komposition, Bewegungsqualitäten und räumliche Gesetzmäßigkeiten. Einige Kapitel, wie Bühnenbild, Film und Beleuchtung, greifen durch die komplexe Thematik der Choreographie hindurch und durchpflügen das nahe, beeinflussende Umfeld des Tanzes.
Nichttänzer erhalten einen tieferen Einblick in den choreographischen Prozess und haben die Möglichkeit, ein differenziertes Verständnis für die Welt des Tanzes zu entwickeln.
Zu jedem Kapitel sind in der Praxis entstandene und erprobte Übungen enthalten, die den Stoff auf der Ebene der Bewegung vertiefen und sich auch mit Schauspielern und Nichttänzern durchführen lassen.
Der Weg zum Choreographen
Vom Tänzer zum Choreographen
Oft beginnen Tänzer, die ihr Leben lang getanzt und den Schwerpunkt ihrer Aufmerksamkeit im Inneren ihres Körpers hatten, irgendwann zu choreographieren. Ein Schritt, der einen radikalen Wechsel in der Arbeitsweise bedeutet. Waren sie bisher damit beschäftigt zu prüfen, ob die Schultern hochgezogen sind, die Hüfte platziert oder der Fuß gestreckt ist, sind sie als Choreographen nun mit Dingen konfrontiert, die außerhalb ihres Körpers liegen. Von einem Tag auf den anderen müssen sie den Blick von innen nach außen verlagern und sich in andere hineindenken, müssen die Thematik vertiefen, eine Vision entwickeln und bei alledem den Druck der Produktion aushalten.
Wechselt jemand in seiner Arbeit seinen Aufmerksamkeitsfokus von innen nach außen, ist das allein schon eine Veränderung, die ein immenses Quantum an Kraft erfordert. Als Choreograph ist man die letztlich entscheidende Instanz des Stückes. Als Tänzer bekam man noch gesagt, was richtig und was falsch ist. Bei einem solchen Sprung ins kalte Wasser wird es nicht lange dauern, bis sich der Neuling unter den Choreographen überfordert fühlt, und er wird - selbst wenn er mit unverschämt viel Talent gesegnet ist - bald zu spüren bekommen, dass auch in der Kunst, Tänze zu entwickeln, ein Meister nicht vom Himmel fällt.
Quereinsteiger
In der experimentellen Szene, deren Techniken immer gerne auch von etablierten Theatern übernommen werden, arbeiten oft Regisseure mit Tänzern, die nicht die geringste Ahnung vom Wesen des Tanzes haben, geschweige denn über Methoden verfügen, die Tänzer in einer spar-tenübergreifenden Inszenierung zur Entfaltung zu bringen. Schnell entsteht bei Theaterregisseuren ein imaginäres Bild für eine Tanzeinlage - was fehlt, ist die Methode für den Erarbeitungsprozess. Die Visualisierung der Szene entsteht vor dem geistigen Auge; es ist ein schwer entwirrbares Geflecht aus Emotionen und abstrakten Ahnungen, die im Entferntesten noch nichts mit wirklichen Menschen auf einem wirklichen Bretterboden in einem wirklichen Theater zu tun haben.
Die Tänzer werden, unabhängig von der Beschreibung des Regisseurs, nie sein Bild sehen, sondern immer ihr eigenes. Egal, wie gut Sie als Regisseur/Choreograph Ihre Idee konkretisieren - was der Zuhörer visualisiert, ist immer ein anderes, nämlich sein eigenes Bild. Die Probe ist voll von visualisierten Ideen, die alle unterschiedlich sind, und es gibt unendlich viele Formen, eine Idee in eine Szene zu verwandeln - und jede Situation, jede Truppe erfordert einen anderen, einen individuellen Zugang.
Einen Teil der Zugangsmöglichkeiten zu einer Choreographie werde ich hier beschreiben. Diese Zugangsformen sind Bausteine, aus denen sich Tänze gestalten und entwickeln lassen. Die Bausteine werden sich während Ihrer Arbeit verändern, und es werden andere hinzukommen. Sie werden diese Bausteine unterschiedlich kombinieren müssen, um eine eigene Sprache im Tanz zu entwickeln.
Wie viel kann ich lernen oder erarbeiten?
Zwangsläufig wird immer ein großer Teil des Choreogra-phierens im Unausgesprochenen bleiben - einer der Gründe, warum es so wenige Bücher zu diesem Thema gibt -, und das trotz zahlreicher Techniken, die sich im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts enorm vervielfältigten. Der Fächer, der zur Verfügung stehenden choreographischen Techniken weitete sich mit dem Beginn der modernen Tanzformen, der Integration östlicher Energiearbeit und des durch experimentelle Theaterformen gewonnenen Zuwachses an Schauspiel und Performanceverständnis enorm aus. Damit hat sich nicht nur das Verständnis von Tanz und Choreographie erweitert und gewandelt, es wuchs auch die Zahl der Techniken, mit denen sich Tänze betrachten und inszenieren lassen.
Mit welchen Tanztechniken Sie arbeiten, ist letztlich unerheblich, da diese auf der Ebene der Gestaltung immer wieder denselben Gesetzen gehorchen. Unterschiedliche Techniken können mit den gleichen Gestaltungsimpulsen gefüttert werden. Wie viel Sie sich an choreographischem Handwerk aneignen, hängt mit Ihrer Einsatzbereitschaft und Ihrer Spielfreude zusammen, wie Sie die Impulse, die Sie hier in diesem Buch und aus der ganzen Welt des Tanzes erhalten, weiterentwickeln, indem Sie hinterfragen und ausprobieren und sich damit eine eigene Wahrheit erschaffen. Die Frage ist das WIE, mit dem Sie Ihr Technikkonglomerat gestalterisch auffächern, um es mit einer dramaturgischen Lupe zu untersuchen.
Tanz beginnt da, wo die Verbalisierung endet. Der Tanz wird mit den Sinnen erfahren, und die Sinne sind nun einmal nicht verbal. Eines der Probleme am Choreographieren ist deshalb der Spagat zwischen Intuition und Intellekt. Es ist die Arbeit mit etwas Ungreifbarem, Nonverbalem, im Moment Vergänglichem, welches aber trotzdem intellektuell bearbeitet werden will und kann. Die intellektuelle Analyse ist vielschichtig. Alle in ihr enthaltenen Komponenten beeinflussen sich gegenseitig, sodass sie nicht mehr einzeln, sondern nur in Beziehung zueinander betrachtet werden können.
So wertvoll diese Analyse akademisch auch sein mag - sie klammert das Nonverbale aus und ist nur eine Hälfte des Rades, die ohne die andere nie richtig ins Rollen kommt. Oft versteifen sich Tanzkreierende auf eine dieser Hälften. Ähnlich einseitig verhält es sich mit vielen Ausbildungskonzepten. Wünschenswert wären Ausbildungsansätze, die beide Seiten erfolgreich integrieren. Tanz ist nonverbal, benötigt aber in der Gestaltung eine intellektuelle Zersplitterung, ohne dabei seinen Ursprung zu verlieren.
Es geht für den Choreographen darum, sich ein gestalterisches Bewusstsein zu erarbeiten, das ihm die Entscheidung ermöglicht, in der unüberschreitbaren Magie des Tanzes immer wieder die technische Analyse dazwischenzuschalten, ohne die Verbindung zur Intuition zu verlieren.
In der Technik der Gestaltung gibt es Werkzeuge, die Sie entsprechend den verschiedenen Situationen zusammenstellen können. Diese Werkzeuge oder Hilfsmittel stellen handwerklich erfahrbare Techniken dar.
Für den Erfolg Ihrer Arbeit wird es entscheidend sein, wie Sie die Techniken an die Situationen anpassen können, und nach welchen Gesichtspunkten Sie diese auswählen.
Die Technik der Choreographie setzt sich aus vier Bausteinen zusammen:
Diese Oberbegriffe werden in den nach Themen strukturierten Kapiteln behandelt:
Kapitel 1
Subtext und Geist
Kapitel 2
Thema - Struktur - Dramaturgie
Kapitel 3
Gestalterische Grundlagen
Kapitel 4
Thematische Bearbeitung
Kapitel 5
Arrangement und Komposition
Kapitel 6
Pädagogische Aspekte
Kapitel 7
Schauspiel, Sprache und Tanz
Kapitel 8
Tanz und Film
Kapitel 9
Bühnenbild
Kapitel 10
Beleuchtung
Kapitel 11
Studien und Übungen
Um die, in der Abbildung auf der vorigen Seite durch den Kreis symbolisierten Zusammenhänge zwischen den Bausteinen des choreographischen Handwerks zu erfassen, empfehle ich Ihnen, zuerst alle Kapitel zu lesen, um sie in einen intuitiven Zusammenhang zu stellen. Der zweite Schritt ist die Durchführung der Studien und Übungen. Lassen Sie sich dabei von den Anregungen mehr inspirieren als leiten. Entwickeln Sie eigene Recherchen. Gehen Sie dabei nicht chronologisch vor, sondern lassen Sie sich von Ihrem eigenen Interesse führen.
Möge dieses Buch Sie inspirieren! Mögen Ihre Tänze die Welt bereichern!
1 Subtext und Geist
Da es nun einmal keine Objekte sind, die sich über die Bühne bewegen, sondern Menschen, und der Mensch sich durch den Geist auszeichnet, lohnt sich die Frage nach den Techniken, die den Untertext hinter den Schritten manipulieren. Ein Stück ohne Geist ist wie ein leeres Gefäß, bei dem wir auf einen Inhalt hofften. Wie oft sehen wir Stücke mit virtuosen Bewegungen und raffinierten choreographischen Ideen, ohne dass sie uns erreichen? Alles ist großartig, aber niemand ist begeistert, keiner weiß die Zauberformel, mit der man das Gebotene beschwören, mit Geist erfüllen und in Sinn verwandeln könnte. Nur die Kritiker weisen mit Überschriften, wie „Ohne die Kraft des Unerwarteten!" auf den von allen gefühlten Mangel hin.
Es sind mehr Dinge als Schritte im Raum, die eine emotionale Anteilnahme des Zuschauers auslösen. Es ist auch nicht das, was ein Tänzer spielt, während er tanzt! Aber es hat etwas damit zu tun, was er erlebt! Bei einem Gruppenstück stehen diese Erlebnisse entweder im Kontrast zueinander oder sie multiplizieren sich gegenseitig. Viele Choreographen erwarten von ihren Tänzern, dass sie das hinter den Schritten liegende Geheimnis von sich aus mitbringen und dem Tanz Ausdruck verleihen. Leider funktioniert das oft nicht. Die Tänzer kennen den erwarteten Ausdruck nicht. Derzeit arbeite ich in verschiedenen Produktionen, und erst vor Kurzem hörte ich zwei Tänzer sich auf einer Probe darüber unterhalten, dass sie oft nicht wüssten, was sie darstellen, und sich fragen, wie sie aus einem Moment etwas machen sollen, wenn sie nicht wissen, was verhandelt wird. Sie haben Angst, etwas falsch zu machen, und halten sich zurück bzw. geben etwas allgemeinen Ausdruck. Ist es das, was Sie als Choreograph wollen? Etwas allgemeinen Ausdruck? Wenn nicht, dann müssen Sie den Tänzern Inspiration und Geist einhauchen. Gefühle wecken. Und den Mut, diese Gefühle zu zeigen.
Die Stoffquelle des inneren Raumes
Künstlerisch zu wirken bedeutet für viele Menschen, eine innere Spannung zu empfinden, die in der Arbeit ausgedrückt wird; das heißt, dass sich verschiedene Pole im Inneren konfrontativ gegenüberstehen. Beispiel: Ein Mensch aus Grönland zieht nach New York. Er kann sich an die Begrenzung des Raumes nicht gewöhnen. Das Bild der Häuserfassade überlagert er in Gedanken ständig mit der Weite. Die wahrzunehmende Enge und die Sehnsucht nach der Weite stehen sich in seinem Inneren als Spannungsfelder gegenüber. Aus diesem Spannungsfeld heraus entsteht in ihm der Wunsch, ein Stück zu kreieren, mit dem er diese Gedanken in eine Form bringen möchte, um seine Erfahrungen mit den in New York lebenden Menschen zu teilen.
Wollen Sie aus einem inneren Konflikt heraus Material erzeugen, das in eine Gestaltung mündet, dann brauchen Sie den inneren Raum in Verbindung mit einem offenen Kanal nach außen. Es nützt dem Grönländer noch nicht viel, wenn er Bilder der Weite zwischen den Hochhäusern sieht. Er muss die Empfindungen umsetzen können, um dann zu vergleichen, ob die Umsetzung dem entspricht, was in seinem Inneren entstand. Deshalb arbeitet dieser Kanal in beide Richtungen und ist Teil der handwerklichen Ausstattung, um künstlerisch zu gestalten. Und das ist keine Fähigkeit, die, einmal in uns etabliert, funktioniert. Es ist ein ständiger achtsamer Prozess, den inneren Raum mit dem äußeren in Verbindung und ins Verhältnis zu setzen. Funktioniert diese Verbindung, dann spüren wir es daran, wie die Welt, die wir sehen, ständig zu uns eindringt und Reaktionen und Spannungen auslöst, die uns antreiben, Stücke zu machen.
Andererseits entsteht mit diesem Kanal eine gewisse Verwundbarkeit, denn es ist ein Zustand ohne Mauern um unsere Seele - also ohne Schutz. Eigentlich wissen Sie, ob der Kanal funktioniert oder nicht. Sie wissen, ob die Welt in Sie eindringt oder draußen bleibt. Falls kein Impuls von außen nach innen dringt, dann äußert es sich zum Beispiel darin, dass wir uns in der Wahl der Themen wiederholen oder keine haben, und es stellt sich die Frage, ob wir uns mit der Wiederholung und der Leere begnügen oder an der Verbindung zwischen der mentalen und der äußeren Welt arbeiten.
Choreographen bilden ihre Tänzer immer auch mit aus. Zum einen geschieht das, um mit besseren Tänzern bessere Stücke zu machen, zum anderen entwickeln sich auch die Choreographen während der Ausbildung der Tänzer. Ich empfehle Ihnen deshalb, den inneren Raum bei Ihren Tänzern zu trainieren - es wird sich auch auf Sie als Choreograph auswirken. Was die Tänzer betrifft, so sollten diese mit dem Thema vertraut sein, wenn der Choreograph über die folgenden Zugänge seine Choreographie erarbeitet:
Geleitete Komposition
Die Tänzer entscheiden in der Improvisation, wie sie sich bewegen, und reagieren dabei auf Anweisungen von außen.
Visualisierung
Bewegungen entstehen über ein inneres Bild.
Identifikation
Bewegungen entstehen durch die Einarbeitung in eine vorher umrissene Charakterisierung einer Figur.
Emotion
Bewegungen entstehen über das Herstellen vorher definierter emotionaler Stimmungen.
Intensionen
Unabhängig davon, ob Sie für einen Showtanz ein Repertoire zusammenstellen oder aus Ihren innersten Regungen heraus schöpferisch authentisches Material entwickeln - für jede Bewegung, jede Szene und jedes Stück gibt es eine Intension und mit ihr eine übergeordnete, stilistische Form.
Sehen Sie sich die Proben oder Tanzstücke im Theater an und beurteilen Sie aus freiem subjektivem Empfinden heraus:
Sehen Sie eine Intension, eine Notwendigkeit im Aufeinanderfolgen der Bewegungen? Die Intension muss aber nicht unbedingt verbal benennbar sein.Ergänzen sich bei Gruppentänzen die Intensionen der Tänzer bzw. stehen diese, weil es die Dramaturgie erfordert, zueinander im Kontrast?Gibt es eine Gesamtintension und eine daraus übergeordnete, stilistische Form?Ist eine szenische Intension erkennbar?Wie kommt die Bewegungsintension zum Ausdruck?Was genau transportiert Intensionen?Was wirkt austauschbar?Da die getanzte Intension oft nicht in Worten fassbar ist, ist es wichtig, immer wieder mit den Tänzern in den Dialog zu treten. Begreifbar zu machen, WAS ES IST. Was wollen wir damit? Was passiert überhaupt? Wer hier keine Antworten spürt oder keinen Grund, warum er überhaupt losgeht, der wird auch nirgendwo landen.
Die Kraft des Antriebs, ein Stück zu inszenieren, geht nicht selten in der wachsenden Komplexität der Probenarbeit verloren. Wachstum endet dort, wo sich die Wurzeln verlieren. Machen Sie sich also immer wieder die Intension klar - dann gibt es etwas, das Sie mit dem Stück wollen, wonach die Tänzer suchen können und woran - insofern die Ansätze greifen - alle an der Produktion Beteiligten glauben werden.
Nehmen Sie Aufträge für die choreographische Umsetzung von gegebenen Themen an, werden Sie sich so lange mit dem Thema beschäftigen müssen, bis Sie persönliche Intensionen in dem Stoff entdecken - etwas, das Sie als Ihre persönliche Chance begreifen. Sie müssen die Schnittmenge Ihres Selbst und der des Materials entdecken, bevor eine Notwendigkeit entsteht, die Sie mit der Aufgabe hinaus auf die Bühne vor die Augen der Zuschauer treibt. Nehmen Sie Choreographieaufträge für Tanzeinlagen in Schauspielproduktionen an, kann es mitunter zu einem schwierigen Unterfangen werden, die Visionen des Regisseurs zu treffen und gleichzeitig eine Identifikation mit der Materie zu erlangen.
Um die Verbindung zwischen Form und Intension zu überprüfen, experimentieren Sie mit den folgenden Extremen:
2 Thema – Struktur – Dramaturgie
Die Energie eines Stückes ist vor dessen Entstehung schon da. Diese Energie sucht sich eine Form, in der sie sich entwickeln kann. Diese Form wird gebildet aus den in der oberen Abbildung vorhandenen Elementen, über denen ein Thema oder eine Idee schwebt.
Das Thema kann wirklich alles sein: die reine Bewegung an sich, die Besetzung zentralafrikanischer Staaten, einfach Tanz zu Musik, das Ausprobieren, alles kann ihr Thema sein. Aber Sie müssen es haben, sonst können Sie es nicht vertiefen. Die Tänzer, das Licht, alle Faktoren, die gestalterisch in Ihre Aufführung einfließen, alles, was außerhalb des Choreographen stattfindet, das alles wird es nur geben, wenn vorher im Innersten eine Notwendigkeit und eine damit verbundene Intension entstanden ist.
Thema und Stoff
Einerseits können Sie aus jedem Thema eine gute Arbeit machen, weil es wichtiger ist, was Sie aus dem Stoff machen, als was in ihm steckt. Andererseits, wenn der Stoff zu wenig Gehalt aufweist, wird er ungleich mehr Blut, Schweiß und Tränen kosten, um ein gutes Stück daraus zu machen. Manchmal entpuppt sich ein zuerst großes, vielversprechendes Thema während der Arbeit als Seifenblase, oder eine Lappalie, aus der man unter keinen Umständen ein ganzes Stück machen wollte, entwickelt sich dann jedoch zu einer großartigen Idee, die einen über einen langen Zeitraum begleitet. Läuft Ihnen ein Thema über den Weg, und Sie legen sich sofort fest, daraus ein Stück zu machen, kann es passieren, dass Sie sich dadurch bereits zu sehr fixieren. Geben Sie dem Stoff Zeit, sich zu entwickeln. Vergessen Sie ihn mit ruhigem Gewissen wieder. Wenn der Stoff etwas mit Ihnen zu tun hat, wird er Sie verfolgen, und der Stoff kommt wieder.
Eine als wertvoll erscheinende Idee, die ein Treffen des Zeitgeists erahnen lässt, in Ihnen aber keine Bilder zum Leben erweckt, die nach tänzerischen Übersetzungen verlangen, sollte auf das Potenzial für eine choreographische Lösung hinterfragt werden, bevor dem Stoff ein bloßes „Vertanzen" aufgezwungen wird, das ihn ärmer und oberflächlicher erscheinen lässt anstatt tiefer und mehrdimensionaler.
Wenn Sie über Themen nachdenken, nehmen Sie jene, die bildhaft sind und eine Notwendigkeit zur tänzerischen Auflösung in Ihnen auslösen. Beobachten Sie, wie Sie in Bildern und Gedanken auf die Themen reagieren. Wenn Sie sich von einer Geschichte angezogen fühlen, denken Sie über die mythologischen Aspekte dieser Geschichte nach - oder ob die Geschichte eine archaische Komponente hat, die eine tiefe, nonverbale Thematik in Ihnen anspricht. Damit will ich sagen: Es sollte etwas darin geben, das Sie nur mit Tanz ausdrücken können. Vermeiden Sie das bloße tänzerische Illustrieren einer Geschichte oder einer Handlung.
Der Vorteil einer theatralisch erzählten Geschichte ist, dass sich der Zuschauer mit den Figuren identifiziert, durch die Handlung der Geschichte in einen aufsaugenden, den Zuschauer hineinziehenden Sog gerät, und sich die Grenzen zwischen Wirklichkeit und fiktiver Geschichte im erzählerischen Moment verlieren. Dieser Sog baut sich aus „Plot Points" auf, welche die Figuren, die wir verstehen und lieben lernen, in Situationen bringen, in denen sie über sich selbst hinauswachsen müssen. Dadurch lösen die Figuren innerhalb ihrer Reise durch die Handlung oft einen tiefen unbewussten, eigenen Konflikt, durchlaufen eine Metamorphose mit vielen Rückschlägen und Prüfungen und sind am Ende eine Persönlichkeit, die sich von der am Beginn der Geschichte gelöst oder erweitert hat.
Die Identifikation mit den Figuren über eine erzählende Handlung lässt sich im Tanz nur sehr schwer realisieren, da das erzählerische Moment stark an verbale Ausdrucksformen geknüpft ist. Es entspricht nicht dem Wesen des Tanzes, als Sprachrohr für eine Erzählung zu dienen, bei der es um Identifikation und eine Dramaturgie entlang einer Plot-Point-Linie geht. Vielmehr vermag der Tanz die Geschichte in eine höhere Ebene zu transformieren, eine Ebene, die seelischen Dingen näher ist als rationell-gedanklichen. Untersuchen Sie Ihre Themen nach solchen Ansätzen. Wenn Sie dabei allerdings zu dem Schluss kommen, dass Sie einfach nur eine Geschichte erzählen wollen, dann sollten Sie sich fragen, ob es nicht besser oder effizienter ist, mit Schauspielern zu arbeiten.
Alles, was Sie tänzerisch zu erzählen bemüht sind, lediglich um eine Handlung zu illustrieren, wird über mühsames Gestikulieren schwerlich hinausragen. Es geht darum, die Aspekte einer Handlung oder einer Figur mit dem Wesen des Tanzes zu begreifen, das dem Narrativen weniger nah ist als dem Allegorischen. Handlung ist nicht zu verwechseln mit der Intension eines Beziehungsaspektes, der eine handlungsähnliche Charakteristik aufweist. Wie zum Beispiel: A will zu B. Aber B erträgt es nicht, weil B unberühr-barer sein will, als es den Intensionen von A entspricht.
Das hat mit Charakteren zu tun und lässt sich auch wie ein dramatischer Ablauf konstruieren, aber es ist noch keine Geschichte wie die von Romeo und Julia.
Nun mögen Sie dem entgegensetzen, dass Sie Tanzvorstellungen einer Geschichte wie Romeo und Julia gesehen haben, die mit den tänzerischen Mitteln sehr berührt haben. Aber fragen Sie sich: „Ist es wirklich die Geschichte, die berührt, oder wurde mit dem Ausdruck des Tanzes eine Vertiefung geschaffen, die über das Narrative der Geschichte hinausgeht?" „Hat die Vorstellung nicht andere Aspekte der Geschichte beleuchtet als das Erzählerische?"
Jeder berührende Roman bringt eine tiefere Ebene als die der bloßen Handlung ans Licht. In der Literatur geschieht dies mit literarischen Mitteln, die in der choreographischen Umsetzung mit tänzerischen Möglichkeiten ersetzt werden müssen. Allzu oft aber wird die tänzerische Entsprechung dieser Vertiefung deshalb vergessen, weil wir das, was mit literarischen Mitteln erzeugt wurde, intuitiv der Geschichte anhaften, obwohl es eigentlich Kunstfertigkeiten sind, die, losgelöst von der Handlung, dem Roman eine weitere Dimension schenken.
Machen Sie sich bewusst, dass es neben der Handlung eine mythologische Ebene gibt, die Sie, wenn Sie eine Geschichte in Tanz transformieren, kennen oder wenigstens erahnen müssen, um sie vertiefen zu können. In vielen Geschichten gibt es eine vom Autor bewusst erzeugte Mythologie, wie zum Beispiel das Aschenputtel-Syndrom in Liebesgeschichten im Film „Pretty Woman" oder den Sieg des Schwachen über den Starken wie in „Rocky" oder die Fügung einer von den Göttern vorbestimmten Liebe, die stärker als der Tod ist. In vielen Geschichten aber wird sich die mythologische Ebene nicht klar definieren lassen; sie wird sich eher als Ahnung um eine weitere Dimension über der Geschichte abzeichnen, die von jedem anders empfunden wird. Ein Beispiel: Das Buch „Fleisch ist mein Gemüse" erzählt die Jugendjahre eines Singlemusikers, der am Ende dieser Zeit mit etwa Mitte zwanzig doch noch eine Frau findet. Manch ein Leser stellt sich die ahnende Angst vor, dass hinter den Figuren und dem Milieu, in denen sich diese bewegen, die große Leere wartet; dass da nichts mehr ist. Ein Gefühl, das viele Menschen in Augenblicken der Selbstreflexion als subtiles Aufflackern erleben, das sie dann im Keim ersticken. Die Angst vor der großen Leere, die hinter allem wartet, ist ein Thema mit einer mythologischen Dimension, das für manche Leser über der Geschichte schwebt und als Impuls für die Arbeit mit einer Choreographie genommen werden kann. Für einen anderen Leser aber wiederum liegt in der Geschichte das Ahnen, dass auch auf den, der weit weg von einer Beziehung lebt, noch irgendwann das Happy End mit der großen Liebe wartet - ein Wunsch, den viele in ihrer Einsamkeit und Isoliertheit durch einen selbst geschaffenen Kosmos gar nicht mehr zu träumen wagen, aber in einer ungesehenen, tiefen Bewusstseinsebene noch immer die Hoffnung auf eine vom Schicksal gebrachte Wendung schwebt. Auch hier findet sich viel Mythologisches, das weit entfernt vom sprachlichen Bewusstsein in einer choreographischen Lösung Ansätze finden kann.
Fragen an das Thema:
Lässt sich, speziell mit Tanz, eine Essenz der Thematik treffen?Entwickeln Sie zu dem Thema Assoziationen, die sich schwer verbalisieren lassen, aber tänzerische Bilder initiieren.Welche Annäherungsmöglichkeiten bietet der Stoff? (Filme, Bücher usw.)Welche Unterthemen ergeben sich aus dem Thema?Was hat das Thema speziell mit Ihnen selbst zu tun? Provoziert es unterschiedliche emotionale Haltungen?Haben Sie der Thematik ausreichend Zeit gelassen, sich zu entwickeln?Was wollen Sie für sich selbst mit diesem Stück erreichen?Von der Eröffnung bis zum Finale baut sich die Struktur auf.
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer Plexiglaskugel, die durch einen dreidimensionalen Raum fliegt. Manchmal fliegt die Kugel mit Ihnen durch eine Art enges Geäst und weicht schnell aus, aber dann schlagen die Äste gegen die Kugel. Daraufhin taucht die Kugel mit Ihnen im Inneren durch eine eigenartige Masse, die sich lautlos und unheimlich an ihr vorbeiquält. Das Gefährt nimmt an Geschwindigkeit auf, die Masse, durch die Sie sich eben noch hindurchbewegten, verflüchtigt sich, und Sie fliegen durch einen weiten offenen Raum, der in einen Trichter hinein führt, in dem Sie eine Straße entdecken, auf der Sie sich jetzt entlangbewegen. Aber die Kugel kommt ins Schleudern, jagt steuerlos, Kapriolen schlagend durchs Ungewisse, bis die Kapsel zerbricht, und Sie auf einer watteweichen Unterlage laden.
Die Struktur des Stückes
Die Plastik der Struktur
Der Zuschauer ist der Mensch in der Kapsel, das Stück, das Sie choreographieren, bildet die Landschaft, und es liegt an Ihnen, wie lange Sie in welcher Gegend bleiben. Der Wechsel der Umgebung, über die gesamte Reise betrachtet, formuliert die Struktur. Wenn der Zuschauer nach wenigen Minuten das Gefühl entwickeln wird, er sei auf einer endlosen Straße, die sich noch endlos lange so weiter zieht, wird sein Interesse für den Verlauf der Straße einfach irgendwann gegen null tendieren, denn er muss sich nicht mit dem, was Sie machen, auseinandersetzen; er kann es, wenn Sie ihn mitnehmen, wenn Sie die Strukturlandschaft so schaffen, dass er ohne sein Zutun mitgezogen wird. Sie müssen ein Gespür dafür entwickeln, wann die Kugel zur Genüge in dem jeweiligen Raum war, und wie der Raum aussehen muss, in den das Gefährt, in dem der Zuschauer sitzt, nun eintaucht. Das heißt, die Beschaffung der Struktur des Stückes hängt erst einmal von der Reise ab, die Sie mit dem Zuschauer in dem Raumgleiter zusammen zurücklegen wollen, und zwar im Kontext des Themas. Das wiederum bedeutet, dass Sie die Inhalte in die Landschaften hineinlegen müssen und nicht umgekehrt.
Beispiel
Wenn Sie so etwas wie Krieg darstellen wollen, heißt das nicht, dass unbedingt 15 Tänzer wie von der Tarantel gestochen über die Bühne jagen müssen. Es kann auch ein Kind eine Straße entlanggehen oder ein einzelner Mensch völlig bewegungslos dasitzen. Der Krieg, den Sie im ersten Moment sehen wollen, ist vielleicht der mit den 15 Tänzern. Aber wird Ihr Publikum da mitgehen? Mit 15 rasenden Tänzern formulieren Sie eine andere Landschaft als mit einem allein gehenden Kind, und Sie müssen darüber entscheiden, auf welchen Krieg Ihr Publikum sich an welcher Stelle der Gesamtstruktur einlassen wird.
Die emotionale Intensität eines Stückes und deren zeitliche Entwicklung
Beharren Sie nicht steif auf dem, was Sie sehen wollen, sondern denken Sie darüber nach, was es mit Ihnen macht, wenn Sie den Vorgang zum allerersten Mal ohne ein erklärendes Wort und im Zusammenhang mit den vorangegangenen Szenen sehen. Wenn sich nicht das herstellt, was Sie wollen, werfen Sie die Struktur um. Vielleicht funktioniert Ihre Vorstellung von der Szene an einer anderen Stelle des Stückes problemlos. Wenn Sie an eine Reihenfolge gebunden sind, dann müssen Sie sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, die Szene zu ändern.
Ein und dieselben Inhalte einer Szene verlangen an unterschiedlichen Stellen innerhalb des Stückes eine unterschiedliche Form, weil der Zuschauer auf seiner Reise in der „Kugel“ zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich bewegt werden will.
Den Inhalt in die Struktur einzubetten bedeutet nicht, dem Publikum gefällig zu sein, sondern es mitzuziehen. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt Filme, in denen möchte man gern wegsehen, schaut aber unablässig zu. Das ist das beste Beispiel für einen ungefälligen Strudel, der einen gefangen nimmt, weil die Struktur des Filmes flüssig bleibt und den Sog beibehält. Das hat mit Achtsamkeit und Handwerk zu tun. Einer holprigen Stückstruktur bringt die entstehende Ungefälligkeit nichts, weil das Interesse des Zuschauers verloren geht. Wenn es Ihnen davor graut, Gefahr zu laufen, die Zuschauer gefällig zu bedienen, so versuchen Sie nicht, über eine holprige Struktur ungefällig zu sein, sondern über Ihre Bewegungssprache und darüber, was diese zu erzählen vermag.
Einführung
Der Zuschauer will abgeholt werden. Er kommt mit der ganzen Welt im Nacken ins Theater, und es wird einige Zeit dauern, bis er die Welt aus seinen Gedanken entlässt und sich auf Ihr Projekt einlassen kann. Die ersten Überlegungen gelten demnach also der Einführung des Zuschauers in das Stück:
Wie wollen Sie den Zuschauer in das Stück hineinführen?
Wie viel Zeit haben Sie für die Einführung? 15 Sekunden? Zehn Minuten?
Müssen Sie die Figuren einzeln einführen oder als Gruppe?
Wie viel Zeit ist für die Einführungsphase notwendig?
Wollen Sie ein Postulat setzen?
Wie tragen Sie das Thema an den Zuschauer heran?
Mittelteil
Nach der Einführungsphase gibt es den Mittelteil. Der Mittelteil zeichnet sich immer durch eine Dynamik aus, das heißt, er besteht aus mehreren Teilen, die sich getrennt voneinander ergeben, zueinander im Kontrast stehen usw. Achten Sie darauf, dass der Mittelteil keine zu vorhersehbare Eigendynamik hat; er ist der Anker, um den sich die Inszenierung dreht. Das heißt: Vermeiden Sie Muster.
Fragen an den Mittelteil des Stückes:
Wie viele Teile beinhaltet der Mittelteil?
Haben die Teile einen gemeinsamen Nenner auf einer tieferen Ebene?
Wie stehen diese zueinander dynamisch im Kontrast?
Hat der Mittelteil eine Progression?
Entwickelt er sich auf ein Finale zu?
Finale
Das Finale entscheidet darüber, mit welchen Gefühlen die Zuschauer das Theater wieder verlassen. Widmen Sie ihm die entsprechende Aufmerksamkeit! Achten Sie darauf, dass es ein klarer, eindeutiger Schluss ist. Es ist ein nervtötender Akt, wenn der Zuschauer mehrmals hintereinander denkt, hier ist Schluss, zu applaudieren beginnen möchte, um dann noch und noch eine Schlepptau-Szene zu sehen.
Fragen an das Finale:
Wollen Sie einen Schluss mit offenem Charakter, das heißt, soll das Ende verklingen, sodass die Illusion bleibt, das Stück würde noch endlos weiter verhallen, oder wollen Sie ein Ende mit einem Punkt am Schluss?
Hat das Ende eine Klimax?
Können Sie Punkte definieren, die das Finale vom Rest abhebt?
Wie wollen Sie den Zuschauer in die Welt entlassen, mit einem Fazit, einem Ausblick, mit euphorischen Gefühlen?
Strukturierung
Befinden Sie sich in einer Teilstruktur, ist es nachvollziehbarerweise schwer, die gesamte Struktur zu überblicken! Das ist so, als würden Sie durch einen Wald laufen: Es ist schwer, die lokale Position im Verhältnis zum ganzen Wald auszumachen, wenn Sie sich im Wald befinden, ohne ihn zu kennen. Es scheint deshalb auf der Hand zu liegen, zuerst vom Hubschrauber aus eine Karte zu skizzieren, bevor Sie sich in den Wald begeben und eventuell nicht mehr herauskommen. Der Wald ist etwas real Greifbares, das sich einteilen lässt. Bei einem Stück sieht das aber ganz anders aus: Da weiß man anfangs noch gar nicht so genau, wie es überhaupt eingeteilt bzw. strukturiert werden soll. Ein sehr erfahrener Lehrer für Improvisation sagte mir einmal: „Ich fahre sehr gut damit, wenn ich mich detailliert vorbereite und mich dann nicht daran halte." Würde er sich nicht vorbereiten, gäbe es keinen Halt im Rücken. Er weiß, er kann auf etwas zurückgreifen, und das macht ihn frei. Er hat eine Landkarte im Hinterkopf, die es ihm ermöglicht, sich frei zu bewegen, ohne sich total zu verlaufen. Die Struktur ist für den Choreographen die Landkarte im Hinterkopf.
Die Struktur für Ihr Tanzstück sollten Sie auf keinen Fall als etwas Starres begreifen, sondern als ein in ständiger Veränderung befindliches Provisorium. Nehmen Sie das strukturelle Gerüst zu ernst, dann wird es Sie um sämtliche Entstehungsmomente bringen. Aber wie auch immer Sie mit der Strukturierung umgehen, ob Sie alles detailgenau im Vorfeld festlegen oder am Tag vor der Premiere die Szenen in eine Reihenfolge bringen - wie diese beschaffen ist, wird entscheidend mitbestimmen, ob Ihr Publikum an Ihrer Arbeit Anteil nimmt. An einem Stück mit einer guten Strukturierung wird es dranbleiben, selbst wenn es das Stück inhaltlich nicht anspricht.
Vorstrukturierung
Vor dem Probenprozess ist immer schon irgendetwas vorhanden. Mal ist es nur eine Musik, mal eine literarische Vorlage oder ein Thema. Mal sind es Bewegungen oder ästhetische Konzepte oder einfach nur einzelne Bilder in Ihrem Kopf. Die Frage ist nun, inwieweit Sie dieses vorhandene Material bereits in ein Gerüst packen wollen. Ein Gerüst hat den Vorteil, dass Sie innerhalb der Arbeit orientierter sind, um aus dieser Orientierung heraus Ziele zu definieren, die im Zusammenhang mit dem dramaturgischen Bogen oder mit der angestrebten Form und Ästhetik der Arbeit stehen. Sie werden während der Strukturierung der Choreographie schneller ein Gefühl für den Spannungsbogen erhalten. Vor dem geistigen Auge und auf dem Papier entwickelt sich die Dynamik des Stückes und der Szenen. Die erforderliche Intensität der einzelnen Sequenzen oder Szenen zeichnet sich bereits im Vorfeld ab. Die Vorstrukturierung lässt ein dialogisches Verhalten der Choreographie zum Thema zu, und die unterschiedlichen Qualitäten der choreographischen Intensität einer Szene in Korrespondenz zum Thema leiten die erforderlichen Zugangsformen ein.
Restrukturierung
Viele Choreographen und Companys erarbeiten sehr lange assoziativ zum Thema Szenen, Tänze, Duette, Filme und Musik, ohne sich von einer möglichen Struktur einengen lassen zu wollen. Bewegen Sie sich innerhalb einer Struktur, die Sie definiert haben, werden Ihnen Dinge, die außerhalb dieser Abläufe liegen, schwerer zugänglich sein. Sie werden unter Umständen ein reicheres Material, eine weitere Bandbreite an Szenen zur Verfügung haben, wenn Sie auf die Bahnen der Struktur verzichten, und Sie sich frei schwebend im Raum von dem Thema anstoßen lassen. Das hieraus entwickelte Material kann dann strukturiert und in einem dramaturgischen Bogen verknüpft werden.
Ganz gleich, für welchen Strukturierungsansatz Sie sich entscheiden - wichtig ist, sich die situative Arbeitsweise klar vor Augen zu halten. Machen Sie sich bewusst, ob Sie im Moment, losgelöst vom dramaturgischen Bogen, frei Material entwickeln oder ob es Ihr Ziel ist, innerhalb des Bogens, zwischen einer vorangehenden und einer nachfolgenden Szene eine per Definition umrissene Form, Dynamik und Ästhetik zu entwickeln. Dieses Bewusstsein für die eine oder andere Arbeitsweise lässt eine klare Haltung dem Stück gegenüber zu und führt schneller zu befriedigenden Ergebnissen.
In der Restrukturierung werden Szenen und Fragmente in einen Spannungsbogen gesetzt.
Der dramaturgische Bogen
Jedes Stück, auch wenn es nur eine Minute lang ist, hat einen dramaturgischen Bogen. Die Aufmerksamkeit des Zuschauers verändert sich während des Stückes. Dies hängt mit der Gestaltung der Dramatik innerhalb einzelner Abschnitte und der Zusammensetzung dieser Abschnitte zusammen.
Das Wirken der Szenen in ihrer Reihenfolge erzeugt den dramaturgischen Bogen des Stückes (dicke Linie).
Dieser Bogen formuliert den gesamten Spannungsverlauf einer Aufführung. Kaum ein Beobachter wird ein Stück von eineinhalb Stunden überschauen. Wir setzen uns gewöhnlich mit dem, was wir im Augenblick entdecken, auseinander, ohne diese Wahrnehmung ins Verhältnis zum Vorher oder fiktiven Nachher zu stellen.
Weil die Eindrücke vor und nach einem Moment in einem Stück aber genauso wichtig sind wie der Moment selbst, ist es für einen Choreographen existenziell, ein Empfinden für das Ganze zu entwickeln. Um den Moment im Verhältnis zum Ganzen zu betrachten und die Dynamik der Dramaturgie eines Stückes greifbarer vor Augen haben, zeichnen viele Choreographen und Regisseure den Verlauf des dramatischen Bogens auf Papier und orientieren sich während der Arbeit an der Szene an dieser Zeichnung. Der dramaturgische Bogen ist in einer Bühnenperformance immer da, auch wenn Sie diesem gar kein Interesse schenken. Über die Zeit, die vergeht, wird der Zuschauer verschiedene Spannungs- und Entspannungsmomente erleben. Augenblicke der Intensität und Besänftigung und die unterschiedlichen Höhen dieser Spannung und Entspannung formulieren - auf die Zeit übertragen - eine Kurve.
Die erlebte Zeit innerhalb einer Dramaturgie
Zeit ist immer etwas Relatives. Ihr Maß ist abstrakt. Die Zeit, die es wirklich gibt, ist nur die eigene. Ihr Erleben ist emotional und maßlos subjektiv. Ihre Geschwindigkeit wird durch die subjektive Emotionalität bestimmt. In manchen Tagen liegt mehr an Zeit als in Jahren. Es gibt diese endlosen Augenblicke und Stunden, die man gar nicht wahrgenommen hat, so schnell sind sie verflogen.
In einem Tanzstück kreiere ich die Zeit. Weil es eigentlich keine objektive Zeit gibt, gestalte ich ein Zeitempfinden. Das Zeitempfinden ist das Kurzweilige oder Langatmige, welches das Stück mit sich bringt. Eine der schwersten Aufgaben ist es, die Zeit „aus-zu-dehnen" ohne langatmig zu werden. Wird die Zeit ausgestreckt, bedeutet das, dass die großen Kontraste im Raum und der Dynamik der Choreographie nicht mehr in der Form vorhanden sind, wie das in einer schnellen Choreographie der Fall sein wird. Der Geschwindigkeit werden sich weniger Zuschauer entziehen als der Langsamkeit. Die Geschwindigkeit verfügt leichter über eine Sogwirkung als die Retardierung.
Zusammenhang zwischen subjektivem Zeitempfinden und erlebtem Kontrast
Die Langsamkeit erfordert die Bereitschaft des Zuschauers, mit der Choreographie durch eine Durststrecke zu wandern, die mit weniger Reizen und Impulsen auskommen muss. Bevor Sie also beginnen, die Zeit auszudehnen, überlegen Sie sich genau, ob das Stück für Sie an der Stelle bereit ist, den Zuschauer in die Langsamkeit mitzunehmen. Schaffen Sie die Voraussetzung für die Langsamkeit, indem in der vorhergehenden Situation eine Sehnsucht für die Leere oder die Stille erzeugt wird.