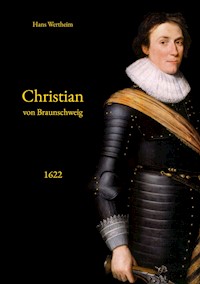
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Christian von Braunschweig im Pfälzischen Krieg
- Sprache: Deutsch
Der zweite Band Wertheims ist die Fortführung der detaillierten Ausarbeitung über die Armee Christians von Braunschweig während des Jahres 1622. Die Aufarbeitung der militärischen Züge in Westfalen der gegnerischen Heere, Pläne und Marschbildungen bilden den Auftakt. Die Belagerung Gesekes, die Geschehnisse in und um Paderborn, der anschließende Marsch ins Eichsfeld, Neuwerbungen sowie die Bedeutung der Schlachten bei Wiesloch, bei Wimpfen und bei Höchst im Kontext bilden den Inhalt dieses Bandes. Zuletzt fügt Wertheim die Aufstellungen aller beteiligten Armeen an, darunter die Offiziersliste der braunschweigischen Regimenter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 811
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zweiter Band Die Operationen des Jahres 1622
für Maximilian und Ferdinand
INHALT
VIII. KAPITEL: DIE BESETZUNG WESTFALENS BIS ZUM ERSCHEINEN ANHOLTS
Protestantische Pläne
Die katholischen Truppen in Westfalen
Christians Einfall in Westfalen. Einnahme von Lippstadt
Ranzonierungsverhandlungen
Einnahme von Soest. Festigung der Stellung Christians
Besetzung von Stadt und Stift Paderborn
Beginn großangelegter Werbungen
IX. KAPITEL: DIE GRUPPE ANHOLT BIS ZUM EINGREIFEN IN WESTFALEN
Unmöglichkeit weiterer Verfolgung Christians
Rückzug Anholts
Marsch Anholts nach Westfalen
Kurkölnische Rüstungen
X. KAPITEL: VERSUCH ANHOLTS ZUR WIEDEREROBERUNG WESTFALENS
Eingreifen Anholts; die Spanier; die Jägerdorfer
Anholts Plan und erfolgreiche Offensive
Das Gefecht bei Soest und seine Folgen
XI. KAPITEL: BILDUNG UND MARSCH DER GRUPPE WEIMAR
Bildung des weimarischen Kontingents
Marschversuch nach Westfalen
Herzog Wilhelms Marsch nach Baden
XII. KAPITEL: DIE BILDUNG DER HALBERSTÄDTISCHEN ARMEE BIS ZUM AUFBRUCH
Christian öffnet sich wieder die Straße zur Weser
Vorstoß Fleckensteins ins Niederstift Münster
Christians Werbungsfortschritte
Situation Anholts
Attentatsversuch gegen Christian
Belagerung von Geseke
Christians erste Vorbereitungen zum Abmarsch über die Weser
Christians Unternehmung gegen Münster
Weitere Vorbereitungen Christians zum Abmarsch. Eintreffen des spanischen Sukkurses in Westfalen
XIII. KAPITEL: DER MARSCH DES HALBERSTÄDTERS BIS ZUR EICHSFELDISCHEN GRENZE
Feldzugslage und Motivierung des Marsches nach der Weser
Konzentrierung an der Weser und Übergang
Vergebliche gegnerische Verfolgung bis zur Weser
Vormarsch bis Katlenburg. Marschzielfragen
Zusammensetzung und Qualität von Christians Heer
XIV. KAPITEL: DER WEITERMARSCH BIS NIDDA
Sächsische Verteidigungsmaßnahmen gegen Christian
Christian auf dem Eichsfeld
Wechsel der Marschrichtung
Kursachsen und das Eichsfeld nach dem braunschweigischen Abzug
XV. KAPITEL: DER WINTERFELDZUG AM OBERRHEIN. ALLGEMEINE NEUWERBUNGEN
Mansfeld im Elsaß
Mansfelds neue Rüstungen
Neue Rüstungen der katholischen Partei
XVI. KAPITEL: DER FRÜHJAHRSFELDZUG AM OBERRHEIN BIS ZUM RÜCKZUG DER BAYERN AUF WIMPFEN
Mansfelds Wiederauftreten in der Pfalz
Gefecht bei Weingarten
Zernierung Heidelbergs
Eintreffen Friedrichs V. in der Pfalz
Schlacht bei Wiesloch
Folgen der Schlacht
XVII. KAPITEL: DIE SCHLACHT BEI WIMPFEN; MANSFELDS OPERATIONEN AUF DER INNEREN LINIE
Umgruppierung der Heere
Die Schlacht bei Wimpfen
Eroberung von Ladenburg
Vorstoß Mansfelds ins Elsaß. Vernichtung der Armee Erzherzog Leopolds
Vorstoß Mansfelds an den Main
Verzögerung bei Darmstadt
XVIII. KAPITEL: ZUSAMMENZIEHUNG DER KAISERLICHEN ARMEEN. CHRISTIANS MAINÜBERGANG BEI HÖCHST
Die Lage der katholischen Partei. Die Festung Glatz
Vereinigungsmarsch Anholts
Anmarsch Caracciolos und Herberstorffs
Pfälzischer Rückzug. Gefecht bei Lorsch. Katholischer Vormarsch auf Aschaffenburg
Christians weiteres Vorrücken. Einnahme von Höchst
Die braunschweigischen Verteidigungslinien. Die beiderseitige Stärke
Bayrisch-Spanischer Angriff auf Höchst
Kritik der Bedeutung des Kampfes
XIX. KAPITEL: ENTLASSUNG UND SCHLUSS
Protestantische Kriegslage. Entlassung des Landgrafen von Darmstadt
Die katholischen Heere nach Höchst
Das Schicksal der Christianischen Neuwerbungen
Das Ende
ARMEEAUFSTELLUNGEN
Pfälzische Armee
Badische Armee
Gruppe Weimar
Gruppe Dohna
Armee Herzog Christians
Bayrische Armee
Spanische Truppen
Kaiserliche Truppen
Armee Erzherzog Leopolds
Kurkölnische Truppen
Würzburg
Mainz
Hessen-Darmstadt
Kursächsische Armee
KRIEGSKOSTENAUFSTELLUNG
LITERATURVERZEICHNIS
AKTENVERZEICHNIS
VIII. KAPITEL: DIE BESETZUNG WESTFA- LENS BIS ZUM ERSCHEINEN ANHOLTS
Protestantische Pläne
Herzog Christian hatte durch seinen ersten Vormarsch, durch den er sein Ziel nicht erreicht hatte, hinzugelernt. Er sah, daß ein Durchbruch von Norddeutschland nach der Unterpfalz mit einer so kleinen Heeresmacht bei einiger Wachsamkeit der Gegenseite nicht zur Ausführung kommen konnte, was von großer Bedeutung für die kommenden Ereignisse werden sollte. Denn nicht nur für ihn allein galt dieses, sondern ebenso für alle anderen in Norddeutschland geplanten bzw. bereits unternommenen Werbungen, welche durch die fortdauernde Notwendigkeit der Vergrößerung der eigenen Truppenzahl für den mit immer wachsender Erbitterung und Energie geführten Krieg veranlaßt wurden. Während dies für die katholische Partei (wenn ich von den finanziellen Schwierigkeiten, die übrigens auf protestantischer Seite ebenfalls größer waren, absehen darf) jedenfalls mit keinem großen Wagnis verbunden war, so war für die Protestanten die Frage der Heeresergänzung und Verstärkung ein außerordentlich schwieriges Problem. In den großen, vom Kriege zum mindesten augenblicklich nicht bedrängten Gebieten, wie z.B. den habsburgischen Alpenlanden, Italien, Spanien, Niederburgund, Ober- und Niederösterreich, Bayern u. a. konnte man gänzlich ungestört werben. Das war den Protestanten überhaupt nirgends möglich. Gegen jede bekanntwerdende Unterstützung der Geächteten schritt der Kaiser sofort mit aller Schärfe ein. Die Pfalz kam als Werbegebiet nicht mehr in Frage. Es blieb nur die Werbemöglichkeit im Elsaß (mit einiger Unterstützung der benachbarten Schweizer und Hugenotten) und eine stille, von einigen protestantischen Ständen geduldete Werbung in Norddeutschland.
Hierhin waren vor allem die Blicke der pfälzischen Heeresleitung gerichtet, und so waren bereits seit dem November Versuche im Gange, aus Norddeutschland Unterstützung zu bekommen, auch außer den beiden hier geschilderten Versuchen unter Dohna und Christian. Doch der Kaiser und Herzog Maximilian von Bayern - als Haupt der Liga - hatten ebenso ein Auge auf Norddeutschland geworfen. So z. B. hatte Bayern schon seit 1619 den Niederrhein und Westfalen zu Truppenbildungen benutzt. Ich will nur die Regtr. Anholt, Erwitte, Boeninkhausen, v. d. Lippe-Eynatten-Lintelo, Herberstorff (altes Regt.) und Fürstenberg z. Pf. nennen, die ganz oder teilweise dort geworben worden waren. So hatte man noch in allerletzter Zeit ein Reiterregiment, das spätere Nievenheimsche, über dessen Entstehung noch zu sprechen sein wird, aufgebracht. Für den Kaiser waren hauptsächlich die Reiterregimenter Sachsen-Lauenburg und Holstein aufgebracht worden bzw. in Werbung begriffen. Diese hatten hauptsächlich in Holstein-Gottorp, dem Erzstift Bremen und Braunschweig-Wolfenbüttel ihre Laufplätze gehabt.1
Von Mansfeld war am 30. XII. 1621 Major v. Velmede von Germersheim aus an Christian d. Ä. geschickt worden mit der Bitte um Gestattung einer Reiterwerbung.2 Ferner hatte Graf Johann Kasimir v. Löwenstein begonnen, in Mecklenburg ein Reiterregiment von 1000 Pferden auf die Beine zu bringen.3 Weitere Werbungen standen für die nächste Zeit in Aussicht. Sollten irgendwelche von diesen vereinzelten Unternehmungen nun endlich einmal einen positiven Erfolg für die Protestanten zeitigen, so mußte die ganze Angelegenheit von Grund auf anders angefaßt werden, und der dies wußte und plante und, was das wichtigste war, auch die Eignung zur Ausführung besaß, war der 22jährige Herzog von Braunschweig. Seit dem Abzug von Amöneburg stand der Plan, an dem er sehr wahrscheinlich schon vorher gearbeitet hatte, fest, wie im folgenden gezeigt wird. Es mußte unter äußerster Zusammenfassung aller Mittel eine große, schlagfertige Armee gebildet werden, d. h. zuerst einmal ein starker Kern, an den sich dann alle Truppenteile der eigenen Partei, die im Entstehen begriffen waren, herankristallisieren konnten. Der Tatkraft und Umsicht des Herzogs bei der Ausführung seiner Pläne ist es zuzuschreiben, daß er von Mansfeld, Baden und Holland aus reibungslos als Leiter der Operationen anerkannt und behandelt wurde, wie dies die Unterstellung aller protestantischen Truppenteile in Norddeutschland unter den Herzog deutlich beweist.
Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß die Schaffung eines solchen Oberkommandos für den Herzog durch die Kriegsleitung der Generalstaaten, der die Persönlichkeit des Herzogs seit längerer Zeit bekannt war, sogar geradeswegs betrieben wurde.
Was die Realisierung des Planes einer Armeebildung in Norddeutschland anbelangte, so mußte man sich zuerst einmal eines Gebietes bemächtigen, in dem unter größtmöglicher Sicherheit die Bildung und Zusammenziehung des Heeres vonstatten gehen konnte. Das eben Gesagte war ja eigentlich eine Binsenweisheit und jedem Einsichtigen selbstverständlich. Sicherlich waren all diese Dinge bereits von Holland aus in der eben beschriebenen Art Friedrich V. und den Machern seiner Politik gegenüber propagiert worden. Überhaupt ruhte in den Händen des Prinzen Moritz und der holländischen Heeresleitung eine gewisse strategische Oberleitung über die pfälzische Kriegführung, was, neben dem Mitbestimmungsrecht, das man in den Generalstaaten aus den vielfältigen Unterstützungen herleitete, hauptsächlich dem Ruf der dortigen Kriegskunst zuzuschreiben sein dürfte.
Doch handelte es sich bei der Entfernung von den verschiedenen pfälzischen Kriegsgebieten und der Langsamkeit der Post mehr um allgemeine als ins Einzelne gehende Direktiven an die verschiedenen Heerführer, so daß diese doch volle Handlungsfreiheit und Verantwortung in allen Dingen besaßen. So muß man auch die kommenden Ereignisse in Westfalen bis zum Abmarsch im Mai als das Werk Herzog Christians ansehen. Allerdings gingen die Unternehmungen des Herzogs von Anfang an mit den holländischen Plänen konform und wurden durch alle in Frage kommenden Machtmittel der Generalstaaten unterstützt, besonders da die Unternehmungen des Halberstädters als Teil in den Gesamtplan so vortrefflich paßten: eine große, allgemeine Offensive im Frühjahr 1622, verbunden mit dem Erscheinen des Winterkönigs in den pfälzischen Erblanden.
Schon im Sommer 1621 stand dieser Plan fest, wie der Brief des Herzogs Johann Ernst von Sachsen-Weimar an den Pfalzgrafen beweist. Doch darf man vor allen Dingen nicht übersehen, daß diese Pläne nichts weiter als leere Schimären waren und bleiben mußten, solange eins nicht vorhanden war, nämlich das nötige Geld, und dies besaß weder der Pfalzgraf. noch konnten es die Holländer zur Verfügung stellen. Es war der springende Punkt, der gordische Knoten, der gelöst werden mußte, und den Herzog Christian nach wahrer Soldatenart durchschlug. Im eigenen Lager waren die Mittel weder vorhanden noch zu beschaffen; so mußte man also versuchen, den Feind die Aufstellung der Armee bezahlen zu lassen. Außerdem war von größter Wichtigkeit, den Laufplatz für die neue Armee unter dem Schutz ausreichender militärischer Machtmittel zu errichten, da nur hierdurch Aussicht auf Durchführung der Pläne bestand. Selbst wenn ein befreundeter protestantischer Fürst seine Gebiete dazu hergegeben hätte, würde selbstverständlich die kaiserliche Partei sofort Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Man achtete auf kaiserlicher Seite die Neutralität nur, soweit sie im Augenblick von Nutzen war. Anderenfalls war man sofort mit Drohschreiben bei der Hand und ließ diesen Taten folgen. Die Behandlung der Gräfinwitwe von Hanau im vergangenen Herbst hatte beredtes Zeugnis dafür abgelegt.
So mußte auch darauf gesehen werden, daß der Laufplatz sich auf katholischem Grund und Boden befand, um nicht die wohlwollenden Neutralen ins Unglück zu stürzen und diese dadurch von dem Wagnis einer Freundschaft mit der pfälzischen Partei noch mehr abzuschrecken. Nicht zuletzt mußte noch für die Zeit, während der die Armee zusammenkam, wozu selbstverständlich Monate nötig waren, die Quartier- und Proviantfrage befriedigend gelöst werden. Es mußte verhindert werden, daß die Erstankommenden mehr bekamen, als absolut notwendig war. Es mußte also eine Aufsicht vorhanden sein: Magazine mußten errichtet werden. Vor allem aber mußten die im Lande befindlichen Lebensmittel erfaßt und planmäßig ausgegeben werden. Ähnlich lagen die Verhältnisse bei der Quartierungsfrage.
Da sich bei all diesen Dingen eine Landesregierung absolut feindlich erzeigen mußte, ergab sich deren Übernahme durch die Heeresleitung als einfache Notwendigkeit, d. h. also die Errichtung einer Art von Militärstaat für die Zeit bis zur Marschbereitschaft der Armee. In verhältnismäßig kurzer Zeit, schneller vielleicht, als er selbst gedacht hatte, jedenfalls aber für alle Welt überraschend, gelang Herzog Christian die Lösung dieser drei notwendigen Probleme. Hierdurch zu einer immer wichtiger werdenden Figur in den derzeitigen Verhältnissen werdend, begann er, soweit es nur in seiner Macht stand, in die allgemeine politische Lage einzugreifen oder es wenigstens zu versuchen. Doch wird hierauf im Verlauf der Ereignisse noch weiter eingegangen werden.
Übrigens darf nicht unerwähnt gelassen werden, daß die Pläne des Halberstädters keineswegs aus der augenblicklichen Situation heraus geboren worden waren. Schon seit langem hielt er den Weg, den er nun einzuschlagen im Begriff stand, für den gangbarsten zum Erfolg. So berichtete Kurfürst Ferdinand schon am h. X. 1621 aus Brühl an seinen Bruder nach München,4 Christian ließe verlauten, die Pfaffen, die gegen Friedrich V. kontribuierten, könnten auch seine Truppen zahlen; und später, vor Volkmarsen - d. h. also noch vor dem Beginn der Besetzung von Paderborn -, sagte der Sekretär des Herzogs, es sei eine feste Taxe zur Kontribution aller Paderbornschen Städte gemacht.5
Als Christian, von Amöneburg kommend, sich dem Stift Paderborn näherte, fühlte er sich bereits mit diesem Gebiet im Kriegszustand befindlich. Als er auf dem ersten Marsch nach Süden zum erstenmal das genannte Stift berührte, hatte er versucht, mit der Regierung in ebenso freundschaftliche und korrekte Beziehungen zu treten wie mit allen anderen bis dahin wie auch späterhin durchzogenen Gebieten. Doch hatte man auf seiten der Paderborner Regierung geglaubt, dem jungen Herzog und seinen wenigen Kompagnien gegenüber sich aufs hohe Pferd setzen zu dürfen. Man hatte weder Geleitskommissar noch sonst irgend jemand zu ihm abgeordnet, den formal einwandfrei erbetenen Durchmarsch nicht gestattet, obwohl die kölnischen Gebiete behaupteten, neutral zu sein, und sogar durch Angriffe auf die herzoglichen Truppen diesen einen Verlust von mehreren Toten beigebracht. Auf die hierauf erfolgte Sühneorderung des Halberstädters war man ebenfalls nicht eingegangen. Trotz alledem hatte der Herzog, gezwungen durch die damalige Lage, es für nötig erachtet, keine weiter gehenden Gegenmaßnahmen zu ergreifen, sondern hatte dieselben einer späteren Zeit anheimgestellt. Die Gelegenheit dazu sollte sich schneller bieten, als man auf beiden Seiten gedacht hatte. Trotzdem werden wir sehen, daß. der Herzog sich keineswegs von blinder Wut treiben ließ. Wenn er gleich anfangs scharf zugriff, so war dies die zwangsläufige Folge des soeben geschilderten Verhaltens der Regierung des Stifts. Herzog Christian hatte deutlich genug gesehen, daß man ihm sein geplantes korrektes Betragen, das sein erster Brief nach Paderborn aus Ärzen6 deutlich genug beweist, nur als Schwäche auslegte. Zweifellos wußte er auch auf dem Umweg über Wolfenbüttel durch Rautenberg von dem Brief der Paderborner nach Hildesheim, in dem die Stiftsregierung sich anheischig machte, eventuell sich sammelnde Christiansche Kompagnien auseinanderzutreiben.7 Selbstverständlich wußte der Herzog sehr gut, daß diese Politik fast ausschließlich von der vom Kurfürst Ferdinand von Köln eingesetzten und abhängigen Regierung betrieben wurde, während dagegen das zum großen Teil protestantische Land sich eine völlig neutrale Politik gewünscht hätte. So werden wir sehen, daß die Gewaltmaßnahmen des Herzogs gegen das Land während der ganzen Dauer der. Besatzung in drei Kategorien eingeteilt werden können:
1. Beim Beginn der Besetzung. Da der erste Durchmarsch deutlich gezeigt hatte, daß mit Güte bei der Stiftsregierung nichts auszurichten war, so mußte mit Gewalt versucht werden, dieselbe an den Verhandlungstisch zu zwingen und ihr, um sie gefügig zu machen, die zur Verfügung stehenden Machtmittel deutlich vor Augen zu führen.
2. Nach erfolgter Besetzung. Maßnahmen gegen feindlich. gesinnte Regierungsmitglieder und aufsässige Adlige, um neuer-liehe Intrigen zu ahnden oder zu verhüten.
3. Maßnahmen rein militärischen Charakters im Kampfe gegen die Macht des Feindes.
Gewaltmaßnahmen aus Zerstörungswut und Racheakte aus niedrigen Motiven kamen, wie wir sehen werden, nicht vor.
Die katholischen Truppen in Westfalen
Die taktische Lage im Stift Paderborn und den angrenzenden Gebieten war folgende, als der Halberstädter durch Waldeck heranzog: An der bedrohten Grenze lag, Warburg und einige weitere Plätze in der Nähe besetzt haltend, Obr. Jobst v. Landsberg mit seinem Regiment z. F.; Lippstadt und Soest hatten spanische Besatzungen, wie auch noch einige weitere Städte. Im Stift Münster hatte die Regierung eine Anzahl Soldaten auf die Beine gebracht - die sogenannten Hahnenfedern -, die an Kampfwert denen aus dem Ausschuß geworbenen gleichkamen und die außerhalb des Stiftsgebiets nicht recht zu verwenden waren.
Des ferneren lag ein frisch geworbenes, komplettes Reiterregiment von 1000 Pferden im östlichen Herzogtum Westfalen; doch hatte es hiermit seine besondere Bewandtnis. Bekanntlich war im März 1621 Pilsen durch Verrat der Besatzung der Liga in die Hände gespielt worden. Hierbei hatten neben dem Obr. Fränck, dessen Beteiligung nicht ganz sicher ist, fünf Hauptleute eine ausschlaggebende Rolle gespielt, und zwar8 Johann v. Pieritz, Leonhard Syrach, Wolf Sigmund Teufel, Johann Grott und Magnus Laurwald. Sehr wahrscheinlich war diesen neben der versprochenen und ihnen auch ausgehändigten Summe die lndienstnahme im Ligaheere zugesagt worden. So finden wir Teufel später als Kompagnieführer im Regt. z. F. Heimhausen. Syrach dagegen und mit ihm vielleicht auch noch andere seiner Spießgesellen (es gelang mir nicht, weitere Namen festzustellen) wurde im Sommer 1621 als Rittmeister mit einer Reiterwerbung betraut. Im September 1621 erschien er9 zu eiliger Werbung in Mainz, am 1. X. bei Kurfürst Ferdinand in Brühl.10 Hier kam es auch zu einer Werbung, und zwar sollte ein komplettes Reiterregiment von 1000 Pferden auf die Beine gebracht werden. Da Syrach anscheinend nicht genügend Rittmeister an der Hand hatte, erscheinen nun auch kölnische Landsassen als Führer der Reiterkornetts. Einen Obristen hatte dies Regiment nicht. Doch scheint Syrach die ganze Angelegenheit geleitet zu haben. So ist auch immer von den „Syrachschen Reutern“ die Rede.
Die Werbung ging gut und schnell vonstatten. Syrach hatte das Unglück, Ende Oktober bei einem Ritt nach Ravensberg von der Gegenpartei aufgegriffen zu werden, worauf Friedrich V. wegen der Pilsener Übergabe justitiam über ihn ergehen lassen wollte.11 Dabei dürfte er seinen wohlverdienten Lohn empfangen haben. Die Gefangennahme wird zwar in diesem Brief von Kurköln noch nicht als ganz feststehend berichtet, jedoch später nicht mehr erwähnt; ebenso verschwindet hiermit der bis dahin häufiger vorkommende Name Syrachs vollständig aus den Akten.
Die Führung der Reiter übernahm nunmehr Rittm. Ludwig v. d. Asseburg (auch Aschenbroich). Bereits am 31. X. berichtete Kurköln, Rittm. Ludwig Westphal v. Lichtenau habe ihm die 1000 Pferde als komplett gemeldet, doch bäten die Rittmeister zugleich um sofortigen Abmarsch - d. h. wohl um Musterung und Beginn der Soldrechnung -, da ihnen sonst die Mannschaft fortliefe und dem Halberstädter zuzöge. Bisher lagen die Reiter in Wartgeld, das ihnen von Köln gezahlt wurde, und der Erzbischof hoffte nun auf Übernahme des kompletten Regiments durch die Liga. Doch Herzog Maximilian war keineswegs gewillt, das Regiment in seine Dienste zu nehmen. Er versuchte es vielmehr an eine fremde Macht zu verhandeln. Am 16. XI. 1621 schrieb er12 aus München an Kurköln, der Graf von Vaudemont-Lothringen - habe ihn um Truppen gebeten, da Mansfeld, von den Hugenotten um Unterstützung angegangen, sich dahin wenden könnte. Darauf habe er, Herzog Maximilian, die in Wartgeld stehenden Reiter angeboten. Man müsse nun erst Antwort abwarten. Köln möge doch solange das Wartgeld weiter zahlen. Er fügte noch hinzu, Ferdinand möge aber ja die Rittmeister hiervon nichts wissen lassen, damit sie sich nicht selbst Frankreich anböten und man so des Danks verlustig gehe. Hinsichtlich Herzog Christians glaubte Maximilian den Bruder vertrösten zu können: Spanien werde helfen; schon Belgiens wegen. Ebenso der niedersächsische Kreis, wie er es ja auch gegen Hogenhouck getan habe.
Mit diesem Brief kreuzte sich ein Schreiben aus Köln vom 14. XI.,13 das nochmals, nunmehr in ganz deutlichen Worten bat, das Regiment in Ligasold gegen Christian zu nehmen. Doch auch dies änderte nichts; nach Lothringen gingen die Truppen auch nicht, und so lagen sie um die Jahreswende noch immer in Wartgeld in ihren alten Quartieren, hatten aber an Zahl bereits stark abgenommen, wie das bei einem ungemusterten Regiment ohne Obristen und bei der Entlohnung durch das geringe Wartgeld nicht weiter verwunderlich ist. Außer den hier genannten Truppenteilen stand noch der Paderbornsche Ausschuß zur Verfügung.
Hätte das Verteidigungswesen des Stifts in einer energischen Hand gelegen, hätte man sich vor allem mit Anholt sofort in Verbindung gesetzt, so würde man den Einfall des Halberstädters zum mindesten abgewehrt haben können, wenn nicht überhaupt die gänzliche Vernichtung der Braunschweiger dadurch bewerkstelligt worden wäre. Doch fürs erste geschahen keinerlei weitsichtige Maßnahmen.
Christians Einfall in Westfalen. Einnahme von Lippstadt
Während des Marsches nach Norden scheint sich Herzog Christian persönlich zwischen dem 28. und 30. XII. von dem östlicher marschierenden Kontingent zu dem über Corbach vorrückenden begeben zu haben. Dieses fiel am 30. XII., von Waldeck aus kommend, in die Hardehausener Börde ein und nahm hier in verschiedenen Dörfern Quartier. Der Herzog lag in Ossendorf. Es wurde eine Aufforderung an Warburg - eine der stärksten Festungen des Landes, 800 Mann des Regts. Landsberg lagen als Besatzung darin - gerichtet oder eine Loskaufsumme von 10 000 Rtlrn. verlangt.14 Am folgenden Tage rückte die Heeresgruppe vor die Festung.
Inzwischen waren die von Naumburg kommenden Kompagnien vor die in einer kölnischen Exklave gelegene Stadt Volkmarsen gerückt und hatten sie zur Übergabe aufgefordert oder ihr anheimgestellt, sich mit 4000 Rtlrn. zu ranzionieren.15 Es kam schon zum Anschrauben der Petarden an die Tore, ehe man in der Stadt, in Erkennung der ernsten Lage, zu verhandeln begann und schließlich mit 1500 Rtlm. akkordierte, die auch bezahlt wurden.16 Daraufhin vereinigte sich dieser Heeresteil vor Warburg mit der Hauptgruppe. Hier kam es zu den ersten Kämpfen, da Warburg die Aufforderung abgelehnt hatte. Wenn auch die anscheinend von hier aus verbreiteten Nachrichten, Obrltn. Styrum und Rittm. Pflug seien unter den Toten, die vor der Stadt gefallen waren, nicht zutrafen, so kann man doch aus diesen Meldungen auf Verluste bei den Kämpfen schließen.
Es hieß jetzt für den Herzog, die Bevölkerung des feindlichen Gebiets einzuschüchtern. Gelang es ihm nicht, sich hier festzusetzen, die Oberhand zu behalten und so seine Pläne zur Verwirklichung zu bringen, so war er verloren. Vor Volkmarsen hatte der Herzog gezeigt, daß er zu Verhandlungen über die geforderten Summen bereit war. Vor Warburg zeigte er, daß er in der Lage war, bei runder Abschlagung seiner Forderungen den Betreffenden einen Schaden zuzufügen, der größer war als die zu zahlenden Gelder. Ausdrücklich berichtete Gerlach Buyte über seine Unterredung mit Styrum, in der dieser sich äußerte:17 man hab zu brennen begonnen, da Dörfer, Städte und Räte wegen der geforderten Summen Ausreden gebrauchten.
Die Warburger Vorstadt wurden von den Braunschweigern eingenommen. Hier wurden zehn Häuser abgebrannt, sowie das Hospital und die neue kurfürstliche St.-Johannis-Mühle. Ebenso wurde in dem Mönchskloster Dalheim und dem Nonnenkloster Wormeln, die ebenfalls nicht zahlen wollten, ebenfalls Brand angelegt. Am Abend desselben Tages, des 31. XII., rückte man wieder in die alten Quartiere. Hier wurde vor Einbruch der Dunkelheit Obrltn. Graf Styrum mit 150 aus allen Truppenteilen ausgewählten Reitern und 50 Musketieren, die man auf Pferde gesetzt hatte, zu einem Handstreich auf Lippstadt abgeordnet. Am nächsten Morgen zogen die Braunschweiger ab, nachdem auch Ossendorf in Brand gesteckt worden war.
Sofort zeigte sich die Wirkung dieser Politik. Die Äbte von Hardehausen und Spiegel kauften für ihre Dörfer den Brand mit je 2000 (nach anderen Berichten 1000 oder 1500) Rtlrn. ab. Nachdem die Truppen in Hardehausen verpflegt worden waren, ging es in nordwestlicher Richtung weiter. Am Abend (1. I. 1622) lag der Herzog in Haaren. Die übrigen Truppen waren zu Helmern, Atteln, Henglarn und Etteln einquartiert. An diesem Abend sowie am nächsten Morgen schickte der Herzog eingehende Schreiben an die Paderborner Räte:18 sie hätten nicht mit ihm akkordieren wollen; nun habe es aber sofort zu geschehen, sonst solle das ganze Stift ab-gebrannt, die Einwohner niedergehauen und erschossen werden, daß sich noch Kindeskinder darüber beklagen sollten. Als Ablösung wurden von der Geistlichkeit und den Jesuiten 100.000 Rrlr., von der Judenschaft 30.000, von der Ritter- und Landschaft 20.000 Rtlr. gefordert. Sollte aber der Geringste der Leute des Herzogs erschossen werden, so sollte Dorf auf Dorf abgebrannt werden.
Diese Sprache des Herzogs wirkte. Die Räte, die den Herzog bisher keiner Antwort für würdig gehalten und seine Truppen auseinandertreiben. zu können geglaubt hatten, waren plötzlich so verängstigt, daß niemand von ihnen zum Herzog gehen wollte, aber trotzdem wollten sie noch immer nicht zahlen:19 „Das E. F. G. wir Jemandten schicken solten, Darzu kennen wir Keimandten wegen besorgter gefahr bewegen, So haben wir auch kein gelt, vndt wießen bei dießen erbahrmlichen Zuestandt darzue kein raht oder mittell.“ Immerhin hatten sie aber sofort, am 2. I. 1622 geantwortet. Dann ging es weiter in kläglichem Ton, man wüßte nicht, daß braunschweigische Soldaten erschossen wären, und die im November erfolgte Ranzionierung des Steinheimer Rentmeisters empfände ihr Kurfürst schwerer als der Herzog den Tod seiner Soldaten. Zugleich hatten die Räte an den Obristleutnant des Stifts Minden, Philipp Eberhard de Wrede, geschrieben und ihn gebeten, er möchte doch statt ihrer zu Christian gehen und mit ihm verhandeln. Am 23. XII. scheint der Herzog in Erwartung der Antwort aus Paderborn stillgelegen zu haben. Wahrscheinlich wurden an diesem Tage wie auch am nächstfolgenden einige Reiterdetachements bis dicht vor Paderborn vorgeschickt.
Obrltn. Styrum löste inzwischen die ihm gestellte Aufgabe glänzend. Mit seinen 200 Berittenen war er von der Gegend von Ossendorf am 31. XII. abmarschiert. Es gelang ihm, seinen Marsch fast völlig geheimzuhalten. Tagsüber versteckte er sich im Busch, nachts wurde vorgegangen. In knapp zwei Nächten legte er - eine ganz außerordentliche Leistung für damalige Zeiten - trotz Wegelosigkeit, Umgehung von Ortschaften, Kälte und Schnee 60 km zurück und gelangte vor Tagesanbruch vor die Festung Lippstadt. Beim Öffnen des Tores, am Sonntag, dem 2. I. 1622, sollte die Stadt überrascht werden. Doch hatte ein Bauer Spuren eines Trupps Reiter im Schnee gefunden und dies einem kurfürstlichen Rat gemeldet, welcher daraufhin den Hauptmann in der Stadt benachrichtigt hatte. Die Besatzung der Stadt, die obrigkeitlich kölnisch und neuburgisch war, bestand aus ungefähr 50 Spaniern vom Regt. Emden unter Hptm. Hieronymus Raab. Nachdem der erste Überrumpelungsversuch fehlgeschlagen war, schickte Styrum einen bereitgehaltenen Brief an die Stadt und forderte sie auf, die Besatzung zu entfernen. Währenddessen zeigte er sich mit seinen in fünf Trupps geteilten Soldaten vor den Mauern.
Aus verschiedenen Gründen sah sich die Bürgerschaft veranlaßt, für den Fall eines Kampfes ihre Neutralität zu proklamieren. Der in der Stadt verbreitete Protestantismus, die Abneigung gegen die Spanier, Überschätzung des Feindes, unzulängliche eigene Bewaffnung und Angst vor der Rache des Herzogs dürften als Gründe hierfür anzusehen sein. Sobald dem Obristleutnant etwas von der Neutralität der Bürger zu Ohren gekommen war, ließ er - es war Sonntag vormittag gegen 10 Uhr -, bei hellichtem Tage absitzen und seine Leute über den zugefrorenen Stadtgraben stürmen. Die erschreckte Wache floh, ein Tor wurde genommen, die Spanier wurden erst auf den Markt, dann ins Rathaus zurückgetrieben und hier mit ihrem Capitaine gefangen. Somit befand sich Lippstadt in den Händen Styrums. Herzog Christian besaß den ersten festen Stützpunkt im Lande. Die Erstürmung war fast ganz unblutig verlaufen. Auf seiten der Braunschweiger war niemand verletzt worden, die Spanier hatten zwei Verwundete.20 Herzog Christian wurde sofort von der Einnahme in Kenntnis gesetzt.
Bei der Einnahme von Lippstadt war auch durch einige Soldaten die Schorlemersche Besitzung Overhagen besetzt worden. Hierbei waren elf Pferde geraubt und der Freifrau mit Gewalt die Ringe vom Finger gezogen worden. Dem Gutsherrn selbst, der sich nach einer nahen Mühle geflüchtet hatte, geschah nichts; er begab sich nach Werl. Nach wenigen Tagen erlangte er übrigens vom Halberstädter eine Salvagardia und erhielt sofort vier seiner Pferde zurück. Dazu wurde ihm bedeutet, daß er, falls er seine übrigen Pferde ausfindig machen könnte, sie zurückerhalten würde.21 Am Morgen des 4. I. 1622 schickte Styrum einen Trompeter an die Stadt Soest, die ebenfalls von einer spanischen Garnison besetzt war, und forderte sie auf, die Spanier auszuweisen und Braunschweiger aufzunehmen.
Um die Regierung von Paderborn zum Zahlen zu zwingen, kam es am Heiligabend neuerlich zur Anlegung von Bränden. Sechs Dörfer wurden nach dem Styrumschen Bericht verbrannt, darunter Steinhausen und Brenken. Haaren, wo der Herzog gelegen hatte, konnte den Brand mit 2000 Rtlrn. ablösen. Auch in Fürstenberg scheint gebrannt worden zu sein. Die Brandlegungen wurden also beim Abzug und während des Marsches vorgenommen. In der Weihnachtsnacht lagen die Truppen zu Störmede, Langeneike und Eikeloh und rückten am ersten Feiertag in Lipp-stadt ein. Haufenweise, berichtet Styrum an Buyte, kamen Junker und Bauern, sogar schon aus dem Kölnischen, und begehrten das Brennen abzulösen. Man dachte also nicht daran, das Zögern der Regierung mitzumachen, sondern suchte sich sein Eigentum zu erhalten. Anscheinend noch vor dem Einzuge des Herzogs hatte Styrum mit Erwitte, einem ummauerten Dorf, und Westernkotten verhandelt. Die Orte mußten zusammen eine Brandablösung von 4000 Rtlrn. zahlen und einschließlich der diesen Orten unterstehenden Dörfer 1000 Reiter eine Zeitlang mit Futter versehen. Bald waren es 1200, und zwar 800 in Erwitte und 400 in Westernkotten.
Die Truppenstärke des Herzogs betrug damals, ebenfalls nach Styrums Bericht, 700 bis 800 Mann z. F. und 13 Kornetts von insgesamt 1600 Pferden. Die beiden inzwischen hinzugekommenen dürften die Kompn. Mengersen I (Georg?) und Schneidewind gewesen sein.22 Aus Hessen folgten zwei Kompagnien z. Pf. unter Rittm. Hans Werner v. Eschwey und Johann Friedrich v. Boyneburg.
Alles einkommende Geld wurde augenblicklich für Neuwerbungen angelegt. Überall verbreiteten sich im Lande die Werber von allen möglichen Offizieren, und es ist für die Folgezeit sehr schwer, eine genaue Aufstellung der vorhandenen Truppen zu geben, da sie sich ständig vermehrten.
Dazu kommt, daß die einzelnen Offiziere verschieden lange Zeit zur Aufbringung und Bewaffnung ihrer Formationen brauchten. Einzelne Kontingente, die besonders stark anwuchsen, wurden geteilt, und zwar wurde der Leutnant dann Rittmeister der 2. Kompagnie. So hatte beispielsweise Johann v. Velmede anfänglich von Mansfeld nur den Auftrag, im Ravensbergischen eine Kompagnie aufzubringen. Doch teilte Velmede bald eine zweite ab, die er seinem Ltn. Jreentorp unterstellte. Beim Abmarsch führte er schließlich ein ganzes Regiment. Es muß also für den Verlauf des nächsten Vierteljahres von der Aufstellung genauer Truppenlisten, die Vergrößerung der Armee betreffend, abgesehen werden.
In Lippstadt zog der Herzog von Braunschweig am 4. I. 1622 ein. Sofort begann er, die Befestigungswerke der Stadt in guten Zustand zu setzen, um sie verteidigungsiähig zu machen, wozu viele Eichen in der Nähe der Stadt gefällt wurden.
Am 26. XII. wurde ein zweiter, in schärferen Worten gehaltener Brief an Soest geschickt und die Stadt zur Übergabe aufgefordert. Falls die Stadt sich nicht ergäbe, würde die Exekution in der Soester Börde vorgenommen werden. Die Pfalz-Neuburger Regierung in Düsseldorf, der Soest unterstand, versandte daraufhin einige mit Drohreden untersetzte Proteste - nutzlos verschriebenes Papier.23
Die Stadt schrieb an den Herzog, unter gewissen Voraussetzungen innerhalb 14 Tagen die Garnison hinausschaffen zu wollen; doch Braunschweiger wollte man nicht einnehmen. Man wollte den Herzog hinhalten; in Wirklichkeit sah man sich nach Hilfe um, und die Bürgerschaft erklärte, treu zu der innehabenden Garnison stehen zu wollen.
Ranzonierungsverhandlungen
Inzwischen verhandelte in Lippstadt die Paderbomer Gesandtschaft mit dem Herzog. Neben Philipp Eberhard de Wrede bestand sie aus dessen in lippischen Diensten stehenden Bruder Johann Eberhard und einem Paderborner Rat Rudolf v. Sehagen. Die vom Klerus und der Judenschaft geforderte Summe von 100 000 bzw. 30 000 Rtlrn. ermäßigte der Herzog nicht. Die von der Ritter- und Landschaft geforderte von 20 000 Rtlrn. setzte er auf 15 000 Rtlr. herunter. Da die Gesandtschaft hierauf nicht eingehen konnte, reiste sie am 5. I. 1622 zurück. Der Herzog gab der Regierung zu Beratungen vier Tage Frist und gebot den Truppen bei Leibesstrafe eine viertägige Neutralität gegen das Stift.24 Doch die Stände wollten den Herzog nur hinhalten und hofften noch immer, seiner Herr werden zu können. Man wollte sich jedenfalls den gestellten Forderungen nicht fügen. Ein Bericht vom 5. I. 1622 aus Paderborn25 sagt: „Die Stätte vnd Schlößer dieses Bischtumbs werden mit Landt: vnd neuerlich geworbenem Kriegsvolck besetzet, So verhoffts vnd erwartet man von andern Orten Hülff vnd Secours.“
Während der Verhandlungen war am ersten Weihnachtsfeiertag ein Reiter vom Grafen Mansfeld angekommen mit der Meldung, sein General habe genügend Geld - 15 Tonnen Gold, heißt es an anderer Stelle -, um 1600 Pferde und 3 Regimenter z. F. werben zu können. Wahrscheinlich wurde auch zugleich die baldige Ankunft der mit Patenten versehenen Offiziere angekündigt. Auch die Holländer hatte der Graf durch eine Meldung nach Pfaffenmütz benachrichtigt.
Während man in Paderborn beriet, dehnten sich die Braunschweiger von Lippstadt aus in den nicht Paderbornschen Gebieten weiter aus. So wurde am 7. I. 1622 das nahe bei der Stadt in einer lippischen Exklave gelegene befestigte Lipperode besetzt und später am 13. und 14. I. geschleift, um im gegebenen Fall einem Gegner ein Festsetzen hier in nächster Nähe von Lippstadt unmöglich zu machen.26 Ferner zog der Herzog am gleichen Tage (7. I. 1622) zur Eintreibung von Brandschatzungsgeldern nach Rüthen und Geseke.27 Da die Einwohnerschaft von Lippstadt schon mit der starken Einquartierung als solcher viel zu schaffen hatte, befreite sie der Herzog, um sie nicht zu überlasten, völlig von der Verproviantierung der Truppen, die, zuweilen unter Anwendung von Drohungen, nunmehr vom Land geliefert werden mußte. Die Lebensmittel wurden, ebenso wie das Futter, „proportionaliter“ an die Mannschaft ausgegeben. Der Herzog hatte sein Quartier im Hause des „Richters zu Lippe“.28 Täglich wurden für den Herzog und seinen Stab zwei Rinder geliefert, dazu „Hünerken vnd Eyrken“.
Auch mit dem Stift Münster und dem zum Erzstift Köln gehörigen Herzogtum Westfalen war der Herzog in Verhandlungen eingetreten. So wurden von dem im Münsterschen gelegenen Kloster Marienfeld 5000 Rtlr. verlangt, vom Herzogtum Westfalen 50 000 Rtlr.29 als Gesamtablösung. Als Gesandte des letzteren Gebietes waren Christoph und Bernhard Sylvester v. Hörde erschienen. Sie waren die ersten, die sich mit den Tatsachen abfanden und wirklich einen Vertrag zustande bringen wollten. Nachdem der Herzog schließlich die geforderte Summe auf 20 000 Rtlr. ermäßigt hatte, unterzeichnete er am 9. I. 1622 einen Revers,30 das Herzogtum Westfalen zu verschonen und seine Truppen über die besetzten Orte Erwitte, Westernkotten und Anröchte - dies war kurz zuvor von 2 Kompagnien besetzt worden - nicht auszudehnen. Es ist ganz selbstverständlich, daß sich der Herzog hierbei für alle militärischen Operationen völlige Handlungsfreiheit vorbehielt. Ein kölnisches Hilfsgesuch an Kursachsen vom 30. I. aus Brühl31 bestätigt dies ausdrücklich: Die Westfälischen hätten sich mit 20 000, die Münsterischen mit 30 000 Rtlrn. „über den vorbehaltenen schweren conditionen des freien ein- vnd durchzugs“ hinaus abgefunden.
Es wurde und wird von katholischer Seite Klage geführt, der Herzog habe diesen wie auch andere Akkorde gebrochen. Hierzu ist folgendes zu bemerken: Proviantlieferung mußte sich der Herzog ebenso wie Operationsfreiheit vorbehalten. Die Summen waren von den Ländern als Brandablösung und zum Schutz von Leben und Eigentum der Einwohner gezahlt worden. Es war selbstverständlich, daß die gesamte Einwohnerschaft dem Heer gegenüber eine völlig korrekte Haltung einnehmen mußte, und ebenso selbstverständlich, daß Verstöße hiergegen von der bewaffneten Macht geahndet werde mußten; daß der Herzog, nachdem Übergriffe vorgekommen waren, den Einwohnern teilweise die Waffen abnehmen ließ- worüber sich das kölnische Hilfsgesuch im Anschluß an oben zitierten Satz beschwert -, kann nicht verwundern. Ebensowenig das rechtzeitige Eingreifen gegen sich sammelnde feindliche Truppen oder bei Absendung von Geldern an den Feind. Bei Unterzeichnung des Akkordes mit Westfalen war auch schon berichtete Erstattungsgesuch Kaspar Dietrichs v. Schorlemer wegen Overhagen berücksichtigt worden.
Trotz der nochmaligen Ermahnung des Herzogs am 7. I. 1622 kam die Paderborner Regierung noch immer zu keinem Entschluß. Immerhin war für jeden Einsichtigen damals schon klar, was kommen mußte. So schrieb Obrltn. de Wrede Christian d. Ä.,32 der Halberstädter zwänge durch sein Vorgehen die an sich nicht dazu geneigte Regierung zum Ranzionieren. Als nach Ablauf der gestellten viertägigen Frist niemand beim Herzog erschienen war, wurde Generalbrandmeister David mit 300 Pferden nach Paderborn geschickt, wo er einige Vorwerkshäuser von Neuhaus und einige Höfe abbrannte. In Benhausen sowie Altenund Neuenbeken wurde nicht gebrannt. Der Droste zu Vlotho, Johann v. d. Horst, berichtet in einem Brief vom 15. I. ausdrücklich, entgegen allen Nachrichten sei in Gegend von Lippspringe nicht gebrannt worden.33
Um die Jahreswende zog Konrad Nell mit einem Auftrag seines Herzogs nach Warburg durch das Stift Paderborn, wobei auch das Kloster Gehrden berührt wurde. Nach dem Bericht des ungenannten Gewährsmannes haben sich die Truppen sehr gut benommen und keinerlei Schaden getan, was wahrscheinlich auf die noch vor Ablauf des Waffenstillstandes erfolgte Abschickung zurückzuführen sein dürfte. Vielleicht hatte dieser Ritt auch mit der bald darauf einsetzenden Errichtung von Werbeplätzen in jener Gegend zu tun.
In den ersten Tagen des Januar, wohl am 12., erschien Obrltn. de Wrede wieder in Lippstadt, diesmal aber in Sachen seines eigenen Herrn. Als Administrator von Minden erbat Christian d. Ä. Verschonung des Stifts, die ihm auch vollkommen zugesichert wurde. Herzog Christian d. Ä. hatte sich seinem Vetter in Lippstadt freundlich erzeigt, indem er dessen vom Stift Halberstadt aus in den letzten Tagen des Dezember durchreisendem Stall- und Rittmeister Marquard v. Hodenberg freien Paß gestattet und ihm einen Neujahrsglückwunsch für seinen Herrn mitgegeben und gleichzeitig um Schonung des Stifts gebeten hatte. Die dortige Stiftsregierung war eigentlich schon zur freiwilligen Zahlung einer Summe Geldes entschlossen gewesen. Nun unterließ man aber ihre Abschickung, da Obrltnde Wrede fand, daß der Herzog dem Stift ohnedies gut gesonnen sei.34 Zur gleichen Zeit war der holländische Gouverneur von Sparenberg-Bielefeld, de Viri, in Lippstadt wegen späterer Aufnahme einer holländischen Garnison und um gute Ordnung machen zu helfen, wie er sich ausdrückte. Soest würde bald folgen, schrieb er ferner, sowie andere Städte mit feindlicher Besatzung.35
Auch gegen das Stift Münster begann der Herzog vorzugehen, um dessen Regierung - die hartnäckigste der drei Stiftsregierungen, mit denen Christian zu tun hatte - zur Ranzionierung zu zwingen. Inzwischen hatte der Herzog, als neuerliches Zwangsmittel gegen Paderborn, die Dörfer Benhausen, Dahl, Alten- und Neuenbeken durch den Grafen Styrum besetzen lassen. Dann mußte sich jeder der Orte zur Zahlung von 5000 Rtlrn. verpflichten, wozu sie natürlich nicht in der Lage waren. Bei der Besetzung von Benhausen war der Quartiermeister des Obristleutnants von Einwohnern erschossen worden, wofür gesondert 3000 Rtlr. verlangt wurden. Daß eine Ahndung der Tat in dieser Weise möglich war, und nicht die völlige Vernichtung des Ortes erfolgte, zeigt die gute Disziplin der Truppe sowie die ruhige Art des Grafen Styrum. Merkwürdigerweise führt Weskamp, wie auch vorher Opel, diese Ablösung als besondere Härte auf.
Jetzt endlich fand man sich seitens der Regierung bereit, dem Herzog 20 000 Rtlr., in wenigen Tagen zahlbar, anzubieten, worauf dieser einging und dafür die Ranzionierung der Dörfer einstellte. Nur Benhausen mußte das Strafgeld für den erschossenen Quartiermeister zahlen. Auch die Borkeschen Dörfer mußten gesondert eine Summe liefern. Ebenso waren Warburg, Delbrück und Lippspringe, von denen je 2000 Rtlr. verlangt wurden, in den Akkord nicht mit einbegriffen. Im übrigen mußte die Regierung versprechen, den aufgebotenen Ausschuß zu entlassen und keinerlei Werbungen für Friedrich V. verhindern oder verweigern zu wollen. Untertanen, die sich bei Christian anwerben lassen, heißt es ferner, dürfen in keiner Weise irgendwie behelligt werden. Wer braunschweigische Soldaten am Leben oder sonstwie schädigt, soll nach Recht und Gesetz bestraft werden.36
Delbrück kam übrigens schon wenige Tage nach dem Akkord in die Hände der Braunschweiger und mußte 2000 Rthl. zahlen. Auch die Einwohner dieses Ortes mußten, ebenso wie die von Erwitte und anderen besetzten Gebieten, am Lippstädter Festungsbau mitarbeiten. Die Erwitter waren es übrigens auch, die, als sie zum Schleifen von Lipperode befohlen wurden, ihre Waffen abgeben mußten, wovon schon weiter oben die Rede war.
Wie diszipliniert das Brennen übrigens vor sich ging, geht aus einem Bericht des Gaugreven zu Herford, Dr. jur. Franz Giesebier, an den Mindenschen Kanzler vom 15. I.37 hervor, betreffend einen am 13. I. zur Erzwingung der Kontribution abgebrannten Hof. Man nahm hierzu ausschließlich die Liegenschaften von Geistlichen oder solchen vom Adel, die kurkölnische Ämter verwalteten. „vnd sei Vorgestern noch ein stadtlicher hoff abgebrandt, Davor der Meyer vor das principall wonhaus 1000 Rthaller gebotten Der brantmeister aber sich entschuldiget ehr habe befelig den hoff in brandt zu stecken, wann ehr es nicht thete müste ehr henkenn hatt also den leuten helfen retten was konnen weg gebracht werden vnd folgens feur darin gelegt vnd aufbrennen laßen, vnd gehören solche dorler alle den geistlichen zu.“ Der Herzog wußte ganz genau, daß es bei dem großen Reichtum der Geistlichkeit für diese bei gutem Willen ein leichtes war, große Summen zu erlegen. Doch fanden sie sich stets erst nach Bedrohung ihres Privateigentums zu Zahlungen bereit.
Im allgemeinen ließ der Herzog betreffs der Höhe der geforderten Summen mit sich reden und begnügte sich oft mit einem Bruchteil. Jedoch ein Vorfall zeigt, daß man es in dieser Beziehung nicht zu weit mit ihm treiben durfte. Der junge Herr v. Büren hatte die von ihm geforderte Summe auf 2000 Rtlr. durch Bitten heruntergehandelt. Als er aber noch weiter davon abhandeln wollte, setzte Herzog Christian sie wieder auf 3000 Rtlr. herauf.38
Wie übrigens der Herzog unrechtmäßigem Verhalten der Soldaten gegenübertrat, zeigt folgender Fall. Am 18. I. war in Lippstadt ein Brand ausgebrochen, dem ein Frauenkloster zum Opfer fiel, während die dazugehörige Kirche verschont blieb. Während des Feueralarmes machten sich einzelne Soldaten an diese Kirche, um sie zu „spolieren“. Der Herzog, der auch zu dem Feuer geritten war, schlug mit dem blanken Degen dazwischen, wobei mehrere tödlich verwundet wurden.39
Einnahme von Soest. Festigung der Stellung Christians
Das Kontributionsgeld, das stets sofort wieder für Neuwerbungen ausgegeben wurde, begann bereits damals, Mitte Januar, seine ersten Früchte zu zeitigen. In der Gegend von Brilon und Thülen sowie bei Delecke a. d. Mähne treten neben Rekognoszierungstn1pps die ersten heranziehenden neugeworbenen Formationen auf. Auch zeigen sich damals an verschiedenen Stellen Norddeutschlands Christiansche Truppen. So beispielsweise an der Elbe auf cellischem Gebiet. Ferner bei Wietersheim a. d. Weser unter Heinrich v. Zerven. Im Bistum Halberstadt lagen Rittm. Christoph v. Hünegken und Hptm. Paul Schufenorth mit einer Kompagnie und einem Fähnlein.40 Bei Brilon trat Rittm. Winter auf, von dem, um nichts zu übergehen, der Paderborner Bericht behauptet, er habe wegen allerlei Delikten vordem in Arnsberg in Arrest gesessen. Ferner werden unter den neuen Offizieren noch genannt, und zwar sämtlich als Rittmeister: ein Mengersen - der zweite Rittmeister dieses Namens bei Christian -, Adam Sinnemann, der bis dahin in Waldeckschen Diensten gewesen war, Adam Erich v. Kerssenbrock, Heinrich v. Limburg, Wolf Christoph v. Haxthausen, Johann Cordes v. Gröningen und Mainolf v. d. Maisburg. Während über Rittm. Winter - außer, daß er damals Brilon und Thülen bedroht haben soll - späterhin weiter keine Klagen vorkommen, scheint der Rittm. v. Kerssenbrock nicht gerade hervorragende menschliche Qualitäten besessen zu haben.
In diese Tage, jedenfalls in die Zeit zwischen dem 11. und 19. I., fällt auch der Versuch einer Überrumpelung Höxters,41 und zwar durch den früheren Aufwärter des Herzogs, jetzt Leibgardecapitaine, Heinrich Hillefeld, mit 300 Mann z. F. Einige Wagen mußten sich einige Zeit im Tor aufhalten, währenddessen drangen die Soldaten ein. Die Bürger waren aber schnell mit Waffen bei der Hand, die Sperrketten wurden vorgehängt, und so mußte Hillefeld unverrichteterdinge wieder abziehen.
Inzwischen begann man die Pläne gegen das widerspenstige Soest in die Tat umzusetzen. Die in Lippstadt eroberten Geschütze waren fahrbar gemacht, außerdem war die holländische Garnison in Hamm um weitere Stücke angegangen worden.42 Am 22. I. rückte dann der Herzog mit Truppen und fünf Stücken aus Lippstadt vor Soest und begann, die Stadt zu beschießen. Graf Heinrich v. d. Berg, den die Stadt sofort um Hilfe gebeten hatte, ließ ihr mitteilen, daß sie von ihm keinen Entsatz zu erhoffen habe. Trotzdem hielten die Bürger zur Garnison und kämpften gegen die anrückenden Braunschweiger.43 Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es schließlich, das Osthofener Tor mit einer Petarde zu sprengen, sowie mittels Hopfenstangen einen Brand anzulegen, dem mehrere Vorstadthäuser zum Opfer fielen, und der ins Innere weiterzugreifen drohte. Nun sah man sich genötigt. zu verhandeln, und am 23. I. mittags wurde die Stadt förmlich übergeben. Der Herzog hatte einige Tote (30 Mann) und Verwundete bei der Einnahme gehabt, dabei einen Hauptmann und einen Leutnant, für die von der Stadt eine Sühne von 15 000 Rtlrn. gefordert, die dann aber auf 10 000 Rtlr. ermäßigt wurde. Die spanische Garnison unter Hptm. Amberger vom Regt. Emden durfte abziehen. Die städtische Verwaltung behielt ihre Macht, und es wurde ihr versprochen, die Höhe der neuen Garnison in erträglichen Grenzen zu halten. Auch hier wieder war das Verhalten der Truppen trotz des Sturms und der Verluste tadellos. Der Bremer Syndikus Dr. Gerlach Buxtorff (Buyte?), der auf Besuch bei seinem Vater weilte und so die Einnahme unfreiwillig mitmachte, hat auf der Durchreise in Minden über die Einnahme genauen Bericht erstattet, den die dortige Regierung an den Landesherrn nach Celle meldete: „vnd Aber sonsten kein schade so weinig den Soldaten, Als der Geistlichkeit wiederfahren“, heißt es in dem Bericht. Auch die Heimreise des Syndikus sofort nach der Einnahme - am 17. I. hatte er bereits Minden passiert - zeigt die Sicherheit auf den Straßen.
Noch am Tage der Einnahme richtete der Herzog einen Brief an Werl, in dem diese Stadt zur gutwilligen Übergabe aufgefordert wurde. Andernfalls sollte gestürmt werden. Jedoch unterblieb eine Aktion gegen den Ort; die Truppen wurden zur Aktion gegen Paderborn wieder nach Osten geschickt. In Soest war dem Herzog ein dort deponierter Schatz, der dem verstorbenen Bischof von Paderborn oder dem Paderborner Dom gehörte, in die Hände gefallen. Der oben angegebene Bericht44 veranschlagt ihn auf 20.000 Rtlr., doch sind anscheinend im Laufe der nächsten Tage und Wochen durch die braunschweigische Besatzung weitere dazugehörige Werte ausspioniert, beschlagnahmt und der herzoglichen Kriegskasse zugeführt worden. Nach der genauen Aufstellung im Meteranus novus repräsentierte der ganze Schatz einen Wert von 339.000 Rtlrn., welche Summe sich aus folgenden Posten zusammensetzte:
Fünfftzig Centner gemüntzter Reichsthaler
86 000
Drey vnd sechtzig Säck mit alten Sächsischen Thaler
53 000
Ein güldin Creutz mit Diamanten geschätzt auff
53 000
Allerley Silbergeschirr zur Tafel
25 000
Zwey vbergülte Rappieren/
fünff güldene Ketten vnd Armbandt
9000
Ein silberne Platten / welche gewogen
56 000
Etliche silberne vnd güldene Pocalen
8 000
Etliche Schachteln mit Edelgesteinen vnd Diamanten
49 000
Summa summarum
339 000
Neben dieser, für damalige Zeit ungeheuren Summe, wurden durch den braunschweigischen Kommandanten im Laufe der nächsten Monate noch weitere Summen aus geistlichem Besitz festgestellt und eingezogen.
Inzwischen waren die Verhandlungen mit den verschiedenen benachbarten Landgebieten weitergegangen. Der Graf von Rietberg hatte an Spinola geschrieben, man solle ihm Volk schicken, dann wolle er dem Unwesen wohl ein Ende machen.45 Die Boten waren aufgegriffen und die Briefe Christian übergeben worden. Nun wurde der Graf mit Brand bedroht und mußte sich loskaufen. Ferner mußte er geloben, nichts gegen Christians Leute zu unternehmen und keine Spionagedienste zu leisten. Er hat dieses Gelöbnis auch getreulich gehalten und eine ihm vom Herzog von Bayern angetragene Oberstencharge abgelehnt. Nach dem Vorbild der Holländer46 wurden nämlich Eingesessenen, die beim Feinde Dienst taten, Repressalien an ihren Liegenschaften angedroht.
Auch das Münsterland hatte kontribuieren müssen.47 Nach dem gewöhnlichen Hin und Her war der Herzog von den verlangten 50.000 Rtlrn. auf 30.000 Rtlr. heruntergegangen. Am 26. I. war der Münstersche Marschall v. Vehlen in Soest, nachdem Bitten um weitere Heruntersetzung der Summe fruchtlos geblieben waren, im Namen des Stifts auf Christians Forderungen eingegangen. Die Summe mußte binnen 10 Tagen erlegt werden. Ferner sollten alle Stiftssoldaten abgedankt werden. Als man hierbei der Umgebung des Herzogs Geschenke machte, um für das Stift möglichst viel herauszuschlagen, wies Styrum ein ihm angebotenes Pferd zurück: Er werde auch ohnehin das Beste des Stifts sich angelegen sein lassen.48 Als man von seiten des Stifts auf die Forderungen des Herzogs eingegangen war, versprach dieser in einem schriftlichen Revers, das Stift von Plünderung und Einquartierung und aller sonstigen Beschwerung nach Möglichkeit zu befreien. Die Eingesessenen sollten ungehindert ihren Geschäften nachgehen können.
Die Summen wurden auch pünktlich gezahlt. Am 10. II. bescheinigte der Herzog ihren Empfang und erteilte den Räten in Münster die Vollmacht, ihm diejenigen seiner Soldaten gefesselt auszuliefern, welche sich ohne Paß im Münsterlande aufhalten und sich dort etwas zuschulden kommen lassen sollten.
Wahrscheinlich kam es damals bei einer dieser Verhandlungen zu einer Aussprache des Herzogs mit v. Vehlen, wobei alle möglichen militärischen und politischen Fragen angeschnitten wurden. Über die Aussprüche des Herzogs hierbei existiert ein Bericht49 in kurzen, knappen Sätzen - wahrscheinlich in Anlehnung an die Sprechweise des Halberstädters -, aus dem besonders folgende von Interesse sind: Die Acht sei ihm gleichgültig, wollte tausendmal lieber sterben, als um Verzeihung bitten. - Dies Jahr sollten 130.000 Mann ins Feld. - Protestanten hätten stärkere Liga als je zuvor. - Bethlen Gabors Traktation nichts anderes, als des Mansfelders Praktik. - „Caesaris schreiben seien intercipyrt, in quibus nihil pacifici. Ergo ... „ - Bavarus hätte schon den kurfürstlichen Reichsapfel im Wappen. - Der Kurfürst zu Köln sei sein Feind. - „Gott zu freundt, vnd aller Welt feindt.“ - Kaiser und Kurfürst auch in die Acht erklären und publizieren lassen. - In 14 Tagen wolle er sich Bischof von Paderborn schreiben lassen. - Die Staaten haben ihm versprochen, ihm so stark wie die Königischen (Spanier) zu Hilfe zu kommen. - Läßt für das abgeschatzte Geld neu werben, gibt noch immer Patente aus. - Die heimlichen Kontributionen von Münster und andern Stiftern durch interzipierte Briefe bekannt, wollen ebensoviel und mehr haben. - Mansfeld schickt eine Bestallung über die andere heraus. - Bischof von Osnabrück und Principis Henrici Schreiben wolle er nicht lesen, hätten ihm nichts zu kommandieren. - Mansfeld aber wohl. Wenn Vehlen ihm davon Schreiben brächte, wollte er dem folgen. - Mit den Abmahnungen der niedersächsischen Fürsten und fürstlichen Verwandten, bemerkt Vehlen noch, treibe der Herzog nur Spott. -
Bereits hier wies Christian den kölnischen Marschall darauf hin, daß er durch interzipierte Briefe über die geheimen Zahlungen an Kurköln unterrichtet sei. Trotzdem ließ man in der Folgezeit in Münster nicht davon ab, so daß der Herzog, der seine Forderungen gegen das Stift von 50 000 auf 30 000 Rtlr. herabgesetzt hatte, sehen mußte, daß noch genügend Geld zu Kontributionen im Lande war, und dann auch seinerseits wieder Gelder verlangte. Ebenso gab es, und zwar noch vorher, dadurch mehrfach Mißhelligkeiten, daß das Stift trotz der eingegangenen ausdrücklichen Verpflichtung seine Truppen nicht abdankte, sondern im Gegenteil eine Reihe Grenzorte von ihnen besetzen ließ, wo Herzog Christian sie unmöglich dulden konnte. Auch das Vest Recklinghausen mußte eine Summe erlegen, nachdem der Herzog am 27. I. eine Gesandtschaft zur Ablösung vor sich zitiert hatte.
Die Stadt Warburg hatte ebenfalls ihren Widerstand aufgegeben und zeigte sich zu einer Kontribution bereit, die vom Herzog auf 14 000 Rtlr. festgesetzt wurde. Nun schickte die Stadt eine Gesandtschaft zu dem Herzog nach Soest, der die Summe schließlich auf 8000 Rtlr. ermäßigte.
Die von Tag zu Tag sich mehrende Truppenzahl verlangte neue Maßnahmen. Einerseits mußte man um Lippstadt, das Herz des besetzten Gebietes, mehr Orte mit Quartieren belegen, andererseits brauchte man vorgeschobene Posten, um nicht von einem plötzlich auftauchenden Feind Überraschungen zu erleben. Auch schon darum mußten die in der Nähe von Lippstadt gelegenen kleinen Ortschaften besetzt werden, um einen Gegner sich hier nicht festsetzen zu lassen. So wurde zur Sicherung das Möhnetal besetzt, vor allem Belecke und Körbecke. Die Gegend um letztgenannten Ort mußte auch die Soester Besatzung verproviantieren, um die dortigen Bürger nicht zu überlasten. Ferner wurden Rüthen, Büren, Geseke, Salzkotten und Marsberg - damals Stadtberge genannt - mit Truppen belegt. Es war dies einfach eine militärische Notwendigkeit. Man mußte auf braunschweigischer Seite so handeln, ob man wollte oder nicht. So heißt es in den kontinuierenden Berichten über den Herzog aus Köln,50 der Herzog habe verlauten lassen, wenn auch die Verhandlungen abgeschlossen und das Geld bar erlegt sei, so müsse er doch in Salzkotten, Paderborn, Büren und anderen Orten etliche Kompagnien Reiter einlegen, da man sie in und um Lippstadt nicht länger erhalten könne. „Er Hertzog auch wegen der gelegenheit, vnnd damit Er der Reuter Jederzeit in der nähe mechtig vnnd gesichert, Dieselbe anderßwohin nit verlegen konte.“
Auf die in Kölner Klageschriften jener Zeit vorkommende Feststellung, daß man hie und da im Lande erfrorene Kinder fände, was dem Herzog von Braunschweig dann in die Schuhe geschoben wurde, ist bereits eingegangen worden, worauf hier verwiesen sei.51 Die außergewöhnliche Kälte forderte damals eben allenthalben Todesopfer.
Übrigens will ich nicht unerwähnt lassen, daß ich für die erste Hälfte des Januar den ersten Beleg für den Beinamen des Herzogs, den der Volksmund „der Tolle“ nannte, gefunden habe. In einer Zeitung aus Köln52 heißt es, Christian habe verboten, ihn den „tollen Bischof“ zu nennen, sondern Herzog von Braunschweig. Ob das Verbot ergangen ist, lasse ich dahingestellt, jedenfalls war der Beiname damals bereits geläufig.
In der ersten Hälfte des Januar hatte der Herzog den Rittmeister Johann Egbert Westphal nach dem Haag geschickt,53 später den Obersten Eschwey zu seinem Bruder nach Wolfenbüttel. Im Verlauf des Monats hatten sich auch die mit Patenten von anderen protestantischen Parteigenossen versehenen Offiziere beim Herzog eingefunden, um nun unter dem Schutz der braunschweigischen Truppenmacht ihre Kontingente in den Stiftern zu „vergaddern“54 und zu mustern. So Major v. Velmede und Graf Johann Kasimir v. Löwenstein, der um die Zeit der Einnahme von Soest in Lippstadt eintraf; ein wenig später erschien Joachim v. Carpzo, der seine ersten Werbungen im Ansbachischen vorgenommen hatte.55 Auch ein in französischen Diensten stehender Oberst Walraff (Walram) Baron de Gent trat damals in Erscheinung, jedoch ohne daß es durch ihn zu einer Werbung gekommen wäre.56 Auch badische Offiziere erschienen, vor allem Oberst Georg Freiherr v. Fleckenstein-Dagstuhl. Dieser hatte am 22. XII. 1621 vom Markgrafen Georg Friedrich ein Patent erhalten, ein Reiterregiment von 600 Kürassieren und 200 Arkebusieren zu werben, und sich verpflichtet, diese bis Ende März zu liefern.57 Nachdem er Cassel passiert hatte, traf er kurz nach der Einnahme von Soest beim Herzog ein, mit ihm sein Obrltn. Eberhard Bechermondt, im Zivilverhältnis badischer „Amtmann zum Stein“; etwas später Obrltn. Albrecht Thilo v. Uslar, um ein Regiment z. Pf. für den ebenfalls in badischen Diensten stehenden Herzog Wilhelm von Weimar aufzubringen.
All diese mansfeldischen und badischen Offiziere unterstanden Christian nur bis zu einem gewissen Grade, jedenfalls solange die Truppen in den westfälischen Quartieren lagen. Er konnte ihnen nur allgemeingehaltene Befehle geben. Über ihr persönliches Tun und Lassen, über das Betragen der Mannschaft usw. hatte er keinerlei Befehlsgewalt und war nicht dafür verantwortlich. Er konnte ihnen hierin nur seine Wünsche übermitteln lassen, die jedoch keineswegs immer befolgt wurden, was häufig zu Reibungen führte. Dies zeigte sich schon in Soest, wo Fleckenstein von Westfalen eine Kontribution verlangte und auf die Vorweisung des Vertrages mit Christian rund heraus antwortete, der Herzog hätte ihm nichts zu kommandieren.58
Von Soest aus begab sich Fleckenstein nach Bielefeld, wo er sich vom 25. bis 31. I. aufhielt.59 Dann reiste er über Lippstadt, von wo aus er am 23. I. die westfälischen Stände wegen Nichtabfindung bedrohte, nach dem Haag, die Werbung seinem Obristleutnant überlassend.
Übrigens begannen die Werbungen keineswegs erst mit dem Erscheinen des Obersten. Sofort nach Unterzeichnung der Reverse wurden Rittmeister und Subalternoffiziere zwecks Vornahme erster Werbungen ausgeschickt, so daß bei Eintreffen der Regimentsführer die einzelnen Kompagnien, wenn auch noch nicht komplett, vorhanden waren; und zwar ging die Löwensteirische Werbung in Mecklenburg und Pommern vor sich, die Fleckensteinsche in Hessen und Ravensberg mit angrenzenden Gebieten, die Carpzosche im Ansbachischen und bei Nürnberg sowie im Stift Bremen, Fürstentum Holstein und teilweise gemeinsam mit den eben Genannten.
Auch in Holland wurde geworben.60 Opel zitiert einen Bericht61 des Obersten Sebastian v. Kötteritzsch, der damals in Cassel seiner rheumatischen Beschwerden halber die Kur gebrauchte, über den Herzog von Braunschweig. Er lautet wörtlich: „Sonstet Füehret dießer von Braunschweygk ein Seltzam Leben, vndt Wunderlich Kriegesregiernendt, spricht Cehoffa führe Ihn, vndt Sey ein abgesagter feindt der geystlichen, mit vorgeben, wehr Pfaffen vorderben will, der mus Solches durch Pfaffen thun, deren ehr dan einer Sey, Ehr hatt Wunderliche haabe, von Befehllichshabern, vndt Reuttern, darunter Sehr wenigk von Adell, oder andern So Etwas zue verliehren haben, Seinne Rittmeysters Seindt mihr mehrentheylls Bekandt, Es Ist fast Keines Sein Vermügen J 000 tall. werth, dießes Volck drauhen dem Evßfellde, der Stadt Erfurth, vndt andern Benachbarten Stifftern, So Ewer Churß. Cn. grentzen nahe liegen, Sehr hartt, Wargiren der Manßfelder werde mit Seiner Armada Bey sie, oder sie zue Ihme stoßen, wie dan vohr wenigk tagen, Ein F reyherr von Fleckenstein zue Cassell angelanget, der Soll 1000 Pferde vohr den Margkgraffen von Baden werben.“
Schon an sich sind diese Berichte ähnlich wie die des Obersten v. Schwalbach aus Gießen mit großer Vorsicht aufzunehmen. Tapferkeit drückte jedenfalls die beiden genannten Offiziere nicht sehr stark. So fanden sie stets neue Ausflüchte merkwürdigster Art, wenn ihnen die ganz unzweideutigen Befehle des Kriegsherrn zugingen, sich wieder bei der Armee einzufinden. Auch im Mai, als eine Waffenentscheidung mit Christian drohte, erschienen sie nicht. Einmal waren sie krank, ein andermal war die Frau schwanger,62 ein drittes Mal behauptete Schwalbach, Gießen nicht verlassen zu können; jedenfalls war das Endresultat, daß sie bei ihrer Drückebergerei verharrten. Dafür aber suchten sie sich beim Kurfürsten durch wichtige Meldungen beliebt und auf ihren Posten nützlich zu machen. So findet man häufig in ihren Berichten die Nachrichten sensationell aufgebauscht. Die oben zitierten Worte kann der Herzog natürlich in seiner drastischen Art gesagt haben. Doch habe ich sie sonst nirgends gefunden, und als historischer Beleg ist dieser Brief des Casseler Obersten, der vom Schauplatz der Ereignisse weit entfernt war und über keinerlei offizielle Verbindungen verfügte, nicht anzusehen. Landgraf Moritz ließ ihm sehr auf die Finger sehen und hatte ihm sogar eine Zeitlang den Aufenthalt in der Stadt verboten, so daß er sich versteckt halten mußte. Daß der größte Teil der Christianschen Rittmeister ihm bekannt war, scheint auch nicht zu stimmen. Der Nachsatz beweist dies jedenfalls. Es waren viele Adlige unter ihnen, und viele von ihnen waren auch wohlhabend. So war Obrltn. v. Styrum in Holland sehr begütert und hatte es keineswegs nötig, aus finanziellen Rücksichten am Kriege teilzunehmen.
Rittm. Nell besaß ein größeres Haus in Höxter. Die Rittmeister v. Boyneburg und v. d. Malsburg waren beide aus wohlhabenden Familien. An adligen Namen will ich nur v. Haefften, Quad v. Wickradt, v. Neuhof, v. Bardeleben, v. Hatzfeld, v. Cölln, v. Lesch, v. Hodenberg, v. d. Sachsen, Jason v. Overfest, v. Wietersheim, v. Kerssenbrock, v. Haxthausen, v. Mengersen, v. Zerven, v. Eschwey, v. Stockhausen, v. d. Lippe, v. Keudell unter vielen anderen nennen, so daß hiermit diese Bemerkung wohl ad absurdum geführt sein dürfte.
Besetzung von Stadt und Stift Paderborn
Nach der Einnahme von Soest begann man im braunschweigischen Lager an die Besetzung von Paderborn zu denken; verschiedene Gründe dürften hierzu maßgebend gewesen sein. Es war an sich schon eine Gefahr für den Herzog, die feste Hauptstadt des sonst von ihm besetzten Landes nicht in seiner Hand zu haben. Die darin liegende, mehrere hundert Mann starke feindliche Besatzung des kölnischen Regts. z. F. Landsberg unter den Hauptleuten Mahler und Esdevierde63 konnte vor allem nach Eintreffen einer feindlichen Armee, die in nächster Zeit unausbleiblich erscheinen mußte, dem braunschweigischen Heere sehr gefährlich werden. Ebenso waren die in der Stadt befindliche feindliche Regierung, die katholische Geistlichkeit und das Jesuitenkollegium gefährliche Spionagezentralen. Daneben hatte sich das Land nur mit einer ungenügenden Summe, oder wie Opel64 behauptet, zuletzt doch nicht mit dem Herzog abgefunden. Außerdem wurde der Halberstädter65 durch die protestantischen Einwohner der Stadt geradezu um deren Besetzung gebeten.
Bis zum 26. I. scheint man sich in Paderborn über den drohenden braunschweigischen Anmarsch noch nicht im klaren gewesen zu sein, wie aus dem letzten Bericht der dortigen Regierung nach Köln am genannten Tage hervorgeht.66 An diesem Tage setzte dann die Flucht des größten Teils der Regierungsmitglieder und der Geistlichkeit ein, die zum Teil (nach Opel) durch die protestantische Einwohnermehrheit zu verhindern gesucht wurde. Herzog Christian muß Nachricht von feindlichen Handlungen einiger Flüchtiger gehabt haben, so daß z. B. hinter dem Domdechanten ein Verfolgungskommando unter Generalbrandmeister David nachgeschickt wurde, vor dem der Verfolgte nur mit Mühe seine Person durch rasche Flucht über die Weser bei Vlotho in Sicherheit bringen konnte, während seine Kutsche mit Pferden und Zubehör sowie einiges bares Geld dem Generalbrandmeister in die Hände fiel. Entgegen anderen Nachrichten berichtete Vogt Rudolph Krecke,67 daß sich das Verfolgungskommando gut betragen und nur den Dechanten gesucht habe. Ein anderer Bericht1) spricht auch nur von einer Geringfügigkeit: einem einzelnen Mann seien anscheinend nach Mißhelligkeiten Kleider genommen worden; nach einem Mindenschen Regierungsbericht vom 17. 1. 162268 aus Petershagen sollen zwei Vögte an der Weser je eine geringe Summe (18 Rtlr.) an die Soldaten wegen Beherbergung des Dechanten haben zahlen müssen. Sonst wird nichts weiter erwähnt. Auf die Einbringung des Domdechanten wurde dann vom Herzog eine Belohnung von 10 000 Tlrn. und 1000 gfl. ausgesetzt. Es muß gegen ihn etwas ganz Besonderes vorgelegen haben, was beispielsweise auch aus der Kölner Meldung vom 14. II.69 hervorgeht, wonach die Güter des Dechanten von denen seines Bruders getrennt und preisgegeben wurden.
In Paderborn war Kanzler Wippermann verblieben, der noch weiterhin den vergeblichen Versuch machte, die Übergabe der Stadt abzuwenden. Ein braunschweigisches Truppenkontingent wurde allerdings noch abgewiesen, am 29. I. wurde aber nachmittags um 3 Uhr eine Kompagnie z. F. unter v. Neuhof, am folgenden Tage Rittm. Pflug mit seiner Kompagnie eingelassen.70 Die kölnische Besatzung zog nach Dringenberg ab und wurde dort kassiert. Die Mannschaft trat teilweise in braunschweigische Dienste. Am 31. I. gegen Abend hielt der Herzog seinen Einzug71 und nahm sein Quartier im Jesuitenkolleg. Den Ordensmitgliedern gegenüber zeigte er sich entgegen allen früher verbreiteten Drohungen sehr freundlich, obwohl sie sich nicht mit Geld loskaufen wollten. So heißt es in einem Schreiben aus Warburg vom6. II.,72 daß der Herzog den zurückgebliebenen patribus nichts „leidts thutt, besondern die Musica fleissigh brauchen mussen“.
Nun mußte die Geistlichkeit das hergeben, was sie früher verweigert hatte. Das Silber aus der bischöflichen Residenz und dem Dom wanderte ins Jesuitenkolleg und später in die herzogliche Münze nach Lippstadt. Daraus wurden die Pfaffentaler geprägt, so genannt nach der Inschrift „Gottes Freund der Pfaffen Feind“.73 Unter den im Dom erbeuteten Dingen befand sich ein vergrabener Schatz, den die Kölner Berichte74 auf 100.000 Rtlr. veranschlagen. Ferner der silberne Sarg des heiligen Liborius, der mit den in Metall getriebenen Statuen der zwölf Apostel geschmückt war. Hierbei soll sich auch die bekannte, schon bei der Charakteristik des Herzogs erwähnte Anekdote abgespielt haben.75 Wenn sich, wie Opel und Weskamp berichten, die Reiter zum Spaß mit kirchlichen Gewändern geschmückt haben sollen, so geschah dies jedenfalls gegen den Willen des Herzogs, der, wie Weskamp selbst berichtet,76





























