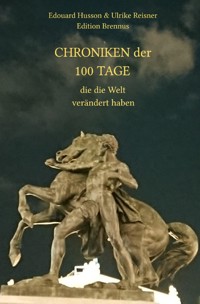
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Konfrontation zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und dem demokratischen Establishment im Zuge des US-Wahlkampfes war eng mit den aktuellen Konflikten in der Welt verknüpft. Was in der Ukraine und in Gaza geschieht, hängt zum Teil von den Entscheidungen ab, die in Washington von einer geschwächten demokratischen Regierung getroffen wurden. Und umgekehrt wirkte die Entwicklung der Konflikte auf die Präsidentschaftswahlen zurück. Es stand daher mehr auf dem Spiel als die Frage, ob Donald Trump oder Kamala Harris die Nachfolge von Joseph Biden antreten würde. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine erleben wir, wie der euro-atlantische Unilateralismus vom Rest der Welt in Frage gestellt wird. Der Gaza-Konflikt hat diese Tendenz noch verschärft. Einige sagen, dass ein neuer Kalter Krieg begonnen hat. Andere befürchten eine nicht beherrschbare Eskalation zwischen dem "Westen" und dem "Globalen Süden". Wir am Institut Brennus sind eher der Ansicht, dass eine neue, multipolare Welt entsteht, in der die USA Kompromisse eingehen müssen. Und in der die europäischen Nationen ihren Platz finden müssen, indem sie sich von den USA distanzieren - um nicht von der Neuordnung der Welt ausgeschlossen zu werden. Das wird schwierig sein, weil weder Washington noch London, Paris oder Berlin derzeit bereit sind, das neue strategische, wirtschaftliche und politische Kräfteverhältnis zwischen den G7 und den BRICS-Staaten zu akzeptieren. Wenn Sie entschlüsseln wollen, was vor sich geht, gehen Sie mit uns an Bord. Die "Chroniken der 100 Tage, die die Welt verändert haben" zeichnen die Wochen bis zu den US-Wahlen nach, die zu den dramatischsten der zeitgenössischen Geschichte gehören.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort von Edouard Husson
Prolog
1. Washington plante eine Offensive auf Kursk, um die Kontrolle über das westliche Narrativ zurückzugewinnen
2. Die Ereignisse in Bangladesch: Eine "Farbrevolution", um das chinesische "One Belt One Road"-Projekt zu sabotieren?
3. Punkt ohne Rückkehr? Israel und die Ukraine verfügen nicht mehr über den Hebel der Verhandlungen, um die laufenden Kriege zu beenden…
4. Irans Strategie zur Vermeidung des Krieges, den Benjamin Netanjahu sucht
5. Ukraine: Auf dem Weg zur endgültigen Explosion?
6. Das Shanghai-Ranking der Universitäten und die Macht der Nationen
7. Eintauchen in das Herz der mühsamen Reindustrialisierung der USA
8. Die ukrainische Armee und die neue Schlacht um Kursk: Die Strategie, die zu nichts führt…
9. Kann Großbritannien aufgrund seines Engagements in ukrainischen Schulden bankrottgehen?
10. An die Tastatur: Der Untergang von Mike Lynchs Yacht ist ein gutes Thema für einen „Thriller“...
11. Die Machthaber in Washington stehen vor einem Problem…
12. Russlands langsame Strategie in der Ukraine: Militärische Mängel oder bewusster Plan?
13. China setzt darauf, dass Russland ihm hilft, den Druck der USA zu neutralisieren
14. Ukraine: Eskalieren oder verhandeln? Das Dilemma des Westens
15. Ukraine: Warum es schwierig ist, die Bedingungen für Verhandlungen zwischen den USA und Russland zu schaffen
16. Die Auswirkungen eines Abschusses einer oder mehrerer Hyperschallraketen durch den kämpfenden Jemen (Ansar Allah) auf Israel
17. Gerhard Schröder bleibt dabei: Frankreich und Deutschland müssen mit Russland verhandeln
18. Die gegensätzlichen Strategien Israels und der Hisbollah begrenzen die militärische Eskalation
19. Wer hat die USA während der Amtszeit von Joseph Biden wirklich regiert? (der ukrainische Fall)
20. Wladimir Putin schlägt eine neue Doktrin der russischen nuklearen Abschreckung vor, um einen neuen Ukraine-Krieg zu verhindern
21. Unfähig, Netanjahu ihren Willen aufzuzwingen, hat die Biden-Regierung Wladimir Putin um Hilfe im Nahen Osten gebeten
22. Ist der Iran in den letzten Monaten zu einer Atommacht geworden?
23. Warum hat Friedrich Merz, der deutsche Oppositionsführer, „Putin den Krieg erklärt“?
24. Kazan 2024: Die BRICS-Staaten werden die Welt mit oder ohne die „westlichen“ Länder neu ordnen
25. Hat sich das amerikanische Establishment mit einem Sieg von Donald Trump abgefunden?
26. Wird Trump einen Platz für „sein Amerika“ in der neuen polyzentrischen Welt finden können?
Epilog
Quellennachweis
Impressum
Texte: © Institut Brennus
Umschlaggestaltung: © Institut Brennus (Darstellung: Bronzestatue „Rossbändiger“ von Josef Lax, 1899, Standort: Wien, Parlament; Foto: Ulrike Reisner)
Edition:
Institut Brennus
Edouard Husson, Ulrike Reisner
c/o 3, Rue Crébillon, Paris, Ile-de-France 75006, FR
Mail : [email protected]
Webseite: https://www.institut-brennus.com
Vertrieb:
epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Vorwort von Edouard Husson
Laufende Ereignisse zu entschlüsseln: Das ist eine beträchtliche Herausforderung für jeden Analytiker. Als ausgebildeter Historiker kenne ich den Unterschied zwischen der Beobachtung eines in der Vergangenheit eingefrorenen, unbeweglich gewordenen Objekts und der Geschichte, die gerade gemacht wird.
Der berühmte Ausspruch Churchills, der selbst ein Akteur der Geschichte war, ist bekannt: „Ein guter Politiker ist derjenige, der die Zukunft vorhersagen kann und dann auch in der Lage ist, zu erklären, warum die Dinge nicht so gekommen sind, wie er es vorhergesagt hat“. Man hat es sogar verallgemeinert: „Die Vorhersage ist eine schwierige Kunst, besonders wenn sie die Zukunft betrifft“.
Nehmen wir die Wiederaufnahme des Syrienkriegs nach einem Waffenstillstand und den plötzlichen Zusammenbruch des Assad-Regimes. Alle Analysten, denen ich folge, um meine eigene Informationsverarbeitung zu nuancieren, haben ihre Überraschung zugegeben. Simplicius, Pepe Escobar, Julian MacFarlane und mehrere andere: Wenn ich die Kühnheit besitze, mich in die Gruppe dieser Freigeister einzureihen, werde ich sagen, dass wir die Stärke Syriens nach 2019 wohl überschätzt hatten.
In den letzten zehn Tagen gab es zahlreiche Hypothesen: Für die einen war es Syrien, das seine Partner im Stich gelassen hat; für andere war es der Iran; für wieder andere war es Russland. Wenn es darum geht, das Ausmaß des Umbruchs zu messen, werden viele Fragen aufgeworfen: Handelt es sich um einen israelischen Sieg? Und wenn ja, welcher Art ist er? Handelt es sich um einen überwältigenden Erfolg oder um einen Pyrrhussieg? Darüber hinaus haben Ulrike Reisner und ich uns gefragt, inwieweit die Ereignisse in Syrien die eine oder andere Schlussfolgerung dieser Chroniken in Frage stellen könnten.
Tatsächlich scheint es uns, dass die dramatischen Ereignisse in Syrien in einer größeren Perspektive zu sehen sind, die genau diejenige ist, die in diesen Chroniken der 100 Tage, die die Welt verändert haben, dargelegt wird.
In der gegenwärtigen Phase muss man immer die Wahl von Donald Trump im Hinterkopf behalten. Und man muss verstehen, dass das amerikanische Establishment eigentlich seit Anfang des Jahres wusste, dass sie unausweichlich war - es sei denn, es kam zu einem gewaltsamen Umsturz wie der Ermordung des ehemaligen Präsidenten, der jedoch beiden Anschlägen auf ihn entging. Das amerikanische Establishment fragte sich, ob es möglich sei, die Bedingungen für einen Konflikt zu schaffen, der Donald Trump daran hindert, die USA von ihrer imperialen Politik abzukoppeln, wenn es nicht gelingt, den Kandidaten physisch zu beseitigen.
Und das ist zum großen Teil das Thema der vorangehenden Chroniken: die Farbenrevolution in Bangladesch, die Kursk-Offensive, die Versuche, das Recht zu erhalten, Russland mit Raketen vom Typ ATACMS tief zu treffen, Benjamin Netanjahus zunehmende Provokationen gegenüber dem Iran, der versuchte „Maidan-Putsch“ in Georgien, die Annullierung der Volksabstimmung bei den Präsidentschaftswahlen in Rumänien und mehrere andere aktuelle Ereignisse zeichnen das Bild einer westlichen herrschenden Klasse, die bereit ist, die Provokation auf die Spitze zu treiben, solange der US-Präsident Nummer 45/47 nicht in Ruhe eine Politik der Konfliktentflechtung betreiben kann.
Die jüngste und wenig beachtete Episode eines Putschversuchs des Präsidenten gegen das Parlament in Südkorea folgt derselben Logik:
Am 3. Dezember putschte der Präsident Südkoreas, Yoon Suk Yeol, gegen die von der Opposition geführte Nationalversammlung. Er verhängte das Kriegsrecht und befahl Sondereinheiten der Armee und der Polizei, die Gesetzgeber an der Versammlung zu hindern.
Doch die Mitglieder der Versammlung gewannen das Rennen:
Nur 150 Minuten nach der Ankündigung des Präsidenten stimmten 191 der 300 Mitglieder der Nationalversammlung für die sofortige Aufhebung des Kriegsrechts. Truppen und Polizei drangen in das Parlament ein, aber die Abstimmung gegen das Kriegsrecht hatte bereits stattgefunden.
Seitdem ist viel passiert. Präsident Yoons Verteidigungsminister und Schulfreund Kim Yong-hyun wurde verhaftet, weil er das Kriegsrecht initiiert und sich daran beteiligt haben soll:
Kim wurde beschuldigt, Yoon das Kriegsrecht empfohlen und Truppen zur Nationalversammlung geschickt zu haben, um die Gesetzgeber an der Abstimmung zu hindern. Eine ausreichende Anzahl von Gesetzgebern verschaffte sich schließlich Zutritt zu einer Kammer des Parlaments und lehnte Yoons Dekret einstimmig ab, wodurch das Kabinett gezwungen war, es vor Sonnenaufgang am 4. Dezember aufzuheben.
Seitdem hat Kim einen Selbstmordversuch unternommen.
Einige der Militärkommandeure, die den Befehl zur Verhängung des Kriegsrechts erhalten hatten, sprachen seither mit den Ermittlern. Sie enthüllten, dass das geplante Kriegsrecht Teil eines größeren, noch verrückteren Plans war, der zu einem Krieg mit Nordkorea hätte führen können:
Der ursprüngliche Plan des Verteidigungsministers bestand darin, einen Angriff Nordkoreas zu provozieren und diesen als Vorwand zu nutzen, um das Kriegsrecht zu verhängen. Zu diesem Zweck ließ die südkoreanische Armee mehrere Drohnen über dem Himmel über Pjöngjang fliegen und verstreute Propagandaflugblätter. Nordkorea griff jedoch nicht an.
...
Die ersten Vorbereitungen für den Putsch begannen bereits im Juli 2023, da die Armee zu dieser Zeit die Referenzdokumente für Operationen unter Kriegsrecht zusammenstellte und ein Handbuch produzierte.
Ukraine, Schwarzmeerküste, Naher Osten, indischer Subkontinent, Ferner Osten: Alle Kriege und Putschversuche, von denen wir sprechen, finden entlang der geopolitischen Linie statt, die Halford Mackinder vor 120 Jahren gezogen hat. Zitieren wir einen weiteren unserer Lieblingsgefährten in der Analyse, Alex Krainer:
Die heutigen Kriege werden von der westlichen imperialen Oligarchie geführt, die bestrebt ist, ihre Vorherrschaft aufrechtzuerhalten und ihre „regelbasierte“ Weltordnung durchzusetzen. Das zentrale Element ihrer Agenda ist das übergeordnete Gebot, ihre Hegemonie über die eurasische Landmasse zu bewahren. Diese seit langem bestehende Besessenheit hat ihre Wurzeln im Britischen Empire. Sie wurde Anfang des letzten Jahrhunderts von dem britischen Gelehrten und Staatsmann Sir Halford Mackinder explizit formuliert.
Nach einem eingehenden Studium der Weltgeschichte und -geografie veröffentlichte Mackinder 1904 einen grundlegenden Artikel mit dem Titel „The Geographical Pivot of History“ (Der geografische Drehpunk der Geschichte), in dem er behauptete, dass die ausschließliche Betonung der Seemacht durch das Empire falsch sei und das Schicksal der Welt von den Landmächten geformt werde. Mackinder stellte die Hypothese auf, dass die langfristige Lebensfähigkeit von Staaten daher vor allem von ihrem Raum und ihrem Standort abhängt, und kam zu dem Schluss, dass die optimalen Raum- und Standortbedingungen nur in den inneren Regionen Eurasiens zu finden sind, die er als Pivot-Zone bezeichnete: ein riesiges Gebiet, das grob gesagt Russland, den Kaukasus, Kasachstan, den Iran und Afghanistan umfasst.
Nach Mackinders Auffassung ist die Pivotzone vom Inneren Halbmond oder Randhalbmond umgeben, der Europa, Nordafrika, Kleinasien, die arabische Halbinsel, Indien, China und Japan umfasst, während die Länder des Äußeren Halbmonds oder Inselhalbmonds den Rest der Welt einschließen. Für Mackinder und die britische Imperialkabale war die Pivotzone strategisch wichtig, da sie in der Lage war, als unabhängige und lebensfähige Wirtschaftsmacht aufzutreten, die ein mächtiges rivalisierendes Imperium hervorbringen konnte.
Die Einführung der transsibirischen Eisenbahn im Jahr 1904, welche die durch die Eisenbahn ermöglichte Verbesserung der Kommunikation und des internen Transports in der Region erleichterte, galt als wichtiger Katalysator für diese Entwicklung sowie als Grund zur Sorge für die imperiale Kabale in London.
Russland wurde als die Nation angesehen, die am ehesten als zentrale Landmacht entstehen würde. Mackinder schreibt dazu wie folgt:
„Die Räume innerhalb des Russischen Reiches und der Mongolei sind so groß und ihre Potenziale in Bezug auf Bevölkerung, Weizen, Baumwolle, Treibstoff und Metalle so unermesslich, dass es unvermeidlich ist, dass sich eine riesige, mehr oder weniger getrennte Wirtschaftswelt entwickelt, die für den ozeanischen Handel unzugänglich ist... In der Welt im Allgemeinen nimmt [Russland] die zentrale strategische Position ein, die Deutschland in Europa innehat. Es kann aus allen Richtungen zuschlagen, außer aus dem Norden. Die vollständige Entwicklung seiner modernen Eisenbahnmobilität ist nur eine Frage der Zeit... Die Umkehrung des Kräftegleichgewichts zugunsten des Pivot-Staates, die seine Expansion in die Randgebiete Europas und Asiens nach sich zieht, würde die Nutzung riesiger kontinentaler Ressourcen für den Flottenbau ermöglichen, und das Weltreich wäre dann in Sicht. Dies könnte eintreten, wenn Deutschland sich mit Russland verbündet“.
Das Britische Empire betrachtete dies als eine existenzielle Bedrohung, die neutralisiert und vernichtet werden müsse. Mackinder schlägt eine Lösung für diese Herausforderung vor, die das Jahrhundert der britischen Geopolitik vorwegnimmt:
„Die Bedrohung durch ein solches Ereignis sollte daher Frankreich in ein Bündnis mit den Überseemächten werfen, und Frankreich, Italien, Ägypten, Indien und Korea würden zu Brückenköpfen, an denen die Außenmarinen Armeen unterstützen würden, um die Pivot-Verbündeten zum Einsatz von Landstreitkräften zu zwingen und sie daran zu hindern, ihre gesamte Kraft auf Flotten zu konzentrieren.
Russland mit einem Krisenbogen umgeben
Der Krisenbogen des Imperiums: Im Klartext schlug Mackinder vor, die Pivotzone mit einer wachsenden Zahl von Krisenherden zu umgeben und Nationen wie Frankreich, Italien, Ägypten, Indien und Korea dazu zu bringen, die Pivotmacht (Russland) in eine ununterbrochene Reihe von zermürbenden und lähmenden Sumpfgebieten zu locken. Seine Vorschläge wurden sehr ernst genommen und bestimmen seither die Außenpolitik des westlichen Imperiums.
In den folgenden Jahrzehnten veränderte sich die genaue Geografie der designierten Stützpunkte aufgrund der sich wandelnden geopolitischen Möglichkeiten ein wenig, und auch Mackinders Sprache und Ideen entwickelten sich weiter. So veröffentlichte er beispielsweise 1919 den Artikel „Democratic Ideals and Reality“, in dem er die Pivotzone in „Heartland“ umbenannte und ihre Bedeutung verdeutlichte: „Wer Osteuropa regiert, regiert das Heartland; wer das Heartland regiert, regiert die Weltinsel; wer die Weltinsel regiert, kontrolliert die Welt.“
Heute sind die Ukraine und Syrien (zusammen mit Israel) Teil des „Rimlands“ oder „Krisenbogens“, den das Imperium vom Mittelmeer bis Korea angelegt hat, um Russland und seine verbündeten Mächte ständig im Krieg zu halten. Die Schwächung dieser Schlüsselmächte und die Verhinderung der Entstehung eines rivalisierenden Imperiums auf dem eurasischen Kontinent ist für die westliche Oligarchie ein absolutes Muss. Sie wird dieses Ziel sogar um den Preis eines Atomkriegs gegen Russland verfolgen.
Unter Berücksichtigung dieses globalen Kontexts könnte es aus russischer Sicht sinnvoll sein, das Imperium in seinen letzten Sumpf in Syrien zu ziehen. Schließlich hat der Westen die Sowjetunion in den 1980er Jahren auf diese Weise zerstört: nicht durch einen Frontalkrieg, sondern indem er die UdSSR in einen Sumpf in Afghanistan hineinzog. Es handelte sich um einen intelligenten Schachzug, der jedoch keine Hexerei war. Und es funktionierte.
Der glänzende Sieg, den der Westen derzeit feiert, könnte sogar die Panik des herrschenden Establishments beruhigen, genug, um die Finger von den nuklearen Abzügen zu nehmen und Ressourcen in Syrien anzuhäufen, um den unerwarteten Preis zu sichern und zu verteidigen. Doch wenn die Vergangenheit ein Prolog ist, haben sie nur einen Pyrrhussieg errungen und den Krieg bereits verloren. Die Bilanz der klugen Pläne und schmutzigen Tricks des Westens ist sehr kohärent und vorhersehbar.
15. Dezember 2024
Prolog
Kaum ein anderes Ereignis hat hierzulande die politische Debatte 2024 so dominiert wie die Präsidentschaftswahlen in den USA. Der 5. November stellte für die Länder der „westlichen Hemisphäre“ einen Kulminationspunkt dar. Es ging nicht nur um die Konfrontation zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und dem demokratischen Establishment, vertreten durch die Vizepräsidentin Kamala Harris. Spätestens seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine erleben wir, wie der euro-atlantische Unilateralismus vom Rest der Welt in Frage gestellt wird. Der Gaza-Konflikt hat diese Tendenz noch verschärft. Manche sagen, dass ein neuer Kalter Krieg begonnen hat.
Wir wissen heute, dass Donald Trump diese Wahl gewonnen hat. Wir wissen allerdings nicht, wie sich diese Wahl auswirken wird, beispielsweise auf den Krieg in der Ukraine und auf Europa.
Erinnern wir uns an das bekannte Bild aus der griechischen Mythologie: nachdem die Griechen viele Jahre lang die Stadt Troja erfolglos belagert hatten, griffen sie zu einer List. Ein riesiges Holzpferd wurde den Trojanern als Geschenk präsentiert, während sich die Griechen vermeintlich geschlagen gaben und sich zurückzogen. Wie wir wissen, saßen im Bauch des Holzpferdes griechische Krieger. Nachdem die Trojaner das Pferd in die Stadt gezogen hatten, verließen diese Krieger im Schutz der Dunkelheit ihr hölzernes Versteck und öffneten ihren Kameraden die Tore. Troja ging in Flammen auf…
Und nun ein Gedankenspiel: stellen wir uns vor, die Griechen von heute wären die Amerikaner und Europa das „belagerte“ Troja kurz vor dem Fall. Sehen wir, dass sich die Amerikaner auf das Meer zurückziehen? Steht ein Pferd in Europa? Und wenn ja, wo? In der Ukraine? Oder gar in Brüssel? Und welche amerikanischen Interessen sind im Bauch des Pferdes versteckt? Lassen wir Europäer uns durch das Geschenk blenden? Oder sind wir gewappnet, weil wir damit rechnen, dass das eigentliche Ziel in einem „gefallenen Europa“ besteht? Sehen wir uns die Bronzeskulptur auf dem Titel unseres Buches an: sind wir in der Lage, dieses „Pferd zu bändigen“?
Das Ende einer Ära
Der Fall des Eisernen Vorhangs vor 35 Jahren hat eine Ära der Hegemonie durch die USA einleitet. Diese Ära geht nunmehr zweifellos zu Ende. Am Institut Brennus tendieren wir zu der Ansicht, dass wir Zeitzeugen der Bildung einer neuen, multipolaren Weltordnung sind, in der die USA Kompromisse einzugehen haben. Für die europäischen Nationen bedeutet das, auch sie werden ihren Platz finden müssen, um bei der Neuordnung der Welt nicht an den Rand gedrängt zu werden.
Wir sehen auch, dass in unserer globalisierten Welt Ursachen und Wirkungen parallel weit über geografische Räume hinweg mannigfaltig vernetzt sind. Politische Entscheidungen in einer Weltregion wirken auf Entwicklungen in anderen Regionen und umgekehrt. Was in der Ukraine und in Gaza geschieht, hing zuletzt maßgeblich von Entscheidungen ab, die in Washington von einer geschwächten demokratischen Regierung getroffen wurden. Umgekehrt hat sich die Entwicklung dieser Konflikte auf die US-Präsidentschaftswahl ausgewirkt – jedenfalls mittelbar.
Es besteht kein Zweifel: Die Welt befindet sich in einem Paradigmenwechsel, wie es ihn seit dem Fall der Berliner Mauer nicht mehr gegeben hat. Das Muster der westlichen Vormachtstellung hat sich überholt. In Europa sind viele Entscheidungsträger in der Defensive: der Aufstieg Asiens, die wachsende Rolle der BRICS-Staaten, der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten zwingen dazu, Gewissheiten in Frage zu stellen, auf denen die bisherigen politischen Entscheidungen der NATO und der Europäischen Union beruhten.
Angesichts dieser Realität kann man sich entweder verkrampfen oder überreagieren; man kann darin aber auch eine Chance sehen: das ist die Wahl, die das Institut Brennus trifft.
Bedingt durch den derzeit stattfindenden, tiefgreifenden Wandel bedarf es, wie man so schön sagt, einer Neuorientierung. Die von vielen westlichen Analysten verwendeten Interpretationsschlüssel sind überholt. Allzu oft zielen die Erklärungsmodelle darauf ab, die Realität dem eigenen Wunschbild anzupassen – sofern sie nicht einfach nur darin bestehen, um jeden Preis die Privilegien der alten Weltordnung bewahren zu wollen.
Die „erfolgreiche Globalisierung“ beruhte auf einer Illusion: der Illusion, dass der Rest der Welt langfristig eine „wohlwollende Hegemonie“ des Westens akzeptieren würde. In Wirklichkeit kann kein modernes internationales System auf Dauer funktionieren, ohne den Grundsatz der Selbstbestimmung der Völker zu respektieren; oder ohne die historisch aufgebauten staatlichen Souveränitäten behutsam zu festigen.
In dieser Hinsicht stellt der BRICS-Gipfel in Kazan im Oktober 2024 ebenfalls einen Kulminationspunkt der aktuellen geopolitischen Entwicklung dar: Es ist wichtig, das Gründungsprinzip der BRICS-Staaten zu verstehen, die zu einer „westfälischen Ordnung“ der internationalen Beziehungen zurückkehren wollen, die auf der Achtung der Souveränität der Staaten und der Verbannung von Ideologien aus den internationalen Beziehungen beruht.
Der große geopolitische Umschwung der Gegenwart kann entschlüsselt werden: der „Rest der Welt“ strebt danach, sein Schicksal selbst zu bestimmen und die Angelegenheiten des Planeten mitzubestimmen. Wir stehen am Übergang in eine neue geopolitische Ära, deren Muster wir erst verstehen müssen.
Methoden der Entschlüsselung
Für die politischen Entscheidungsträger in Europa, für seine Bürger, vor allem aber für die Industrie- und Wirtschaftswelt schaffen diese geopolitischen, wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Umwälzungen ein Klima der Unsicherheit, wie man es seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat. Die üblichen Bezugspunkte des Entscheidenden, die Einflussparameter, an die er gewöhnt ist, scheinen nicht mehr zu funktionieren. Die Folge ist, dass es schwierig oder gar unmöglich ist, mittel- bis langfristig zu antizipieren und sogar kurzfristig zu prognostizieren. Für Entscheidungsträger ist es jedoch von eminenter Bedeutung, rechtzeitig reagieren zu können oder, wenn sich dies vermeiden lässt, nicht von den Ereignissen überrascht zu werden.
Die multipolare Welt macht in dem Maße unsicher, wie die Komplexität der Entscheidungen und deren Auswirkungen steigt. Sie erfordert den Umgang mit einer immer größeren Informationsflut, die es zu sortieren und zu verarbeiten gilt.
Viele in der politischen und wirtschaftlichen Praxis verwendeten Analysemethoden und Erklärungsmodelle zielen darauf ab, komplexe Vorgänge und Abläufe zu vereinfachen und sie in Teilfragen zu zerlegen, bis sich daraus ein Verständnis des Sachverhaltes ableiten lässt. Diese Vorgangsweise geht allerdings zwangsweise mit einer Reduktion der Fragestellung auf eine kausale, lineare (eindimensionale) Betrachtung einher. Die starke Konzentration auf Details verstellt den Blick auf große Zusammenhänge und Muster, die es zu identifizieren gilt, um sich Orientierung zu verschaffen. Um es an einem konkreten Beispiel festzumachen: so wie der weitere Verlauf des Ukrainekrieges nicht an der Frage der Waffenlieferungen durch den Westen festgemacht werden kann, hängt die Zukunft der europäischen Wirtschaft nicht (nur) davon ab, ob Donald Trump europäische Exporte in die USA durch weitere Zölle verteuert oder nicht.
Am Institut Brennus beschäftigen wir uns damit, neue Parameter und Bewertungskriterien für Methoden der Entschlüsselung zu identifizieren. Wir verfolgen einen interdisziplinären, geopolitischen Ansatz, der mithilfe eines offenen Schemas verschiedene Perspektiven gegenüberstellt. So identifizieren wir zentrale Fragen und damit verbundene Herausforderungen in einem komplexen Umfeld. Wir entwickeln „große Linien“, die zu einem differenzierten Gesamtbild, einer „Kartografie“ zusammengefügt werden. Diese Kartografie kann Orientierung bieten und es ermöglichen, wichtige Zusammenhänge und kritische Einflussparameter zu identifizieren.
Es ist dieser Ansatz, der die „Chroniken der 100 Tage, die die Welt verändert haben“ maßgeblich bestimmt. Die erste Ausgabe datiert vom 8. August 2024, die letzte vom 9. November 2024. Dazwischen entstanden mehr als 20 Chroniken, die wir in einer französischen, und nun auch in einer deutschen Gesamtausgabe zusammengefasst haben.
Die Schlaglichter, die diese Chroniken auf das Zeitgeschehen der 100 Tage vor der US-Präsidentschaftswahl werfen, sind - im Hinblick auf ihre katalytische Wirkung - natürlich auf die Konfliktherde in der Ukraine und im Nahen Osten gerichtet. Im Sinne der großen Linien, die wir zu Mustern einer Kartografie zusammenführen, haben wir unseren Blick aber auch auf die Umwälzungen der Weltwirtschaft gerichtet. Die Rolle Chinas und Indiens ist – ebenso wie das neue Selbstverständnis Russlands – vor dem Hintergrund der Bildung neuer Allianzen in einer multipolaren Welt zu betrachten. Das Institut Brennus richtet seinen Blick auf die Entstehung neuer Erwerbsräume und die damit zusammenhängenden Verschiebungen in der geopolitischen Tektonik.
Als Chronisten halten wir uns mit Prognosen zurück – auch wenn der Leser zwischen den Zeilen immer wieder Ansätze dieser Art entdecken wird. Wir sehen unsere Aufgabe vielmehr darin, unterschiedliche Perspektiven auf das Weltgeschehen aufzuzeigen. Dafür greifen wir auf Quellen innerhalb und außerhalb Europas zurück und scheuen uns nicht, diese zum Teil auch sehr ausführlich zu zitieren.
Das Große Schachbrett
Es lohnt, an dieser Stelle einen kurzen Blick auf die großen außenpolitischen Leitlinien der geopolitischen Mächte zu werfen. In den Chroniken wird mehrfach auf „The Grand Chessboard“ von Zbigniew Brzeziński verwiesen. Erstmals erschienen 1997 legt Brzeziński in der Tradition Halford Mackinders den Fokus auf die Vereinigten Staaten als „erste, einzige wirkliche und letzte Weltmacht“ nach dem Zerfall der Sowjetunion, die ihre Vorherrschaft auf dem „großen Schachbrett“ Eurasien kurz- und mittelfristig sichern müsste, um so in einer weiteren Zukunft eine mehrpolige Weltordnung möglich zu machen. Knappe 20 Jahre später, im Nachwort der Neuauflage von 2016, sah der Autor den Schlüssel zu einer neuen Ordnung der Weltgemeinschaft in der friedlichen Zusammenarbeit zwischen den USA, China und einem „europäisierten Russland“.
Der außen- und sicherheitspolitische Kurs der USA muss aber immer auch im Lichte der Wolfowitz-Doktrin aus dem Jahr 1992 gesehen werden. Dieses vieldiskutierte und international auch vielkritisierte Konzept stellt den Unilateralismus in den Mittelpunkt. Präemptive, aber auch präventive Militärschläge werden ausdrücklich befürwortet, um eine potenzielle Gefährdung der USA und ihrer Interessen abzuwenden. Länder wie Russland, Deutschland, Japan oder Indien, sollten daran gehindert werden, den USA ihre hegemoniale Stellung streitig zu machen. Vor diesem Hintergrund ist das militärische Einschreiten der USA in Jugoslawien, dem Irak, Afghanistan oder auch in Syrien zu sehen.
China, das Brzeziński 2016 noch von den Vereinigten Staaten friedlich an der Hand genommen sehen wollte, wendet seit gut 20 Jahren allerdings seine eigene Strategie auf dem geopolitischen Schachbrett an. Der „friedliche Aufstieg“ des Reichs der Mitte ist eng mit Zheng Bijian, dem ehemaligen Vizepräsidenten der Zentralen Parteikommission der Kommunistischen Partei Chinas, verbunden. Die Sicherung der Erwerbsräume soll seiner Doktrin zufolge nicht durch Invasion, Kolonisierung, Expansion oder groß angelegte Angriffskriege erfolgen. Der Aufstieg Chinas solle durch Ressourcen ermöglicht werden, die auf friedliche Weise erworben werden. Im Gegensatz zu den USA strebt China keine Hegemonie oder Vorherrschaft in der Weltpolitik an, vielmehr wird die friedliche Natur der chinesischen Außenpolitik bis heute betont.
Dieses Konzept muss eingeblendet werden, um zu verstehen, warum China im Rahmen seiner „One Belt One Road Initiative“ seit 2013 die unfassbare Summe von 1 Billion US-Dollar in Infrastrukturprojekte in fast 150 Ländern investiert – darunter Häfen, Flughäfen, Straßen, Eisenbahnen, Brücken, Dämme, Gas- und Ölpipelines sowie Kraftwerke.
Zwischen den beiden Polen USA und China sucht die Russische Föderation ihre geopolitische Rolle – zuletzt festgeschrieben in der außenpolitischen Doktrin von 2023. Russland strebt ein System internationaler Beziehungen an, das Sicherheit und Entwicklungschancen für alle Staaten garantiert, unabhängig von ihrer geografischen Lage, der Größe ihres Territoriums, ihrer Ressourcen oder ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Struktur. Im Zentrum der von Russland angestrebten „multipolaren Weltordnung“ steht die souveräne Gleichheit der Staaten. Jedwede Form der Hegemonie in internationalen Angelegenheiten wird ebenso abgelehnt wie die Einmischung in innere Angelegenheiten.
Russland sieht es als seine Aufgabe an, „die Überreste der Vorherrschaft der USA und anderer unfreundlicher Staaten in globalen Angelegenheiten zu beseitigen“, was eine dem chinesischen Nachbarn vergleichbare „friedliche Natur“ in der Außen- und Sicherheitspolitik ausschließt. Andererseits setzen die Russen auf eine Stärkung des Völkerrechts und internationaler Organisationen, wie der UNO oder den BRICS, deren kontinuierliche Weiterentwicklung sie als unabdingbar für die neue, multipolare Weltordnung sehen. Der seit zehn Jahren Russland vom Westen gerne unterstellte „Neo-Imperialismus“ oder „Expansionsdrang“ bildet sich in der außenpolitischen Doktrin nicht ab. Besser erklären sich die militärischen Konflikte, die die Russische Föderation begonnen (Ukraine) oder an denen sie sich beteiligt hat (Syrien), mit dem erklärten Kampf gegen US-amerikanische Hegemonialansprüche sowie gegen die von Russland wahrgenommenen Bedrohungen der eigenen territorialen oder staatlichen Integrität.
Die autonome außenpolitische Positionierung EU-Europas ist auf Grund der starken Fokussierung der EU auf die Realisierung des Binnenmarktes lange Zeit vernachlässigt worden. Der Umstand, dass 23 der 27 Mitgliedstaaten NATO-Mitglieder sind, hat dazu beigetragen, dass die „westliche Hemisphäre“ sich seit Jahrzehnten mehr oder weniger der Außen- und Sicherheitspolitik des transatlantischen Bündnispartners USA unterordnet.
Unter dem Eindruck des Irak-Krieges wurden 2003 in der Europäischen Sicherheitsstrategie als Hauptbedrohungen für Europa der Terrorismus, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, regionale Konflikte, gescheiterte Staaten und organisierte Kriminalität identifiziert. 2016 erweiterte man mit der Globalen Strategie die Herausforderungen um die Bereiche Energiesicherheit, Migration, Klimawandel, gewaltbereiter Extremismus und hybride Bedrohungen.
Die Sicherheits- und Verteidigungsaspekte der Globalen Strategie wurden erst unter dem Eindruck des Ukrainekrieges im März 2022 durch den Strategischen Kompass umfassend ergänzt. Die EU vollzog damit – nach eigenen Angaben - einen Paradigmenwechsel und fokussiert sich seither auf Initiativen zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie zur Verteidigungsindustrie. Der Europäischen Kommission folgend nimmt die EU für sich selbst in Anspruch, für Multilateralismus und eine auf Regeln beruhende Weltordnung zu stehen, in der die Europäische Union eine aktivere und größere Rolle spielen soll. Dafür unerlässlich ist nach Ansicht der Kommission eine koordinierte Außenpolitik, die von der Entwicklungshilfe bis zur Verteidigungspolitik reicht.
Das steht in einem erkennbaren Spannungsverhältnis mit den USA, wegen der engen Verzahnung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mit der NATO, die ihrerseits von den USA dominiert ist.
Die Brennus-Kartografie
Wie bereits erwähnt, geht es in den Chroniken darum, große Linien für eine Kartografie nachzuzeichnen und Fragen zu den Zusammenhängen und kritischen Einflussparametern zu stellen:
Wenden wir uns zunächst dem Ukrainekrieg zu, der – ebenso wie der Konflikt im Nahen Osten – auf den folgenden Seiten immer wieder thematisiert wird. Wie soll man die Ereignisse seit 2014 verstehen können, ohne die außenpolitischen Doktrinen der USA und Russlands mit in Betracht zu ziehen? Wie soll man die verteidigungspolitischen Aktivitäten der USA, und damit nachgeordnet auch der NATO, einordnen, ohne sich daran zu erinnern, dass die Wolfowitz-Doktrin von 1992 indirekt eine Spaltung zwischen Europa und Russland ins Visier nimmt, um die hegemoniale Stellung der USA zu sichern? Wir könnte man das Engagement des NATO-Mitglieds, ehemaligen EU-Mitgliedslandes und wichtigsten Verbündeten der USA auf dem europäischen Kontinent, Großbritannien, analysieren, ohne die Kenntnis der Bedeutung der „Politik des Gegenwalls“? Seit Jahrhunderten greifen die Briten immer wieder zu dieser Strategie - dem Vorbild des römischen Hadrianwall -, um ihre eigenen Erwerbsräume abzusichern. Jetzt sieht Großbritannien die „Gefahr“ im Osten und gilt als einer der stärksten Unterstützer der Ukraine im Kampf gegen Russland.
Tatsächlich kann beim Ukrainekrieg, wie bei vielen anderen Konflikten, ein zentrales Muster identifiziert werden: Es geht um die Sicherung von Erwerbsräumen. Wo dies nicht friedlich erfolgt, kommt es zu Auseinandersetzungen. Die Ukraine verfügt nach Norwegen mit über einer Billion Kubikmeter über das zweitgrößte Erdgasvorkommen in Europa (Russland ausgenommen) und eine der größten Steinkohlereserven mit etwa 34 Milliarden Tonnen. Dazu kommen Uranerze, Titanerze, Manganerze, Eisenerze und Quecksilbererze, die zu den größten Vorkommen in Europa, teilweise sogar weltweit zählen. Ein Großteil dieser Bodenschätze liegt im Osten des Landes und damit in den vom Krieg am heftigsten betroffenen Gebieten.
Auch beim Nahost-Konflikt geht es um Fragen der Vorherrschaft und damit verbunden um die Sicherung von Erwerbsräumen. So wie die Ukraine historisch oft Boden für bewaffnete Auseinandersetzungen war, ist das auch im Nahen Osten so. Natürlich handelt es sich im Kern um einen Territorialkonflikt. Die Konfliktparteien, früher Juden gegen Araber, ab 1948 dann Israelis gegen Palästinenser, erheben Anspruch auf das Territorium des ehemaligen britischen Mandatsgebiets Palästina zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer. Israels Souveränität umfasst heute mehr als zwei Drittel dieses Gebietes, den Rest hält es seit 1967 besetzt. Die unterschiedlichen Religionen werden seit langem von beiden Seiten zur Rechtfertigung der Gewalthandlungen instrumentalisiert.
Die israelische Kontrolle wirkt sich hemmend auf die wirtschaftliche Entwicklung in den palästinensischen Gebieten aus. Dazu kommt der Kampf um knappe Ressourcen: Israel bezieht einen Großteil seines Wassers aus gemeinsamen Grundwasserbecken, die sich auch im Westjordanland befinden. Die immer wiederkehrende extreme Wasserknappheit schürt die Konflikte und die Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft über das Territorium.
Geostrategisch nimmt der Nahe Osten eine Schlüsselposition auf den Land- und Seehandelsrouten zwischen Asien und Europa ein. Durch den Suezkanal in Ägypten werden 12 % des weltweiten Seehandels und 60 % des chinesischen Handels mit Europa abgewickelt. Iran, der größte Widersacher Israels in der Region und Promotor der „Achse des Widerstands“ ist mit Teheran ist ein wichtiger Knotenpunkt für den „Nord-Süd-Korridor“, der Indien über den Iran entlang des Kaspischen Meers bis nach Russland und von dort nach Osteuropa verbindet.
Bei der Sicherung von Erwerbsräumen geht es darum, neue Handels- und Bündnispartner zu finden, die ebenfalls in diese Handelsrouten investieren bzw. diese auch sichern wollen und können. Heute werden 90 % der weltweiten industriellen Handelslogistik auf dem Seeweg abgewickelt. Damit werden Meerengen oder Kanäle zu Engstellen, aber auch zu bevorzugten Zielen von bewaffneten Angriffen. In Zeiten der Globalisierung ist die Sicherung der Lieferketten eine vorrangige geopolitische Herausforderung.
In den vergangenen Jahren haben sich die Aktivitäten zur Bildung weltumspannender Handelskorridore vor allem auf dem Landweg verstärkt: der „Nordkorridor“ umfasst Schienenstraßen und Pipelines, die von China nach Kasachstan, Russland und Europa führen. Der weniger entwickelte „Südliche Korridor“ umfasst den Bau durchgehender Schienenstraßen von China nach Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Libanon und möglicherweise bis in die Türkei. Von dort aus kann Europa über Häfen im Libanon und in Syrien oder über Landverbindungen von der Türkei aus erreicht werden. Die „Transkaspische Internationale Transportroute“, auch „Mittlerer Korridor“ genannt, ermöglicht den Schienen- und Seetransit von China über Kirgisistan, Turkmenistan, Aserbaidschan, Armenien, Georgien und die Türkei nach Europa. Dazu kommt der bereits erwähnte Internationale Nord-Süd-Transportkorridor, ein 7.200 km langes Netzwerk aus Schiffs-, Schienen- und Straßenrouten zwischen Indien, Iran, Aserbaidschan, Russland, Zentralasien und Europa.
Über all dem schwebt das langfristige Großprojekt Chinas, „One Belt One Road“, auch „Neue Seidenstraßen“ genannt. Nach dem Vorbild der historischen Routen zwischen China und dem Westen wird mit enormen Investitionen ein Netz an Infrastrukturen errichtet für Transport, Versorgung und Handel.
Und so sei an dieser Stelle genau diese Karte eingeblendet, bevor Sie sich selbst auf die Reise machen und die Chroniken der 100 Tage, die die Welt verändert haben, lesen. Vielleicht blättern Sie immer wieder zurück und werfen einen Blick auf diese Karte, um zu sehen, durch welche Länder und Weltregionen die Handelsrouten der Mächte zur Sicherung der Erwerbsräume verlaufen. Dieser Blick ermöglicht eine eigene Perspektive, einen neuen Fokus auf das Weltgeschehen - abseits tagesaktueller Nachrichten, Kommentare und Versuche, sich für wenige Minuten die Deutungshoheit im digitalen Informationsraum zu sichern.
Globales Infrastruktur-Netzwerk der „Neuen Seidenstraßen“ (Quelle: Mercator Institute for China Studies)
1. Washington plante eine Offensive auf Kursk, um die Kontrolle über das westliche Narrativ zurückzugewinnen
Donnerstag, 8. August 2024
Die ukrainische Armee hat gerade einen Teil ihrer mageren Reserven zusammengezogen, um in der Region Kursk auf russisches Territorium vorzudringen. Und Wolodymyr Selenskyj kündigt, während die ersten F16 in der Ukraine eintreffen, eine Gegenoffensive für den Herbst an. Es ist unerlässlich zu verstehen, dass Washington bei der Planung die Fäden in der Hand hält. Die Demokraten wollen Trump mit einem Sieg - der Übernahme des Kraftwerks Enerhodar (in der Nähe von Saporischschja) - ins Unrecht setzen, bevor sie im Herbst Verhandlungen aufnehmen. Dies ist der Plan. Die Realität sieht viel düsterer aus: Der vorläufige Durchbruch in der Region Kursk ist mit schweren Verlusten verbunden. Die russische Armee rückt in den Donbass vor. Die Desertionen nehmen zu. Die russische Armee fährt systematisch damit fort, westliches Material, das in der Ukraine ankommt, zu zerstören.
Der ukrainische Einfall in die Region Kursk am 6. August 2024 (Quelle: southfront.press)
Der gescheiterte Krieg in der Ukraine wiegt schwer in der Unruhe des demokratischen Lagers in den USA. Laut übereinstimmenden Informationen haben sich die Demokraten mit der Aussicht auf Verhandlungen zur Beendigung des Krieges abgefunden. Sie wollen jedoch nicht öffentlich darüber sprechen, um Donald Trumps Argumentation nicht noch mehr Nahrung zu geben. Im Gegenteil, es muss alles getan werden, um den ehemaligen Präsidenten ins Unrecht zu setzen. Es geht darum, nach einer für die Demokraten siegreichen Wahl zu Verhandlungen zu kommen, bei denen ein Sieg an einem Punkt der Frontlinie dazu führen würde, die Verhandlungsposition zu stärken.
Durchbruch auf russischem Gebiet
Die militärische Situation in der Ukraine am 7. August 2024 (Quelle: southfront.press)
Die Darstellungen, die von der ukrainischen Offensive in der Kursk-Region gemacht werden, sind daher voreingenommen: Zwar kämpft Wolodymyr Selenskyj mit einer schwierigen Situation, aber er tut nichts ohne die Zustimmung Washingtons. Und die Kursk-Operation kann nicht ohne erhebliche logistische Unterstützung durch NATO-Personal und US-amerikanisches Geheimdienstmaterial inszeniert worden sein. Dies umso mehr, als wir uns im Norden befinden, weit entfernt vom Rest der Front:
Was wie ein weiterer Sabotageangriff an der Grenze in der Region Kursk aussah, hat sich zu einer groß angelegten Offensive entwickelt.
Die Kiewer Streitkräfte [griffen] mehrere Grenzpunkte an, indem sie kleine Sturmtrupps einsetzten, um die vorgeschobene russische Verteidigungslinie zu durchbrechen, damit ihre Hauptstreitkräfte eine Offensive entwickeln konnten. Am Morgen des 6. August waren an der ersten ukrainischen Angriffswelle an der Grenze mehr als 30 militärische Ausrüstungsgegenstände, die hauptsächlich von der NATO geliefert wurden, und 300 Soldaten beteiligt.
Nach den ersten Angriffswellen griffen reguläre Streitkräfte und Militärs verschiedener Formationen in die Schlacht ein und drangen trotz schwerer Verluste tief in das russische Hinterland vor.
Die andauernden Kämpfe wurden von massiven Drohnen- und Raketenangriffen sowie Artilleriebeschuss begleitet, was zu erheblichen Schäden an der zivilen Infrastruktur führte. (...)
Die ukrainische Armee setzte starke Luftabwehrkräfte in den Grenzgebieten ein und erschwerte so die Operationen der russischen Flugzeuge. Diese schossen einen russischen Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 ab. Darüber hinaus wurden am 6. August mindestens zwei ukrainische Buk-Raketensysteme zerstört.
Am Ende des ersten Tages der Grenzkämpfe waren die ukrainischen Streitkräfte rund 15 km vorgerückt und hatten etwa ein Dutzend kleinerer Dörfer teilweise eingenommen.
Das ukrainische Militär hat in der Nähe der Grenze Gruppen von mehreren tausend Soldaten angesammelt und verlegt ständig Verstärkungen in die Region. Verschiedenen Schätzungen zufolge könnten sie ihre Operationen noch mehrere Tage lang fortsetzen.
Stadt Kurtschatow (in Rot) und Atomkraftwerk (in Gelb) (Quelle: Simplicius Blog)
Der Plan
In der Nacht vom 6. auf den 7. August zerstörten die russischen Luftabwehrkräfte ukrainische Raketen über der Stadt Kurtschatow, in deren Nähe sich das Kernkraftwerk Kursk befindet.
Das Hauptziel der laufenden Operationen könnte darin bestehen, die Kontrolle über die strategisch wichtigen Einrichtungen in der Region Kursk zu erlangen. Das Kernkraftwerk Kursk befindet sich nur 60 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.
Dort liegt auch die Gasmessstation Sudscha, die der letzte Punkt vor der Durchleitung von russischem Gas durch die Ukraine ist. Kiew weigerte sich kürzlich, den Vertrag über den Transit von russischem Gas durch sein Territorium zu verlängern.
Die amerikanische Planung lässt sich an den Energiezielen ablesen. Ungarn und die Slowakei befinden sich in einem Machtkampf mit Kiew über die Lieferung von russischem Gas. Washington kann die Weigerung der beiden Länder, sich dem Rest der Europäischen Union anzuschließen, um Krieg gegen Russland zu führen, nicht ertragen. Durch die Kontrolle über Sudscha können Budapest und Bratislava unter Druck gesetzt werden.
Selenskyj und der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Syrskyj, planen für den Herbst eine Offensive, um das Atomkraftwerk Enerhodar zurückzuerobern. Simplicius erzählt uns mehr darüber:
Die große Frage, die sich jeder stellt, ist, in welche Richtung diese Offensive gehen wird. Die jüngsten Lecks und Gerüchte legen nahe, dass Syrskyj einen weiteren Großangriff auf das Atomkraftwerk Enerhodar plant.
Das ist absolut vernünftig und eine Richtung, die ich seit letztem Jahr als das einzige praktikable Ziel vorhersage, das die Ukraine verfolgen könnte, um sich irgendeine Form des Sieges auf dem Schlachtfeld zu sichern. Die AFU (Armed Forces of Ukraine, Anm.) hat keine Chance, die russischen Massenkräfte an einer Front, die mit einer echten Tiefenverteidigung ausgestattet ist, zurückzudrängen. Aber das Atomkraftwerk als Teil eines dreisten Plans zur nuklearen Erpressung zu entführen, wäre etwas, das angesichts der Ressourcen, die der Ukraine zur Verfügung stehen, zumindest vage realisierbar wäre.
Die Ukraine steht unter starkem Druck.
Washington und Kiew brauchen zweifellos einen Sieg. Man muss jedoch hinzufügen, dass die Ukraine aufgrund der Zerstörung der Energieinfrastruktur durch Russland unter starkem Druck steht. Ein Angriff auf das Kurtschatow-Kraftwerk oder der Versuch, Enerhodar zurückzuerobern, ist ein Versuch, im "Energiekrieg" zu punkten, in dem Russland derzeit die Oberhand hat.
Nach den gezielten Angriffen auf die Energieversorgung der Ukraine in den letzten Monaten drängt die Zeit:
Mehr als die Hälfte der betroffenen Infrastruktur ist beschädigt. Auch in Kiew gehören stundenlange Stromausfälle mittlerweile zum Alltag. Der Instandsetzungsbedarf wird bereits auf 50,5 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Und Selenskyj freut sich über die Ankunft der F16 in der Ukraine, weil er darin eine weitere Unterstützung für die Umsetzung seines kühnen Plans sieht, mit dem er wieder die Oberhand gewinnen will. Beobachter zweifeln jedoch weiterhin an der ukrainischen Fähigkeit, diese Flugzeuge einzusetzen.
In Wirklichkeit geht es in der unmittelbaren Zukunft vor allem darum, die Aufmerksamkeit von all den Gebieten abzulenken, in denen die russische Armee punktet. Simplicius weist jedoch darauf hin, dass die Amerikaner und die Ukrainer mit doppelten Karten spielen:
Das Risiko hierbei ist, dass die Quellen glauben, dass die Offensive groß sein und alle verbleibenden Reserven der Ukraine gleichzeitig nutzen könnte, da die Führung weiß, dass sie eine letzte Chance hat, Lärm zu machen, da Lieferungen, Finanzierung, Arbeitskräfte usw. nie wieder auf das frühere Niveau zurückkehren werden.
Darüber hinaus betrachtet Selenskyj diese potenzielle Offensive wahrscheinlich als seine letzte Chance, eine günstige Verhandlungsposition zu erreichen. Wenn er die ZNPP (Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, Anm.) übernimmt, glaubt er, dass er, wenn die Verbündeten ihn endlich zu Verhandlungen zwingen, in der Lage sein wird, Aufforderungen zur Landabtretung erfolgreich abzuwehren, und vor allem wird er als Held angesehen werden, was ihm angesichts seiner Illegitimität helfen könnte, einen Sturz zu verhindern. (...) Aber das enorme Risiko für die Ukraine besteht darin, dass, wenn sie sich Hals über Kopf in die Sache stürzt und massiv scheitert, dies angesichts des verheerenden Zustands, in dem sich die UFA bereits befindet, zu einem völligen Zusammenbruch der UFA führen könnte.
Die Kursk-Offensive geht nicht mit einer Aufstockung der Truppen einher: Zwischen Toten und immer mehr Desertionen (sie werden auf 30.000 pro Monat geschätzt) hat die ukrainische Armee Mühe, ihre Truppenstärke dank einer massiven Einberufungskampagne bei etwa 260.000 Mann zu halten. In der Zwischenzeit verfügt Russland über rund 700.000 Soldaten.
Alles in allem findet die von Washington angestrebte Offensive früher statt als von Selenskyj und Syrskyj vorhergesagt. Sie ist in der Regierung und im ukrainischen Oberkommando keineswegs unumstritten. Sie kann nur durch den Abzug von Truppen von anderen Punkten der Front erreicht werden.
Und sie führte zu zahlreichen undichten Stellen in Bezug auf die für diesen Herbst geplante Operation am Kraftwerk Enerhodar in der Region Saporischschja. Das Überraschungsmoment oder zumindest der Unsicherheitseffekt wurde verfehlt.
Der einzige Punkt, in dem die Ukrainer etwas mehr Spielraum als zuvor hatten, war die Möglichkeit, so zu kämpfen, wie sie es können, "auf sowjetische Art", anstatt die Methoden der NATO übernehmen zu müssen (wie es bei der "Gegenoffensive" im Sommer 2023 der Fall war). Dies erklärt den Durchbruch zu Beginn der Woche über gut zehn Kilometer auf russischem Gebiet. Dies wird jedoch nicht ausreichen, um den Verlauf des Konflikts umzukehren und Kandidatin Harris im Rennen um das Weiße Haus zu helfen.
2. Die Ereignisse in Bangladesch: Eine "Farbrevolution", um das chinesische "One Belt One Road"-Projekt zu sabotieren?
Freitag, 9. - Samstag, 10. August 2024
Innerhalb weniger Tage kam es in Bangladesch zu einer regelrechten Revolution. Was mit Studentenprotesten begann, setzte sich fort mit der Flucht der Premierministerin Sheikh Hasina Wajed, der Auflösung des Parlaments und der Rückkehr des Wirtschaftswissenschaftlers Muhammad Yunus, der die Regierung als Interimsregierung übernehmen sollte. Wer würde sich auf den ersten Blick nicht über die scheinbare Demokratisierung des Landes freuen?
Doch der ehemalige indische Diplomat M.K. Bhadrakumar, einer der scharfsinnigsten Analysten des sich vollziehenden geopolitischen Wandels und zweifellos einer der bestinformierten Menschen der Welt, zeichnet ein komplexeres Bild. Der Übergang von den Studentenunruhen zum Regimewechsel war seiner Meinung nach sehr plötzlich und zu glatt, um nicht wie ein von langer Hand geplantes Ereignis auszusehen. Es scheint interessant, die Ereignisse in Bangladesch im Kontext der Versuche der USA zu sehen, Chinas Errichtung der "Neuen Seidenstraßen" zu verhindern.
Seit Monaten verbrachte Melkulangara K. Bhadrakumar, dessen Blog Indian Punchline wir empfehlen, den Großteil seiner Zeit damit, für seine Leser die aktuellen Ereignisse in der Ukraine, im Nahen Osten und im Fernen Osten zu analysieren. Dann brachten ihn die Ereignisse in Bangladesch plötzlich wieder in die Nähe seines Landes, um seine Besorgnis zu bekräftigen. Für diesen besonnenen und bemerkenswert informierten Mann ist Indien nicht ausreichend darauf bedacht, dass die Revolution, die gerade in Dhaka stattgefunden hat, Teil eines größeren geopolitischen Bildes ist. Bhadrakumar geht in einigen Analysen seines Blogs sehr ins Detail, aber um zu verstehen, was er vorhat, sollten wir ein Interview verwenden, das er der Agentur Tass gegeben hat:





























