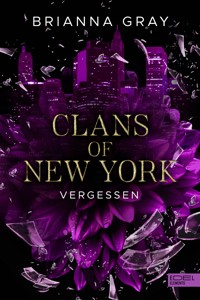
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clans of New York
- Sprache: Deutsch
Obwohl Liliana und Danik ein gut gehütetes Geheimnis miteinander verbindet, lässt Danik sie im Glauben, dass ihre Beziehung einzig seiner Rache an Luca geschuldet ist. Umso schlimmer, dass ausgerechnet Danik längst Lilianas Herz gestohlen hat. Giulio verstrickt sich derweil immer weiter in sein Konstrukt aus Geheimnissen und Lügen, worunter das Verhältnis zu seinen engsten Vertrauten mehr und mehr leidet. Zudem setzt Ekaterinas Schwangerschaft ihm zu und zwingt ihn, sich mit seinen inneren Dämonen auseinanderzusetzen. Während jeder mit sich und seinen Problemen kämpft, bemerkt niemand den neuen Feind, der bereits in der Finsternis lauert und mit seinem ersten Schlag nicht nur einen der Clans trifft …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 717
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Kurzbeschreibung
Obwohl Liliana und Danik ein gut gehütetes Geheimnis miteinander verbindet, lässt Danik sie im Glauben, dass ihre Beziehung einzig seiner Rache an Luca geschuldet ist. Umso schlimmer, dass ausgerechnet Danik längst Lilianas Herz gestohlen hat.Giulio verstrickt sich derweil immer weiter in sein Konstrukt aus Geheimnissen und Lügen, worunter das Verhältnis zu seinen engsten Vertrauten mehr und mehr leidet. Zudem setzt Ekaterinas Schwangerschaft ihm zu und zwingt ihn, sich mit seinen inneren Dämonen auseinanderzusetzen.Während jeder mit sich und seinen Problemen kämpft, bemerkt niemand den neuen Feind, der bereits in der Finsternis lauert und mit seinem ersten Schlag nicht nur einen der Clans trifft …
Brianna Gray
Clans of New York – Vergessen
Band 3
RomanIns Deutsche übertragen von Brianna Gray
Edel Elements
Edel Elements
- ein Verlag der Edel Verlagsgruppe GmbH
© 2023 Edel Verlagsgruppe GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2023 by Brianna Gray
Lektorat: Vera Baschlakow
Korrektorat: Julia Kuhlmann
Covergestaltung: Designomicon, München.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-442-4
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
PROLOG
GIULIO
Ich habe schon viele Schlachtfelder gesehen. Ich habe komplett zerfetzte Menschen gesehen. Tote Körper mit unnatürlich abgespreizten Gliedmaßen. Leblose, verstümmelte Körper, deren Arme und Beine – ja, auch Köpfe und sogar Hautfetzen – überall auf dem Schlachtfeld verteilt gewesen waren. Ich habe wirklich viele Schlachtfelder gesehen, doch hat mich noch nie eines so berührt wie dieses.
Schreiende Helfer rennen zwischen dem Blut und all den anderen Körperflüssigkeiten umher. Hilfesuchend und panisch bemühen sie sich, die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ich stehe einfach inmitten dieses riesigen Chaos und kann mich keinen Zentimeter bewegen. Es ist, als wäre ich an Ort und Stelle festgewachsen. Unfähig, auch nur die kleinste Bewegung auszuführen.
Hilflos.
Machtlos.
Absolut nutzlos.
In voller Bandbreite prasseln alle Gefühle auf mich ein, die ich seit meiner Kindheit nie wieder hatte und nur bei dem geringsten Anflug ihrer unangenehmen und bedrängenden Gegenwart über Jahre erfolgreich verdrängt habe. Gefühle, mit denen ich nicht umgehen und die ich so nicht akzeptieren kann, weil sie nicht in meine Welt und nicht zu mir gehören, und weil ich sie mir verbiete. Und trotzdem bin ich ihnen völlig ausgeliefert und absolut unfähig, auch nur das Geringste dagegen zu unternehmen. Ich bin wehrlos. Ich bin ihnen erlegen und mehr noch, ich muss darauf vertrauen, dass es diesen panischen Drohnen, die hier um mich herumschwirren und bemüht sind, die Lage in den Griff zu bekommen, auch wirklich gelingt.
Noch nie war ich im Kriegszustand so unbewaffnet wie in diesem Moment. Denn genau das bin ich – unbewaffnet, nackt und ohne jede Möglichkeit, diesen Zustand irgendwie zu beeinflussen und das, obwohl ich bis an den Hals bewaffnet bin und meine Beretta in der Hand halte.
Es ist mein größter Albtraum, der sich hier und jetzt manifestiert und in die Realität übergeht.
Ich bin der mächtigste Mann an der Ostküste. Ich bin die Mafia. Und dennoch kann ich nichts tun. Nicht das Geringste. Ich kann nur hier stehen und beten – als könnte Gott mir helfen, oder vielmehr, als würde Gott gerade mir helfen wollen.
Die Schreie um mich herum sind kaum erträglich, genauso unerträglich wie das chaotische Treiben und das panische Stimmengewirr dieser arbeitenden Drohnen um mich herum. Ich habe schon viele Schreie gehört. Viel mehr, als ein Mensch je zu hören bekommen sollte oder ertragen könnte. Dennoch habe ich sie immerzu ertragen – beinahe schon mein ganzes Leben lang. Doch diese Schreie hier sind anders. Sie knebeln mich und legen mich komplett lahm.
Ich fokussiere mich wieder auf das Desaster vor mir. Auf die Katastrophe, die einfach weiter ihren Lauf nimmt, obwohl ich das doch nie gewollt habe. Alles hier ist voller Blut. Es ist so viel Blut, dass die Luft diesen metallischen Geruch angenommen hat, der mir leider so altbekannt und vertraut geworden ist. Die Panik wird jetzt drängender, kritischer. Die Entscheidung zwischen Leben und Tod liegt in der Luft und mischt sich zu dem Duft des Blutes. Ich weiß es so genau, weil mir auch dieser Geruch so altbekannt und vertraut ist.
Die Wahrheit ist, dass Leben und Tod so nah beieinanderliegen, wie man es eigentlich nur sehr ungerne wahrhaben will, weil man das eine so sehr liebt und das andere so unglaublich fürchtet. Dass sie nur durch einen winzigen Übergang getrennt werden, der so leicht zu überschreiten ist – aber nur in eine Richtung. Tatsache ist, dass unser Leben blutig beginnt, mit Blut seinen Verlauf nimmt und ebenso blutig endet. Blut, Blut, Blut – alles hier ist voller Blut, dem warmen Elixier des Lebens und des Sterbens.
Und als ich denke, dass die Schreie unerträglich sind und ich auf dem Zenit dessen bin, was ich noch ertragen kann, enden sie einfach ohne jede Vorwarnung. Die bedeutungsvolle Stille ist noch schlimmer als jeder der vorausgegangenen Schreie. Denn es ist vorbei. Einfach so, ohne um Erlaubnis zu bitten, und es gewollt zu haben.
Meine Waffe gleitet mir aus der Hand und fällt auf den blutverschmierten Boden. Es ist still. Viel zu still. Es ist die grausame Stille, die nur der Tod verbreiten kann, wenn er ein Leben mit sich über die Grenze nimmt.
KAPITEL EINS
LILIANA
FÜNFZEHN MONATE VORHER
Die ersten frühlingshaften Tage brechen über die Stadt hinein, und von meinem Balkon aus kann ich die in frischem Grün sprießenden Knospen in unserem Park erkennen. Es poltert an meiner Tür, und eigentlich muss sie gar nicht reinkommen, damit ich weiß, dass es Emilia ist. Irgendwann erkennt man seine Mitmenschen auch an ihrer Art zu klopfen. Seine nervigen Geschwister aber ganz besonders.
„Bist du soweit?“ Sie ist immer ein bisschen verträumt. Emilia ist keines dieser Mädchen ohne Tiefgang, auch wenn sie auf den ersten Blick so wirken mag. Sie ist alles andere als oberflächlich.
„Klar.“ Ich folge ihr in den Flur und nicke Romeo zu, der mir als Bodyguard zugeteilt wurde, und begrüße außerdem Antonio, der auf Emilia aufpasst. Seit dem letzten Sommer hat jede von uns einen eigenen Leibwächter.
„Ekaterina wartet schon unten.“ Wir treffen uns heute mit unserer bis vor wenigen Wochen totgeglaubten Schwägerin, die zusammen mit Giulio in Russland war, um Jaroslaw Wasilijew umzulegen. Außerdem hat Ekaterina auch ihre kleine Schwester Oksana und ihre Freundin Keela eingeladen. Ein richtiger Mädelstag – genau das, was wir jetzt alle brauchen, sagt Ekaterina, die es ja wissen muss, denn niemand ist hier wirklich so sehr Mädchen wie Ekaterina.
Eine Dreiviertelstunde später liege ich auf einer Massageliege und presse mein Gesicht durch die Aussparung. Irgendjemand hier kam auf die glorreiche Idee, einen Teller mit stark duftendem Potpourri darunter zu stellen. Leider stinkt das Zeug so erbärmlich, dass ich die Massage kaum genießen kann.
„Das tut so gut“, stöhnt Ekaterina. Wir haben über Jahre dieselbe Schule besucht und hatten bis auf wenige Ausnahmen all unsere Kurse zusammen. Dennoch habe ich mich erst richtig mit ihr angefreundet, als ich auf ihrer Geburtstagsfeier im letzten Jahr vergewaltigt wurde. Nachdem mir beigebracht wurde, was mit mir geschehen war, hatte Giulio ihr aufgetragen, mir zu helfen, und irgendwie hat uns das zusammengeschweißt. Dass Ekat und Giulio einige Wochen später geheiratet haben und sie dann bei uns eingezogen ist, hat die Freundschaft nur noch mehr gefördert. Und seitdem ich mit Ekaterina befreundet bin, bin ich auch mit Oksana befreundet. Und mit Keela. Also mit allen, mit denen ich vorher nicht wirklich etwas zu tun haben wollte. Lustig. Nun liegen wir hier, aneinandergereiht wie die Hühner auf der Stange und lassen uns von kleinen zierlichen Asiatinnen, von denen vermutlich drei zusammen so viel wiegen wie ich allein, durchkneten und von schlechtem Duft-Potpourri die Sinne vernebeln.
„Gott.“ Keela seufzt wohlig. „Das ist so perfekt.“
„Es ist langweilig“, stellt Oksana genervt fest. Oksana ist das, was ich eigentlich immer von Ekaterina dachte, bevor ich sie dann wirklich kennenlernte. Sie ist ein kleines, verwöhntes Mafiamädchen. Zu allem Überfluss hat sie aber etwas Grips im Schädel, und ich befürchte, sie wird nach und nach immer besser lernen, die ihr von Natur aus mitgegebenen Attribute richtig einzusetzen.
„Oksana“, zischt Ekaterina ihr ermahnend zu, die darauf schnaubt, aber ihren Mund hält.
Neben dem Potpourritellerchen erscheint ein Paar gut manikürte kleine Füße in pinken Glitzerpantoletten. Was ist das? Schuhgröße dreiundzwanzig?
„Ich werde jetzt mit den Füßen und Knien weitermachen“, warnt mich die Masseurin. „Dazu werde ich auf Sie steigen. Ich wiege dreiundvierzig Kilo, Sie brauchen sich also keine Sorgen machen.“
Dreiundvierzig Kilo. Das rundet man ab, nicht auf. Wenn sie ein paar Tage weniger isst oder krank wird, hat sie eine drei vorne stehen, und das ist doch wirklich krankhaft, selbst für Asiatinnen.
Dreiundvierzig. Kilo.
Gut, sie ist natürlich auch winzig – so winzig wie ihre Füße. Vielleicht ist sie einsvierzig groß.
Ich muss aufpassen, nicht zu lachen. Okay, sie ist dann doch kein Drittel von mir.
Aber. Dreiundvierzig. Kilo.
„Lassen Sie das doch bei meiner Freundin einfach aus“, unterbricht Ekaterina die Masseurin. Ich hebe meinen Kopf aus dem Potpourriloch und schaue zu Ekaterina hinüber, die sich auch aufgerichtet hat. Die kleine Asiatin schaut verwirrt zwischen uns hin und her. In Ekaterinas grauen Augen liegen Schmerz und aufrichtiges Mitgefühl. Ich kenne diesen Blick. Ich weiß genau, was sie jetzt sieht und woran sie sich in diesem Moment erinnert. Und obwohl ich heute gar nicht daran gedacht hätte und auch gar nicht richtig daran denken kann, weil mir die Erinnerung an diese Nacht fehlt, denke ich jetzt auch wieder daran.
Ich denke daran, wie Luca seine Hand nach mir ausgestreckt hat, während Tränen in seinen dunklen Augen standen. Ich denke daran, wie ich so unter Schock stand, dass ich erst gar nicht begriffen habe, von wem das ganze Blut in meinem Zimmer war, bis ich dann irgendwann realisiert habe, dass ich es war, die blutete. Dass es meine ausgerissenen Haare waren, die überall im Zimmer lagen. Dass meine Kleidung in Fetzen von meinem Körper hing. Und dass ich die schrecklichsten Schmerzen meines Lebens hatte.
Ich presse schnell meine Lider zusammen und atme tief durch. Innerlich zähle ich langsam. Meine Mutter hat immer gesagt, dass ich zählen soll, wenn unser Vater Giulio oder Luca mitgenommen hat, und ich wusste, dass den beiden jetzt etwas Fürchterliches passieren wird. Sie sagte immer, dass das Zählen hilft, sich wieder auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Ich habe keine andere Methode, um meine Gefühle zu bewältigen - und meine nicht vorhandenen Erinnerungen. Also zähle ich.
„Es ist schon okay.“ Ich würde Ekaterina manchmal am liebsten an den Schultern packen und schütteln. Sie alle, aber Ekaterina ganz besonders. Sie sind alle vorsichtig, was mich angeht. Sie packen mich in Watte, achten penibel auf jedes Wort und jede Berührung. Und Ekaterina ist von allen die Sensibelste. Sie achtet nicht nur darauf, was sie selbst sagt oder tut, sondern schirmt mich auch vor jedem anderen ab, der gar nicht weiß, dass ich Watte gebrauchen könnte. Sie beschützt mich extrem und will mich vor jedem noch so kleinen Stoß bewahren. Eigentlich ist das wirklich süß, und ich weiß, dass sie es gut meint. Aber es macht mich auch ein bisschen fertig, weil ich gar nicht so ein Watteleben führen will. Ich will einfach nur normal sein.
„Wenn du etwas nicht magst, kannst du das immer sagen“, flüstert sie mir zu, als müsste sie mich daran erinnern.
Vielleicht denkt sie das wirklich. Vielleicht denkt sie, dass mein Selbstwertgefühl seit der Vergewaltigung so dermaßen am Boden ist, dass ich kein Nein mehr über meine Lippen bringe.
„Ich weiß.“ Ich nicke der Masseurin zu, damit sie endlich mit ihren mickrigen dreiundvierzig Kilo auf mich steigt und mich mit ihren Babyfüßen massiert.
Ich atme noch einmal tief durch und zähle bis zehn. Dann starre ich wieder auf die stinkende Schale mit dem getrockneten Blumenkompost. Es ist immer das Gleiche, und ich frage mich, ob und wann das jemals aufhören wird. Vielleicht bräuchte ich die Watte von allen Seiten, wenn ich mich erinnern könnte. Vielleicht wäre ich dann sogar dankbar, dass alle so vorsichtig mit mir umgehen und Rücksicht auf mich nehmen. Ich weiß, dass sie es alle nur gut mit mir meinen und sich so verhalten, um es mir einfacher zu machen. Und ich weiß, dass ich wirklich dankbar dafür sein sollte. Aber ich bin es nicht.
Und das macht mir zusätzlich ein schlechtes Gewissen, denn ich bin umgeben von Menschen, die sich zurückhalten und in meiner Gegenwart auf alles Mögliche achten. Die es sich wirklich schwer und unbequem machen, sobald sie mit mir zusammen sind, und das nur, um mir zu helfen. Um richtig für mich da zu sein und mir meinen Kummer ein wenig erträglicher zu machen. Und dennoch stört es mich. Es stört mich, dass ich für niemanden mehr die Liliana bin, die ich vor der Vergewaltigung gewesen bin. Es stört mich, dass sie sich zurücknehmen und Rücksicht mir gegenüber walten lassen. Es stört mich, dass die normalsten Dinge plötzlich nicht mehr normal für mich sein dürfen. Es stört mich, dass jeder mich mit anderen Augen sieht.
Es stört mich.
Es nervt mich.
Es kotzt mich an.
Ich will am liebsten schreien.
Ich will schreien, weil es ausgerechnet mich in dieser Nacht getroffen hat. Ich will schreien, weil ich in den Augen meiner Familie, meiner Freunde und in den Augen dieser ganzen verdammten Mafia nicht mehr die bin, die ich davor neunzehn Jahre lang gewesen bin. Und ich will schreien, weil ich mich nicht an das erinnern kann, was da eigentlich mit mir passiert ist.
Ich weiß nicht, ob es Fluch oder Segen ist, und deswegen will ich auch schreien. Denn einerseits bin ich froh, alles vergessen zu haben und mich an rein gar nichts erinnern zu können, was in dieser Nacht passiert ist. Mein blutender und schwer verletzter Körper konnte sich erinnern, was mir ungefähr widerfahren ist. Ich habe die Schmerzen gespürt – wochenlang. Ich spüre auch die Schmerzen, die meine Seele dadurch erlitten hat. Aber ich kann ihn nicht richtig greifen, diesen Schmerz, weil ich alles vergessen habe.
Einerseits bin ich dankbar dafür, dass ich nichts davon weiß. Dass ich mich weder daran erinnern kann, wie der Mann in mein Zimmer kam, noch wie er mich missbraucht und gefoltert hat. Ich bin wirklich dankbar dafür, denn ich bin mir sicher, dass es mir sonst viel schlechter gehen würde. So schlecht, wie es jeder in meinem Umfeld von mir erwartet, denn sonst würden sie diese ganzen Wattepakete nicht um mich herum aufbauschen. Andererseits macht es das umso schwieriger für mich, denn es ist nicht greifbar und dennoch ist er da, dieser Schmerz, den ich ertragen muss, aber nicht fassen kann. Den ich immer unterschwellig mit mir herumschleppe und dennoch nicht verstehen kann. Und was man nicht verstehen oder greifen kann, das kann man auch nicht beherrschen oder mindern. Es ist wie eine Krankheit, die da ist, über die man jedoch nichts weiß. Wie soll man sie heilen?
Mit dem Therapieren ist es ohnehin so eine Sache bei uns. Auf der Gehaltsliste der New Yorker Famiglia stehen wirklich gute Ärzte. Vorrangig einer der Chefärzte aus einem modernen Krankenhaus in Manhattan. Sein Fachgebiet ist die Chirurgie. Natürlich das, was am dringendsten gebraucht wird, denn die meisten Verletzungen sind rein körperlich. Sie sind oberflächlich und begreifbar. Sie sind behandelbar und wenn nicht, dann stirbt man – so einfach ist die Gleichung normalerweise.
Meine oberflächlichen Blessuren konnte Doktor Parker problemlos heilen. Rein körperlich bin ich wiederhergestellt. Genesen – das stand auf meiner Krankenakte, als Luca mich damals von meinem letzten Termin abgeholt hat. Doch die anderen Verletzungen, die tiefer liegen und sogar vor mir selbst verborgen bleiben, um die konnte er sich nicht kümmern. Keiner kann es, denn für die Famiglia arbeiten keine Psychologen. Welcher Clan würde auch schon wollen, dass ein Mitglied bei jemand Außenstehendem sitzt und ihm sein Leid klagt? Und bei uns hat das Leid zwangsläufig immer mit dem Geschäft zu tun. Ein Psychologe oder ein Seelsorger wäre ein unnötiger Zeuge, dessen Aussage uns alle töten könnte. Also gibt es das einfach nicht. Fertig.
Mein Vater war damals sogar froh darum, dass ich einfach alles vergessen habe. Dass ich mich selbst so dermaßen mit Partydrogen und Alkohol vollgepumpt habe, dass mein Hirn einfach alles ausgelöscht hat, was in dieser Zeitspanne passiert ist. Für ihn war das Thema damit erledigt. Und Luca, sosehr er mich liebt, hat auch nur mitleidig den Kopf geschüttelt, als ich ihn vorsichtig darum bat, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, dass ich mit jemandem darüber reden könne. Zu gefährlich und zu hoch wäre das Risiko, dass ich jemandem Details über uns verrate.
Und so kommt es, dass ich Nacht für Nacht aus meinem Schlaf aufschrecke. Dass ich weine wie ein kleines, jämmerliches, hilfloses Baby. Dass der Angstschweiß meinen Körper bedeckt und ich immer einen Moment brauche, bis ich realisiere, dass ich in Sicherheit bin. So kommt es, dass ich damit leben muss und mich jeden Tag frage, ob es nun Fluch oder Segen ist, dieses ewige Vergessen.
KAPITEL ZWEI
LILIANA
Es ist halb sieben am Morgen, als mich Romeo wie besprochen abholt. Er sieht wirklich fix und fertig aus, und jetzt tut es mir schon ein bisschen leid, dass ich ihn so früh aus dem Haus treibe, wo er doch nachts bestimmt noch einige Jobs in einem der Clubs erledigt hat. Er ist zwar mein Bodyguard, aber da ich nicht täglich das Anwesen verlasse und eigentlich nur dann seinen Schutz brauche, übernimmt er auch den ein oder anderen Auftrag.
Ich spare es mir heute Morgen, die Augen über seinen Aufzug zu verdrehen. Wie oft habe ich ihm schon gesagt, er solle sich einfach wie jeder normale Mensch unseres Alters eine Jeans und einen Hoodie überziehen – irgendetwas, das nicht aus fünfzig Metern Entfernung Mafia schreit. Aber Romeo hat das irgendwie nicht drauf. Während ich für unsere Ausflüge in die Normalität auf einen, für unsere Kreise, viel zu legeren Kleidungsstil setze und wirklich als normale Studentin durchgehen könnte, sieht Romeo aus wie der sprichwörtliche Pate.
„Lange Nacht?“
Er lässt sich elegant auf den Fahrersitz gleiten und schaut mich durch den Rückspiegel an. Unter seinen Augen sind dunkle Schatten zu erkennen, die noch Geschichten von letzter Nacht erzählen.
„Ich bin erst um vier Uhr zurückgekommen.“
„Und ich bin seit vier Uhr wach.“
„Wenn ich eine Mafiaprinzessin wäre, würde ich den ganzen Tag schlafen.“
Romeo ist ein Jahr älter als ich und ein ziemlich lockerer Typ. Nicht ganz so locker wie Leonardo, aber auch nicht ganz so steif wie Emilias Bodyguard Antonio. Romeo ist ziemlich gutes Mittelmaß. Ich mag das Mittelmaß. Deswegen kommen wir beide auch so gut miteinander klar, weil wir selten aufbrausend sind und in eines der Extreme übergehen. Uns Freunde zu nennen wäre übertrieben, dennoch haben wir ein freundschaftliches Verhältnis.
„Den ganzen Tag nur zu schlafen muss doch schrecklich langweilig sein.“
Er lacht. „Deswegen willst du auch wieder in die Bibliothek. Dort ist Schlafen verboten, obwohl sie doch geradezu dazu einlädt. Aber warum immer in dieser Herrgottsfrühe?“
„Mache ich es dir denn so nicht viel einfacher?“
„Also ich würde es schon deutlich einfacher finden, länger als zwei Stunden schlafen zu können.“
„Es waren zweieinhalb Stunden.“
„Aber ich konnte nur zwei schlafen, weil ich eine halbe Stunde brauchte, um zu duschen und einen Kaffee zu trinken.“ Er setzt den Blinker und fährt auf den Parkplatz direkt hinter dem Gebäude. „Also, was sollte um diese Zeit leichter für mich sein?“
„Es sind doch viel weniger Menschen unterwegs, Romeo. Dann ist es viel leichter für dich, mich zu bewachen.“
Natürlich ist das nicht der Grund, warum ich um sieben Uhr morgens die Bibliothek in Manhattan aufsuche, aber er muss nicht wissen, dass ich einfach nicht mehr schlafen kann und wir von mir aus auch direkt um vier Uhr hier sein könnten. Aber dann bekäme Romeo wohl gar keinen Schlaf mehr.
„Du bist eine schlechte Lügnerin, Liliana.“
Die über den Tag hereinbrechende Sonne scheint durch die bunten Fenster des alten Gebäudes und taucht den Lesesaal in weiches Licht. Wie immer habe ich mir meine übliche Lektüre in einem der kleinen Körbe zusammengesucht und Platz an einem der langen Tische genommen. Ein bisschen Normalität – dass hat Ekaterinas Vater immer gesagt. Ekaterina benutzt diese Worte auch oft, wenn sie etwas ironisch meint, aber ich finde sie gar nicht so ironisch. Ich kann den Wunsch nach Normalität nämlich durchaus nachvollziehen. Ich finde es eher ironisch, dass gerade sie so gerne die Worte ihres Vaters wiederholt, wo sie mir doch oft mein bisschen Normalität durch ihr Verhalten wegnimmt. Aber das hier ist genau das. Diese Bibliothek ist zu meiner Normalität geworden, seit wir die Schule verlassen haben. Und seit in dieser einen Nacht mein ganzes Leben in Stücke zerbrochen ist.
Für den Schulabschluss habe ich immer in der Bibliothek der Midtown High gelernt. Den Weg hierher habe ich erst im letzten Sommer gefunden, seit ich diese Albträume habe und nichts dagegen unternehmen kann. Wenn ich träume, kann ich nicht durchatmen und zählen. Zumindest weiß ich das in meinen Träumen nicht. Und da ich keine Therapiesitzungen bekomme, in denen ich lerne, mein unterschwelliges Trauma zu greifen und zu verarbeiten, bleibt mir nichts als das hier. So komme ich jeden Dienstag und Freitag hierher und lese mich durch sämtliche Psychologiebücher, welche die Bibliothek zu bieten hat. Wenn mir niemand helfen kann, dann muss ich wohl selbst eine Möglichkeit finden, um mir zu helfen. So einfach ist das – oder auch nicht, denn bisher habe ich hier nicht den Weg zu mir selbst gefunden, der es mir ermöglicht, meine Scherben wieder zusammenzusetzen, wohl aber interessanten Lesestoff.
Vertieft in mein Buch schrecke ich durch das laute Krachen auf. Es ist jetzt das dritte Mal innerhalb der letzten dreißig Minuten, dass Romeo im Sitzen eingeschlafen ist und ihm sein Handy einfach aus der Hand fällt. Prinzipiell wäre das nicht tragisch, wenn es nicht immer auf die massive Tischplatte krachen und dieses laute Geräusch machen würde und wir nicht mitten in einer Bibliothek wären.
„Romeo.“ Ich schlage gegen seine Schulter, weil die Bibliothekarin schon wieder säuerlich in unsere Richtung sieht.
Ruckartig schreckt er auf und sitzt wieder kerzengerade. „Verflucht. Erzähl das bitte nicht Giulio und schon gar nicht Luca.“
„Schon klar. Willst du dich nicht lieber ins Auto legen und ein bisschen schlafen?“
„Bist du übergeschnappt?“
Ich beobachte die Bibliothekarin, die uns jetzt mit dem Rücken zugewandt ist und sich langsam von unserer Tischreihe entfernt. „Nein, nur praktisch veranlagt.“
„Auf. Gar. Keinen. Fall. Liliana“, sagt er langsam und gähnt.
Ich konzentriere mich wieder auf mein Buch, lausche aber weiterhin auf die Geräuschkulisse, die Romeo erzeugt, um auf ein verräterisches Schnarchen zu achten. Ich bin Sturheit durch Luca gewohnt, genau wie die Tatsache, dass ich daran ohnehin nichts ändern kann. Nach weiteren fünfzehn Minuten, in denen er viel zu still für einen Menschen bei Bewusstsein ist, ist es abermals ein lautes Krachen, das die friedliche Stille durchbricht. Ich muss mir ein Lachen wirklich verkneifen, weil es eigentlich zu komisch ist. Die wenigen anderen Leser, die sich um die frühe Uhrzeit eingefunden haben, finden es allerdings weniger belustigend und schauen irritiert in unsere Richtung.
„Merda, tut mir leid, Lili. Die Nacht war einfach ...“
„Viel zu kurz. Weißt du, wenn du schon nicht schlafen willst, dann solltest du dir wenigstens unten im Foyer einen Kaffee aus dem Automaten ziehen, eine rauchen und für fünf Minuten an die frische Luft gehen. Das wird dich etwas fitter machen, denn ich befürchte wirklich einen Sekundenschlaf, wenn du später am Steuer sitzt.“
Dass ich genauso gut zurückfahren könnte, weil ich einen Führerschein habe oder ich am liebsten ganz allein herkommen würde, brauche ich ihm nicht zu sagen. Romeo weiß das, kann aber ebenso wenig etwas daran ändern wie ich.
Romeo scannt den Lesesaal und die Gänge, die zwischen die vielen Bücherregale führen. Er hält nach irgendetwas Verdächtigem Ausschau und legt sich vermutlich schon einen Plan zurecht, wie er uns innerhalb von einer Minute aus dem Gebäude befreien könnte, würde es hier zum Eklat kommen. Es kann nämlich immer zum Eklat kommen. Eine der Tatsachen, die ich jetzt verstanden habe und mit denen ich gut umgehen kann. Es kann hier, mitten in der Öffentlichkeit, genauso zu einem Angriff kommen wie auf einem unserer gut bewachten Anwesen. Sogar auf dem Winterball, der von allen Clans gleichermaßen bewacht wird. Es braucht nur ein paar loyale Männer, die bereit sind, in den sicheren Tod zu gehen, dann kann man vermutlich jedes noch so gut bewachte Anwesen stürmen. Sicher bin ich nirgendwo. Romeo atmet tief durch. In ihm tobt der Kampf zwischen seiner Korrektheit und der Müdigkeit. Zwischen dem, was er unsinnigerweise versprochen hat, weil einfach niemand diese Bibliothek angreifen wird, nur weil ich hier sitze, und dem, was jetzt einfach am logischsten ist, nämlich dass er sich irgendwie wachpusht. „In Ordnung. Ich bin in fünf Minuten wieder da.“
„Yes, Sir.“
„Du bleibst genau hier sitzen. Du holst dir kein neues Buch und streunst hier auch nicht allein durch die Gänge.“
„Und ich gehe nicht auf die Toilette.“ Ich zwinkere ihm zu.
„Bin gleich wieder da.“
Ich atme erleichtert durch und schließe meine Augen. Ich bin allein. Das erste Mal seit – ich glaube, seit ich denken kann. Und es fühlt sich fantastisch an. Es ist interessant, wie ein Gefühl, das für die meisten Menschen ganz normal ist, für mich etwas Besonderes sein kann. Ich beschließe, die Minuten zu nutzen und nicht zu lesen, sondern einfach nur still dazusitzen und mich diesem Moment hinzugeben, den ich vielleicht so nie wieder bekomme. Es sind die Möglichkeiten, die ich jetzt hätte. Würde ich jetzt das Gebäude verlassen, so hielte mich niemand auf. Würde mich jetzt jemand ansprechen, würde ihn niemand vertreiben. Würde ich jetzt einfach jemandem um den Hals fallen und ihn küssen, käme niemand mit einer gezogenen Waffe um die Ecke und würde ihn töten.
So viele Möglichkeiten und ich nutze keine davon.
Ich bin anders als sie alle.
Ich will nicht rebellieren wie Keela. Ich will aber auch nicht neben einem Mann sitzen und einfach nur an den richtigen Stellen zustimmend nicken, so wie Ekaterina es tut. Ich bin keine Rebellin. Ich bin keine Prinzessin. Ich bin das Mittelmaß. Die Grauzone. Das, was zwischen den Extremen ist. Mir reichen schon diese fünf Minuten. Mir reicht ein bisschen Normalität. Vielleicht war ich deswegen auch immer eine der wenigen, die die Zeit auf der Highschool mochte.
Langsam öffne ich meine Augen. Ich gewöhne mich gerade an die Helligkeit, als ich eine Bewegung mir gegenüber wahrnehme. Natürlich ist hier freie Platzwahl und natürlich sitze ich ganz allein an einem langen Tisch, an dem bestimmt vierzig Personen sitzen könnten. Es wäre lächerlich, würde niemand auf die Idee kommen, sich mit an den Tisch zu setzen. Es ist normal, dass sich jemand dazusetzt. Ein bisschen Normalität.
Der Blick des Mannes liegt kurz auf mir. Natürlich, ich hatte meine Augen geschlossen. Vermutlich dachte er, dass ich hier mein Nickerchen halte, so wie Romeo es vorhin mehrfach getan hat. Als er meine Augen auf sich spürt, schaut er weg, zieht sich seinen Stuhl zurecht und nimmt mir schräg gegenüber Platz. Aus einem Stapel Bücher zieht er eines heraus und fängt an zu lesen. Und irgendwie checke ich ihn weiter ab. Nicht so, wie eine Frau das normalerweise bei einem Mann tut. Natürlich aus rein taktischen Gründen, denn Romeo ist ja nicht da und ich muss die potenzielle Bedrohung einschätzen. Natürlich ist es nur das.
Er sieht eigentlich ganz normal aus. Nur ist er verdammt attraktiv und gehört eher auf ein Hochglanzcover als in eine Bibliothek. Er hat braune Haare. Weder so hell, dass man ihn in diese Sunnyboy-Schublade stecken könnte, noch so dunkel wie die meisten italienischen Männer. Sie sind nicht akkurat frisiert, aber auch nicht so chaotisch wie die meines Bruders Luca. Sie sind ein Zwischending. Sie sind genau richtig. Wäre Romeo jetzt hier, würde ich ihm sagen, dass es das Outfit dieses Typen ist, das ich bei unseren Besuchen hier eigentlich von ihm erwarten würde. Er sieht normal aus. Nicht wie jemand, der übertrieben elegant gekleidet ist, aber auch nicht wie jemand, der gar keinen Wert auf sein Äußeres legt. Er trägt eine dunkelblaue Jeans, einen cremefarbenen leichten Pullover und einen dünnen Wollmantel, den er hier drin eigentlich gar nicht mit sich führen darf und verbotenerweise über seine Stuhllehne gehängt hat. Er ist wohl etwas rebellisch. Nicht so wie die Männer, mit denen ich sonst zu tun habe, sondern er scheint ein Alltagsrebell zu sein.
Seine Augen fangen kurz meinen Blick ein, den ich schnell wieder senke. So ein Mist, jetzt hat er mich dabei ertappt, wie ich ihn anstarre. Natürlich nur aus rein strategischen Gründen. Dennoch lasse ich meinen Blick mit gesenktem Kopf noch mal zu ihm hinüberhuschen. Er schaut jetzt auch wieder auf die Seiten vor sich, aber anders als vorhin, liegt jetzt ein leichtes Lächeln auf seinen Lippen, das ihn nur noch attraktiver macht.
Ich schrecke hoch, als Romeo mich antippt und er sich neben mich auf den Stuhl gleiten lässt. Er bringt kühle Märzluft mit herein und riecht ein bisschen nach frisch gebrühtem Kaffee. Kurz schaut er zu dem Neuankömmling hinüber.
„Alles klar bei dir?“
„Sicher.“
„Danke für die kleine Zwangspause. Mir geht‘s jetzt wirklich viel besser.“
„Gern geschehen.“ Als ich mir sicher bin, dass Romeo wieder Lageberichte der anderen Soldaten checkt und nicht mehr ständig einschläft, traue ich mich noch mal zu dem Mann zu schauen. Sein Blick gleitet ein letztes Mal zu mir, bevor er seine Bücher zusammenpackt und geht.
„Oh. Mein. Gott“, verkündet Oksana. „Ihr verpasst so viel, weil ihr nicht mehr auf die Highschool geht.“
Ich sitze zusammen mit Ekat, Keela und Emilia in einem kleinen Café. Wie immer sind auch die Bodyguards dabei, sitzen aber einen Tisch weiter, damit wir wenigstens die Illusion von Freiheit und Privatsphäre haben.
„Was verpassen wir?“ Ekaterina ist immer so interessiert an Oksana, was nicht auf Gegenseitigkeit beruht.
„Wir haben einen neuen Mitschüler“, erklärt Emilia deutlich weniger begeistert. Emilia interessiert sich eher für ihre Malerei als für Oksanas Sensationen, obwohl sie beste Freundinnen sind.
„Elena Markow?“, erkundigt sich Keela. Als würde es um ein Mädchen gehen, so aufgeregt wie Oksana ist. Keela ist bei diesen Themen deutlich zurückhaltender geworden, seit ich vergewaltigt wurde. Ich weiß, dass das Keelas Art ist, mich zu beschützen. Vielleicht denkt sie, dass ich in einer Welt ohne Männergeschichten vergessen könnte, dass ich missbraucht wurde. Sie hält sich spürbar bedeckt, wogegen sie früher gar nicht genug von solchen Geschichten bekommen konnte. Wir waren zwar nie eng befreundet, aber saßen jede Pause zusammen an einem Tisch. Als hätte ich nicht mitbekommen, wie sie Ekaterina über Jahre nach ihrer körperlichen Beziehung zu Aleks ausgefragt hätte. Als hätte ich nicht mitbekommen, wie Keela Ekaterina nach ihrer Verlobung gefühlte tausend Male gefragt hat, ob Giulio überall so groß ist. Als hätte ich mir nicht jedes Mal am liebsten die Ohren zugestopft, weil ich solche Dinge nicht über meine Brüder wissen will, während Luca sich prächtig darüber amüsieren konnte, weil Keelas loses Mundwerk so unterhaltsam ist.
„Natürlich nicht“, sagt Oksana entrüstet. „Was juckt mich meine Cousine? Ich spreche von dem neuen Mitschüler, der mitten im Schuljahr zu den Normalos gewechselt hat und Erbe eines Kristallimperiums ist.“
Kristallimperium? Als würde Oksana die Möglichkeit bekommen, irgendeinen reichen Erben außerhalb der Mafia zu daten. Ich kenne den neuen Boss des New Yorker Markow-Clans noch nicht, kann mir aber kaum vorstellen, dass ihr Cousin ihr die Wahl lassen wird. Wieso sollte es ihr auch besser ergehen als ihrer Schwester?
Keela lacht. „Was interessieren uns normale Männer?“
„Welche Männer interessieren dich denn?“ Provozierend grinst Oksana sie an.
Angriffslustig ist Keelas zweiter Vorname. Nicht gut.
„Mich interessieren die, die ich heiß finde und mir selbst aussuchen kann. Nicht die, die mir mein Daddy vorsetzt, aber auch keine Erben, die billiges Glas in Diamantenform pressen.“
„Mein Daddy kann mir keinen Mann mehr vorsetzen. Er ist tot.“ Oksana schnappt sich ihre Tasche und marschiert in Richtung der Sanitäranlagen, was ihr Bodyguard Maksym am Nebentisch genaustens beobachtet.
„Das ging wohl daneben“, flüstere ich Keela zu.
„Mist, es tut mir leid. Ich habe mich manchmal einfach nicht im Griff.“ Keela hat ein ziemliches Problem damit, sich zurückzuhalten. Sie ist impulsiv und vorlaut. Die meisten finden sie deswegen ziemlich abschreckend, aber mir macht es nichts aus, da ich es gewohnt bin, mit einer tickenden Zeitbombe zusammen zu sein. Luca ist im Gegensatz zu mir total impulsiv.
„Geh ihr hinterher“, fordert Ekaterina sie auf. „Sie wird auf der Toilette vermutlich schon darauf warten, dass du endlich angekrochen kommst und ihre Tränen trocknest.“
„Ich krieche normalerweise nicht, aber ich geh ja schon.“ Ich sehe Keela hinterher, bis sie die Toilettenräume erreicht.
„Wir sollten das Thema jetzt sowieso beenden“, stellt Ekaterina klar und nippt an ihrem Capuccino. „Es gehört sich nicht.“
Ich nicke ihr zu. „Zumindest nicht in ihrem Tonfall. Keela denkt manchmal nicht nach, bevor sie spricht. Sie fühlt sich schnell in die Enge getrieben. Ich glaube nicht, dass sie Oksana verletzen wollte.“
„Aber das meinte ich doch gar nicht. Ich meinte das Männerthema.“
„Was haben wir verpasst, Mädels?“, fragt Oksana wieder gut gelaunt, als sie mit Keela zum Tisch zurückkehrt.
„Ekaterina meint, wir sollten das Männerthema beenden“, klärt Emilia sie auf. „Sie fühlt sich dabei unwohl, als wäre das Thema für sie nicht ohnehin komplett vom Tisch. Wie man hört, wird Giulio dich wohl nicht wieder abgeben.“ Ekaterina wird knallrot. Sie ist nicht immer so zurückhaltend und wohlerzogen, wie sie uns seit Jahren weismachen will.
„Das meinte ich gar nicht.“ Ekaterina nimmt meine Hand. „Ich meinte, dass wir über dieses ganze Zeug sprechen, als wäre es nicht von Bedeutung, wo Liliana bei uns sitzt und ihr so gar nicht nach dem Thema zumute ist.“ Aha. Da ist sie wieder, diese Watte, um mich vor jedem bisschen Normalität abzuschirmen.
„Das macht mir nichts aus. Wirklich nicht.“
Jetzt sehen mich wieder alle mit diesem Blick an, der mir sagt, dass sie sich da nicht so sicher sind. Und der mir sagt, dass sie alle ein schlechtes Gewissen haben, weil sie, bis Ekat damit anfing, meine Vergewaltigung vergessen haben und einfach nur eine Gruppe junger Frauen gewesen sind, die sich nett unterhalten und rumgeblödelt haben. Ich hasse diesen Blick. Ich hasse dieses Mitleid in ihren Augen. Sogar die Bodyguards sehen mich so an.
Der Gedanke überkommt mich, dass sich das wohl niemals mehr ändern wird. Dass ich in unserer Welt und von allen, die darüber Bescheid wissen, wohl niemals mehr als normal angesehen werde. Es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass irgendjemand aus der Mafia mich noch wollen würde. Das ist nicht schlimm, denn es gibt da auch niemanden, den ich wollen würde, aber eine andere Option, außerhalb der Familien, habe ich auch nicht. Und irgendwie setzt es mir zu, weil die Kombination aus dem, was mir passiert ist und der Welt, in die ich hineingeboren wurde, wohl zwangsläufig bedeutet, dass ich für immer allein bleiben werde.
KAPITEL DREI
DANIK
„Blyad!“ Es ist vier Uhr morgens, und ich komme jetzt erst nach Hause, weil wieder irgendein Desaster in dem Ex-Iwanow-Puff gelaufen ist und mich dieser Zuhälter und gleichzeitige Möchtegerngeschäftsführer wirklich misstrauisch macht. Ich traue ihm nicht und auch niemandem sonst hier in New York. Danach war ich so geladen, dass ich mich für einen Joint an den einzigen Ort zurückgezogen habe, der mir inmitten dieses Chaos ein bisschen Ruhe gibt – auch wenn er eigentlich für normale Besucher um diese Zeit schon geschlossen ist und der Bereich, in dem ich mich nachts gerne aufhalte, eigentlich ohnehin nie zugänglich ist. Aber nur weil ich jetzt der Boss bin, heißt das nicht, dass ich mir nicht unbefugten Zugang zu irgendwelchen Häusern verschaffen könnte. Jeder hat mal klein angefangen.
Nun komme ich zurück in dieses Irrenhaus und muss feststellen, dass ich hier wirklich nur mit Irren lebe. Aber was habe ich mir auch vorgestellt, als ich meine Geschwister mit nach New York genommen habe? Es war ein Akt der Barmherzigkeit ihnen gegenüber, dass ich überhaupt hergekommen bin. Wir sind einzig und allein in dieser Stadt, weil sie hier besser leben können. Nicht, weil ich immer scharf auf einen eigenen Clan gewesen wäre. Nicht, weil ich machthungrig bin. Denn ich habe keinen wirklichen Vorteil davon, hier gestrandet zu sein, mit all der Verantwortung und diesem ständigen Druck, neben den anderen bestehen zu müssen.
New York ist ein verdammtes Pulverfass. Hier regiert nicht ein Clan, der die anderen einfach abschlachtet und aus der Stadt vertreibt. Nein. Hier gibt es drei Clans, genau wie mehrere kleinere Kartelle oder Motorradclubs und alle leben und arbeiten nebeneinander, miteinander – ja und im Verborgenen auch gegeneinander – unter der Hand der italienischen Famiglia. Das ist nicht gut. Ich wusste es vorher schon und habe meinen Onkel damals immer dafür bewundert, wie er in diesem Netzwerk aufgeht und sich dem Ganzen fügt. Wobei fügen vielleicht das falsche Wort ist, da hier jeder seine Intrigen spinnt. Ich wusste einfach schon in Russland, dass es hier schwierig sein würde. Trotzdem bin ich jetzt genau hier.
Ich bin seit vierundzwanzig Stunden wach und habe davor auch nur zwei Stunden geschlafen. Ich muss mich mit Menschen herumschlagen, mit denen ich mich nie rumschlagen wollte. Und meine verdammte Schwester feiert eine Party mit unserer Cousine. Ich hasse das!
Die Prinzessinnen halten sich im Salon auf. Maksym, Oksanas Bodyguard, kommt lachend raus. Seine Miene gefriert, als er mich sieht. Gut so, denn hier gibt es ganz und gar nichts zu lachen, und für Maksym, der es sich auf einer VIP-Party mit meiner Schwester und meiner Cousine nett macht, erst recht nicht.
„Danik.“
„Was machen die beiden um diese Zeit hier unten?“ Es nervt mich, dass ich nicht zum Schlafen komme, und die, wegen denen ich mich überhaupt erst in diesem desaströsen Zustand befinde und die durchaus schlafen könnten, es einfach nicht tun.
Maksym verkrampft sich. „Sie wollten, dass Boris und ich sie in einen Club fahren.“
„In einen Club, ja?“
„Da, Boss. Oksana sagte, sie wollen ins Bizzarro.“
„Weil ich ihnen das jemals gestatten würde?“, frage ich ironisch. Als ob ich meine kleine Schwester und unsere Cousine in einen der Clubs ziehen lassen würde.
Er zuckt mit den Schultern. „Elena hat es mit einer Masche versucht.“ Es ist nicht so, als wären die Bodyguards Petzen, die mir jeden Schwachsinn melden. Wenn Elena allerdings lügt, um nachts aus dem Haus zu kommen, ist das schon etwas, was sie mir berichten müssen.
„Hat sie das, ja?“
„Ich will den Mädchen keine Schwierigkeiten machen. Aber ja, Elena erzählte Boris, sie und Oksana seien mit dir und Nikolai verabredet, weil ihr euch dort mit den Romanos trefft und Oksanas Schwester auch dabei ist. Sie sagte, Boris solle dich anrufen. Als er das bei dir überprüfen wollte, hat sie Boris das Telefon abgenommen und es sich in ihr Kleid gesteckt.“
Wo genau sie sich das Handy ihres Leibwächters hingesteckt hat, kann ich mir beinahe denken. „Sie bestand darauf, dass er deinen Befehl missachtet und sie zu spät kämen, weil Boris ihr nicht glauben will, und dass das Konsequenzen für ihn hätte.“
Maksym fährt sich nervös durch die Haare. „Boris war mit den beiden schon auf dem Weg zum Wagen, als ich gerade von meinem Kontrollgang aus dem Garten kam und diesen Irrsinn noch aufhalten konnte.“
In mir schäumt die Wut auf. Ich will einfach nur ins Bett und mich für wenige Stunden der Illusion hingeben, noch in Russland zu sein und nur die Aufgaben des Zweitgeborenen erfüllen zu müssen. Stattdessen komme ich in dieses Haus und muss mich mit diesen außer Kontrolle geratenen Teenagerinnen herumschlagen. „Boris und dich trifft keine Schuld. Elena ist schwierig.“
„Sie war ziemlich sauer. Oksana hat geweint, und dann fing Elena auch an.“ Ich glaube nicht, dass ihn das Gebrüll erweicht hat. Ich glaube eher, dass es ihn und Boris massiv genervt hat. Und ich kann es nachvollziehen.
Es. Ist. Nämlich. Massiv. Nervig.
„Boris hat dann vorgeschlagen, dass sie doch hier Musik hören und tanzen könnten.“
„Alkohol?“
„Eine Flasche Champagner.“
Ich nicke ihm zu. „Ich erledige das.“
Oksana und Elena stehen in Partyoutfits auf dem niedrigen Couchtisch und tanzen. Bei anderen Frauen – wirklichen Frauen – würde ich sagen, dass diese Kleidung durchaus ihren Reiz hat. Meine Begleitung dürfte in einem Club so gekleidet sein. Aber nicht diese beiden dummen Mädchen. Während Oksana noch etwas Hirn besitzt und wenigstens auf dem Tisch ihre schwindelerregenden Schuhe ausgezogen hat, damit sie sich nicht den Hals bricht, hat Elena ihre natürlich anbehalten.
„Ihr seht aus wie zwei billige Schlampen“, schreie ich über die Musik hinweg. „Und ihr bewegt euch auch so.“
Elena zieht eine säuerliche Schnute. „Du bist ein Arschloch, Danik!“
Ich schalte die Musik aus. „Eure Kinderparty ist vorbei!“
Oksana steigt vom Tisch, nimmt ihre Schuhe und die mikroskopisch kleine Handtasche. Sie hat deutlich mehr Respekt vor mir als Elena. Und Angst. In Oksanas Augen sehe ich Angst, und die sollte sie vielleicht auch haben. Gesünder ist es jedenfalls. Elena dagegen verschränkt ihre Arme vor der Brust, bleibt aber auf dem Tisch stehen. „Wir sind aber noch nicht müde.“
Ich mache zwei Schritte auf sie zu und stehe direkt vor ihr. Ich bin deutlich größer als Elena, aber sie ist keine kleine Frau. Wenn sie auf dem Tisch steht, überragt sie mich mit ihren High Heels. Sie soll nicht denken, dass das etwas über unsere Machtverhältnisse aussagt. Dann zerre ich sie vom Tisch runter.
„Aua, Nik. Du tust mir weh!“ Dass ich ihr etwas wehgetan habe, kann durchaus möglich sein, ist aber kein Vergleich zu den Schmerzen, die sie in Russland ertragen musste. Natürlich rechtfertigt das nicht, dass ich ihr dann ein bisschen wehtun kann. Ganz bestimmt nicht. Ich bin aber kein guter Mann, und es ist mir gerade egal, was sich wie rechtfertigt und ob sie meinen Spitznamen nutzt, um mich zu besänftigen.
„Du solltest sehr vorsichtig sein, Elena. Ich bin nicht hier, weil ich den Big Apple unbedingt besichtigen wollte. Ich bin nicht hier, weil ich so versessen darauf war. Ich bin hier, weil Nikolai in Russland zu Tode gefoltert worden wäre. Und ich bin hier, weil du in Russland schon längst an den nächstbesten Vergewaltiger und Sadisten verheiratet worden wärst. Verstehst. Du. Das. Endlich?“
Ihr Atem geht schnell, und ihre Pupillen weiten sich. Sie nickt. Sie nickt immer, wenn ich so mit ihr spreche, aber sie verhält sich trotzdem weiter wie die letzte Bitch. „Wäre Nikolai in Russland geblieben, wäre er tot. Wärst du in Russland geblieben, wärst du tot. Wäre ich in Russland geblieben, hätte ich dagegen einfach meine Ruhe. Ich bin nur für euch hier und ganz besonders für dich, du kleiner nerviger Parasit.“
Jetzt rollen dicke Tränen aus ihren Augenwinkeln und verwischen ihre ohnehin schon versaute Maskerade aus zu viel Make-Up. „Es tut mir leid.“
„Es ist mir egal, was dir leidtut oder nicht. Verpiss dich jetzt einfach in dein Zimmer, verhalte dich leise und zeig gefälligst ein bisschen Dankbarkeit, dass ich mir dich und all das hier überhaupt jeden Tag antue.“
Mehr will ich gar nicht. Ich war schon immer ein genügsamer Mensch, der sich mit kleinen Dingen zufriedengibt. Zumindest als Privatperson. Als Boss des New Yorker Markow-Clans darf ich nicht so genügsam sein. Aber für den Moment bin ich es und will einfach nur ein wenig schlafen und nicht daran denken, dass ich mich hier jeden Tag erneut diesem riesigen Zirkus stellen muss.
Die Morgensonne bricht über die Skyline der Stadt herein, und vom Balkon aus beobachte ich das Schauspiel bei einer Tasse Kaffee und einer Zigarette. Die Villa der Markows hat keinen besonders großen Garten, zumindest nicht im Vergleich mit dem der Romanos, die einen ganzen Park hinter ihrem Haus haben. Nicht, dass ich schon da gewesen wäre, aber Niko hat mir Luftaufnahmen gezeigt. Eigentlich hätte ich schon längst als Gast bei den Romanos auflaufen müssen. Eigentlich wollten die Romanos auch einige Feierlichkeiten ausrichten, als meine Geschwister und ich vor wenigen Monaten angereist sind. Elena hätte sich vor Freude überschlagen. Ich aber nicht. Ich habe alles rigoros abgesagt. Ich bin nicht zum Feiern hier und habe auch keinen Grund dazu.
Das Haus liegt in kompletter Stille. Natürlich, die Partyprinzessinnen schlafen sich jetzt erst einmal fürstlich aus, weil sie ja bis vier Uhr auf den Tischen getanzt haben. Oksana hat im Moment Ferien, und Elena wird nach dieser Gnadenfrist auch auf die Privatschule gehen und Oksanas Jahrgang besuchen. Dann ist endlich Schluss mit diesen Ausschreitungen. Die wenigen Soldaten, die hier momentan wohnen, sitzen schon unten beim Frühstück zusammen. Ich nicke ihnen nur im Vorbeigehen zu. Normalerweise würde ich mir noch wenige Minuten Zeit nehmen und mich ein wenig mit ihnen unterhalten, aber nicht heute. Als mein Onkel noch lebte, residierten hier nur die nötigsten Wachen, aber ich gedenke dies nach und nach zu ändern. Ich gehe die breite Steintreppe runter und sauge jeden Zentimeter meines neuen Zuhauses in mich auf. Igor hatte hier unten nicht wirklich wichtige Räume. Einen Wein- und Vorratskeller, ein kleines Fitnessstudio, das er das letzte Jahrzehnt wohl kaum benutzt haben wird, Lagerräume und dergleichen. Seine Folterkammer hat er in einem der Lagerhäuser. Auch das gedenke ich nach und nach zu ändern.
Nikolai sitzt hinter seinem riesigen Schreibtisch. An der Wand vor ihm hängen sieben Monitore, und er fährt mit seinem Stuhl von einem zum anderen und tippt etwas auf sein Keyboard.
„Niko.“ Er nickt, bevor er sich wieder der Arbeit widmet.
Während Elena in New York immer noch das gleiche dümmliche Gesicht einer verwöhnten Prinzessin zeigt und sich, rein oberflächlich betrachtet, gar nicht verändert hat – zumindest nicht zum Guten – ist es bei Niko komplett anders. Nikolai blüht hier regelrecht auf. Einfach deshalb, weil er zum ersten Mal in seinem Leben er selbst sein kann, ohne die Angst im Nacken zu haben, dafür bestraft zu werden. Ich ermögliche es ihm zumindest so gut es geht. Während er in Russland immer und überall genauso präsent sein musste wie unser Vater, unser ältester Bruder Devid und ich, gestatte ich es ihm hier, sich im Hintergrund aufzuhalten, solange er will. Ich zwinge ihn nicht in die Clubs oder Bordelle. Ich zerre ihn nicht auf Partys, Galas und Bälle. Ich dränge ihn zu keinen Verabredungen oder Zusammenkünften. Eigentlich nehme ich ihn nur mit zu den offiziellen Clantreffen, weil ich ihn dort brauche. Ansonsten hat er die freie Wahl und das tut ihm ziemlich gut.
Ich beobachte ihn einige Minuten, in denen er einfach völlig unbeirrt das tut, was er getan hat, bevor ich kam. Ich weiß, dass er nicht unhöflich oder respektlos mir gegenüber ist, sondern dass es einfach seine Art ist. Eine Art, die ihm bei Devid bereits eine Folter eingebracht hätte. Irgendwann schiebt er die Tastatur weg und dreht sich zu mir. Er bietet mir eine Zigarette an. Eine Geste, die auch nicht immer selbstverständlich bei ihm ist.
„Danke.“
„Gibt es einen Grund für dein Kommen?“
„Ich wollte dich einfach besuchen. Hast du überhaupt geschlafen?“
„Ja, habe ich.“
Ich bin seine wortkargen Antworten gewohnt. Teilweise habe ich mir die Art von ihm sogar abgeschaut, weil es ziemlich gut akzeptiert wird, wenn Männer in unseren Kreisen kaum sprechen. Zumindest, wenn sie es mit Absicht so handhaben.
„Gibt es etwas Neues?“
Wenn man so will, ist Nikolai das Herzstück bei den Geschäften, die ich hier führe. Als ich meinem Vater sagte, dass ich meine Familie hier brauche, war das bei Nikolai kein Stück gelogen. Mein Vater und Bruder waren so geblendet von ihren starren Regeln und ihren Traditionen, von ihren Maßstäben, anhand derer sie Männlichkeit und Macht bemessen, dass sie Nikos wahres Potenzial nie erkannt haben. Ich bin in dieser Hinsicht ein Pragmatiker. Mir ist es egal, ob Nikolai sich konform zu den restlichen Mafia-Männern verhält. Mir ist es egal, ob Nikolai sich mit Nutten oder anderen Frauen trifft, wie oft er überhaupt seinen Schwanz in irgendein Loch steckt oder ob er literweise Wodka trinkt. Mir ist es gleichgültig, ob er seine private Zeit mit Schach, Büchern oder Drogenexzessen verbringt. All das spielt keine Rolle für mich, solange er loyal ist und funktioniert. Und Nikolai funktioniert hier in New York viel besser als in Russland.
„Das Aayusha wird bankrottgehen, wenn es so weiterläuft. Wenn der Laden rote Zahlen schreibt, können wir ihn nicht mehr nutzen, um die Gelder aus dem Waffendeal mit Vegas zu waschen, so wie wir es geplant hatten.“
Dass das Aayusha mies läuft, ist mir gestern auch mal wieder klar geworden. Der Laden ist einfach nur ein billiger Puff – mehr nicht.
„Alle Clans stecken seit dem Tod der Iwanows im Aayusha. Die Iren tragen am wenigsten dazu bei. Vielleicht sollte man sie aus dem Deal lösen und den verbleibenden Profit unter uns und den Italienern aufteilen.“
„Es ist nicht nur das. Ich glaube, der Zuhälter wirtschaftet in seine eigenen Taschen. Aber ja, die Iren müssen auch raus.“
Ich habe bei niemandem hier ein wirkliches gutes Gefühl, aber bei Maghnus Callaghan am wenigsten. Bei seinen Söhnen ebenso wenig. Callaghans Nachfolger ist ein zugekokstes Stück Scheiße. Die zweitgeborene Tochter hat hier in New York, dank italienischer Vorherrschaft, nichts zu melden. Ich kenne sie zwar nicht, bin mir aber sicher, dass das nur von Vorteil sein kann. Der jüngste Irenspross gefällt mir eigentlich. Eigentlich. Er ist sauber. Viel zu sauber, im Vergleich zu seinem Vater und Bruder und auch viel zu sauber im Vergleich zu dem, was man sich über seine Schwester erzählt. Ich mag die Iren einfach nicht.
„Ich brauche dich heute noch mal.“
In Russland ist er immer erstarrt, wenn er zu einem offiziellen Termin musste. Hier nickt er nur. Das ist gut, denke ich.
„Da. Ist in Ordnung, Danik.“
„Gut. Ich gehe dann jetzt.“
„Genießt du das Leben in New York?“, fragt er mich plötzlich, und ich zucke fast zusammen, weil er mir eine persönliche und irgendwie auch unnötige Frage stellt. Es ist beinahe, als wolle er Small Talk mit mir machen. Niko macht nie Smalltalk.
„So gut es geht.“ Ich will ihm nicht sagen, dass ich es hier hasse. „Du könntest mich begleiten.“
„Lieber nicht.“
„Du weißt doch gar nicht, was ich vorhabe.“ Eigentlich würde es ihm dort gefallen, andererseits bin ich unter anderem auch dort, um seinen wachsamen Augen zu entkommen.
„Vielleicht ein andermal.“
„In Ordnung. Vielleicht ein andermal, Niko.“
KAPITEL VIER
LILIANA
„Du siehst gewöhnlich aus“, sagt Romeo und deutet auf meine bequeme Strickjacke.
„An deinen Komplimenten solltest du dringend nochmal arbeiten.“
„Du weißt genau, wie ich das meine.“ Er schläft beinahe beim Reden ein, und ich weiß, dass wir dieses Gespräch überhaupt nur führen, damit er wach bleibt. „Du siehst aus wie ein Normalo. Wie irgendein Mädchen.“
Ich finde meinen Look eigentlich ganz gelungen. Ich trage eine dunkle Jeans, braune Ballerinas und einen passenden Gürtel. Meine lockere Baumwollbluse habe ich in den Hosenbund gesteckt und meine Haare trage ich offen.
„In welchem Outfit sollte ich deiner Meinung nach hier aufkreuzen?“
„Na, so, wie du auch sonst gekleidet bist.“
„Ich soll also in einem Zweitausend-Dollar-Kleid in die Bibliothek gehen und so tun, als wäre ich eine ganz normale Studentin, die ihren Aufgaben nachgeht?“
Sein Denken ist typisch für die italienische Mafia. Einerseits soll niemand über unsere Geschäfte Bescheid wissen. Andererseits soll jeder Mensch wissen, wer wir sind und was wir tun. Jeder soll uns den nötigen Respekt entgegenbringen und uns ernst nehmen.
„Außerdem macht mich das nur angreifbarer, wenn jeder weiß, wer ich bin. Die Tarnung als gewöhnliche Studentin ermöglicht es mir überhaupt erst, so oft hierherzukommen.“
„An einem Samstag. Als würde irgendeine normale Studentin freiwillig am Wochenende die Bibliothek besuchen.“
Romeo soll sich nicht so anstellen. Ein bisschen Kultur und Bildung würde ihm auch guttun, aber er wird bestimmt wieder einschlafen. Er war gestern Nacht wieder lange unterwegs, aber ich habe auch nicht viel mehr Schlaf bekommen.
Wir setzen uns auf unsere Stammplätze im Lesesaal, und als die gleiche Bibliothekarin wie letzte Woche Romeo sieht und ihm einen wütenden Blick zuwirft, zuckt er kurz zusammen, was mich schmunzeln lässt.
„Erinnert sie dich an deine strenge Nonna in Italien?“
„Möglich. Vielleicht bin ich aber einfach auch nur so müde, dass ich mich bloß mit keiner Frau anlegen will.“
„Ich könnte Giulio bitten, dich nur noch in meine Dienste zu stellen, dann hättest du mehr Zeit zu schlafen.“
„Nein, nein. So einfach ist das nicht. Wenn ich irgendwann Captain werden will, muss ich mich auch ein bisschen im Geschäft auskennen.“
„Sollte ich pikiert sein, dass dich dein Job als mein Leibwächter nicht erfüllt?“
Ich will ihn nur ein bisschen ärgern, dabei weiß ich ganz genau, dass die Posten als Bodyguards zwar mit sehr viel Respekt belohnt werden, aber einen in der Hierarchie der Mafia nicht unbedingt aufsteigen lassen.
Er gähnt und schlägt sich beide Hände vor den Mund.
„Scusa, Lili. Ich bin einfach total fertig.“
„Weißt du was? Was hältst du davon, wenn du dir wieder einen Kaffee gönnst und etwas frische Luft schnappst?“
„Willst du mich loswerden?“
„Eigentlich bist du eine ganz angenehme Begleitung, wenn du nicht permanent einschläfst.“
Er grinst. „Aber?“
„Aber du quatschst hier zu viel, und du bist selbst beim Schlafen laut. Mir passiert hier nichts, Romeo. Ich beobachte immer die Lage und käme mir etwas komisch vor, würde ich dich sofort rufen. Außerdem habe ich ja meine Tarnung als graue Maus, und das einzig wirklich Auffällige an mir ist meine dauerübermüdete, grimmige Begleitung, an der so ziemlich alles nach Mafia schreit.“
„So siehst du mich also, ja?“
„Merda, ja.“
Er lacht. „Fluch nicht, das gehört sich nicht für eine Dame.“
„Ich bin keine Dame, sondern eine graue Maus. Schon vergessen?“
„Ich geh ja schon“, flüstert er und steht langsam auf. „Du bleibst genau hier ...“
„Ich bewege mich nicht von meinem Platz weg, und sobald mir etwas seltsam vorkommt, rufe ich dich.“
„Wie lange wirst du ungefähr brauchen?“ Er lässt mich wirklich allein. Ich kann es kaum glauben.
„Gib mir eine Stunde, ja?“ Er nickt und verlässt den Lesesaal.
Ich verliere mich völlig in einem Buch über Träume. Ich bin seit Wochen auf der Suche nach einem Ausweg aus meiner desaströsen Schlafsituation, die nichts mit der Einnahme irgendwelcher Medikamente zu tun hat. Die Tabletten, die ich damals auf Ekaterinas Geburtstag eingeworfen habe, haben zusammen mit dem Alkohol überhaupt erst zu meinem Gedächtnisverlust geführt, von dem ich immer noch nicht weiß, ob er das Beste oder Schlechteste ist, was mir passieren konnte. Ich seufze und fahre durch meine Haare. Es ist doch zum Verrücktwerden, dass es einfach keinen Trick zu geben scheint, mit dem ich diese schrecklichen Träume loswerden oder zumindest abmildern kann. Es ist einfach furchtbar unbefriedigend. Es ist anstrengend – psychisch, aber auch physisch. Es ist zermürbend, und ich wünsche mir abermals, ein-fach nur normal zu sein.
„Kein Happy End?“
Ich bin kein schreckhafter Mensch, auch nicht nach dem, was mir zugestoßen ist. Dennoch zucke ich zusammen. Es ist wieder der Mann, der auch schon letzte Woche hier gewesen ist. Entweder war ich so dermaßen vertieft in meine Lektüre, dass ich unaufmerksam geworden bin, oder er ist ein Meister darin, sich anzuschleichen. Seine Augen sind auf mich gerichtet und erst heute, wo er mir ein ganzes Stück näher sitzt, kann ich sie richtig erkennen. Sie sind dunkelgrau wie Granit.
„Nein, kein Happy End.“
„Du siehst nicht aus wie jemand, der auf Geschichten mit einem bösen Ende steht.“
Ich bekomme eine feine Gänsehaut auf meinen Unterarmen, während er seine Augen darüber und dann auf mein Buch gleiten lässt. Mein Mund wird plötzlich ganz trocken, mein Herzschlag beschleunigt sich und meine Handflächen werden schwitzig. Luca hat mich gelehrt, dass das Reaktionen auf Angst sind, doch ist es keine Angst, die meinen Körper zu diesen Reaktionen treibt. Es ist Aufregung, weil ich noch nie mit einem normalen Mann gesprochen habe.
„Sachbücher haben selten ein Happy End.“
Er fängt an zu lachen. Nicht leise oder zurückhaltend, sondern laut und aus vollem Halse. „Autsch!“
Auf dem Parkett hört man deutlich die schnellen Schritte der Bibliothekarin, die auf der Suche nach dem Unruhestifter bestimmt nach Romeo Ausschau hält. Ich halte mir den Zeigefinger vor den Mund. „Psst!“ Er tut es mir gleich, und nur ein kleines Lächeln huscht noch über seine Lippen, bevor die Furie bei uns ankommt und nach Romeo suchend durch die Tischreihen läuft. Sie räuspert sich und macht dann auf dem Absatz kehrt. Ich halte die Luft an, bis ich ihre Schritte nicht mehr hören kann, und erst dann traue ich mich, wieder auszuatmen und ihn anzusehen.
„Das war knapp. Danke.“
„Gern geschehen.“ Ich senke meinen Blick wieder in das Buch, weil ich auch gar nicht weiß, was ich sonst noch sagen sollte, obwohl ich eigentlich gerne noch etwas sagen würde. Es ist ja nicht so, als hätte ich sonst großartigen Kontakt zu Männern, die nicht zu einem der Clans gehören oder mit mir verwandt sind. Das hier sollte eigentlich die Normalität sein, die ich mir oft so sehr wünsche und so sehr ich diese völlig normale Situation hier genieße, so sehr wird mir auch wieder bewusst, wie wenig Ahnung ich eigentlich davon habe.
„Bist du öfter hier?“, spricht er mich nach einigen Minuten wieder an. „Ich habe dich letzte Woche schon gesehen.“
„Ich dich auch.“ Die Worte haben schneller meine Lippen verlassen, als ich darüber nachdenken konnte, und ich spüre die brennende Röte, die meine Wangen überzieht. Wie erbärmlich bin ich eigentlich? Unsere Mutter hätte mir und Emilia vielleicht die ein oder andere Lektion in Sachen Flirten geben sollen, als ihre vergebliche Liebesmühe mit unseren nicht vorhandenen Talenten in der Küche zu verschwenden. Aber wozu sollten wir flirten können? Das brauchen wir ohnehin nicht, wobei wir auch niemals selbst gemachte Tortellini oder Gnocchi servieren werden.
Er lächelt mich an, aber nicht so wie es jemand tut, der den anderen auslacht oder seltsam findet.
„Ich bin heute erst das zweite Mal hier. Eine beeindruckende Bibliothek.“
„Sie wurde 1895 gegründet. Das Gebäude ist sehr einnehmend.“
„Es ist sogar ziemlich einnehmend.“ Sein Blick ruht auf mir. „Ich hätte es kaum für möglich gehalten, dass es in dieser Stadt solche schönen Orte gibt.“ Er spricht über das Gebäude, aber es fühlt sich an, als würde er von mir reden.
„Bist du nicht von hier?“
„Nein. Ich bin vor Kurzem nach New York gezogen.“ Er spricht komplett akzentfrei, weswegen ich dadurch keinen Anhaltspunkt auf seine Herkunft bekomme, und auch sein Äußeres lässt nicht darauf schließen, wo er ursprünglich herkommt. Ich beschließe, nicht danach zu fragen, weil ich nicht zu neugierig wirken möchte.
„Es gibt einige schöne Ecken in der Stadt. Aber auch viele schlimme und hässliche.“
„Nun, ich kenne mich hier wirklich gar nicht aus.“ Seine Stimme ist die ganze Zeit gleichbleibend ruhig. Den meisten Menschen wäre sie vermutlich zu langweilig oder monoton, aber ich finde sie angenehm. Sie ist weder einschläfernd noch aufdringlich. Sie ist genau richtig, um ihr stundenlang zu lauschen. Er könnte gut vorlesen.
„Vielleicht könntest du mir ein paar schöne Ecken zeigen?“
Mir rutscht mein Herz in die Hose – gut, dass ich heute mal eine trage. Fragt er mich gerade nach einem Date? Gott, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Vermutlich will er sich einfach nur die Stadt ansehen, und ich interpretiere hier eine romantische Geschichte hinein. So eine belanglose Verabredung ist vermutlich das Normalste der Welt. Nur nicht in meiner.
„Oh, ich glaube nicht, dass ich eine gute Stadtführerin bin.“ Ein Treffen, selbst wenn es kein Date und ohne jeden Hintergedanken ist, ist einfach ganz unmöglich. Er könnte dafür sterben und weiß nicht mal etwas davon. Er hat nicht die geringste Ahnung, in welche Gefahr ihn bereits unser kleiner Plausch bringt.
„Schade“, sagt er nur und liest dann in seinem Buch weiter.
„Finde ich auch“, sage ich so leise, dass er mich nicht hören kann und lese dann auch weiter, bis meine Stunde um ist.
Das Wochenende war ereignislos. Seit Ekaterina bei uns lebt, sind die Wochenenden wenigstens nicht mehr ganz so monoton wie früher. Zu dritt dürfen wir in Begleitung der Bodyguards ausgehen, was wir auch oft genug ausnutzen. Wenn wir nicht in einem der unzähligen Restaurants der Stadt essen gehen oder unseren Abend im Kino oder einem der kleinen Theater verbringen, sind wir meistens trotzdem zusammen.





























