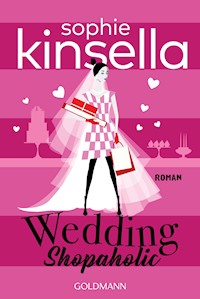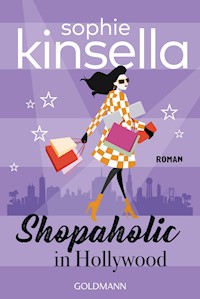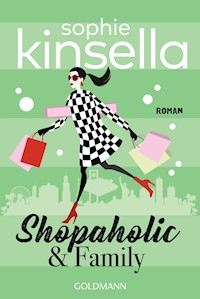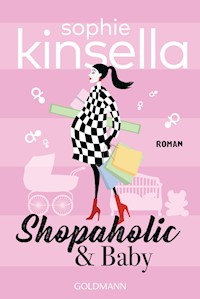7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Freundinnen und eine gute Tat mit unerwarteten Folgen – ein prickelnder Cocktail voller Überraschungen.
Drei junge Frauen arbeiten bei einem Londoner Magazin und treffen sich einmal im Monat, um bei ein paar Cocktails die letzten Neuigkeiten auszutauschen: Da ist die glamouröse, selbstbewusste Roxanne, die stets hofft, dass ihr heimlicher Liebhaber eines Tages seine Frau verlässt und sie heiratet. Die patente Maggie, die bisher noch alles im Leben perfekt gemeistert hat, bis ihre Mutterrolle sie zu überfordern droht. Und Candice – gutmütig und grundanständig. Zumindest glaubte sie das, bis eine alte Bekannte auftaucht, der Candice helfen möchte. Doch damit gerät ihr Leben komplett aus den Fugen. Aber zum Glück sind ja noch Roxanne und Maggie da ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Alle drei arbeiten sie bei demselben Londoner Magazin und sind trotz ihrer Unterschiedlichkeit seit Jahren unzertrennliche Freundinnen: die mondäne Roxanne, die einen verheirateten Liebhaber hat, die solide verheiratete Powerfrau Maggie und die ehrliche, stets an das Gute glaubende Candice. Es hat schon Tradition, dass sie sich einmal im Monat zu einem gemütlichen Drink in immer derselben Bar treffen, wo Candice eines Abends in der neuen Bedienung eine ehemalige Schulfreundin, Heather, erkennt. Es ist offensichtlich, dass Heather im Leben weniger Glück als sie selbst hatte, und Candice entschließt sich, ihr zu helfen. Nicht ganz uneigennützig, denn es gibt zwischen ihnen ein gemeinsames Band – ein unausgesprochenes Kindheitsgeheimnis, an dem Candice schwer trägt. Aber je mehr Erfolg die undurchsichtige Heather mit Hilfe ihrer neuen Freundin hat, desto erschreckendere Katastrophen treffen Candice. Hilflos muss sie mit ansehen, wie ihr Leben Stück für Stück in die Brüche geht. Doch in dieser schier ausweglosen Situation erweist es sich, wie belastbar wahre Freundschaft ist – und dass sie sich nicht im Cocktailtrinken erschöpft …
Weitere Informationen zu Sophie Kinsella
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Sophie Kinsella
Cocktails
für drei
Roman
Aus dem Englischen
von Jörn Ingwersen
Ich danke meiner Agentin Araminta Whitley sowie Linda Evans und Sally Gaminara und allen bei Transworld für ihre unermüdliche Begeisterung und Ermutigung während der Arbeit an diesem Buch. Außerdem danke ich meinen Eltern und Schwestern für ihren steten, heiteren Beistand und meinen Freunden Ana-Maria und George Mosley dafür, dass sie immer einen Cocktailshaker bereithalten.
Und schließlich ein dickes Dankeschön an meinen Mann Henry, ohne den es dieses Buch nicht geben würde und dem es gewidmet ist.
Kapitel Eins
Candice Brewin stieß die schwere Glastür der Manhattan Bar auf und spürte, wie sie von der vertrauten Woge aus Wärme, Lärm, Licht und Gläserklirren umfangen wurde. Es war sechs Uhr an einem Mittwochabend, und die Bar war schon fast voll. Kellner mit dunkelgrünen Fliegen schwebten über den polierten Boden und trugen Cocktails an die Tische. Junge Frauen in luftig leichten Kleidchen standen am Tresen und blickten aufgeweckt und hoffnungsfroh in die Runde. In der Ecke klimperte ein Pianist Gershwin-Songs, was im allgemeinen Geplapper beinah unterging.
Langsam wird es mir hier zu voll, dachte Candice, während sie ihren Mantel abstreifte. Als sie den Laden gemeinsam mit Roxanne und Maggie entdeckt hatte, war er ein stiller, fast verschwiegener Treffpunkt gewesen. Eher zufällig waren sie hineingestolpert, weil sie nach einem stressigen Tag in der Redaktion ganz schnell einen Drink brauchten. Damals war es noch eine düstere, altmodische Bar gewesen mit abgewetzten Hockern und einem abblätternden Wandgemälde der New Yorker Skyline. Die wenigen Gäste – überwiegend ältere Herren mit erheblich jüngerer, weiblicher Begleitung – unterhielten sich leise. Candice, Roxanne und Maggie hatten sofort eine Runde Cocktails bestellt und dann noch einige mehr, und als der Abend zu Ende ging, hatten sie kichernd und gackernd beschlossen, dass der Laden einen gewissen Charme besaß und man ihm dringend einen weiteren Besuch abstatten sollte. Und damit war der monatliche Cocktail-Club geboren.
Inzwischen hatte sich die Manhattan Bar, nachdem sie ausgebaut, neu eröffnet und in sämtlichen Hochglanzmagazinen gepriesen worden war, total verändert. Jetzt trafen sich dort täglich die Jungen und Schönen nach der Arbeit. Auch Prominente waren schon am Tresen gesichtet worden. Selbst die Kellner sahen aus wie Models. Wir sollten uns wirklich etwas anderes suchen, dachte Candice, als sie ihren Mantel der Garderobenfrau gab und dafür einen silbernen Art-déco-Knopf bekam. Irgendwas, wo weniger los war, was weniger angesagt war.
Gleichzeitig wusste sie, dass sie es niemals tun würden. Dafür kamen sie schon viel zu lange hierher, hatten sich schon viel zu viele Geheimnisse mit Martinis in der Hand anvertraut. Eine andere Bar wäre irgendwie nicht richtig. Am Ersten jeden Monats musste es einfach die Manhattan Bar sein.
An der Wand gegenüber hing ein Spiegel, und sie warf einen kurzen Blick hinein, um sicherzugehen, dass ihr kurzes Haar ordentlich aussah und ihr Make-up – das wenige, das sie benutzte – nicht verschmiert war. Sie trug einen schlichten, schwarzen Hosenanzug über einem hellgrünen T-Shirt – nicht gerade der letzte Schrei, aber gut genug.
Eilig suchte sie die Gesichter an den Tischen ab, konnte jedoch weder Roxanne noch Maggie finden. Obwohl sie alle drei für dieselbe Zeitschrift arbeiteten – den Londoner –, kam es nur selten vor, dass sie nach der Arbeit gemeinsam etwas unternahmen. Roxanne zum Beispiel war freie Mitarbeiterin und kam nur gelegentlich ins Büro, um ihre Auslandsreisen zu organisieren. Und Maggie musste als Chefredakteurin oft noch länger als die anderen für Besprechungen dortbleiben.
Heute aber nicht, dachte Candice bei einem Blick auf ihre Armbanduhr. Heute hatte Maggie allen Grund, so früh Schluss zu machen, wie sie wollte.
Sie strich ihren Hosenanzug glatt und steuerte auf die Tische zu, und als sie ein Pärchen entdeckte, das gerade gehen wollte, machte sie sich eilig auf den Weg dorthin. Der junge Mann war kaum aufgestanden, als sie sich schon auf seinen Stuhl gleiten ließ und dankbar zu ihm auflächelte. Wenn man in der Manhattan Bar einen Tisch ergattern wollte, durfte man nicht zögern. Und die drei saßen immer an einem Tisch. Das war Tradition.
Maggie Phillips blieb draußen vor dem Eingang der Manhattan Bar stehen, stellte ihre pralle Tragetasche mit den bunten Stofftieren ab und zupfte ungeniert an ihrer Schwangerschaftsstrumpfhose herum, die um die Beine Falten schlug. Noch drei Wochen, dachte sie mit einem letzten Ruck. Drei Wochen noch in diesen verdammten Dingern. Sie holte tief Luft, griff nach ihrer Tragetasche und stieß die Tür auf.
Sobald sie drinnen war, wurde ihr vom Lärm und der Wärme ganz schwindlig. Sie stützte sich an der Wand ab und stand ganz still, um nicht umzukippen, während sie die Punkte vor ihren Augen wegblinzelte.
»Alles in Ordnung, Liebes?«, erkundigte sich eine Stimme links von ihr. Maggie drehte den Kopf und sah das freundliche Gesicht der Garderobenfrau.
»Alles okay«, sagte sie und lächelte etwas bemüht.
»Sind Sie sicher? Möchten Sie vielleicht ein Glas Wasser?«
»Nein, wirklich, es geht schon.« Wie zum Beweis begann sie, sich aus ihrem Mantel zu schälen, und bemerkte den bewundernden Blick, den die Frau auf ihre Figur warf. Die schwarze Lycra-Hose mit dem Umhang war so vorteilhaft, wie Schwangerschaftskleidung nur sein konnte. Und doch war es da, direkt vor ihr, wohin sie auch ging. Eine Beule von der Größe eines Heißluftballons. Maggie reichte der Frau ihren Mantel und sah ihr offen in die Augen.
Wenn sie mich fragt, wann es so weit ist, dachte sie, bringe ich sie um.
»Wann ist es denn so weit?«
»Am 25. April«, sagte Maggie munter. »Drei Wochen noch.«
»Tasche schon gepackt?« Die Frau zwinkerte ihr zu. »Damit sollte man nicht bis zur letzten Minute warten, oder?« Maggies Haut fing an zu kribbeln. Was ging es irgendwen an, ob sie ihre Tasche gepackt hatte oder nicht? Wieso redeten eigentlich alle davon? In der Mittagspause war ein wildfremder Mann im Pub auf sie zugekommen, hatte auf ihr Weinglas gezeigt und gesagt: »Wie kann man nur!« Fast hätte sie es ihm ins Gesicht geschüttet.
»Es ist Ihr erstes Kind, nicht wahr?«, fügte die Garderobenfrau hinzu, ohne es allzu sehr nach einem Verhör klingen zu lassen.
So offensichtlich ist es also, dachte Maggie. Dem Rest der Welt ist klar, dass ich, Maggie Phillips – oder Mrs Drakeford, wie man mich in der Klinik kennt – so gut wie noch nie ein Baby im Arm hatte. Geschweige denn, dass ich eins zur Welt gebracht hätte.
»Ja, es ist mein erstes«, sagte sie und hielt der Frau die Hand hin, um den silbernen Garderobenknopf entgegenzunehmen und endlich dort wegzukommen. Doch die Frau betrachtete nach wie vor liebevoll Maggies prallen Bauch.
»Ich habe selbst vier«, sagte sie. »Drei Mädchen und einen Jungen. Und jedes Mal waren die ersten paar Wochen etwas ganz Besonderes. Genießen Sie die Zeit, Liebes. Sie geht viel zu schnell vorbei.«
»Ich weiß«, hörte sich Maggie sagen, mit aufgesetztem Lächeln.
Ich weiß überhaupt nichts!, wollte sie schreien. Ich verstehe nichts davon. Ich verstehe was von Seitenlayout und Umfangsanalysen und Verlagsbudgets. Oh Gott. Was mache ich nur?
»Maggie!« Eine Stimme unterbrach sie, und sie fuhr herum. Candice lächelte sie mit ihrem runden, fröhlichen Gesicht an. »Dachte ich mir doch, dass du es bist! Ich habe uns einen Tisch organisiert.«
»Sehr gut!« Maggie folgte Candice durch die Menge, war sich der Schneise durchaus bewusst, die sie mit ihrem dicken Bauch schlug, und auch der neugierigen Blicke, die ihr folgten. Niemand sonst in dieser Bar war schwanger. Es war noch nicht mal jemand dick. Wohin sie auch blickte, sah sie nur Frauen mit flachen Bäuchen und schlanken Beinen und kecken kleinen Brüsten.
»Okay?« Candice war am Tisch angekommen und schob ihr vorsichtig einen Stuhl hin. Maggie verkniff sich die Bemerkung, dass sie nicht krank sei, und setzte sich.
»Wollen wir uns schon was bestellen?«, fragte Candice. »Oder auf Roxanne warten?«
»Ach, ich weiß nicht.« Maggie zuckte mürrisch mit den Schultern. »Vielleicht warten wir lieber.«
»Bist du okay?«, fragte Candice ehrlich interessiert. Maggie seufzte.
»Es geht mir gut. Ich habe es nur satt, schwanger zu sein. Betatscht und getätschelt und wie ein Mutant behandelt zu werden.«
»Ein Mutant?«, fragte Candice ungläubig. »Maggie, du siehst fantastisch aus!«
»Fantastisch für eine fette Frau.«
»Fantastisch. Punkt«, sagte Candice mit fester Stimme. »Hör mal, Maggie – bei mir gegenüber wohnt eine Frau, die ebenfalls schwanger ist. Und ich sage dir, wenn die sehen könnte, wie du aussiehst, würde sie vor Neid platzen.«
Maggie lachte. »Candice, du bist ein Schatz. Du sagst immer genau das Richtige.«
»Aber es stimmt!« Candice nahm die Cocktail-Karte – groß, mit grünem Leder und silbernen Troddeln. »Jetzt komm, wir werfen schon mal einen Blick darauf. Roxanne kommt bestimmt bald.«
Roxanne Miller stand in der Damentoilette der Manhattan Bar, beugte sich vor und zeichnete ihre Lippen mit einem zimtfarbenen Stift nach. Sie kniff den Mund zusammen, dann trat sie zurück und unterzog ihr Spiegelbild einer kritischen Betrachtung, angefangen – wie immer – mit ihren Vorzügen. Hübsche Wangenknochen. Die Wangenknochen konnte einem niemand nehmen. Blaue Augen, etwas gerötet, die Haut nach drei Wochen in der Karibik braun gebrannt. Die Nase nach wie vor lang, nach wie vor krumm. Wallendes, dunkelblondes Haar, das von einem perlenbesetzten Kamm gehalten wurde. Vielleicht wallte es etwas zu wild. Roxanne suchte in ihrer Tasche nach einer Bürste und fing an, es zu bändigen. Sie trug – wie so oft – ein weißes T-Shirt. Ihrer Meinung nach gab es nichts auf der Welt, was Sonnenbräune besser hervorhob als ein schlichtes weißes Shirt. Sie steckte die Bürste weg und lächelte, da sie unwillkürlich von ihrem eigenen Spiegelbild beeindruckt war.
Dann rauschte hinter ihr eine Toilettenspülung, und eine Kabinentür ging auf. Ein etwa neunzehnjähriges Mädchen trat heraus und stellte sich neben Roxanne, um sich die Hände zu waschen. Sie hatte helle, glatte Haut und dunkle, träumerische Augen, das Haar fiel glatt auf ihre Schultern, wie die Fransen eines Lampenschirms. Ein Mund wie eine Pflaume. Nicht das geringste Make-up. Das Mädchen fing Roxannes Blick auf und lächelte, dann ging es hinaus.
Als sich die Schwingtür geschlossen hatte, stand Roxanne noch immer da und starrte sich im Spiegel an. Plötzlich kam sie sich vor wie eine aufgetakelte Fregatte. Eine dreiunddreißigjährige Frau, die sich viel zu sehr mit ihrem Äußeren beschäftigte. Im selben Augenblick wich alles Leben aus ihrem Gesicht. Ihre Mundwinkel sanken herab, und das Leuchten verschwand aus ihren Augen. Leidenschaftslos fiel ihr Blick auf die kleinen roten Äderchen, die sich über ihre Wangen zogen. Sonnenschaden nannte man so was. Schadhafte Ware.
Da hörte sie die Tür, und ihr Kopf fuhr herum.
»Roxanne!« Maggie kam auf sie zu, mit sonnigem Lächeln im Gesicht. Ihr nussbrauner Bob schimmerte im Licht.
»Süße!« Roxanne strahlte sie an und warf ihr Make-up-Täschchen in eine größere Prada-Tasche. »Ich war gerade dabei, mich aufzuhübschen.«
»Völlig überflüssig!«, sagte Maggie. »Sieh dir an, wie braun du bist!«
»Kommt von der karibischen Sonne«, sagte Roxanne fröhlich.
»Behalt’s für dich«, sagte Maggie und hielt sich die Ohren zu. »Das will ich alles gar nicht wissen. Es ist einfach total unfair. Wieso habe ich als Redakteurin eigentlich nie auch nur einen einzigen Reiseartikel geschrieben? Wie konnte ich nur so blöd sein!« Sie deutete mit dem Kopf zur Tür. »Geh und leiste Candice Gesellschaft. Ich komm gleich nach.«
Als sie die Bar betrat, sah Roxanne, dass Candice dort allein saß und die Cocktail-Karte studierte. Unwillkürlich musste sie lächeln. Candice sah immer gleich aus, wo sie auch war, was sie auch trug. Ihre Haut wirkte immer frisch geschrubbt und leuchtend, ihre Haare waren immer ordentlich kurz geschnitten, und wenn sie lächelte, hatte sie immer Grübchen an denselben Stellen. Und immer blickte sie mit denselben großen, vertrauensvollen Augen auf. Kein Wunder, dass sie so gut Leute interviewen konnte, dachte Roxanne. Man taumelte geradezu in diesen freundlichen Blick hinein.
»Candice!«, rief sie und wartete darauf, dass ihre Freundin den Kopf heben, sie erkennen und lächeln würde.
Es war schon merkwürdig, dachte Roxanne. Sie konnte ganz und gar unberührt an jedem noch so süßen Baby vorbeispazieren, ohne dass jemals ihr Mutterinstinkt geweckt wurde. Aber manchmal, wenn sie Candice ansah, versetzte es ihrem Herzen einen Stich. Dann überkam sie ein obskurer Drang, dieses Mädchen mit dem runden Gesicht und der kindlichen Stirn zu beschützen. Aber wovor? Vor der Welt? Vor finsteren, übelwollenden Fremden? Im Grunde war es lächerlich. Wie groß war denn der Altersunterschied zwischen ihnen? Doch höchstens vier oder fünf Jahre. Die meiste Zeit schien er gar nicht zu existieren, trotzdem kam sich Roxanne manchmal eine ganze Generation älter vor.
Sie trat an den Tisch und gab Candice ein Küsschen rechts und links auf die Wange.
»Hast du schon bestellt?«
»Ich guck noch«, sagte Candice und deutete auf die Karte. »Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Summer Sunset und Urban Myth.«
»Nimm einen Urban Myth«, sagte Roxanne. »Summer Sunset ist knallrosa und kommt mit einem Schirmchen.«
»Wirklich?« Candice runzelte die Stirn. »Ist das schlimm? Was nimmst du denn?«
»Margarita«, sagte Roxanne. »Wie immer. Auf Antigua habe ich mich von Margaritas ernährt.« Sie langte nach ihren Zigaretten, dann dachte sie an Maggie und ließ es sein. »Margaritas und Sonnenschein. Mehr braucht man nicht.«
»Und … wie war’s denn so?«, fragte Candice. Mit blitzenden Augen beugte sie sich vor. »Irgendwelche jungen Kavaliere …?«
»Ich kann nicht klagen«, sagte Roxanne und grinste sie verschlagen an. »Unter anderem ein Wiederholungstäter.«
»Du bist unmöglich!«, sagte Candice.
»Ganz im Gegenteil«, sagte Roxanne. »Ich bin richtig gut. Deshalb mögen sie mich. Deshalb kommen sie wieder, weil sie mehr wollen.«
»Was macht dein …?«, Candice stockte betreten.
»Was macht mein Mister Verheiratet mit Kindern?«, fragte Roxanne unbeschwert.
»Ja«, sagte Candice leicht errötend. »Macht es ihm denn nichts, wenn du …?«
»Mister Verheiratet mit Kindern darf nichts dagegen haben«, sagte Roxanne. »Mr Verheiratet mit Kindern hat schließlich seine Frau. Da ist es doch nur fair, wenn ich auch ein bisschen Spaß habe, findest du nicht?« Sie funkelte Candice an, als wollte sie weitere Fragen im Keim ersticken, und Candice kniff den Mund zusammen. Roxanne wollte nie über ihren Freund sprechen. Sie war schon mit ihm zusammen, seit Candice sie kannte, hatte sich aber stets strikt geweigert, seine Identität und irgendwelche Details über ihn preiszugeben. Candice und Maggie hatten im Scherz gemutmaßt, es müsse wohl jemand sein, der berühmt war – vielleicht sogar ein Politiker – und wohlhabend, einflussreich und sexy noch dazu. Roxanne würde sich nie im Leben einem mittelmäßigen Mann an den Hals werfen. Nicht ganz so sicher waren sie in der Frage, ob sie ihn wirklich liebte. Sie klang immer so leichtfertig, fast lieblos, was diese Affäre anging, als benutzte sie ihn und nicht er sie.
»Hör zu, es tut mir leid«, sagte Roxanne und nahm ihre Zigaretten. »Fötus hin oder her. Ich brauche eine Zigarette.«
»Ach, rauch nur«, sagte Maggie, die hinter ihr an den Tisch trat. »Das kann auch nicht mehr schaden als die Umweltverschmutzung.« Als sie sich setzte, winkte sie einer Kellnerin. »Hi. Ja, wir können jetzt bestellen.«
Zielstrebig kam das blonde Mädchen mit der grünen Weste zu ihnen herüber. Candice musterte sie aufmerksam. Irgendwie kam sie ihr bekannt vor – die gewellten Haare, die Stupsnase, die grauen Augen mit den müden Schatten. Selbst die Art und Weise, wie sie ihre Haare von den Schultern strich, kam ihr bekannt vor. Wo um alles in der Welt hatte sie diese Frau schon mal gesehen?
»Stimmt was nicht?«, fragte die Kellnerin.
»Nein. Ich meine … Äh …« Candice lief rot an, schlug eilig die Cocktail-Karte wieder auf und ließ ihren Blick über die Liste schweifen, ohne eigentlich hinzusehen. In der Manhattan Bar konnte man über hundert verschiedene Cocktails bekommen. Manchmal war ihr die Auswahl fast zu groß. »Einen Mexican Swing, bitte.«
»Für mich eine Margarita«, sagte Roxanne.
»Oh, Gott, ich weiß nicht, was ich nehmen soll«, sagte Maggie. »Ich hatte heute Mittag schon Wein …«
»Eine Virgin Mary?«, schlug Candice vor.
»Bestimmt nicht.« Maggie verzog das Gesicht. »Ach, scheiß drauf. Einen Shooting Star.«
»Gute Wahl«, sagte Roxanne. »Soll sich das Kind gleich mal an den Alkohol im Blut gewöhnen. Und jetzt …« Sie griff in ihre Tasche. »Zeit für die Geschenke!«
»Für wen?«, fragte Maggie und blickte überrascht auf. »Nicht für mich. Ich habe heute schon Berge von Geschenken bekommen. Viel zu viele. Und außerdem etwa fünftausend Mothercare-Gutscheine …«
»Mothercare-Gutscheine?«, sagte Roxanne verächtlich. »Das ist doch kein Geschenk!« Sie holte eine kleine, türkisblaue Schachtel hervor und legte sie auf den Tisch. »Das hier ist ein richtiges Geschenk.«
»Tiffany?«, fragte Maggie ungläubig. »Ehrlich? Tiffany?« Ungeschickt öffnete sie mit ihren geschwollenen Händen die Schachtel und holte etwas Silbernes aus dem kleinen Beutel. »Ich fass es nicht! Eine Rassel!« Sie schüttelte sie, und alle grinsten mit kindlicher Begeisterung.
»Lass mich mal probieren!«, sagte Candice.
»Es wird das mondänste Baby weit und breit sein«, sagte Roxanne mit zufriedener Miene. »Wenn es ein Junge wird, besorg ich ihm noch die passenden Manschettenknöpfe.«
»Die ist wundervoll …«, sagte Candice und starrte die Rassel bewundernd an. »Daneben wirkt mein Geschenk eher … na ja, egal.« Sie legte die Rassel weg und fing an, in ihrer Tasche herumzuwühlen. »Ich habe es hier irgendwo …«
»Candice Brewin!«, sagte Roxanne vorwurfsvoll. »Was hast du da in deiner Tasche?«
»Wie?«, fragte Candice und blickt schuldbewusst auf.
»Noch mehr Geschirrtücher! Und einen Schwamm.« Roxanne zog den Stein des Anstoßes aus der Tasche und hielt ihn hoch. Es waren zwei blaue Tücher und ein gelber Schwamm, in Plastikfolie, mit der Aufschrift Young People’s Cooperative. »Wie viel hast du für die Dinger bezahlt?«, wollte Roxanne wissen.
»Nicht viel«, sagte Candice sofort. »Fast nichts. Ungefähr … fünf Pfund.«
»Also zehn«, sagte Maggie und warf Roxanne einen ungeduldigen Blick zu. »Was sollen wir bloß mit ihr machen? Candice, du hast mittlerweile doch bestimmt schon deren gesamten Vorrat aufgekauft!«
»Na ja, die kann man doch immer brauchen, oder? Geschirrtücher?«, sagte Candice und wurde rot. »Und ich kann einfach so schlecht Nein sagen.«
»Genau«, sagte Maggie. »Du tust es nicht, weil du es für eine gute Sache hältst. Du tust es, weil du dich sonst ganz mies fühlen würdest.«
»Ist das nicht dasselbe?«, erwiderte Candice.
»Nein«, sagte Maggie. »Das eine ist positiv, und das andere ist negativ. Oder … was weiß ich.« Sie verzog das Gesicht. »Oh Gott, ich bin schon ganz durcheinander. Ich brauche dringend einen Cocktail.«
»Ist doch egal«, sagte Roxanne. »Entscheidend ist nur: keine Geschirrtücher mehr!«
»Okay, okay«, sagte Candice und stopfte die Päckchen wieder in ihre Tasche. »Keine Geschirrtücher mehr. Und hier ist mein Geschenk!« Sie holte einen Umschlag hervor und reichte ihn Maggie. »Du kannst es machen, wann du willst.«
Alle schwiegen, während Maggie den Umschlag öffnete und eine rosarote Karte hervorholte.
»Eine Aromatherapie-Massage«, las sie ungläubig vor. »Du schenkst mir eine Massage.«
»Ich dachte, so was könnte dir gefallen«, sagte Candice. »Bevor du das Baby bekommst oder danach … Die kommen zu dir nach Hause, du musst nicht mal vor die Tür …« Maggie blickte auf, und ihre Augen glänzten ein wenig.
»Das ist das einzige Geschenk, das ich bekommen habe. Ich – nicht das Baby.« Sie beugte sich über den Tisch und schloss Candice in die Arme. »Danke, meine Süße.«
»Du wirst uns wirklich fehlen«, sagte Candice. »Bleib nicht zu lange weg.«
»Na, ihr müsst mich besuchen kommen!«, sagte Maggie. »Und das Baby.«
»Auf deinem Landgut«, sagte Roxanne sarkastisch. »Dem Palast der Mrs Drakeford.« Sie grinste Candice an, die sich ihr Lachen verkneifen musste.
Als Maggie vor einem Jahr verkündet hatte, sie würde mit ihrem Mann Giles ein Cottage auf dem Land beziehen, hatte Candice sich ein schrulliges Häuschen mit schiefen Fenstern und einem ummauerten Garten vorgestellt, irgendwo mitten in einem Dorf.
Die Wahrheit sah ganz anders aus. Wie sich herausstellte, lag Maggies neues Haus – The Pines – am Ende einer langen, von Bäumen gesäumten Auffahrt. Es hatte acht Schlafzimmer, einen Billardsalon und einen Swimmingpool. Denn – was keiner ahnte – Maggie hatte heimlich einen Millionär geheiratet.
»Das hast du uns nie erzählt!«, hatte Candice vorwurfsvoll gesagt, als sie in der riesigen Küche saßen und Tee tranken. »Du hast uns nie erzählt, dass ihr im Geld schwimmt!«
»Wir schwimmen nicht darin!«, hatte Maggie sich verteidigt und ihren Emma-Bridgewater-Becher umklammert. »Es ist nur … auf dem Land sieht alles irgendwie größer aus.« Diese Bemerkung sollte sie nie mehr vergessen.
»Auf dem Land …«, setzte Roxanne gerade an, schnaubend vor Lachen. »Sieht alles irgendwie größer aus …«
»Ach, lass mich doch in Ruhe«, sagte Maggie gutmütig. »Guck mal, da kommen unsere Cocktails.«
Die blonde Kellnerin kam auf sie zu, trug ihr Silbertablett mit der flachen Hand. Drei Gläser balancierten darauf. Ein Margarita-Glas mit Salzrand, ein Highball-Glas, verziert mit einer aufgeschnittenen Limettenscheibe, und eine Champagnerflöte, die mit einer Erdbeere geschmückt war.
»Sehr stilvoll«, murmelte Roxanne. »Keine Kirsche weit und breit.«
Die junge Frau stellte die Gläser geschickt auf Papieruntersetzer, fügte ein Silberschälchen mit gesalzenen Mandeln hinzu und legte die Rechnung diskret – versteckt in einem grünen Ledermäppchen – an den Rand des Tisches. Als sie sich aufrichtete, sah Candice ihr noch einmal ins Gesicht und versuchte, sich zu erinnern. Irgendwoher kannte sie diese Frau. Da war sie ganz sicher. Aber woher?
»Vielen Dank«, sagte Maggie.
»Gern geschehen«, sagte die Kellnerin und lächelte, und als sie das tat, wusste Candice augenblicklich, wer sie war.
»Heather Trelawney«, stieß sie hervor, ehe sie es verhindern konnte. Und dann, als sich die Frau ihr langsam zuwandte, wünschte sie von ganzem Herzen, sie hätte es nicht getan.
Kapitel Zwei
»Tut mir leid«, sagte die Kellnerin. »Kennen wir …?« Sie stutzte, kam einen Schritt näher und sah sich Candice genauer an. Plötzlich leuchteten ihre Augen. »Natürlich!«, sagte sie. »Candice, oder? Candice …« Sie runzelte die Stirn. »Entschuldige, ich habe deinen Nachnamen vergessen.«
»Brewin«, sagte Candice tonlos, brachte die beiden Silben kaum heraus. Ihr Name schien in der Luft zu hängen wie eine Zielscheibe. Brewin. Als sie sah, wie Heather nachdenklich die Stirn runzelte, wartete Candice auf das Erkennen, den Zorn und die Beschuldigungen. Wieso hatte sie nicht einfach den Mund gehalten? Würde die Frau ihr hier eine Szene machen?
Doch als Heathers Miene sich entspannte, wurde deutlich, dass sie in Candice nur die alte Mitschülerin sah. Wusste sie es nicht?, dachte Candice ungläubig. Wusste sie es denn nicht?
»Candice Brewin!«, sagte Heather. »Stimmt! Ich hätte dich eigentlich gleich erkennen sollen!«
»Das ist ja lustig!«, sagte Maggie. »Woher kennt ihr zwei euch?«
»Wir sind auf dieselbe Schule gegangen«, meinte Heather fröhlich. »Es muss Jahre her sein, dass wir uns zuletzt gesehen haben.« Sie sah Candice noch einmal neugierig an. »Irgendwie bist du mir bekannt vorgekommen, als ich die Bestellung aufgenommen habe, aber … ich weiß nicht. Du siehst irgendwie anders aus. Aber seit damals haben wir uns wahrscheinlich alle verändert.«
»Wahrscheinlich«, sagte Candice. Sie nahm ihr Glas und nippte daran, um ihr rasendes Herz zu beruhigen.
»Ich weiß, es klingt schrecklich«, flüsterte Heather, »aber wenn man eine Weile gekellnert hat, sieht man sich die Gesichter der Gäste nicht mehr an. Ist das nicht furchtbar?«
»Das kann man wohl niemandem vorwerfen«, sagte Maggie. »Ich möchte unsere Gesichter auch nicht sehen.«
»Deins vielleicht nicht«, erwiderte Roxanne sofort und grinste Maggie an.
»Einmal habe ich eine Bestellung von Simon Le Bon aufgenommen«, sagte Heather. »Nicht hier, in meinem alten Laden. Und nicht mal gemerkt, wer er war. Als ich in die Küche kam, meinten alle: ›Wie ist er denn so?‹, und ich wusste gar nicht, wen sie meinten.«
»Recht so«, sagte Roxanne. »Es tut diesen Leuten ganz gut, wenn sie mal nicht erkannt werden.«
Maggie warf einen Blick zu Candice hinüber. Wie erstarrt glotzte diese Heather an. Was hatte sie bloß?
»Und …«, sagte Candice, »arbeitest du schon lange hier?«
»Seit zwei Wochen«, sagte Heather. »Ist ein hübscher Laden, oder? Aber viel zu tun.« Sie sah zum Tresen hinüber. »Apropos, ich sollte lieber weitermachen. Schön, dich zu sehen, Candice.«
Sie wollte schon gehen, als Candice spürte, dass Panik in ihr aufstieg.
»Warte!«, sagte sie. »Wir haben uns doch noch gar nicht richtig unterhalten.« Sie schluckte. »Willst du dich … nicht einen Moment zu uns setzen?«
»Na okay«, sagte Heather nach kurzer Überlegung. Wieder sah sie zum Tresen hinüber. »Aber ich kann nicht lange bleiben. Wir müssen so tun, als würde ich euch bei den Cocktails beraten oder so.«
»Wir brauchen keinen Rat«, sagte Roxanne. »Wir sind die Cocktail-Queens.« Heather lachte leise.
»Mal sehen, ob ich einen Stuhl auftreiben kann«, sagte sie. »Bin gleich wieder da.«
Sobald sie weg war, wandte sich Maggie Candice zu.
»Was ist denn los?«, zischte sie. »Wer ist diese Frau? Du starrst sie an, als hättest du ein Gespenst gesehen!«
»Ist das so offensichtlich?«, sagte Candice betrübt.
»Süße, du siehst aus wie Hamlet, nachdem ihm der Geist seines Vaters erschienen ist«, sagte Roxanne trocken.
»Oh Gott«, seufzte Candice. »Und ich dachte, ich halte mich ganz gut.« Mit zitternder Hand hob sie ihren Cocktail an und nahm einen Schluck. »Prost, ihr Lieben!«
»Vergiss die Prosterei!«, sagte Maggie. »Wer ist sie?«
»Sie ist …« Candice rieb an ihrer Stirn herum. »Es ist Jahre her. Wir waren auf derselben Schule. Sie … sie war ein paar Jahre unter mir.«
»Und?«, hakte Maggie ungeduldig nach.
»Hi!«, ging Heathers fröhliche Stimme dazwischen, und alle blickten schuldbewusst auf. »Endlich habe ich einen Stuhl auftreiben können.« Sie schob ihn an den Tisch und setzte sich. »Sind die Cocktails gut?«
»Wunderbar!«, sagte Maggie und nippte an ihrem Shooting Star. »Genau das, was die Hebamme empfiehlt.«
»Und … was treibst du so?«, fragte Heather Candice.
»Ich bin Journalistin«, sagte Candice.
»Wirklich?« Wehmütig sah Heather sie an. »So was würde ich auch gern machen. Schreibst du für eine Zeitung?«
»Eine Zeitschrift. Den Londoner.«
»Die kenne ich!«, sagte Heather. »Wahrscheinlich habe ich schon Artikel von dir gelesen.« Sie sah sich am Tisch um. »Seid ihr alle Journalistinnen?«
»Ja«, sagte Maggie. »Wir arbeiten zusammen.«
»Mein Gott, das macht bestimmt Spaß.«
»Manchmal ja«, sagte Maggie und grinste Roxanne an. »Manchmal nein.«
Es folgte kurzes Schweigen, dann sagte Candice mit leichtem Beben in der Stimme: »Und du, Heather? Was hast du seit der Schule so getrieben?« Sie nahm noch einen großen Schluck von ihrem Cocktail.
»Ach, na ja …« Heather lächelte kurz. »Es war alles nicht so toll. Ich weiß ja nicht, ob du es weißt, aber ich musste Oxdowne damals verlassen, weil mein Vater unser ganzes Geld verloren hat.«
»Wie schrecklich!«, sagte Maggie. »Wie denn? Über Nacht?«
»Mehr oder weniger«, sagte Heather. Ihre grauen Augen wurden etwas dunkler. »Irgendein Investment ging schief. Irgendwas am Aktienmarkt. Mein Dad hat nie genau gesagt, woran es lag. Aber das war es dann. Wir konnten die Schulgebühren nicht mehr bezahlen. Und auch das Haus nicht. Es war alles ziemlich finster. Mein Dad war schrecklich deprimiert, und meine Mum gab ihm die Schuld für alles …« Sie schwieg betreten. »Na ja, wie dem auch sei.« Sie nahm einen Untersetzer und fing an, damit herumzuspielen. »Am Ende haben sie sich getrennt.«
Maggie betrachtete Candice, um zu sehen, wie sie reagierte, doch diese hatte sich abgewandt. Sie hielt einen Cocktailquirl in der Hand und rührte überschüssige Kohlensäure aus ihrem Drink.
»Und was wurde aus dir?«, erkundigte sich Maggie vorsichtig bei Heather.
»Ich habe mehr oder weniger auch alles verloren.« Heather lächelte. »Eben ging ich noch mit all meinen Freunden auf eine elitäre Privatschule. Im nächsten Moment zogen wir in eine Stadt, in der ich keinen kannte, und meine Eltern stritten sich die ganze Zeit, und ich kam auf eine Schule, in der sie mir das Leben schwermachten, weil ich mich so vornehm ausdrückte.« Sie seufzte und ließ den Untersetzer los. »Ich meine, rückblickend war diese Gesamtschule eigentlich ganz gut. Ich hätte durchhalten und auf die Uni gehen sollen … hab ich aber nicht. Sobald ich sechzehn war, bin ich abgegangen.« Sie strich ihr dickes, gewelltes Haar zurück. »Mein Dad wohnte inzwischen in London, also bin ich zu ihm gezogen und habe einen Job in einem Weinlokal gefunden. Und das war es eigentlich schon. Ich habe keinen Abschluss oder irgendwas.«
»Wie schade«, sagte Maggie. »Was hättest du denn machen wollen, wenn du durchgehalten hättest?«
»Ach, ich weiß nicht«, sagte Heather. Sie lachte bedrückt. »Das, was ihr macht, vielleicht. Journalistin werden oder so. Ich habe mal einen Creative-Writing-Kurs am Goldsmiths College belegt, musste ihn aber aufgeben.« Sie sah sich in der Bar um und zuckte mit den Schultern. »Ich meine, ich arbeite gern hier. Aber es ist nicht wirklich … na ja.« Sie stand auf und zupfte an ihrer grünen Weste herum. »Ich sollte mich lieber wieder an die Arbeit machen, sonst bringt André mich um. Bis später!«
Als sie ging, saßen die drei schweigend da und sahen ihr hinterher. Dann wandte sich Maggie zu Candice um und sagte vorsichtig: »Sie scheint ganz nett zu sein.«
Candice antwortete nicht. Maggie sah Roxanne fragend an, die aber auch nur die Augenbrauen hochzog.
»Candice, was ist los?«, fragte Maggie. »War irgendwas zwischen dir und Heather?«
»Süße, sprich mit uns«, sagte Roxanne.
Candice reagierte nicht, rührte nur immer weiter in ihrem Cocktail herum, schneller und immer schneller, bis er über den Glasrand zu schwappen drohte. Dann sah sie ihre Freundinnen an.
»Es war nicht der Aktienmarkt«, sagte sie mit hohler Stimme. »Nicht der Aktienmarkt hat Frank Trelawney in den Ruin getrieben, sondern mein Vater.«
Heather Trelawney stand am Ende des Tresens und betrachtete Candice Brewins Gesicht durch die Menge. Sie war wie gebannt. Gordon Brewins Tochter, die in voller Lebensgröße dort mit ihren Freundinnen am Tisch saß. Mit ihrer schicken Frisur und ihrem guten Job und Geld für Cocktails jeden Abend. Ahnte offensichtlich nichts davon, wie viel Leid ihr Vater über andere gebracht hatte. Ahnte rein gar nichts, nahm nur sich selbst wahr.
Denn für sie war es ja gut gelaufen, oder? Natürlich war es das. »Good-Time Gordon« hatte es schlau angestellt. Er hatte nie sein eigenes Geld benutzt, nie sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Nur das anderer Leute. Anderer gutgläubiger Trottel, die zu gierig waren, um Nein zu sagen. Wie ihr armer, unbesonnener, dummer Dad. Bei diesem Gedanken biss Heather die Zähne zusammen, und ihre Hände krallten sich um das silberne Tablett.
»Heather!« Es war André, der Oberkellner, der sie vom Tresen her rief. »Was stehst du da rum? Die Gäste warten!«
»Komme schon!«, rief Heather zurück. Sie stellte das Tablett ab, schüttelte ihre Haare aus und band sie mit einem Gummi zusammen. Dann nahm sie ihr silbernes Tablett und ging entschlossen zum anderen Ende des Tresens, ohne ihren Blick auch nur einen Moment von Candice Brewin abzuwenden.
»Alle nannten ihn nur ›Good-Time Gordon‹«, sagte Candice mit bebender Stimme. »Er war immer da, wo es was zu feiern gab. Der Mittelpunkt jeder Party.« Sie nahm noch einen Schluck von ihrem Cocktail. »Bei jeder Schulveranstaltung, jedem Sportereignis. Ich dachte immer, es läge daran, dass er … na ja, dass er stolz auf mich war. Aber eigentlich wollte er nur Geschäftskontakte knüpfen. Frank Trelawney war nicht der Einzige. Er hat alle unsere Freunde geködert, alle unsere Nachbarn …« Ihre Hand krampfte sich um das Glas. »Sie tauchten alle nach der Beerdigung auf. Einige hatten bei ihm investiert, andere hatten ihm Geld geliehen …« Sie nahm einen großen Schluck von ihrem Cocktail. »Es war das Grauen. Diese Leute waren unsere Freunde. Und meine Mutter und ich haben von alldem keine Ahnung gehabt.«
Roxanne und Maggie sahen sich an.
»Woher weißt du, dass Heathers Vater darin verwickelt war?«, fragte Maggie.
»Ich habe es herausgefunden, als ich die Unterlagen durchging«, sagte Candice mit leerem Blick. »Meine Mutter und ich mussten das Chaos in seinem Arbeitszimmer sortieren. Es war einfach … niederschmetternd.«
»Wie hat deine Mum es aufgenommen?«, fragte Maggie interessiert.
»Es war schlimm«, sagte Candice. »Das könnt ihr euch ja vorstellen. Manchen Leuten hatte er ernstlich weisgemacht, sie sei Alkoholikerin und er müsse sich Geld leihen, um sie auf eine Entziehungskur zu schicken.«
Roxanne prustete vor Lachen, dann sagte sie: »Entschuldige.«
»Man kann mit ihr immer noch nicht darüber sprechen«, sagte Candice. »Ich glaube, sie hat sich mehr oder weniger eingeredet, dass es gar nicht passiert ist. Sobald ich davon anfange, wird sie gleich hysterisch …« Sie hob die Hand und massierte ihre Stirn.
»Ich hatte ja keine Ahnung«, sagte Maggie. »Davon hast du nie was erzählt.«
»Na ja«, sagte Candice knapp. »Ich bin nicht wirklich stolz darauf. Mein Vater hat großen Schaden angerichtet.«
Sie schloss die Augen, als unerwünschte Erinnerungen an die schreckliche Zeit nach seinem Tod wach wurden. Bei der Beerdigung hatte sie zum ersten Mal gemerkt, dass irgendwas nicht stimmte. Freunde und Verwandte standen in Grüppchen beieinander und hörten auf zu reden, sobald sie näher kam. Ihre Stimmen klangen gepresst und eindringlich. Alle schienen in ein großes Geheimnis eingeweiht zu sein. Als sie an einer Gruppe vorbeikam, hörte sie die Worte: »Wie viel?«
Dann trafen die Besucher ein, angeblich um Candice und ihrer Mutter ihr Beileid auszusprechen. Aber früher oder später drehten sich alle Gespräche um Geld. Um die fünf- oder zehntausend Pfund, die Gordon sich geliehen hatte. Um die Investitionen, die er getätigt hatte. Natürlich dränge es nicht – sie sahen wohl ein, dass die Lage schwierig war –, aber selbst Mrs Stephens, ihre Putzfrau, erkundigte sich nach den hundert Pfund, die sie ihm vor Monaten geliehen und nie zurückbekommen hatte.
Bei dem Gedanken an die betretene Miene der Frau krampfte sich Candice noch heute der Magen zusammen, vor Schmach, vor brennendem, pubertärem Schuldgefühl. Noch heute fühlte es sich an, als hätte sie das alles irgendwie zu verantworten. Obwohl sie nichts davon gewusst hatte, obwohl sie gar nichts dagegen hätte tun können.
»Und was war mit Frank Trelawney?«, fragte Maggie. Benommen schlug Candice die Augen auf und nahm den Cocktailquirl wieder in die Hand.
»Er stand auf einer Namensliste im Arbeitszimmer«, sagte sie. »Er hatte zweihunderttausend Pfund in irgendein Risikokapitalprojekt gesteckt, das nach wenigen Monaten den Bach runterging.« Sie strich mit dem Quirl am Rand ihres Glases entlang. »Erst wusste ich gar nicht, wer Frank Trelawney war. Es war nur ein Name unter vielen. Irgendwie kam er mir allerdings bekannt vor … Und plötzlich fiel mir ein, dass Heather Trelawney Hals über Kopf von der Schule abgegangen war. Da wurde mir alles klar.« Sie kaute auf ihrer Lippe. »Ich glaube, das war der schlimmste Moment von allen. Die Erkenntnis, dass Heather wegen meines Vaters die Schule verlassen musste.«
»Du darfst deinem Vater nicht die ganze Schuld geben«, sagte Maggie sanft. »Dieser Mr Trelawney muss gewusst haben, was er tat. Er muss gewusst haben, dass er ein gewisses Risiko einging.«
»Ich habe mich immer gefragt, was wohl aus Heather geworden ist«, sagte Candice, als hätte sie den Einwurf gar nicht gehört. »Und jetzt weiß ich es. Noch ein zerstörtes Leben.«
»Candice, mach dich nicht fertig«, sagte Maggie. »Es ist nicht deine Schuld. Du hast nichts getan!«
»Ich weiß«, sagte Candice. »Logisch betrachtet hast du recht. Aber so einfach ist das nicht.«
»Trink noch was«, riet ihr Roxanne. »Das hebt die Laune.«
»Gute Idee«, sagte Maggie und trank aus. Sie hob eine Hand, und am anderen Ende der Bar nickte Heather.
Candice starrte Heather an, die sich bückte, um ein paar leere Gläser von einem Tisch zu nehmen und ihn abzuwischen. Sie merkte nicht, dass sie beobachtet wurde. Als Heather sich wieder aufrichtete, gähnte sie, wischte müde über ihr Gesicht, und Candice spürte, wie sich ihr das Herz zusammenkrampfte. Sie musste irgendetwas tun. Wenigstens diese eine Untat ihres Vaters musste sie wiedergutmachen.
»Sagt mal …«, sagte sie eilig, als Heather sich ihrem Tisch näherte. »Wir haben doch noch keine neue Redaktionsassistentin beim Londoner, oder?«
»Soweit ich weiß, nicht«, sagte Maggie überrascht. »Wieso?«
»Na, wie wäre es denn mit Heather?«, fragte Candice. »Die wäre doch ideal. Oder?«
»Ach ja?« Maggie legte die Stirn in Falten.
»Sie möchte Journalistin werden, sie hat schon einen Schreibkurs belegt … sie wäre doch perfekt! Ach, komm schon, Maggie!« Candice hob den Kopf und sah Heather näher kommen. »Heather, hör mal …!«
»Möchtet ihr noch was trinken?«, fragte Heather.
»Ja«, sagte Candice. »Aber … aber nicht nur das.« Flehentlich sah sie Maggie an. Maggie warf ihr einen gespielt bösen Blick zu, dann grinste sie.
»Wir haben uns gerade etwas überlegt, Heather«, sagte sie. »Hättest du Interesse an einem Job beim Londoner? Als Redaktionsassistentin. Das ist ziemlich weit unten in der Hackordnung, und es gibt auch nicht wahnsinnig viel Geld, aber es wäre ein Einstieg in den Journalismus.«
»Im Ernst?«, sagte Heather und blickte von einer zu anderen. »Das wäre ja wunderbar!«
»Gut«, sagte Maggie und zupfte eine Karte aus ihrer Handtasche. »Das hier ist die Adresse, aber ich werde nicht da sein, um deine Bewerbung zu bearbeiten. Wende dich an Justin Vellis.« Sie schrieb den Namen auf die Karte und gab diese Heather. »Schreib einen Brief. Erzähl was von dir und leg einen Lebenslauf bei. Okay?«
Bestürzt glotzte Candice sie an.
»Super!«, sagte Heather. »Und … danke.«
»Und jetzt suchen wir uns noch ein paar Cocktails aus«, sagte Maggie fröhlich. »Das Leben ist schwer genug.«
Als Heather mit der Bestellung gegangen war, grinste Maggie Candice an und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück.
»So viel dazu«, sagte sie. »Geht es dir jetzt besser?« Verwundert starrte sie sie an. »Candice, ist alles okay?«
»Ehrlich gesagt, nein!«, sagte Candice und versuchte, ruhig zu bleiben. »Kein bisschen! Mehr willst du nicht für sie tun? Du gibst ihr nur die Adresse?«
»Was meinst du?«, fragte Maggie überrascht. »Candice, was ist denn?«
»Ich dachte, du gibst ihr den Job!«
»Einfach so?«, sagte Maggie und musste lachen. »Candice, das soll wohl ein Witz sein.«
»Oder vermittelst ihr ein Vorstellungsgespräch … oder wenigstens eine persönliche Empfehlung«, sagte Candice, die vor lauter Aufregung rot anlief. »Wenn sie nur ihren Lebenslauf schickt wie alle anderen auch, gibt Justin ihr nie im Leben einen Job! Er wird irgendeinen bescheuerten Oxford-Absolventen einstellen.«
»Wie er selbst einer ist«, warf Roxanne grinsend ein. »Irgend so einen schleimigen, intellektuellen Arschkriecher.«
»Genau! Maggie, du weißt, dass Heather nur eine Chance hat, wenn du sie empfiehlst. Besonders wenn er erfährt, dass sie etwas mit mir zu tun hat!« Candice bekam ganz rote Wangen, als sie die Worte aussprach. Es war gerade erst ein paar Wochen her, dass sie sich von Justin, dem Kulturredakteur, getrennt hatte, der Maggie als kommissarischer Chefredakteur vertreten sollte. Es fühlte sich immer noch seltsam an, über ihn zu sprechen.
»Aber Candice, ich kann sie nicht empfehlen«, sagte Maggie. »Ich weiß doch gar nichts über sie. Und – mal ehrlich – du auch nicht. Ich meine, du hast sie seit Jahren nicht gesehen, oder? Sie könnte kriminell sein oder sonst was.«
Trübsinnig starrte Candice in ihren Drink, und Maggie seufzte.
»Candice, ich gut kann verstehen, wie dir zumute ist, wirklich«, sagte sie. »Aber du kannst nicht einfach irgendeiner Frau, die du kaum kennst, einen Job besorgen, nur weil sie dir leidtut.«
»Das stimmt«, sagte Roxanne entschlossen. »Als Nächstes kriegt das Mädchen, das die Gläser abtrocknet, deine persönliche Empfehlung.«
»Und warum nicht?«, sagte Candice plötzlich ungestüm. »Wieso sollte man Leuten nicht hin und wieder einen kleinen Schubs geben, wenn sie ihn verdienen? Wir drei haben es sehr einfach, verglichen mit dem Rest der Welt.« Sie deutete in die Runde am Tisch. »Wir haben gute Jobs und ein glückliches Leben und nicht den leisesten Schimmer, wie es ist, nichts zu haben.«
»Heather hat nicht nichts«, sagte Maggie ganz ruhig. »Sie sieht gut aus, sie hat Verstand, sie hat einen Job, und sie kann jederzeit wieder die Schulbank drücken, wenn sie will. Es ist nicht deine Aufgabe, ihr Leben zu ordnen. Okay?«
»Okay«, sagte Candice nach einer kurzen Pause.
»Gut«, sagte Maggie. »Ende der Standpauke.«
Eine Stunde später traf Maggies Mann Giles in der Manhattan Bar ein. Er stand am Rand der Menge und spähte zwischen den Leuten hindurch, bis er Maggies Gesicht entdeckt hatte. Sie hielt einen Cocktail in der Hand, ihre Wangen waren rosig, und sie warf lachend ihren Kopf in den Nacken. Dieser Anblick brachte Giles zum Lächeln, und er steuerte auf den Tisch zu.
»Achtung, Mann!«, sagte er freundlich, als er an den Tisch trat. »Seid so gut, etwaige Witze über männliche Genitalien einzustellen.«
»Giles!«, rief Maggie und blickte bestürzt auf. »Müssen wir schon los?«
»Wir müssen nicht«, sagte Giles. »Auf ein, zwei Drinks könnte ich ruhig bleiben.«
»Nein«, sagte Maggie nach kurzer Überlegung. »Ist schon okay. Lass uns gehen.«
Es funktionierte nie so recht, wenn sich Giles dazugesellte. Nicht, weil die anderen beiden ihn nicht mochten – und auch nicht, weil er sich nicht bemühen würde. Er war stets liebenswürdig und höflich, und das Gespräch lief immer gut. Aber es war nur einfach nicht dasselbe. Er war nicht einer von ihnen. Wie sollte er auch?, dachte Maggie. Er war keine Frau.
»Ich muss sowieso gleich los«, sagte Roxanne, trank aus und nahm ihre Zigaretten. »Ich treffe mich noch mit jemandem.«
»Sollte es sich dabei unter Umständen um einen gewissen Jemand handeln?«, fragte Maggie.
»Möglich.« Roxanne lächelte sie an.
»Ich kann nicht fassen, dass es das jetzt gewesen sein soll!«, sagte Candice zu Maggie. »Wenn wir uns das nächste Mal sehen, hast du ein Baby.«
»Erinnere mich bloß nicht daran!«, sagte Maggie mit strahlendem Lächeln.
Sie schob ihren Stuhl zurück und nahm dankbar die Hand, die Giles ihr reichte. Gemeinsam drängten sie sich langsam durch die Menge zur Garderobe und gaben ihre Silberknöpfe ab.
»Und glaub nicht, du könntest den Cocktail-Club schwänzen«, sagte Roxanne zu Maggie. »Nächsten Monat sitzen wir an deinem Bett und stoßen auf das Baby an.«
»Abgemacht«, sagte Maggie und spürte plötzlich, wie ihr die Tränen kamen. »Oh, Gott, ich werde euch vermissen.«
»Bis bald«, sagte Roxanne und drückte sie an sich. »Viel Glück, Süße.«
»Okay«, sagte Maggie und versuchte zu lächeln. Plötzlich kam es ihr vor, als würde sie ihre Freundinnen nie wiedersehen, als beträte sie eine neue Welt, in die sie ihr nicht folgen konnten.
»Maggie braucht kein Glück!«, sagte Candice. »Die hat das Baby in null Komma nichts trockengelegt!«
»Hey, Baby!«, sagte Roxanne und wandte sich direkt an Maggies Bauch. »Bist du dir darüber im Klaren, dass deine Mutter die bestorganisierte Frau der westlichen Hemisphäre ist?« Sie tat, als lauschte sie dem Bauch. »Er sagt, er möchte jemand anderen. Da hast du Pech, Kleiner.«
»Hör zu, Candice …«, sagte Maggie in wohlmeinendem Ton. »Lass dich nicht von Justin rumkommandieren, nur weil er ein paar Monate das Sagen hat. Ich weiß, dass die Situation nicht ganz einfach ist …«
»Keine Sorge«, sagte Candice eilig. »Mit dem werde ich schon fertig.«
»Justin, das nervige Wunderkind«, sagte Roxanne abschätzig. »Weißt du, ich bin froh, dass wir jetzt über ihn herziehen können.«
»Du hast immer schon über ihn hergezogen«, erklärte Candice. »Auch als ich noch mit ihm zusammen war.«
»Das hat er auch verdient«, sagte Roxanne unbeeindruckt. »Wer in eine Cocktail-Bar geht und eine Flasche Rotwein bestellt, verschwendet doch nur einen Sitzplatz.«
»Candice, anscheinend hat man Probleme, deinen Mantel zu finden«, sagte Giles, der plötzlich hinter Maggies Schulter auftauchte. »Aber hier ist deiner, Roxanne – und deiner, mein Schatz. Ich glaube, wir sollten bald mal losfahren, sonst ist es Mitternacht, bis wir zu Hause sind.«
»Okay, na gut«, sagte Maggie mit einem Zittern in der Stimme. »Jetzt ist es so weit.«
Sie sah Candice an, und beide lächelten und blinzelten gleichzeitig die Tränen aus ihren Augen.
»Wir sehen uns schon bald wieder«, sagte Candice. »Ich komm dich besuchen.«
»Und ich komme nach London.«
»Du könntest einen kleinen Tagesausflug mit dem Baby machen«, sagte Candice. »Angeblich sind Babys der letzte Schrei, was Accessoires angeht.«
»Ich weiß«, sagte Maggie und lachte. Sie beugte sich vor und nahm Candice in die Arme. »Pass auf dich auf.«
»Und du auf dich«, sagte Candice. »Viel Glück mit … allem. Bye, Giles«, fügte sie hinzu. »Schön, dich zu sehen.«
Giles öffnete die gläserne Tür der Bar, und nach einem letzten Blick zurück trat Maggie hinaus in die kalte Nacht. Schweigend betrachteten Roxanne und Candice durch die Scheibe, wie Giles Maggie beim Arm nahm und die beiden die dunkle Straße hinuntergingen.
»Wenn ich mir das vorstelle«, sagte Candice. »Bald sind die beiden kein Paar mehr, sondern eine Familie.«
»So wird es sein«, sagte Roxanne mit fester Stimme. »Eine glückliche kleine Familie, gemeinsam in ihrem riesengroßen, scheißglücklichen Heim.« Candice sah sie an.
»Alles okay?«
»Natürlich ist alles okay!«, sagte Roxanne. »Ich bin nur froh, dass ich nicht an ihrer Stelle bin! Der bloße Gedanke an Schwangerschaftsstreifen …« Sie schüttelte sich und grinste. »Ich fürchte, ich muss los. Hast du was dagegen?«
»Natürlich nicht«, sagte Candice. »Ich wünsch dir viel Spaß.«
»Den habe ich immer«, sagte Roxanne, »selbst wenn es keinen Spaß macht. Wir sehen uns, sobald ich von Zypern wieder da bin.« Sie küsste Candice kurz auf beide Wangen und verschwand durch die Tür. Candice sah noch, wie sie ein Taxi heranwinkte und hineinsprang. Sekunden später raste das Taxi die Straße entlang.
Candice wartete, bis es verschwunden war, zählte bis fünf, dann wandte sie sich wieder der überfüllten Bar zu. Sie fühlte sich wie ein unartiges Kind. Ihr Magen verkrampfte sich vor Sorge. Ihr Herz schlug laut und schnell.
»Ich habe Ihren Mantel gefunden!«, hörte sie die Stimme der Garderobenfrau. »Er war vom Bügel gefallen.«
»Danke«, sagte Candice. »Aber ich müsste mal eben …« Sie schluckte. »Bin gleich wieder da.«
Eilig schob sie sich durch die Menschen, zielstrebig und entschlossen. Noch nie war sie sich einer Sache so sicher gewesen. Maggie und Roxanne meinten es gut, aber sie täuschten sich. Diesmal täuschten sie sich. Sie begriffen nicht – wie sollten sie auch? Sie konnten nicht wissen, dass es die Gelegenheit war, auf die sie unbewusst schon seit dem Tod ihres Vaters gewartet hatte. Es war ihre Chance, etwas wiedergutzumachen. Es war wie ein … Geschenk.
Erst konnte sie Heather nicht finden und dachte schon, sie käme zu spät. Doch als Candice sich dann noch einmal umsah, entdeckte sie Heather. Sie stand hinterm Tresen, polierte ein Glas und lachte mit einem der Kellner. Candice kämpfte sich durch die Menge zum Tresen hinüber und wartete, weil sie die beiden nicht unterbrechen wollte.
Schließlich blickte Heather auf und sah sie – und zu Candice’ Überraschung schien es, als blitzte in Heathers Augen etwas Feindseliges auf. Doch es verflog sofort wieder, und ein freundliches Lächeln machte sich breit.
»Was kann ich dir bringen?«, sagte sie. »Noch einen Cocktail?«
»Nein, ich wollte nur kurz mit dir reden«, rief Candice über den Lärm der Menge hinweg. »Wegen dieses Jobs.«
»Ach ja?«
»Wenn du möchtest, könnte ich dich Ralph Allsopp, dem Verleger, vorstellen«, sagte Candice. »Es ist keine Garantie, würde aber deine Chancen vielleicht verbessern. Komm morgen so gegen zehn ins Büro.«
»Wirklich?« Heather strahlte. »Das wäre ja wunderbar!« Sie stellte das Glas ab, das sie gerade polierte, beugte sich vor und nahm Candice’ Hände. »Candice, das ist wirklich nett von dir. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll.«
»Na ja, du weißt schon …«, sagte Candice unbeholfen. »Alte Schulfreunde und so …«
»Ja«, sagte Heather und lächelte Candice freundlich an. »Alte Schulfreunde.«
Kapitel Drei
Als sie auf die Schnellstraße kamen, fing es an zu regnen. Giles stellte einen Klassiksender an, und ein glorreicher Sopran erfüllte den Wagen. Nach wenigen Tönen erkannte Maggie »Dove Sono« aus der Hochzeit des Figaro – für sie die schönste, ergreifendste Arie, die je geschrieben wurde. Maggie ließ sich von der Musik mitreißen, starrte in den Regen hinaus und spürte, wir ihr die Tränen kamen, aus Mitleid mit der fiktiven Gräfin. Eine brave, schöne Frau, die sich – ungeliebt von ihrem treulosen Ehemann – traurig an die zärtlichen Momente erinnert …
Maggie blinzelte einige Male und holte tief Luft. Es war lächerlich. In letzter Zeit kamen ihr ständig die Tränen. Neulich erst hatte sie bei einer Fernsehwerbung weinen müssen, weil ein Junge seinen kleinen Schwestern etwas kochte. Sie hatte im Wohnzimmer auf dem Fußboden gesessen, und die Tränen waren ihr nur so übers Gesicht gelaufen. Als Giles hereinkam, musste sie sich abwenden und so tun, als sei sie in eine Zeitschrift vertieft.
»Hattest du eine schöne Abschiedsfeier?«, fragte Giles und wechselte die Spur.
»Ja, sehr nett«, sagte Maggie. »Haufenweise Geschenke. Alle waren sehr großzügig.«
»Und wie bist du mit Ralph verblieben?«
»Ich habe ihm gesagt, ich rufe ihn in ein paar Monaten an. Das habe ich allen so gesagt.«
»Ich finde immer noch, du hättest ehrlich mit ihnen sein sollen«, sagte Giles. »Ich meine, wir wissen doch beide, dass du nicht die Absicht hast, wieder arbeiten zu gehen.«
Maggie schwieg. Sie hatte mit Giles ausgiebig darüber diskutiert, ob sie wieder arbeiten sollte, wenn das Baby da war. Einerseits mochte sie ihren Job und auch ihre Mitarbeiter, wurde gut bezahlt und hatte das Gefühl, als gäbe es da immer noch einiges, was sie in ihrer Karriere erreichen wollte. Andererseits war ihr die Vorstellung zuwider, tagtäglich ihr Baby allein zu lassen und nach London zu pendeln. Denn was hatte es schließlich für einen Sinn, in einem großen Haus auf dem Lande zu leben, wenn man es nie zu sehen bekam?
Den Umstand, dass sie nie wirklich aufs Land hatte ziehen wollen, hatte Maggie mehr oder weniger erfolgreich verdrängt. Schon bevor sie schwanger wurde, war es Giles ungemein wichtig gewesen, dass sich seine zukünftigen Kinder ebenso an der frischen Luft austoben konnten wie er damals. »London ist für Kinder ungesund«, hatte er verkündet. Und obwohl Maggie immer wieder darauf hingewiesen hatte, dass die Londoner Straßen voll kerngesunder Kinder waren, dass man in den Parks sicherer Rad fahren konnte als auf einer Landstraße, dass es auch in den Städten Natur gab, war Giles nicht umzustimmen.
Als sie sich dann Details von Landhäusern kommen ließen, von prächtigen alten Pfarrhäusern mit getäfelten Esszimmern, hektarweise Land und Tennisplätzen, merkte sie, dass ihr Widerstand nachließ. Sie fragte sich, ob es egoistisch von ihr war, dass sie in London bleiben wollte. An einem wunderschönen Sonnentag im Juni hatten sie sich The Pines angesehen. Die Auffahrt knirschte unter den Rädern ihres Autos, der Swimmingpool glitzerte in der Sonne, der Rasen war zu hell- und dunkelgrünen Streifen gemäht. Nachdem die Besitzer sie herumgeführt hatten, schenkte man ihnen einen Pimm’s ein und forderte sie auf, unter der Trauerweide Platz zu nehmen, dann zog man sich taktvoll zurück. Giles hatte Maggie angesehen und gesagt: »Das alles könnte uns gehören, Liebling. Das könnte unser Leben sein.«
Und jetzt war es ihr Leben. Nur war es nicht so sehr ein Leben wie vor allem ein großes Haus, das Maggie nach wie vor nicht sonderlich vertraut war. Während der Woche war sie kaum dort. Und an den Wochenenden machten sie oft Ausflüge oder fuhren nach London, um Freunde zu besuchen. Noch war nichts so renoviert, wie sie es sich vorgenommen hatte. Es fühlte sich noch nicht so an, als gehörte das Haus ihr.
Aber sie sagte sich, wenn erst das Baby da wäre, würde alles anders werden. Dann wäre das Haus endlich ein Zuhause. Maggie legte die Hände auf ihren prallen Bauch und fühlte das Zappeln unter ihrer Haut. Eine kleine Beule wanderte darüber hinweg und verrann wie eine Welle im Meer. Dann trat ihr plötzlich und ohne Vorwarnung etwas in die Rippen. Eine Ferse vielleicht, oder ein Knie. Immer wieder trat es zu, als wollte es ausbrechen. Maggie schloss die Augen. In ihrem Schwangerschaftshandbuch stand, es konnte jetzt jederzeit so weit sein. Das Baby war voll entwickelt. Jeden Moment konnten die Wehen einsetzen.
Bei diesem Gedanken raste ihr Herz vor lauter Panik, und sie redete sich schnell ein, dass alles gut werden würde. Natürlich war sie auf das Baby vorbereitet. Sie hatte ein Kinderzimmer voller Windeln und Watte, voller Deckchen und Hemdchen. Der Babykorb war schon auf seinem Ständer, und auch das Kinderbett, das sie im Kaufhaus bestellt hatten. Alles war bereit.
Aber irgendwie – trotz allem – war sie noch immer nicht so recht bereit, Mutter zu werden. Fast fühlte sie sich noch nicht alt genug. Was albern war, wie sie sich sagte, angesichts der Tatsache, dass sie schon zweiunddreißig war und neun volle Monate Zeit gehabt hatte, sich an den Gedanken zu gewöhnen.
»Ich kann immer noch nicht glauben, dass es wirklich bald so weit ist«, sagte sie. »Nur noch drei Wochen. Das ist gar nichts! Und ich war noch nicht mal in einem Babypflegekurs oder so …«
»Das brauchst du auch nicht!«, sagte Giles. »Du schaffst das auch so! Du wirst die beste Mutter sein, die sich ein Baby wünschen kann.«
»Wirklich?« Maggie biss sich auf die Lippe. »Ich weiß nicht. Ich fühle mich ein bisschen … unvorbereitet.«
»Was gibt es da vorzubereiten?«
»Na ja, du weißt schon. Die Wehen und das alles.«
»Nur ein Wort«, sagte Giles mit fester Stimme. »Drogen.«
Maggie kicherte. »Und hinterher. Darauf aufzupassen. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie ein Baby auf dem Arm.«
»Du bist bestimmt fantastisch!«, sagte Giles sofort. »Maggie, wenn irgendjemand für ein Baby sorgen kann, dann du. Komm schon.« Er sah sie an und lächelte. »Wer wurde zur Redakteurin des Jahres gewählt?«
»Ich«, sagte sie und musste vor Stolz unwillkürlich lächeln.
»Genau. Und du wirst auch Mutter des Jahres werden.« Er nahm ihre Hand und drückte sie, und Maggie erwiderte den Druck dankbar. Giles’ Optimismus heiterte sie noch immer auf.
»Mum meinte, sie will morgen mal reinschauen«, sagte Giles. »Um dir Gesellschaft zu leisten.«
»Oh, gut«, sagte Maggie. Sie dachte an Giles’ Mutter Paddy, eine dünne, dunkelhaarige Frau, die unerklärlicherweise drei große, muntere Söhne mit dicken, blonden Haaren zur Welt gebracht hatte. Giles und seine beiden Brüder beteten ihre Mutter an, und es war bestimmt kein Zufall, dass sein Elternhaus im Nachbardorf stand. Anfangs hatte die Nähe ihrer Schwiegereltern Maggie ein wenig verunsichert, aber schließlich wohnten ihre eigenen Eltern weit weg in Derbyshire, und Giles wies sie darauf hin, dass es sinnvoll sei, wenigstens ein Paar Großeltern in der Nähe zu haben.
»Sie meint, du musst unbedingt die vielen anderen jungen Mütter im Dorf kennenlernen«, sagte Giles.
»Sind es denn viele?«
»Ich glaube schon. Bestimmt trefft ihr euch jeden Morgen woanders zum Kaffeeklatsch.«
»Oh, wie schön!«, flachste Maggie. »Während du also in der City rackerst, kann ich mit meinen Mädels Cappuccino schlürfen.«
»So ungefähr.«