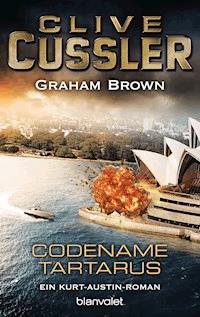
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kurt-Austin-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Der Helikopter machte einen harmlosen Eindruck – bis er im Hafen von Sidney das Feuer auf ein Motorboot eröffnet. Kurt Austin von der NUMA gelingt es, den Hubschrauber zum Absturz zu bringen. Zu spät. Das Boot und seine Insassen sind bereits untergegangen. Austin gelingt es, den einzigen Überlebenden zu bergen, doch dessen Verletzungen sind tödlich. Mit letzter Kraft flüstert der Sterbende: »Tartarus«. Austin muss herausfinden, was sich hinter dieser Bezeichnung verbirgt, oder eine schreckliche Katastrophe wird die Erde zerreißen.
Jeder Band ein Bestseller und einzeln lesbar. Lassen Sie sich die anderen Abenteuer von Kurt Austin nicht entgehen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Autoren
Seit er 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, ist jeder Roman von Clive Cussler ein »New-York-Times«-Bestseller. Auch auf der deutschen SPIEGEL-Bestsellerliste ist jeder seiner Romane vertreten. 1979 gründete er die reale NUMA, um das maritime Erbe durch die Entdeckung, Erforschung und Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er lebt in der Wüste von Arizona und in den Bergen Colorados.
Der leidenschaftliche Pilot Graham Brown hält Abschlüsse in Aeronautik und Rechtswissenschaften. In den USA gilt er bereits als der neue Shootingstar des intelligenten Thrillers in der Tradition von Michael Crichton. Wie keinem zweiten Autor gelingt es Graham Brown, verblüffende wissenschaftliche Aspekte mit rasanter Nonstop-Action zu einem unwiderstehlichen Hochspannungscocktail zu vermischen.
Liste der lieferbaren Bücher
Von Clive Cussler im Blanvalet-Taschenbuch (die Dirk-Pitt-Romane):
Eisberg (35601), Das Alexandria-Komplott (35528), Die Ajima-Verschwörung (36089), Schockwelle (35201), Höllenflut (35297), Akte Atlantis (35896), Im Zeichen der Wikinger (36014), Die Troja-Mission (36473), Cyclop (37025), Geheimcode Makaze (37151), Der Fluch des Khan (37210), Polarsturm (37469), Wüstenfeuer (37755), Unterdruck (38418)
Von Clive Cussler und Paul Kemprecos im Blanvalet-Taschenbuch (die Kurt-Austin-Romane):
Tödliche Beute (36068), Brennendes Wasser (35683), Das Todeswrack (35274), Killeralgen (36362), Packeis (36617), Höllenschlund (36922), Flammendes Eis (37285), Eiskalte Brandung (37577)
Von Clive Cussler und Graham Brown im Blanvalet-Taschenbuch (die Kurt-Austin-Romane):
Teufelstor (38048), Höllensturm (38297), Codename Tartarus (0143)
Von Clive Cussler und Craig Dirgo im Blanvalet-Taschenbuch (die Juan-Cabrillo-Romane):
Der goldene Buddha (36160), Der Todesschrein (36446)
Von Clive Cussler und Jack DuBrul im Blanvalet-Taschenbuch (die Juan-Cabrillo-Romane):
Todesfracht (36857), Schlangenjagd (36864), Seuchenschiff (37243), Kaperfahrt (37590), Teuflischer Sog (37751), Killerwelle (37818), Tarnfahrt (38223)
Von Clive Cussler und Grant Blackwood im Blanvalet-Taschenbuch (die Fargo-Romane):
Das Gold von Sparta (37683), Das Erbe der Azteken (37949), Das Geheimnis von Shangri La (38069), Das fünfte Grab des Königs (38224), Das Vermächtnis der Maya (38387)
Von Clive Cussler (die Isaac-Bell-Romane):
Höllenjagd (37057)
Von Clive Cussler und Justin Scott (die Isaac-Bell-Romane):
Sabotage (37684), Blutnetz (37964), Todesrennen (38167), Meeresdonner (38364)
CLIVE CUSSLER
& Graham Brown
CODENAMETARTARUS
Roman
Aus dem Englischenvon Michael Kubiak
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Zero Hour« bei Putnam, New York.
1. Auflage
Juli 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © 2014 by Sandecker RLLLP
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176 – 0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Redaktion: Jörn Rauser
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-15179-9www.blanvalet.de
PROLOG
18. April 1906Sonoma County, Nordkalifornien
Grollender Donner erschütterte die dunkle Höhle, als ein greller, blauweißer Funke zwischen zwei massigen, hoch aufragenden stählernen Stäben hin- und hersprang. Anstatt zu verblassen, teilte sich die gleißend hell flirrende Ladung, und die beiden schmalen Plasmastränge wanden sich um die jeweiligen Metallstäbe. Sie bewegten sich wie vom Wind gepeitschte Flammen, umkreisten in rasendem Tanz die Stäbe und schlängelten sich an ihnen aufwärts bis in die Wölbung einer stählernen Halbkugel. Dort verknoteten sie sich wie die Arme einer spiralförmigen Galaxis, verschmolzen miteinander, ehe sie mit einem letzten grellweißen Blitz verschwanden.
Darauf folgte Dunkelheit.
Beißender Ozongeruch lag in der Luft.
Von dem Schauspiel geblendet, stand eine Gruppe von Männern und Frauen regungslos in der Mitte des höhlenartigen Saals. Der Blitz war zwar ein durchaus eindrucksvolles Spektakel gewesen, aber sie alle hatten derartige elektrische Entladungen bereits zur Genüge gesehen. Heute hatte jeder der Anwesenden mehr erwartet.
»War das alles?«, fragte eine barsche Stimme.
Die Worte kamen aus dem Mund von Brigadegeneral Hal Cortland, einem Mann mit untersetzter, bulliger Gestalt. Gerichtet waren sie an Daniel Watterson, achtunddreißig, schmächtig, blond und bebrillt, der vor der Kontrolltafel der riesigen Maschine stand, die den künstlichen Blitz erzeugt hatte.
Watterson studierte eine Reihe matt erleuchteter Anzeigeinstrumente. »Ich bin mir nicht ganz sicher«, flüsterte er vor sich hin. Niemand war bisher so weit vorgedrungen, nicht einmal Michael Faraday oder der große Nikola Tesla. Aber wenn Watterson auf dem richtigen Weg war – wenn seine Berechnungen und die während seiner jahrelangen Tätigkeit als Teslas persönlicher Assistent entwickelten Theorien über die Natur dessen, was in Kürze geschehen würde, zutrafen –, dann dürfte die Lichterscheinung, die sie soeben beobachtet hatten, nur der Anfang gewesen sein.
Er schaltete die Stromzufuhr aus, trat von den Anzeigeinstrumenten zurück und setzte die Brille aus Drahtgestell ab. In der Dunkelheit konnte er ein schwaches bläuliches Schimmern erkennen, das die stählernen Stäbe umgab. Sein Blick stieg weiter hinauf zur Kuppel darüber. Ein irisierender Lichtschleier glitt über die gewölbte Innenwand.
»Nun?«, fragte Cortland ungehalten.
Die Nadel einer Anzeige auf der Kontrolltafel zuckte und wanderte langsam über die Skala. Watterson konnte es aus den Augenwinkeln verfolgen.
»Nein, General«, sagte er leise. »Ich glaube, es ist noch nicht ganz vorbei.«
Wattersons Antwort ging in einem dumpfen Grollen unter, das plötzlich die Höhle erfüllte. Es klang wie eine Lawine mächtiger Felsbrocken in einem fernen Steinbruch, gedämpft und verzerrt, deren Schwingungen meilenweit durch solides Gestein gewandert waren, um bis zu ihnen zu gelangen. Es dauerte einige Sekunden, dann wurde es schwächer und verstummte schließlich.
Der General verzog das Gesicht zu einem spöttischen Grinsen. Er knipste eine Taschenlampe an. »Für ein derart armseliges Feuerwerk macht Uncle Sam keinen einzigen Dollar locker, mein Sohn.«
Watterson ignorierte die Bemerkung. Stattdessen lauschte er weiter und strengte seine sämtlichen Sinne an, um irgendetwas wahrzunehmen.
Die Geduld des Generals war erschöpft. »Kommt, Leute«, sagte er, »die Party ist zu Ende. Sehen wir zu, dass wir aus diesem Erdloch verschwinden.«
Die Anwesenden setzten sich in Bewegung. Das Scharren ihrer Füße und ihr Gemurmel übertönten alle anderen Geräusche.
Watterson hob eine Hand. »Bitte!«, rief er laut. »Rühren Sie sich für einen Moment nicht vom Fleck!«
Die Zuschauer blieben stehen, und Watterson ging dorthin, wo die Stahlstäbe im Felsboden verankert waren. Von dieser Stelle aus reichten sie fast zweihundert Meter weit hinab, um »die Erde richtig im Griff zu haben«, wie Tesla es einst ausgedrückt hatte.
Watterson legte eine Hand auf einen der Stäbe und spürte ein unterschwelliges Vibrieren. Es durchdrang seinen Körper, als wäre er selbst zu einem Teil des Stromkreises geworden. Doch es war weder schmerzhaft wie elektrischer Strom noch rief es in seinen Muskeln krampfartige Zuckungen hervor. Auch wanderte es nicht weiter in den Untergrund wie ein Stromschlag. Es wirkte beinahe wohltuend, machte ihn leicht benommen und erzeugte einen Anflug von Euphorie.
»Es kommt«, flüsterte er.
»Was kommt?«, fragte der General.
Watterson drehte sich zu ihm um. »Das Echo.«
Cortland wartete einige Sekunden lang, dann verfinsterte sich seine Miene. »Ihr Wissenschaftler seid wie Schaubudenausrufer auf einer Kirmes. Ihr glaubt, wenn ihr etwas nur laut und oft genug hinausposaunt, werden wir alle es schon irgendwann für bare Münze halten. Aber ich höre kein …«
Der General verschluckte die letzten Worte, als abermals ein dumpfes Grollen laut wurde. Diesmal rollte es heftiger durch die Höhle, und das blaue Leuchten, das die Stäbe umhüllte, wurde intensiver, begann zu flackern und pulsierte schließlich synchron mit den Klangwellen.
Als die Schwingungen nachließen, blieben die Anwesenden ruhig. Nun warteten sie auf mehr. Vierzig Sekunden später wurden sie belohnt. Die dritte Welle kündigte sich wie ein Güterzug an, der in nächster Nähe vorbeidonnerte. Sie erschütterte die Felsmassen unter der Höhle und ließ die Blitze wieder über die polierte Oberfläche der Kuppel über den Köpfen der Zuschauer zucken. Die flirrende Energiespirale wanderte an den Stäben abwärts und verschwand auf halber Höhe über dem Felsboden.
Reflexartig machte Watterson ein paar Schritte und zog sich aus der Gefahrenzone zurück.
Sekundenbruchteile später erreichte eine vierte Nachhallschwingung die Höhle. Die Stäbe flackerten, als sie sich bemerkbar machte. Lichtblitze zuckten zwischen ihnen hin und her. Der Felsensaal erbebte. Staub und winzige Steinsplitter regneten von der Decke herab und zwangen die Zuschauer, eiligst Schutz zu suchen.
Watterson erhaschte einen Blick auf General Cortland, der vom Licht der elektrischen Entladungen überstrahlt wurde. Ein irres Grinsen verzerrte sein Gesicht. Jetzt waren ihre Rollen vertauscht. Cortland sah zufrieden aus, während Watterson besorgt die Stirn runzelte. Der Wissenschaftler trat an die Schalttafel, setzte die Brille wieder auf und studierte die Anzeigeinstrumente. Er konnte sich die neuerlichen Schwingungen nicht erklären.
Ehe er auch nur imstande war, damit anzufangen, über die Ursache dieser Erscheinung nachzudenken, rollte die fünfte Druckwelle an. Die Vibrationen und die künstlich erzeugten Blitze nahmen an Intensität noch einmal zu, und sogar dem General dämmerte inzwischen, dass hier irgendetwas nicht in Ordnung war. »Was ist los?«
Watterson konnte seine Stimme kaum hören, aber er stellte sich die gleiche Frage. Die Zeiger der Volt- und Amperemeter – soeben noch auf Null und in Ruheposition – standen zitternd im roten Bereich der Messskalen.
Eine kurze Pause setzte ein, ehe die sechste Hallwelle aufbrandete und die Zeiger weit aus dem kritischen Bereich hinauswanderten. Die Erschütterungen sprengten jedes erträgliche Maß. Gesteinsbrocken lösten sich aus der Decke und stürzten polternd herab. Ein breiter Riss klaffte plötzlich in einer der Höhlenwände, die von Soldaten der technischen Truppe mit Beton verstärkt worden waren. Watterson musste sich an der Instrumententafel festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren und hinzustürzen.
»Was ist los?«, wiederholte der General seine Frage. Watterson wusste es nicht, aber es konnte nichts Gutes sein.
»Lassen Sie den Saal räumen«, brüllte er. »Alle nichts wie raus – auf der Stelle!«
Der General deutete auf den Fahrstuhlkäfig, der sie durch gut einhundertdreißig Meter soliden Fels ans Tageslicht bringen würde. Die Anwesenden stürmten wie eine in Panik geratene Rinderherde darauf zu. Doch die Vibrationen wurden noch einmal stärker, und die hintere Höhlenwand gab nach, ehe sie den rettenden Lift erreichten.
Tausend Tonnen Gestein und Betontrümmer stürzten auf sie herab. Diejenigen, die der Wand am nächsten waren, wurden sofort zerquetscht. Die Nachfolgenden konnten gerade noch rechtzeitig zurückweichen und sich in Sicherheit bringen, als die Gitterkonstruktion des Fahrstuhlschachts aus der Verankerung gerissen und von den Gesteinsmassen beiseitegeschoben wurde.
Watterson geriet in Panik. Seine Hände flatterten wie aufgescheuchte Vögel über die Instrumententafel, legten Schalter um, drückten auf Schaltknöpfe und klopften auf Anzeigen. Das Beben intensivierte sich. Der Donner, der durch die Felsmassen rollte, wurde ohrenbetäubend.
Cortland packte den Wissenschaftler bei den Schultern. »Ausschalten!«
Watterson reagierte nicht. Er versuchte das Geschehen zu begreifen.
»Haben Sie nicht gehört?«, brüllte der General. »Schalten Sie die verdammte Anlage aus!«
»Sie ist ausgeschaltet!«, brüllte Watterson zurück und schüttelte die Hände des Generals ab.
»Wie bitte?«
»Sie ist schon seit dem ersten Entladungsblitz ausgeschaltet«, erklärte Watterson.
Die letzte Welle verlief sich, aber auf den Anzeigen der Instrumententafel konnte er erkennen, dass sich die nächste bereits aufbaute. Die Nadeln spielten verrückt, und Watterson wurde aschfahl. Bislang war jede Welle stärker gewesen als die vorhergehende. Er wagte nicht, sich vorzustellen, mit welcher Wucht diese neue Welle auf sie zurollen mochte.
»Woher kommt dann diese Energie?«, wollte Cortland wissen.
»Von überall«, antwortete Watterson. »Aus jeder Richtung. Das sollte das Experiment doch beweisen.«
Abermals erbebte die Höhle. Diesmal beschränkten sich die Entladungsblitze nicht nur auf die stählernen Stäbe, sondern zuckten quer durch die Kaverne, schlugen in die Wände, die Decke und den Boden ein. Gesteinssplitter wurden herausgesprengt, Staubwolken wallten auf und wehten in den Felsensaal.
Inmitten der verzweifelten Schreie und namenlosen Panik stand Watterson wie gelähmt vor der Instrumententafel und musste tatenlos zusehen, wie sein mühsam erkämpfter Triumph in eine Katastrophe mündete. Ein bedrohliches Knirschen erklang über seinem Kopf.
Während die Höhle derart heftig schwankte, dass sie sich kaum aufrecht halten konnten, blickten Watterson und der General nach oben. Der dunkle Schatten einer Spalte zog sich durch die Decke. Er reichte von Wand zu Wand und zerfaserte abrupt zu einem Spinnennetz winziger Risse.
Schließlich löste sich die gesamte Decke auf, und Millionen Tonnen Felsgestein stürzten auf sie herab.
Der Tod raffte alles Leben in der Höhle dahin, und weder Watterson noch der General erfuhren jemals, welche vernichtenden Kräfte sie geweckt hatten und wie viel Unglück und Verderben das nachfolgende Erdbeben in San Francisco auslöste.
1
Dezember 2009
Patrick Devlin stand inmitten eines aufkommenden Unwetters auf dem Achterdeck des hochseetüchtigen Schleppers Java Dawn, der durch eine einzige massive Trosse mit dem von Rost zerfressenen Stahlkoloss eines ehemaligen Kreuzfahrtschiffs namens Pacific Voyager verbunden war.
Hohe Wellen drückten von der Seite gegen den Schlepper und brachen sich mit dem ohrenbetäubenden Krachen einer Schrotflintensalve an seinem Rumpf. Sintflutartiger Regen überschüttete das stampfende Schiff und mischte sich mit dichten Wolken eisiger Gischt, die der Sturm von den Wellenkämmen riss und über das Deck peitschte.
Umgeben von Schlepp- und Ladevorrichtungen, wozu auch ein zwanzig Meter hoher Kran und eine leistungsfähige Winsch mit imposanter Kabeltrommel gehörten, wirkte Devlin beinahe zwergenhaft. Tatsächlich war er einen Meter achtzig groß und hatte auffällig breite Schultern, die er in diesem Moment zum Schutz vor der Kälte hochzog.
Mit den grauen Bartstoppeln auf seinen Wangen und der faltigen sonnenverbrannten Haut um seine Augen stellte er auch optisch den Inbegriff des sturmerprobten Seefahrers dar, der er tatsächlich war. Indem er die sich stetig verschlechternde Wetterlage, die zunehmende Spannung der Schlepptrosse und den schweren Seegang addierte, gelangte er zu einer schwerwiegenden Schlussfolgerung: Es war eine in jeder Hinsicht fatale Entscheidung gewesen, den Hafen zu verlassen. So wäre es reines Glück, wenn sie unversehrt wieder dorthin zurückkehrten.
Während Devlin den Telefonhörer der schiffsinternen Sprechanlage aus der sturmsicheren Halterung angelte, wurde der Bug des Schleppers von einer schweren Quersee überrollt. Der Kapitän meldete sich am anderen Ende der Leitung.
»Welcher Kurs?«, brüllte Devlin in die Sprechmuschel.
»Genau nach Süden«, antwortete der Kapitän.
»Nicht gut«, erwiderte Devlin. »Diesen schweren Querseen können wir nicht ewig standhalten. Wir müssen den Bug in die Wellen drehen.«
»Das ist unmöglich, Padi«, lehnte der Kapitän ab. »Dann packt uns der Sturm von vorn.«
Während er sich mit dem Rücken gegen das Schott presste, um durch das Schlingern des Schleppers nicht von den Füßen gerissen zu werden, beobachtete Devlin, wie ein schwerer Brecher das Deck unter sich begrub. »Das ist der nackte Wahnsinn«, stieß er keuchend hervor. »Wir hätten Tarakan niemals verlassen dürfen.«
Tarakan war der Name des verschlafenen Provinznests mit primitivem Hafen auf der gleichnamigen Insel vor der Küste des indonesischen Teils von Borneo. Dort hatten sie die Pacific Voyager abgeholt. Das alte Kreuzfahrtschiff war an dieser Stelle vor einigen Jahren wegen notwendiger Reparaturarbeiten nach einer Havarie vor Anker gegangen. Als seine Schifffahrtslinie mehrere Tage später Konkurs angemeldet hatte, blieb die Voyager sich selbst überlassen und vergessen.
Irgendwann wurde das Schiff dann an einen geheimnisvollen Interessenten verkauft, aber aus unerfindlichen Gründen blieb die Voyager auch für weitere drei Jahre in Tarakan liegen und rostete vor sich hin. Wahrscheinlich wegen des Konkursverfahrens und infolge von Streitigkeiten hinsichtlich der Übernahme der Reparaturkosten, wie Devlin vermutete.
Was auch immer der Grund sein mochte, auf jeden Fall sah das Schiff völlig heruntergekommen aus, als sie es fanden: der ganzen Länge nach mit einer dicken Rostschicht bedeckt und kaum seetüchtig. Die notdürftig reparierten Schäden, dort, wo der Frachter es gerammt hatte, waren als ausgefranstes Loch knapp oberhalb der Wasserlinie in Bugnähe deutlich zu sehen.
Nun in den Klauen eines Sturms gefangen, der an Wucht stetig zunahm, würde die Voyager so gut wie sicher in Kürze absaufen.
»Was macht die Trosse?«, fragte der Kapitän.
Devlin blickte auf das dicke Tau, das von der riesigen Winsch über den Achtersteven des Schleppers bis zur Voyager reichte. Das Tau straffte sich unter der schweren Last, ehe es wieder schlaff durchhing.
»Die Spannung der Trosse wechselt ständig«, meldete Devlin. »Der Rosteimer fängt schon an, mit der Dünung zu rollen. Außerdem liegt er deutlich tiefer im Wasser. Wir müssen die Notbesatzung zurückholen.«
Gegen den ausdrücklichen Wunsch Devlins hatte der Kapitän drei Männer an Bord des Kreuzfahrtschiffs zurückgelassen, wo sie mögliche Lecks aufspüren und melden sollten – unter den herrschenden Bedingungen war dies lebensgefährlich und zudem eine vollkommene Zeitverschwendung. Falls die Voyager volllief, hätten sie nichts tun können, um es zu verhindern. Und falls sie zu sinken begann – wovon Devlin mittlerweile überzeugt war –, müssten sie die Trosse kappen und sich von dem Schiff trennen, ehe es die Java Dawn mit sich in die Tiefe zog. Aber angesichts der drei Männer an Bord des schwimmenden Schrotthaufens wäre für Devlin das Kappen der Trosse gleichbedeutend mit vorsätzlichem Mord.
Der massige Schlepper kippte nach vorn und tauchte mit dem Bug in das bis zu diesem Zeitpunkt tiefste Wellental. Dabei nahm die Spannung der Trosse so zu, dass sie wie eine Klaviersaite zu singen begann. Die enorme Last zerrte am Heck des Schleppers und zog ihn zurück. Die Propeller kämpften dagegen an und brachten die Wassermassen um den Rumpf zum Brodeln.
Als der Schlepper vom nächsten Wellenkamm hochgehoben wurde, tauchte die Voyager offenbar gleichzeitig in ein Wellental, weil die Trosse abwärtsgezogen wurde. Sie knickte hinter dem mit Stahlträgern verstärkten Bügel über dem Heckspiegel des Schleppers nach unten ab und drückte das gesamte Achterschiff unter Wasser.
Devlin setzte das Fernglas an die Augen. Der Wellengang sorgte zwar dafür, dass ihre Notlage nicht in vollem Umfang einzuschätzen war, aber das Wichtigste war doch zu erkennen. Die Voyager lag um einiges tiefer im Wasser.
»Sie ist buglastig, Käpt’n. Und sie hat leichte Schlagseite nach Backbord.«
Der Kapitän zögerte. Devlin wusste auch, weshalb: Diese Abschleppoperation brachte ein kleines Vermögen ein, das sie jedoch in den Wind schreiben müssten, wenn das Schiff seinen Bestimmungsort nicht erreichte.
»Rufen Sie sie zurück!«, drängte Devlin. »Um Himmels willen, Käpt’n, holen Sie die Männer von diesem schwimmenden Sarg herunter!«
Der Kapitän ließ sich mit seiner Antwort einige Sekunden Zeit. Dann meinte er: »Wir haben sie schon mehrmals angefunkt, Padi. Sie antworten nicht. Irgendwas muss schiefgegangen sein.«
Die Worte ließen Devlins Blut gefrieren. »Wir müssen ein Boot rüberschicken.«
»Bei diesem Unwetter? Viel zu gefährlich.«
Als wollte sie diese Feststellung unterstreichen, traf eine weitere Welle den Schlepper breitseits, und einige tausend Liter Seewasser wälzten sich über die Reling und überfluteten das Achterdeck.
Der kraftvolle Schlepper schüttelte diese Wassermassen noch ab, doch nur wenige Augenblicke später wurde er von einer weiteren Welle getroffen, die ihn mit noch mörderischerer Wucht überspülte.
Während sich die Java Dawn von dieser neuerlichen Attacke des aufgewühlten Ozeans erholte und mühsam wieder aufrichtete, schaute Devlin zur Voyager hinüber.
Es war deutlich zu erkennen, dass sie sank. Entweder waren einige Luken geborsten, oder bei den Reparaturarbeiten musste geschlampt worden sein.
Der Kapitän musste es ebenfalls gesehen haben. »Wir sollten sie aufgeben«, entschied er.
»Nein, Käpt’n!«
»Wir müssen es tun, Padi. Machen Sie die Trosse los. Die Männer haben ein eigenes Boot. Und wir können ihnen nicht helfen, wenn wir untergehen.«
Die nächste Welle krachte auf das Deck.
»Um Gottes willen, Käpt’n, lassen Sie die Männer nicht im Stich!«
»Kappen Sie die Trosse, Padi! Das ist ein Befehl!«
Devlin wusste, dass die Entscheidung des Kapitäns richtig war. Er ließ den Telefonhörer los und streckte die Hand nach dem Hebel aus, mit dem sich im Notfall die Verbindung zwischen dem Havaristen und dem Hochseeschlepper trennen ließ.
Das Deck bäumte sich auf, als ein weiterer schwerer Brecher über das Heck schlug und sich auf ihn zuwälzte. Er traf ihn wie eine Brandungswelle am Strand, riss ihn von den Füßen und sog ihn mit sich.
Während er sich aufrappelte, sah Devlin, dass die Trosse nun im Wasser verschwand. Durch den Regen und die Gischtwolken konnte er erkennen, dass das Kreuzfahrtschiff bereits teilweise von der Dünung überspült wurde. Es sank schnell, tauchte in den Abgrund hinab und zog den Schlepper jetzt mit sich in die Tiefe. Das Heck des Schleppers wurde bereits überflutet.
»Padi!«
Der Ruf drang aus dem an seiner Schnur baumelnden Telefonhörer, aber Devlin brauchte keine weitere Aufforderung mehr. Er streckte sich nach dem Nothebel und zog mit aller Kraft daran.
Ein lauter Knall ertönte. Die mächtige Trosse löste sich und glitt wie eine Pythonschlange auf der Flucht vor einem übermächtigen Feind schlängelnd über das Deck. Der Schlepper machte einen Satz vorwärts und stellte für einen kurzen Moment den Bug auf, sodass Devlin mit dem Gesicht zuerst gegen das nächste Schott geworfen wurde. Seine Unterlippe platzte auf, und der runde Kopf einer Niete bohrte sich in ein Auge und blendete ihn.
Für einen kurzen Moment war er benommen gewesen, doch dann gewann Devlin seine Orientierung zurück und wandte sich um. Das alte Kreuzfahrtschiff tauchte in einem sanften Winkel geradezu friedlich in den tobenden Ozean ab. Sekunden später war es verschwunden. Die Männer, die auf dem Schiff zurückblieben, waren dem sicheren Tod geweiht. Aber die Java Dawn war frei.
Devlin schnappte sich den hin und her schwingenden Telefonhörer.
»Drehen Sie um«, verlangte er. »Vielleicht sind die Männer über Bord gegangen.«
Das Deck erzitterte, als das Ruder und die Propeller ihre volle Wirkung entfalteten. Der Schlepper vollführte eine scharfe, gefährliche Wende. Nachdem er seine Drehung vollendet hatte, stand Devlin bereits am Bug.
Es war nahezu vollständig dunkel. Am Himmel über der schwarzen See verblasste ein letzter silberner Schimmer. Kein Farbtupfer hellte die Szenerie auf. Devlin kam sich vor wie in einem Schwarzweißfilm.
Er starrte in die Finsternis. Dort war nichts zu sehen.
Die Suchscheinwerfer des Schleppers tasteten die nähere Umgebung ab. Zweifellos hielten ebenso wie Devlin alle Angehörigen der Schleppercrew Ausschau nach den Männern. Ohne Erfolg.
Achtzehn Stunden lang sollte die Java Dawn vergebens nach den verschollenen Angehörigen ihrer Mannschaft suchen.
Der Ozean gab sie nicht mehr frei.
2
Gegenwart
Sebastian Panos schlich durch den schmalen Korridor wie eine streunende Katze durch die nachtdunklen Hinterhöfe der Gourmettempel der »Restaurant Row« in Manhattan. Der Flur war kalt und nass und hatte mehr Ähnlichkeit mit einem Abwasserkanal als mit einem Laufgang. Kondenswasser troff so reichlich von den Wänden, dass er sich oft fragte, ob die giftige Brühe außerhalb der Unterwasserstation nicht durch die Mauern sickerte und sie alle langsam aber sicher tötete.
Dennoch war es hier nicht so schlimm wie auf der Insel mit dem berüchtigten Steinbruch in ihrer Mitte, wo der Hauptanteil der Arbeiten ausgeführt wurde. Verglichen damit waren die Bedingungen in dieser Station beinahe angenehm. Trotzdem konnte Panos an nichts anderes als Flucht denken.
Als Ingenieur und zypriotischer Staatsbürger mit griechischen und türkischen Vorfahren war er mit der Aussicht auf einen umfangreichen Auftrag und genug Geld, um seiner Familie ein sorgenfreies Leben zu garantieren, in diesen Unterwasseralbtraum gelockt worden. Als Gegenleistung musste er drei Jahre seines Lebens opfern und absolute Verschwiegenheit geloben. Nach einem halben Jahr machte sich ein erstes Unbehagen bei ihm bemerkbar. Und ehe das erste Jahr verstrichen war, wusste er, dass er einen großen Fehler gemacht hatte.
Gesuche, vorzeitig entlassen zu werden, wurden abgelehnt. Sämtliche Kommunikation wurde überwacht und häufig unterbrochen. Protest, ganz gleich, wie behutsam geäußert, resultierte in versteckten Drohungen. Sollte er sich weigern, in der Station zu bleiben und seine Arbeit zu vollenden, müsse er damit rechnen, dass seiner Familie etwas zustieß.
Als das Projekt mehr und mehr Gestalt annahm, wurden Panos und die anderen Ingenieure gezielt gegeneinander ausgespielt. Es war unmöglich zu entscheiden, wem noch zu trauen war und vor wem man sich in Acht nehmen musste. Sie begegneten einander mit Misstrauen, taten, was von ihnen verlangt wurde, und aus einem Jahr wurden zwei.
Die ganze Zeit verbrachte Panos wie ein gewaltsam zum Dienst auf einem Schiff angeworbener Matrose. Er hatte keine andere Wahl, als die Forderungen seines Herrn zu erfüllen, wenn er sein Leben nicht aufs Spiel setzen wollte, obgleich er sich zunehmend sicher war, dass ihn der Tod erwartete. Das Projekt war so geheim und obskur, dass seine Logik ihm sagte, am Ende werde kein Zeuge übrig bleiben.
Hier kommt niemand lebend raus, hatte ein Arbeitskollege einmal scherzhaft bemerkt. Einen Tag später war der Mann verschwunden, daher traf seine Prophezeiung wahrscheinlich zu.
Panos erinnerte sich an ein Angebot, seine Familie mitzunehmen. Er war kein religiöser Mensch, aber er dankte welchem Gott oder Geist oder geheimnisvollen Instinkt auch immer, der ihn dieses Angebot hatte ablehnen lassen. Andere hatten ihre Familien mitgebracht. Er hatte sie auf der Insel gesehen, elend und unglücklich, in viel schlimmerem Maß Gefangene als er selbst. Frühzeitig hatte er erkannt, dass man ihnen nicht trauen konnte. Sie waren am einfachsten unter Kontrolle zu halten, da sie noch mehr zu verlieren hatten als nur ihr eigenes Leben. Einige hatten sogar Kinder, die in den Tiefen dieser grässlichen, schwefelgeschwängerten Welt geboren worden waren. Sie lebten wie Schuldknechte, wie Sklaven, die zum Bau einer neuzeitlichen Pyramide verurteilt waren.
Panos konnte es sich wenigstens halbwegs ungefährdet erlauben, an Flucht zu denken, auch wenn er nicht ernsthaft in Erwägung zog, etwas Derartiges tatsächlich zu versuchen. Zumindest nicht, bis die Nachricht in seinem Spind lag.
Es war die erste in einer Reihe geheimnisvoller Botschaften von einem unsichtbaren Schutzengel.
Anfangs hatte er angenommen, dass es eine Falle war, ein kleiner Test, um zu sehen, ob er nach dem Köder schnappen werde. Aber er hatte einen Punkt erreicht, an dem Zweifel nicht mehr von Bedeutung waren. Die Freiheit winkte. Ganz gleich, ob sie sich ihm durch Flucht oder durch den kalten Hauch des Todes bot, sie war ihm in jeder Gestalt willkommen.
Er ging auf das Angebot ein und erhielt weitere Mitteilungen. Sie erreichten ihn unregelmäßig und zu den verschiedensten Zeiten. Hilfe zu seiner Flucht stünde bereit, versprachen die Nachrichten, aber zuvor seien einige Bedingungen zu erfüllen. Er sollte die Pläne dieser schrecklichen Waffe denjenigen mitbringen, die den Wahnsinnigen möglicherweise aufhalten könnten, der sie baute. Ein Treffpunkt wurde vereinbart. Panos hatte nichts anderes zu tun, als lebendig bis zu dem entsprechenden Ort zu gelangen.
Mit diesem Ziel vor Augen huschte er durch den von Kondenswasser triefenden Korridor und gelangte zur Tauchkammer. Es war so spät, um davon ausgehen zu können, dass dort niemand mehr anzutreffen war. Mit dem Schlüssel, den sein unbekannter Kontakt in seinem Spind deponiert hatte, öffnete Panos die Tür und schlüpfte in den Raum dahinter. Er schloss die Tür hinter sich und knipste eine Schreibtischlampe an.
Der Raum hatte einen rechteckigen Grundriss von etwa sieben mal dreizehn Metern, in dessen Mitte eine wasserdichte Luftschleuse aufragte. Durch die dicken Glaswände der Schleuse war ein kreisrunder Tümpel dunklen Wassers zu erkennen.
Panos schaltete die Beleuchtung des Tümpels ein. Das Wasser erstrahlte nun in hellem Glanz und funkelte glasklar, weil die darin enthaltenen Giftstoffe bewirkten, dass es absolut keimfrei und überhaupt frei von Verunreinigungen war. Aber anstatt blau oder türkis oder grün schimmerte das Wasser rötlich, eine Farbe, die an durchsichtiges Blut erinnerte.
Panos atmete tief durch. Er hatte nichts zu befürchten. Der Tauchanzug würde ihn vor den Giftstoffen schützen. Zumindest hoffte er, dass er es tat.
Er warf einen Blick auf ein Whiteboard. Drei von Hand geschriebene Zahlen waren darauf zu erkennen: 3, 10, 075. Sein unsichtbarer Helfer war also schon vor ihm dort gewesen, genauso wie er es versprochen hatte.
Panos prägte sich die Zahlen ein und wischte sie eilig weg. Er ging zum dritten Spind und öffnete ihn. Ein Tauchanzug und Sauerstoffflaschen waren für ihn vorbereitet worden. Die Lünette einer Taucheruhr, die neben dem Anzug hing, war auf zehn Minuten eingestellt. Dies war die Zeitspanne, die er brauchte, um mit einer Geschwindigkeit von etwa neun Metern pro Minute aufzutauchen, ein Tempo, das ihn vor den gefährlichen Auswirkungen der Taucherkrankheit bewahrte. Außer der Uhr wartete auch ein Marschkompass auf ihn. Wenn er auftauchte, würde er ihn ausrichten und sich nach der Kursangabe richten: 075 Grad. In dieser Richtung würde er Hilfe finden.
Ein Tauchermesser wäre seine einzige Waffe, falls er eine brauchte.
Er schnallte die Uhr ums Handgelenk und schleppte die Sauerstoffflaschen zur Luftschleuse. Er steckte den Kompass in die Hosentasche und überprüfte ein zweites Mal, dass sich die Ware, die er mitzunehmen versprochen hatte – die Lagepläne der Station und die mit Daten gefüllte tragbare Computerfestplatte –, sicher in einer wasserdichten Box befand.
Er verstaute die wertvolle Beute in seinem Hemd, holte den sperrigen Anzug aus dem Spind und setzte sich hin, um ihn anzuziehen. Ehe er ein Bein hineinschieben konnte, erklang ein leises Klicken.
Ein Schlüssel im Türschloss.
Der Türknauf drehte sich, und die Tür schwang auf. Zwei Gestalten kamen herein, in ein angeregtes Gespräch vertieft.
Für einen kurzen Moment bemerkten sie Panos nicht. Als sie ihn dann doch entdeckten, erschienen sie eher verwirrt und überrascht als alarmiert. Aber Panos wusste, dass ihn der Anzug und die Sauerstoffflaschen verraten würden.
Er griff an, ehe die Männer reagieren konnten, zielte mit dem Messer auf die Gestalt, die ihm am nächsten war, und stieß dem Mann die Klinge in die Schulter. Der taumelte zurück, umklammerte Panos und zog ihn mit sich zum Schreibtisch. Der zweite Mann sprang ihn von hinten an und schlang einen Arm um seinen Hals.
Panos bäumte sich auf und warf sich nach hinten, bis sie beide gegen den Schreibtisch prallten, zu Boden stürzten und getrennt wurden.
Angestachelt vom Adrenalin in seinem Blut, kam Panos als Erster wieder auf die Beine. Er rammte dem Mann ein Knie ins Gesicht, ergriff dann die Schreibtischlampe und schmetterte sie auf die Stirn des Gegenübers. Der Mann sackte auf den Boden und rührte sich nicht mehr, aber der Erste, den Panos mit dem Messer erwischt hatte, rannte zur Tür hinaus.
»Nein!«, rief Panos.
Da keine Möglichkeit bestand, die Tür zu verbarrikadieren, und nur eine kurze Zeitspanne blieb, bis ein Alarm ausgelöst würde, traf er eine folgenschwere Entscheidung. Er ließ den Taucheranzug auf den Boden fallen und betrat die Luftschleuse. Indem er einen Schalter umlegte, schloss er die innere Tür und begann damit, das Tauchgeschirr und eine Sauerstoffflasche anzulegen.
Panos hatte ein Knacken in den Ohren, als ihm ein Zischen verriet, dass die Luftschleuse verriegelt und unter Druck gesetzt wurde. Obgleich der Innendruck der Station das Zweifache des normalen Luftdrucks an der Erdoberfläche betrug, reichte er nicht aus, um zu verhindern, dass Wasser durch den offenen Tauchpool eindrang. Darum war die Luftschleuse nötig.
Er setzte den Tauchhelm auf. Die Dichtung erfüllte ihren Zweck zumindest einigermaßen. Panos vergewisserte sich, dass die Atemluft in ausreichender Menge aus der Druckflasche strömte, zog die Schwimmflossen an und ließ sich in das leuchtend rote Wasser gleiten.
Stille umgab ihn. Er schwamm abwärts, weg vom Licht und hinaus in die Dunkelheit. Als er den Rand des Unterwasserbauwerks erreichte, verstärkte er den Beinschlag und strebte aufwärts. Oder, genauer, in die Richtung, die er für aufwärts hielt.
In einhundert Metern Tiefe war kein Lichtschein auszumachen. Er verlor schnell die Orientierung. Ein Schwindelgefühl setzte ein, und es schien, als vollführte sein Körper Purzelbäume, obwohl er vollkommen ruhig im Wasser schwebte.
Als er eine Lampe anknipste, nutzte ihm das nur wenig. Im roten Wasser war so gut wie nichts zu erkennen. Er geriet in Panik, da er wusste, dass schon bald Männer aus der Station die Jagd nach dem Flüchtling aufnehmen würden.
Was hatte er getan?
Er atmete eine Wolke Luftblasen aus. Unbewusst achtete er darauf, in welche Richtung sie davontanzten. Panos kam es vor, als bewegten sich die Luftblasen seitwärts, aber die Vernunft sagte ihm, dass dies nicht der Fall. Die Luftblasen konnten nicht anders als senkrecht nach oben aufsteigen. Die Naturgesetze konnten nicht verändert oder so überlistet werden wie sein Gleichgewichtssinn.
Indem er seinen Verstand zwang, sich über das hinwegzusetzen, was sein Innenohr ihm vorgaukelte, begann er den Luftblasen zu folgen. Dabei kam es ihm so vor, als tauche er in den Schacht, also hinab auf den Grund dieser roten Todesgrube, anstatt hinauf zum Tageslicht.
Er setzte seinen Weg fort, bis sein Geist ihn als richtig erkannte. Sein Gleichgewichtssinn pendelte sich wieder ein und normalisierte sich. Er atmete eine weitere Wolke Luftblasen aus und schwamm, so schnell er konnte, in Richtung Wasseroberfläche.
In seiner Eile vergaß Panos, die zehnminütige Zeitspanne einzuhalten. Als er über sich die Wasseroberfläche schimmern sah, wurde er von schmerzhaften Krämpfen gepackt. Seine Knie, Ellbogen und sein Rücken fühlten sich an, als wollten sie ihm den Dienst versagen.
Trotz der Schmerzen brach Panos durch die Wasseroberfläche und blickte zum ersten Mal seit Monaten zum Abendhimmel auf. Er war lavendelblau. Panos vermutete, dass vor nicht allzu langer Zeit die Abenddämmerung eingesetzt hatte.
Er sah sich um. Auf allen Seiten begrenzten hohe Sandwälle die Sicht. Die hatte er noch nie zuvor gesehen. Er wusste nicht einmal, wo er sich befand. Personelle Zugänge und Abgänge fanden stets unter Sedierung statt. Die Arbeitskräfte wurden hier in Tiefschlaf versetzt und auf der Insel geweckt oder in diesem Zustand von der Insel in den Unterwasserkomplex transportiert.
Trotz der Schmerzen in seinen Gelenken schaffte es Panos, den Kompass aus der Hosentasche zu holen. Er begann in Richtung 075 Grad zu schwimmen. Das quälende Pochen in seinen Gelenken verschlimmerte sich noch und wurde schon bald von blendend hellen Lichtblitzen begleitet, die wie ein Gewitter durch sein Gehirn zuckten.
Trotzdem kämpfte er sich weiter, kroch am Ende aus dem Wasser und schleppte sich an den Sandstrand. Er legte einige Meter zurück, bis er zu einer Felsenterrasse gelangte. Sie war nicht mehr als drei Meter hoch, kam ihm jedoch wie ein Berg vor.
Wie sollte er sie erklimmen? Er konnte es nicht. Nicht in diesem Zustand. Er versuchte sich aufzurichten und brach von Schmerzen gepeinigt zusammen.
Das Geräusch eiliger Schritte, die sich näherten, kündigte sein nahes Ende an. Aber als ein Paar Hände ihn ergriff und hochhob, geschah es eher fürsorglich und behutsam.
Er erblickte ein Gesicht, das zur Hälfte von einem Halstuch verhüllt wurde.
»Sie sind zu hastig aufgetaucht«, sagte der Mann hinter dem Halstuch.
»Ich … musste es …«, stieß Panos hervor. »Sie … haben mich gesehen.«
»Sie wurden gesehen?«
»In der Luftschleuse …«, sagte Panos.
»Das heißt, dass sie kommen.«
Der unbekannte Helfer packte Panos unter den Achseln und hievte ihn die Felsstufe hoch, ohne auf seine Schmerzen Rücksicht zu nehmen. Er schleppte ihn zu einem wartenden SUV, lud ihn in den Kofferraum und schlug die Heckklappe zu.
Panos rollte sich in fetaler Haltung zusammen, während sein Retter sich hinters Lenkrad setzte und den Zündschlüssel umdrehte.
Der Motor heulte auf, und sie rollten hüpfend über unwegsames Gelände, wobei jedes Schwanken eine neue Schmerzwelle erzeugte. Panos kam es vor, als würde sein Körper zerquetscht und zugleich auseinandergerissen.
»Ich sterbe«, schrie er.
»Nein«, widersprach der Fahrer. »Aber es wird noch etwas schlimmer, bevor es sich bessert. Benutzen Sie Ihr Atemventil. Das hilft.«
Panos gelang es unter Mühen, das Genannte in seinen Mund zu bugsieren. Er fixierte es, indem er krampfhaft die Zähne zusammenbiss, und atmete so tief er konnte. Aber sogar jetzt noch wurde er von einer ganzen Serie schwerer Krämpfe durchgeschüttelt, während das SUV über tiefe Bodenwellen ratterte.
Panos drückte den Kopf tiefer auf die Brust. Es schien, als mildere er damit die Schmerzen ein wenig. Gleichzeitig bemerkte er, wie sich seine Finger und Arme einwärtskrümmten.
»Haben Sie die Papiere?«, fragte der Fahrer. »Und den Computer?«
Panos nickte. »Ja … können Sie mir verraten, wohin wir fahren?«
Der Fahrer zögerte, als befürchtete er, zu viel verlauten zu lassen, falls sie doch noch geschnappt würden. Schließlich gab er sich jedoch einen Ruck. »Zu jemandem, der helfen kann«, sagte er. »Zu jemandem, der diesem Wahnsinn ein für alle Mal ein Ende bereiten kann.«
3
Sydney, Australien, 19.00 Uhr
Kurt Austin saß in einem komfortablen Sessel der achten Sitzreihe vor der Hauptbühne des Joan Sutherland Theatre, dem kleineren der beiden von einem Segelschiff und einer Seemuschel inspirierten Gebäude des berühmten Sydney Opera House. Die größere Concert Hall befand sich nebenan und wurde zu diesem Zeitpunkt nicht benutzt.
Seit Jahren hatte Kurt die Absicht gehabt, Sydney zu besuchen und einer Vorstellung in diesem Gebäude beizuwohnen. Beethoven und Wagner hätten ihm gut gefallen, und beinahe hätte er den Abstecher dorthin arrangieren können, als U2 anlässlich ihrer Welttournee dort auftraten, aber leider hatte es zeitlich dann doch nicht gepasst. Unglücklicherweise war nun, da er es endlich geschafft hatte, das Einzige, was von der Bühne an seine Ohren drang, ein staubtrockener, akademischer Vortrag, bei dem ihm immer wieder die Augen zufielen.
Er nahm an der Muldoon Conference on Underwater Mining teil, veranstaltet von Archibald und Lisette Muldoon, einem reichen australischen Ehepaar, das im Verlauf von vierzig Jahren mit riskanten Bergbauprojekten ein Vermögen verdient hatte.
Kurt Austin war auf Grund seiner Erfahrung in der Tiefseebergung und seiner Position als Chef der Special-Projects-Abteilung bei der National Underwater and Marine Agency als offizieller Gast eingeladen worden. Doch es schien, als wünschten die Muldoons seine Anwesenheit auch deshalb, weil sie offenbar hofften, ihre Veranstaltung mit dem Fünkchen Ruhm aufwerten zu können, den er sich in der Bergungsindustrie erworben hatte – falls es in diesem schwierigen Geschäft überhaupt so etwas wie Ruhm zu erwerben gab.
Während des letzten Jahrzehnts war er an einer Reihe bedeutender Unternehmungen beteiligt gewesen. Einige dieser Projekte unterlagen strengster Geheimhaltung, und es gab lediglich Gerüchte, dass sie stattgefunden hatten. Andere Vorfälle hatten den Weg in die Öffentlichkeit gefunden und waren weithin bekannt geworden, darunter auch ein kürzlich erfolgter Einsatz, um einen Schwarm selbstreduplizierender Mikromaschinen aus dem Indischen Ozean zu fischen, ehe sie die Wetterverhältnisse über Indien und Asien veränderten, was den Hungertod von Milliarden Menschen zur Folge gehabt hätte.
Neben dem, was er an Bekanntheit errungen hatte, erfreute sich Kurt einer bemerkenswerten äußeren Erscheinung, die sofort ins Auge fiel. Braungebrannt, mit frühzeitig ergrautem Haar und intensiven tiefblauen Augen, war er der Prototyp des sprichwörtlichen Abenteurers. All das hatte zur Folge, dass seine Abwesenheit bei jedem publikumswirksamen Ereignis sofort aufgefallen wäre, was die ständige Aufmerksamkeit von Seiten eines oder beider Muldoons bislang aber hatte verhindern können.
Sie waren in jeder Hinsicht großzügig und durchaus liebenswert, aber nach drei Tagen, die mit Seminaren und Vorträgen vollgestopft waren, hatte Kurt Austin allmählich genug und plante seine Flucht.
Während sich die Beleuchtung im Saal verdunkelte und der Redner mit der Präsentation einer Fotoserie begann, erkannte Kurt die Chance, auf die er sehnsüchtig gewartet hatte. Er angelte sein Mobiltelefon aus der Tasche und drückte auf die Taste, die ein Summen erklingen ließ, als wäre seine Nummer von einem Anrufer gewählt worden.
Ein paar Köpfe drehten sich zu ihm um.
Er zuckte mit einem verlegenen Lächeln entschuldigend die Schultern und hielt das Telefon ans Ohr.
»Hier ist Austin«, sagte er im Flüsterton zu niemandem. »Richtig«, fügte er mit ernster Stimme hinzu. »In Ordnung. Okay. Das klingt nicht gut. Natürlich. Ich mache mich gleich auf den Weg.«
Er tat so, als würde er die Verbindung unterbrechen, und verstaute das Telefon wieder in der Tasche.
»Gibt es Probleme?«, fragte Mrs. Muldoon, die zwei Plätze weiter neben ihm saß.
»Ein Anruf aus der Zentrale«, sagte er. »Ich soll etwas überprüfen.«
»Müssen Sie uns verlassen?«
Kurt nickte. »Ich fürchte. Wir arbeiten seit mehreren Tagen an einem speziellen Projekt, das offenbar in die entscheidende Phase eingetreten ist. Wenn ich mich nicht sofort persönlich darum kümmere, könnte es zu einer Katastrophe kommen.«
Mrs. Muldoon streckte den Arm aus und ergriff seine Hand. Ihre Miene drückte tiefe Enttäuschung aus. »Aber Sie versäumen den besten Teil des Vortrags.«
Kurt machte ein ernstes Gesicht. »Das ist nun mal der Preis, den ich zahlen muss.«
Nachdem er sich von den Muldoons verabschiedet hatte, erhob sich Kurt aus seinem Sessel und schlenderte durch den Mittelgang zu den Saaltüren. Er schlüpfte hinaus und eilte die Treppe zum Foyer hinauf. Um zu vermeiden, in Gespräche verwickelt zu werden, falls er anderen Konferenzteilnehmern begegnete, wandte er sich nach links und folgte einem gekrümmten Korridor zu einer nicht näher gekennzeichneten Seitentür.
Er stieß sie auf und trat in die schwüle Luft des australischen Abends hinaus. Zu seiner Überraschung war er nicht allein.
Eine junge Frau saß vor ihm auf einer Treppenstufe und hantierte gerade am Absatz einer hochhackigen Sandale herum. Sie trug ein weißes Cocktailkleid und eine ebenfalls weiße Blumenblüte in ihrem rotblonden Haar. Kurt tippte auf eine Orchidee.
Offensichtlich erschrocken über sein plötzliches Auftauchen, blickte sie hoch.
»Ich wollte Ihnen keine Angst machen«, sagte er.
Für eine Sekunde flackerte ihr Blick gehetzt, als habe er sie beim Diebstahl der Kronjuwelen erwischt. Dann schaute sie sich kurz um und konzentrierte sich wieder auf ihren Schuh. Sie zerrte an dem widerspenstigen Absatz, bis sein schlankes spitzes Ende zwischen ihren Fingern abbrach.
»Das dürfte Ihr Problem wahrscheinlich auch nicht lösen«, vermutete Kurt Austin.
»Meine Lieblingsschuhe«, sagte sie mit einem melodischen australischen Akzent. »Die geben den Geist meist am ehesten auf.«
Sichtlich enttäuscht, aber doch einen bewundernswert gesunden Menschenverstand demonstrierend, schlüpfte sie aus dem anderen Schuh, brach dessen Absatz ebenfalls ab und hielt beide Schuhe vergleichend nebeneinander.
»Zumindest passen sie jetzt zusammen«, sagte er und streckte eine Hand aus. »Kurt Austin.«
»Hayley Anderson«, erwiderte sie. »Stolze Besitzerin der teuersten Ballerinas in ganz Australien.«
Kurt musste lachen.
»Ich nehme an, Sie wollen sich den Hauptvortrag ersparen und haben die Flucht ergriffen«, sagte sie.
»Schuldig im Sinne der Anklage«, gab er zu. »Kann man mir das übel nehmen?«
»Überhaupt nicht«, erwiderte sie. »Wenn ich nicht hier sein müsste, läge ich sowieso längst am Strand.«
Sie stand auf und ging zu der Tür, durch die Kurt herausgekommen war. Er hätte es als bedauerlich empfunden, wenn diese Begegnung ein derart schnelles Ende gefunden hätte.
»In flachen Schuhen kann man auch durch Sand laufen«, meinte Kurt. »Fast genauso gut wie barfuß.«
»Tut mir leid«, sagte sie, »ich darf das nicht versäumen, sonst reißt mir jemand den Kopf ab. Aber Sie können mit mir wieder reingehen, und ich verspreche Ihnen, Sie bei guter Laune zu halten.«
»Wirklich verlockend«, sagte Kurt. »Aber meine mühsam zurückgewonnene Freiheit ist mir zu diesem Zeitpunkt zu viel wert. Wenn Sie da drin die Langeweile packt, finden Sie mich am Bondi Beach. Sie können mich gar nicht verfehlen. Ich bin derjenige, der ein wenig overdressed ist.«
Sie lachte verhalten und streckte schnell die Hand nach der Tür aus. Anscheinend hatte sie es eilig. Sie zog die Tür auf, aber dann hielt sie noch einmal inne. Ihr Blick wanderte an Kurt vorbei und über den Hafen von Sydney.
Kurt wandte sich um. Im abnehmenden Tageslicht gewahrte er die bogenförmige Gischtfahne am Heck eines Powerboots. Es schoss gerade quer durch den Hafen und kam dem Bug eines Fährschiffs gefährlich nahe. Ein wütender Warnton drang aus dem Nebelhorn des Fährschiffs, aber das Rennboot wurde kein Deut langsamer.
Einen kurzen Moment später erkannte Kurt, weshalb. Ein dunkelfarbiger Helikopter stieg hinter dem Fährschiff hoch, schwang sich im nächsten Augenblick über das mit Passagieren dicht bevölkerte Deck und ging über dem Wasser wieder in den Tiefflug über, um die Jagd fortzusetzen.
Das rasende Boot schwenkte nach links und rechts, furchte ein schäumendes S ins Hafenwasser und schob sich fast auf Tuchfühlung an einem langsamen Segelboot vorbei. Wer auch immer das Boot auf diesem Irrsinnskurs durch den Hafen lenkte, musste den Verstand verloren haben.
»Offenbar ein Irrer«, sagte Hayley Anderson und beobachtete die Manöver des Rennboots.
Kurt nahm den Helikopter genauer in Augenschein, einen dunkelblauen Eurocopter EC145. Eine kurze kugelförmige Kanzel, die weit vorragte, verlieh der Nase ein seltsam gedrungenes Aussehen und hatte Ähnlichkeit mit dem Maul eines besonders großen weißen Hais. Der Rotor hatte vier Blätter und war als weiße, verschwommene Scheibe über der Passagierzelle zu erkennen, während der kurze, kompakte Heckausläufer in drei kleinen vertikalen Stabilisierungsflossen endete, die Ähnlichkeit mit einem überdimensionalen Dreizack hatten.
Kurt konnte keinerlei Hoheitszeichen oder irgendwelche Navigationsleuchten ausmachen, aber er bemerkte grelle Lichtpunkte, die in der offenen Frachtraumtür aufflackerten: Mündungsblitze.
Er holte sein Mobiltelefon heraus und wählte 911. Nichts geschah.
Hayley machte einen Schritt vorwärts. »Dort wird geschossen. Sie wollen diese Leute töten.«
»Wie lautet hier die Notrufnummer?«
»Null, null, null«, antwortete sie.
Kurt tippte sie ein und drückte auf CALL. Als er weiterverbunden wurde, hatte das Powerboot seinen Kurs in Richtung Opernhaus geändert. Es kam mit Höchstgeschwindigkeit direkt auf sie zu. Sein Ziel war das runde Ende der Promenade, die wie eine breite Pier in den Hafen von Sydney hineinragte.
Der größte Teil der Promenade war eine glatte Mauer aus solidem Beton, aber auf der linken Seite führte eine Treppe zum Wasser hinunter. Das rasende Boot hielt in gerader Linie darauf zu. Der Helikopter folgte ihm und versuchte, in eine günstige Position zu gelangen, um dem Scharfschützen einen tödlichen Schuss zu ermöglichen.
Weitere Mündungsblitze flackerten in der Öffnung des Frachtabteils.
Das Boot wich scharf nach links aus, während der Schusslärm bis zum Ufer drang. Dann ging das Boot wieder auf seinen ursprünglichen Kurs und rammte mit vollem Tempo die Treppe. Es stieg in die Luft wie ein Automobil, das bei einem Filmstunt von einer schräg aufragenden Rampe abhebt. So flog es gut zwanzig Meter weit und drehte sich halb um die Längsachse, ehe es auf die Seite krachte.
Danach rutschte das Boot noch ein Stück über die Betonfläche, prallte gegen einen Lampenmast und zerbarst. Fiberglassplitter flogen in alle Richtungen, während sich der Lampenmast verbog und seine Leuchtelemente mit lautem Knall explodierten.
»Notrufzentrale«, meldete sich eine Stimme im Telefon.
Kurt war von dem Unfall derart gefesselt, dass er vergaß zu antworten.
»Hallo? Hier ist die Notrufzentrale.«
Während das zertrümmerte Powerboot zur Ruhe kam, donnerte der Eurocopter über die Szene hinweg und verfehlte nur knapp die oberste Spitze des Opernhausdachs.
Kurt reichte Hayley das Telefon. »Holen Sie Hilfe!«, rief er und rannte bereits die Treppe hinunter. »Polizei, Krankenwagen, Nationalgarde. Alles, was zur Verfügung steht.«
Kurt hatte keine Ahnung, was hier los war, aber sogar von seinem erhöhten Standort auf der Plattform konnte er erkennen, dass zwei Personen in den Bootstrümmern eingeklemmt waren, und er konnte auslaufendes Benzin riechen.
Er erreichte das Ende der Treppe, rannte ein kurzes Stück und flankte dann über eine Mauer auf die Promenade. Während er sich dem gestrandeten Boot näherte, berührten die immer noch rotierenden Propeller den Beton. Ein dichter Funkenschauer wirbelte in die Luft. Die Funken kamen mit den Benzindämpfen in Berührung, und ein Feuerball blähte sich auf.
Im Gefolge dieser kleinen Explosion loderte von der sich ausbreitenden Benzinpfütze eine Flammenwand hoch.
Trotz der glühenden Hitze stürzte sich Kurt in das Inferno.
In einhundertdreißig Metern Höhe und eine Meile entfernt flog der Eurocopter eine scharfe Kehre über den Randbezirken von Sydney.
Obwohl er angeschnallt war, streckte der Scharfschütze eine Hand aus, um sich am Türrahmen festzuhalten.
»Immer mit der Ruhe!«, rief er.
Er mühte sich bereits damit ab, ein Trommelmagazin mit fünfzig Schuss Inhalt an seinem langläufigen Heckler & Koch-Präzisionsgewehr einzurasten. Das Letzte, was er jetzt brauchen konnte, war, aus dem Frachtabteil hinausgeschleudert zu werden.
»Ich mache einen zweiten Überflug«, rief der Pilot zurück. »Wir müssen sichergehen, dass sie tot sind.«
Der Scharfschütze bezweifelte, dass jemand diese Kollision überlebt haben könnte, aber das zu entscheiden war nicht seine Aufgabe. Während der Helikopter in die Waagerechte zurückkehrte, gab der Schütze seine Versuche auf, das Gewehr mit dem Trommelmagazin zu versehen. Stattdessen rammte er ein standardmäßiges Zehn-Schuss-Magazin in den Magazinschacht.
»Halt den Vogel diesmal so ruhig wie möglich in der Luft«, verlangte er. »Zum Schießen brauche ich eine stabile Basis.«
»Wird gemacht«, erwiderte der Pilot.
Der Scharfschütze rutschte zur offenen Tür, winkelte ein Bein an und setzte sich auf den Unterschenkel, während er das andere Bein ausstreckte und sich mit dem Fuß auf der letzten Leiterstufe über den Landekufen des Helikopters abstützte.
Sie hatten die Kehre vollendet und näherten sich nun deutlich langsamer den Segeln des Operndachs. Der Schütze lud durch und machte sich schussbereit.
Als Kurt das zertrümmerte Boot erreichte, stand bereits das gesamte Heck in Flammen. Eine Gestalt kauerte auf dem Passagiersitz und versuchte sich zu befreien. Kurt hievte den Mann hoch und zog ihn über den Bootsrand, wobei er seine Schmerzensschreie ignorierte.
Fünfzehn Meter vom Boot entfernt legte Kurt den Verletzten auf den Boden. Dabei fiel ihm die seltsam gekrümmte Haltung seiner Arme und Finger auf. Der Anblick war so seltsam, dass er Kurt auch nicht aus dem Kopf ging, als er im Laufschritt zum Boot zurückkehrte, um dem Fahrer zu helfen.
Sich durch die dichten Schwaden beißenden Rauchs kämpfend, kletterte Kurt auf das Bootsdeck. Mittlerweile leckten die ersten Flammen über den Rücken des Fahrers.
Kurt versuchte, den Mann hochzuziehen, doch er wurde von dem zertrümmerten Abschnitt des Armaturenbretts festgehalten.
»Kümmern Sie sich nicht um mich!«, rief der Mann. »Helfen Sie Panos!«
»Wenn Sie damit Ihren Passagier meinen, der befindet sich in Sicherheit«, rief Kurt. »Und jetzt helfen Sie mir, Sie frei zu bekommen.«
Der Mann stemmte sich hoch, und Kurt zog an seinen Schultern, aber das aus seiner Verankerung gerissene Armaturenbrett hielt ihn fest. Kurt wusste, dass er einen Hebel brauchte. Er schnappte sich einen Bootshaken, den er zwischen den Trümmern des Bugabschnitts gefunden hatte, und zwängte ihn zwischen den eingeklemmten Fahrer und das Armaturenbrett.
Indem er sich mit aller Kraft darauf stützte, schuf Kurt ein wenig Raum zwischen dem Fahrer und dem Armaturenbrett. »Jetzt!«, rief er.
Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht«, sagte er. »Ich habe kein Gefühl in den …«
Plötzlich schlug der Kopf des Fahrers ruckartig nach hinten, und Blut spritzte auf das Armaturenbrett. Qualmwolken hüllten das Boot ein, und die Flammen schlugen in alle Richtungen, als der Abwind des Hubschraubers sie erfasste.
Kurt erkannte, dass dem Fahrer nicht mehr zu helfen war und er selbst wahrscheinlich als Nächster an die Reihe kommen sollte. Reflexartig rollte er sich über den Bootsrand und suchte sich einen Weg über die Promenade.
Rechts und links von ihm trafen Gewehrkugeln den Beton, während er verzweifelt nach einer Deckung Ausschau hielt.
Von Qualmwolken verhüllt und so gut wie unsichtbar, blickte Kurt zum Himmel. Der Eurocopter befand sich gut zwanzig Meter über ihm im Schwebeflug. Er konnte verfolgen, wie der Scharfschütze auf der Suche nach einem Ziel den langen Gewehrlauf hin und her schwenkte. Dann zog der Helikopter nach links und drehte ab.
Der Schütze musste gesehen haben, wie der verletzte Passagier über die Promenade humpelte. Er nahm ihn sofort heftig unter Beschuss.
Querschläger umschwirrten den Mann wie ein wütender Hornissenschwarm, bis eine Kugel ihr Ziel fand und den Unglückseligen auf die Knie sinken ließ. Doch bevor der Schütze ihn endgültig ausschalten konnte, tauchte ein unerwarteter Helfer auf. Es war Hayley Anderson. Sie zerrte die schlaffe Gestalt hinter ein großes Pflanzgefäß aus Beton und duckte sich.
Der Scharfschütze eröffnete sofort wieder das Feuer. Die Kugeln sprengten Splitter aus der Betonschale und schleuderten Erdbrocken hoch. Aber das Pflanzgefäß erwies sich als sicherer Schutz. Es war zu massiv, als dass die Gewehrkugeln es durchschlagen konnten.
Der Helikopter trieb seitlich ab. Kurt hatte nur wenige Sekunden Zeit, bevor der Schütze wieder ein freies Schussfeld fand.
Er ergriff erneut den Bootshaken, von dessen stählerner Spitze, die mit auslaufendem Benzin benetzt worden war, Flammen hochzüngelten. Dann packte er den hölzernen Schaft etwa in der Mitte, rannte ein paar Schritte und schleuderte ihn wie einen Speer.
Der Helikopter wandte ihm seine Breitseite zu, und die brennende Lanze flog der offenen Frachtabteiltür entgegen wie ein wärmesuchendes Geschoss.
Sie traf mitten ins Ziel, verfehlte den Schützen nur um wenige Zentimeter, verkeilte sich jedoch in der Kabine und entfachte dabei einen Feuersturm. Augenblicklich quoll eine dichte Qualmwolke aus der Seitentür des Helikopters. Kurt sah, wie der Körper des Scharfschützen von den Flammen erfasst wurde, und er konnte nur vermuten, dass sein Wurfgeschoss eine Benzin- oder Sauerstoffleitung perforiert hatte.
Der orangefarbene Feuerschein breitete sich in der Kabine aus, während der Hubschrauber eine Drehung ausführte. Für einen kurzen Moment schien es, als würde der Pilot seine Maschine wieder unter Kontrolle bekommen, die Flucht ergreifen und den Hafen hinter sich lassen. Aber die Kurve, die der Helikopter beschrieb, wurde stetig enger und führte ihn in Richtung Konzerthalle. Mittlerweile tobte in der Kabine ein Flammeninferno, und aus sämtlichen Öffnungen drang schwarzer Qualm.
Brennend, absackend und gleichzeitig beschleunigend, rauschte der Eurocopter mitten in die berühmte Glaswand der Konzerthalle und zerschmetterte die fünfzehn Meter hohen Fensterscheiben. Durch die Kollision wurden Scherben wie Schrapnellgeschosse ins Innere des Gebäudes geschleudert, während andere Abschnitte der Glasfassade großflächig aus den Rahmen brachen und sich explosionsartig in Tausende winziger Splitter auflösten, die auf dem Erdboden aufschlugen.
Der Helikopter stürzte mitsamt seinen Insassen ab wie ein Stein, die Rotorflügel abgerissen und die Nabe rotierend wie ein Rasentrimmer, der seine Schnur verbraucht hatte. Schließlich schlug er knirschend auf der Promenade auf und war schon nach Sekunden nicht mehr als ein kaum noch identifizierbarer Trümmerhaufen inmitten eines kleinen Infernos.
Mittlerweile trafen auch die ersten Rettungsteams ein. Ein Trupp Polizisten näherte sich im Laufschritt. Feuerwehrfahrzeuge hielten mit quietschenden Bremsen. Bühnenarbeiter tauchten mit Feuerlöschern bewaffnet aus den verschiedenen Gebäuden des Sydney Opera House auf. Eine andere Gruppe rollte einen Wasserschlauch aus und schloss ihn an einen Feuerhydranten an.
Kurt war sich ziemlich sicher, dass für die Insassen des Helikopters, von denen sich niemand hatte aus der Kabine befreien können, jegliche Hilfe zu spät käme.
Er ging zu Hayley Anderson und dem Bootspassagier hinüber, der offenbar noch am Leben war. Der Mann lag in Hayleys Armen. Sein Blut tränkte ihr weißes Kleid. Sie versuchte verzweifelt, den Blutstrom zu stoppen, der sich aus zwei Schusswunden ergoss.
Es war ein aussichtsloser Kampf. Die Kugeln hatten seinen Körper glatt durchschlagen. Sie waren am Rücken eingedrungen und in Höhe des Brustbeins ausgetreten.
Kurt kniete sich neben die Frau und half ihr, ausreichend Druck auf die Wunden auszuüben, um den Blutverlust so gut wie möglich einzudämmen. »Sind Sie Panos?«, fragte er.
Die Augen des Mannes flackerten und blickten für einen kurzen Moment ins Leere.
»Sind Sie Panos?«
Mühsam nickte der Mann.
»Wer waren diese Leute, die auf Sie geschossen haben?«
Diesmal erhielt er keine Antwort. Die einzige Reaktion war ein leerer Blick.
Kurt hob den Kopf. »Wir brauchen hier drüben Hilfe!«, rief er und hielt nach einem Rettungssanitäter Ausschau.
Zwei Männer rannten auf sie zu, aber das waren keine Erste-Hilfe-Spezialisten. Kurt kamen sie wie Polizisten in Zivil vor. Sie blieben abrupt stehen, als er in ihre Richtung blickte.
»Ich habe mitgebracht … was ich versprochen habe«, sagte der verletzte Mann. Für Kurt klang es, als habe er einen griechischen Akzent.
»Was meinen Sie?«, fragte er.
Der Mann murmelte etwas und streckte dann eine zitternde Hand aus, mit der er mehrere mit Blutflecken übersäte Bogen Papier umklammerte.
»Tartarus«, sagte er mit matter, schwankender Stimme. »Das Herz … des Tartarus.«
Kurt nahm die Papiere entgegen. Sie waren mit seltsamen Symbolen, verschlungenen Linien und Zahlen bedeckt, die ihm wie komplizierte Berechnungen vorkamen.
»Was ist das?«, fragte Kurt.
Der Mann öffnete den Mund, um zu antworten, aber kein Laut drang über seine Lippen.
»Nicht wegtreten!«, rief Hayley.
Er reagierte nicht, und sie begann mit den Maßnahmen, die für die Herz-Lungen-Wiederbelebung notwendig waren. »Wir können ihn nicht sterben lassen.«
Kurt tastete nach seinem Puls. Er spürte nichts. »Es ist zu spät.«
»Nein, das kann nicht sein«, sagte sie und übte mit den Händen rhythmisch Druck auf die Brust des Mannes aus, als könnte sie auf diese Weise das Leben in seinen Körper zurückholen.
Kurt Austin hielt sie davon ab. »Es hat keinen Sinn. Er hat zu viel Blut verloren.«
Sie sah zu ihm hoch, das Gesicht tränennass und mit Ruß beschmiert, das weiße Kleid blutbesudelt.
»Es tut mir leid«, sagte Kurt. »Sie haben wirklich alles versucht.«
Sie setzte sich auf den Erdboden, sichtlich erschöpft. Ihr Haar fiel herab und verhüllte das ganze Gesicht wie ein Vorhang, als sie zu Boden starrte. Sie schluchzte so heftig, dass ihr Körper bebte.
Kurt legte eine Hand auf ihre Schulter und betrachtete das Bild der Zerstörung, das sich seinen Augen ringsum darbot.
Das Wrack des Powerboots auf der Promenade brannte noch, und die lodernden Überreste des Eurocopters befanden sich dort, wo die Trümmer der gläsernen Konzerthallenfassade hätten liegen sollen. Freiwillige zielten mit einem Löschschlauch darauf und bemühten sich verzweifelt zu verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Währenddessen strömten Teilnehmer der Konferenz über Tiefseebergung aus dem Joan Sutherland Theatre. Die Hälfte von ihnen konnte sich an dem Zerstörungswerk gar nicht sattsehen, während sich die restlichen Konferenzgäste eilig in die andere Richtung entfernten.
Es war so schnell geschehen. Ohne Vorwarnung war das vollkommene Chaos ausgebrochen. Und der Einzige, der vielleicht den Grund für dieses tödliche Schauspiel gekannt hatte, lag tot zu ihren Füßen.
»Was hat er gesagt?«, fragte Hayley Anderson und wischte ihre Tränen ab. »Was hat er Ihnen mitgeteilt?«
»Tartarus«, antwortete Kurt.
Sie starrte ihn verständnislos an. »Was heißt das?«
Kurt war nicht überzeugt, dass er den Mann richtig verstanden hatte. Und selbst wenn, dann ergab das Gesagte doch wenig Sinn.
»Das ist ein Begriff aus der griechischen Mythologie«, erklärte er. »Er bezeichnet den tiefsten Kerker der Unterwelt. Der Ilias zufolge befindet er sich genauso tief unter dem Hades wie der Himmel über der Erde.«
»Was meinen Sie, was er uns damit mitteilen wollte?«
»Keine Ahnung«, sagte Kurt Austin, zuckte die Achseln und reichte ihr den Stapel Papiere. »Vielleicht glaubte er, dass er dorthin unterwegs war. Oder«, fügte er hinzu, während er an den Schmutz, den Staub und den Gestank dachte, die den armen Mann einhüllten, »es ist möglicherweise auch der Ort gewesen, an dem er sich aufgehalten hat.«
4
Rotes und blaues Blinklicht wurde in einander überschneidenden Mustern von den berühmten Segeln des Opernhauses reflektiert, während blendend weiße Scheinwerfer die Trümmer des Powerboots und die von Feuer gezeichnete Hülle des dunkelblauen Helikopters anstrahlten. Die Wracks, qualmend und glühend, lagen dort, wo das Schicksal sie ereilt hatte, während Feuerlöschwagen sie mit Schaumbergen zudeckten, um jede noch so vage Möglichkeit eines Wiederaufflackerns der Flammen auszuschließen, die nahezu vollständig verschlungen worden waren.
Das Spektakel lockte Gaffer an Land und auf dem Wasser an. Polizeiliche Plastikbänder und Absperrgitter hielten die Neugierigen auf der Promenade in sicherer Distanz, doch die Anzahl kleiner Boote, die sich im Hafen drängten, war auf mehr als einhundert angewachsen. Fotoblitzlichter zuckten in der Dunkelheit wie Glühwürmchenschwärme.
Aus dem Schatten eines Türdurchgangs studierte Cecil Bradshaw von der Australian Security Intelligence Organisation den Mann, der für all diese Schäden verantwortlich war.
Ein Assistent reichte ihm einen Schnellhefter.
»Der ist aber verdammt dick«, stellte Bradshaw fest. »Ich brauche nur die Glanznummern des Burschen und nicht jeden Zeitungsausschnitt, in dem er erwähnt wird.«
Bradshaw war ein stämmiger Mann Mitte fünfzig. Er hatte Möbelpackerarme, einen massigen Hals und einen Bürstenhaarschnitt. Auf gewisse Art erinnerte sein Anblick an eine imposante menschliche Bulldogge. Der Vergleich gefiel ihm, und er betrachtete sich gerne genauso. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich und sollte sich in Acht nehmen, lautete sein Motto.
Der Assistent ließ sich nicht einschüchtern. »Das sind schon die Höhepunkte, Sir. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen noch fünfzig weitere Seiten ausdrucken.«
Bradshaw antwortete mit einem ungehaltenen Knurren und schlug den Schnellhefter auf. Er blätterte die Seiten durch und informierte sich darüber, was die ASIO über Mr. Kurt Austin von der amerikanischen Organisation NUMA wusste. Die Aufzählung seiner Aktivitäten las sich wie eine Serie rasanter Abenteuerromane. Für die Zeit davor konnte er offenbar eine erfolgreiche Karriere bei der CIA vorweisen.
Bradshaw vermochte sich nicht vorzustellen, welche seltsamen Zufälle des Schicksals Austin in genau diesem Moment an diesen Ort geführt haben mochten, aber das Ganze konnte durchaus ein Durchbruch sein, auf den die ASIO sehnsüchtig wartete.
Austin könnte es sein, dachte Bradshaw. Er wäre sogar ideal.
»Behalten Sie ihn im Auge«, befahl er. »Wenn er wirklich so clever ist, wie aus der Akte hervorgeht, wird er in null Komma nichts versuchen, alles an Informationen aus Miss Anderson herauszuholen, was sie liefern kann. Wenn er das tut, dann bringen Sie die beiden zu mir.«
»Wozu soll das gut sein?«
Bradshaw sah ihn verärgert an. »Könnte es sein, dass Sie befördert wurden, und ich nichts davon weiß?«
»Ähm … nein, Sir.«
»Das wird auch ganz sicher nicht geschehen, wenn Sie weiterhin so dumme Fragen stellen.«
Danach drückte Bradshaw dem Agenten den Schnellhefter in die Hand und marschierte mit stampfenden Schritten den Korridor hinunter.
Auf der anderen Seite des Platzes saß Kurt Austin neben Hayley Anderson, während ein Sanitäter einige ihrer Kratzer und Hautabschürfungen versorgte und beide auf mögliche Folgen eines Schocks untersuchte.
Während dieser Behandlung wurden die beiden von einem hochrangigen Detektiv des Sydney Police Department mit Fragen über den Vorfall gelöchert. Was hatten sie gesehen? Was hatten sie gehört? Was um alles in der Welt hatten sie mit dieser ganzen Geschichte zu tun?
»Sehen Sie sich nur die Schäden an«, sagte der Polizeioffizier und deutete auf die zerstörte Fassade der Konzerthalle. »Sie können von Glück reden, dass das Gebäude leer stand.«
Tatsächlich schätzte sich Kurt in diesem Punkt glücklich. Allerdings war er ebenso überzeugt, dass er keine andere Wahl hatte als zu handeln. »Wäre es Ihnen lieber gewesen, wenn ich sie weiterhin hätte wild um sich schießen lassen?«
»Mir wäre es lieber gewesen …«, begann der Detective, »wenn Sie beide sich zurückgehalten hätten, bis ausgebildete taktische Teams eingetroffen wären.«
Kurt war das völlig klar. Die Polizei unterschied sich in dieser Hinsicht nicht von anderen Gruppierungen ausgebildeter Fachkräfte. Überlassen Sie alles den Profis. Genau das hätte Kurt nur zu gern getan, nur war dazu eben keine Zeit mehr gewesen. Außerdem gewann er nach und nach den Eindruck, dass durchaus andere Profis am Ort des Geschehens im Einsatz gewesen waren.





























