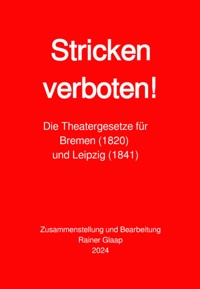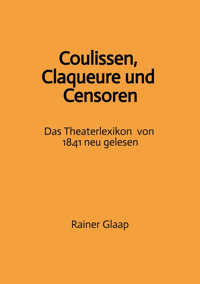
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit 2018 arbeite ich daran, das Theaterlexikon von 1841 wieder lesbar und zugänglich zu machen. Es handelt sich um eine Enzyklopädie, in der die Autoren alles Wissenswerte über das Theater und seinen Betrieb in einem einbändigen Lexikon zusammengefasst haben. Ihre Adressaten damals: Vorstände, Mitglieder und Freunde des Theaters (aus dem Untertitel) Als Anhang präsentieren sie ihren Entwurf der Theatergesetze für das Theater Leipzig. Daraus habe ich bereits ein eigenes Buch gemacht: Stricken verboten! (Selbstverlag, über ePubli erhältlich). In vielen hundert Beiträgen erläutern die Autoren alphabetisch, was ihrer Meinung nach Bedeutung hat: Rollenfächer, Verhalten auf der Bühne, Darstellung von Charakteren, Bühnentechnik, Garderobe, Schminke, Gesundheit (was gehört in die Bühnenapotheke, was tun bei Unfällen etc.) bis hin zur Verwaltung, einen langen Essay über den Verfall der Bühnen, Vertragsangelegenheiten bis hin zur Altersversorgung (Gründung und Regeln für Pensionskassen, Witwenrente etc.). Ein eigenes Kapitel beschäftigt sich mit den vielen Curiosa im Buch: Was sind Coulissenreisser, was bedeutet Unterschleif und was sind Kritikaster oder Claqueure?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 729
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Coulissen, Claqueure und Censoren
Das Theaterlexikon von 1841 neu gelesen
Rainer Glaap
© 2025 Rainer Glaap
Website: https://publikumsschwund.wordpress.comDruck und Distribution im Auftrag des Autors:tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Rainer Glaap, Hackfeldstr. 36, 28213 Bremen, Germany / E-Mail: [email protected]
ISBN Druck: 978-3-384-72356-7 eBook: 978-3-384-72357-4
Warum ist ein Theater-Lexikon von 1841 heute noch interessant?
Dieses Theaterlexikon von 1841 behandelt zahlreiche Aspekte des Theaterwesens, von der Organisation und Verwaltung bis hin zu szenischen und technischen Details. Es listet alphabetisch Stichworte wie „Proben,“ „Rolle,“ und „Garderobier“ auf und diskutiert dabei praktische Fragen der Aufführungspraxis, wie etwa die Beleuchtung (Gaslicht, Blitz), die Maschinerie (Flugwerk, Versenkungen) und das Kostümwesen (Schminken, Federn, Farbenwahl). Darüber hinaus beleuchtet der Text künstlerische und ästhetische Betrachtungen, beispielsweise die Rolle des Schauspielers als „Menschendarsteller,“ die Wichtigkeit von Kritik und Publikum sowie Überlegungen zum „Verfall des Theaters“ in verschiedenen Bereichen. Abschließend werden auch finanzielle und administrative Abläufe einer Theaterdirektion, wie Kassenwesen, Buchhaltung und Engagements, detailliert erörtert.
Neben den fachlichen Informationen ist es aus heutiger Sicht auch in vielen Bereichen unterhaltsam. Und es zeigt, dass viele Probleme quasi zeitlos sind – sie galten damals und sie gelten auch heute noch. Die Texte sind also überraschend aktuell.
Disclaimer: Die Texte in dieser Einführung sind zum Teil mit Hilfe der Google KI NotebookLM entstanden1.
Zur Auswahl der Einträge
Die Auswahl ist subjektiv geleitet von den Interessen des Autors dieser Zusammenstellung. Nicht auszuschließen ist, dass bei der Auswahl weitere interessante Stichwörter übersehen wurden.
Vorgehensweise
Das Theaterlexikon ist nur noch in wenigen gedruckten Exemplaren verfügbar. Der Autor hat über eine indische Druckerei einen Nachdruck erhalten. Über Google steht eine eingescannte Version zur Verfügung, zweispaltig in Fraktur. Der Text wurde mit einem OCR-Reader von Google behandelt, das Ergebnis ist zwar gut, aber nicht ausreichend. Die Texte wurden also aufwändig nachbearbeitet, im Wesentlichen allerdings in der Schreibweise von 1841.
Das vollständige Buch liegt gescannt bei Google Books vor.2
1 https://notebooklm.google.com/
2 https://books.google.de/books?id=RtZJAAAAMAAJ&pg=PA1&dq=theaterlexikon+1841+d%C3%BCringer
Historische Einordnung: Vom Wiener Kongress 1815 bis zur Märzrevolution 1848
Das Theaterlexikon erscheint in einer Zeit, die wir heute als Vormärz bezeichnen. Die folgenden Kapitel bieten eine knappe historische Einordnung, aus der heraus möglicherweise auch die sichtbar werdende Einstellung zur Obrigkeit und die Hinweise auf die Zensur verständlicher werden.
Anmerkung: einige Fußnoten zu hier genannten Daten und Personen finden sich in der anschließenden tabellarischen Übersicht.
Wiener Kongress und Restauration (1815)
Der Wiener Kongress (1814/15) stellte nach den napoleonischen Kriegen die Restauration der alten monarchischen Ordnung in Europa und Deutschland wieder her. Anstatt eines geeinten Nationalstaates wurde der lose Deutsche Bund gegründet. Das Leitprinzip war die Legitimität der Fürstenherrschaft und die Solidarität der Monarchen gegen revolutionäre Ideen.
Die Folge war eine tiefgreifende Zensur und Unterdrückung liberaler und nationaler Bewegungen, manifestiert in den Karlsbader Beschlüssen (1819).
Die Kunst tendierte zum Klassizismus und dem unpolitischen Biedermeier, das sich auf das private, häusliche Glück zurückzog. Die freiheitlich-nationalen Tendenzen der Romantik wurden zunehmend unterdrückt.
Vormärz und Opposition
Zwischen dem Wiener Kongress und 1848 formierte sich im Vormärz (im engeren Sinne ab der Julirevolution 1830) eine wachsende Opposition gegen die restaurative Politik Metternichs. Die Forderungen nach Einheit, Freiheit und Mitsprache wurden lauter.
Die Literatur des Vormärz (auch „Junges Deutschland“ genannt) wurde zur kritischen Stimme. Autoren wie Heinrich Heine und Georg Büchner nutzten ihre Werke, um politische und soziale Missstände anzuprangern und die Zensur kreativ zu umgehen. Büchners Aufruf „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ im „Hessischen Landboten“ ist ein Beispiel für diesen revolutionären Geist. Die Zensur war allgegenwärtig und traf neben der politischen auch die moralische und religiöse Äußerung, führte aber auch zur Entwicklung subtiler Ausdrucksformen wie etwa der politischen Lyrik oder des Reisebildes bei Heine.
Hambacher Fest (1832)
Das Hambacher Fest vom 27. bis 30. Mai 1832 war die bis dahin größte politische Massenveranstaltung in Deutschland. Rund 20.000 bis 30.000 Menschen demonstrierten für nationale Einheit und Volkssouveränität sowie für Bürgerrechte wie Presse- und Versammlungsfreiheit. Die schwarz-rot-goldene Fahne wurde zum Symbol dieser Forderungen.
Das Hambacher Fest führte zu einer weiteren Verschärfung der Repression. Der Deutsche Bund erließ die "Sechs Artikel" und die "Zehn Artikel", die die Überwachung verschärften, Versammlungen verboten und die Zensur weiter zementierten. Viele Organisatoren des Festes, wie Johann Georg August Wirth und Philipp Jakob Siebenpfeiffer, wurden verhaftet oder mussten emigrieren. Die liberale Presse wurde massiv unterdrückt.
Märzrevolution (1848)
Die Februarrevolution in Frankreich von 1848 wirkte als Initialzündung. In vielen Staaten des Deutschen Bundes brachen im März 1848 revolutionäre Unruhen aus, die als Märzrevolution bekannt sind. Das Bürgertum, unterstützt von Handwerkern und Arbeitern, forderte in Märzforderungen sofortige Reformen, allen voran die Pressefreiheit, Volksbewaffnung, die Einberufung eines Nationalparlaments und eine Verfassung.
Eine der ersten und wichtigsten Forderungen, die die Fürsten unter dem Druck der Massenbewegungen erfüllen mussten, war die Aufhebung der Zensur in vielen deutschen Staaten. Dies führte zu einer kurzfristigen Blüte der politischen Publizistik (Flugschriften, neue Zeitungen) und zur Freisetzung der zuvor unterdrückten literarischen und künstlerischen Energien, die nun offen die Revolution unterstützten.
Scheitern und Exil
Die Märzrevolution von 1848/49 scheiterte an der Uneinigkeit der Revolutionäre sowie am Machtmonopol der alten Eliten. Der entscheidende Wendepunkt war die Ablehnung der Kaiserkrone durch den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. im April 1849, was die Paulskirchenverfassung zunichtemachte und die Gegenrevolution stärkte. Die letzten Aufstände in Baden und der Pfalz wurden im Sommer 1849 militärisch niedergeschlagen, womit die Revolution beendet war und die Restauration erneut triumphierte, auch wenn wichtige Errungenschaften wie die Bauernbefreiung und die Idee der Grundrechte blieben.
Der Publizist Karl Marx, der während der Revolution die "Neue Rheinische Zeitung" in Köln herausgab, wurde nach dem Verbot seiner Zeitung im Mai 1849 aus Preußen ausgewiesen. Er ging zunächst nach Paris und emigrierte schließlich im August 1849 nach London, wo er staatenlos für den Rest seines Lebens im Exil blieb. In London, oft in ärmlichen Verhältnissen und unterstützt von Friedrich Engels, widmete er sich intensiv wirtschaftswissenschaftlichen Studien im Lesesaal des Britischen Museums, die Grundlage für sein Hauptwerk „Das Kapital“.
Wichtige Daten der Zeitgeschichte von 1815 bis 1850 (notwendigerweise unvollständig)
Literaturhinweise:Wiener Kongress3
Karlsbader Beschlüsse4
Hambacher Fest5
Deutsche Revolution 1848/496
Karl Marx7
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Kongress
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Karlsbader_Beschl%C3%BCsse
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Hambacher_Fest
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Revolution_1848/1849
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
Einführung
Das Theaterlexikon von 1841 ist der Versuch der Autoren, das gesamte Theaterwesen ihrer Zeit enzyklopädisch zu erfassen. Es beschreibt die Bauten, die Techniken, die verschiedenen Gruppierungen, die am Theater arbeiten, die Verwaltung, Kasse und Verkauf sowie das Gesundheitswesen und die (mangelnde) soziale Absicherung. Das Theaterwesen im 19. Jahrhundert ist stark durch obrigkeitliche und ökonomische Mechanismen reguliert. Diese umfassende Reglementierung hat sich in der Verwaltung, den Gesetzen für das Personal und der sozialen Absicherung manifestiert.
Ungewöhnliche Theater-Begriffe …
… aus der Welt der Darsteller und der Bühne
• Bellerophonsflug: technische Apparatur für einen kreisförmigen Flug von Schauspielern über der Bühne.
• Bettelbrief: So nennt man eine schmeichelhafte, an das Publikum gerichtete Rede oder ein Lied am Ende eines Stückes, um Beifall zu bitten – eine als "schlechter Coup" bezeichnete Sitte.
• Coulissenreißer: Dies ist ein sehr ausdrucksstarker Begriff für einen schlechten, effekthascherischen Schauspieler. Das Lexikon beschreibt ihn als jemanden, der "nach dem Beifall des großen, oder besser rohen Haufens hascht, und dessen Mittel dazu in übermäßigem Schreien und tollem Rasen mit Händen und Füßen besteht, so daß man, um den höchsten Grad zu bezeichnen, sagt: er reißt Coulissen mit fort".
• Extemporiren: Dieses Wort bedeutet ohne Vorbereitung aus dem Stegreif zu reden oder zu improvisieren. Im Theaterkontext war es sowohl eine Fähigkeit, um Pausen oder Fehler der Mitspielenden zu überbrücken, als auch eine Quelle für "abgeschmackte Gedanken" oder "elende, niedrige Schwänke".
• Hanswurstiade: Beschreibt die derbe, volkstümliche Komödie oder Buffonerie, aus der sich eine natürlichere Spielweise entwickelte.
• Meßbudenstückchen: Ein abfälliger Ausdruck für primitive, anspruchslose Unterhaltung, wie sie auf Jahrmärkten gezeigt wurde. Der Text beklagt, dass selbst Hoftheater solche Stücke aufführen.
• Pasquill: Bezeichnet eine Spott- oder Schmähschrift.
• Schwimmen: Ein bildlicher Ausdruck, der heute noch vereinzelt vorkommt, aber damals fest im Theaterjargon verankert war. Er beschreibt die Unsicherheit eines Schauspielers, der seinen Text schlecht gelernt hat. Das Lexikon erklärt: "Wenn der Schauspieler nicht Herr seiner Rolle ist, so kämpft er mit dem Gedächtnisse, mit den Worten, wie der Schwimmende mit den Wellen".
• Rollen fressen: Dieser Ausdruck wird für das schnelle Lernen und Spielen vieler verschiedener Rollen verwendet, aber auch für die "Sucht, jede Rolle, ohne Unterschied, zu spielen".
• Zugstück: Ein Stück, das das Publikum stark anzieht, ein Kassenschlager.
… aus der Welt des Publikums und der Kritik
• Auspochen / Pochen: Dies bezeichnet das Klopfen mit Stöcken oder Füßen, was je nach Region sowohl Beifall als auch Missfallen ausdrücken kann. Im Norden Deutschlands gilt es als "erhöhter Grad von Mißfallen", während es im Süden auch als Beifallszeichen dient.
• Auspfeifen: Das Auspfeifen eines Stücks oder Schauspielers gilt als der "höchste Grad des Mißfallens".
• Claqueurs: So nennt man gedungene Beifallklatscher. In Deutschland werden sie laut Theaterlexikon oft mit "Freibilletten, Schmeicheleien, Einladungen oder Späßen auf der Bierbank" bezahlt.
• Fraubasengewäsch8: Ein äußerst abfälliger Begriff, der im Text verwendet wird, um die damalige Theaterkritik zu beschreiben, die sich "zum Fraubasengewäsch erniedrigt" habe.
• Krittler / Kritikaster: Diese Begriffe bezeichnen kleinliche, tadelsüchtige Kritiker, die sich von einem wahren "Kunstrichter" unterscheiden.
… aus der Welt der Verwaltung und Finanzen
• Unterschleif: Es bedeutet Veruntreuung oder unehrliche Machenschaften . Im Text wird es u.a. im Zusammenhang mit dem Kassensystem erwähnt, wo darauf zu achten sei, dass bei der Auszahlung der Statistengelder keine Unterschleife begangen werden.
• Corsarische Directionen: Eine sehr bildhafte Beschreibung für ausbeuterische, rücksichtslose Theaterleitungen, die z. B. die Autoren nicht angemessen bezahlen.
• Conventionalstrafe: Bezeichnet eine vertraglich festgelegte Strafe bei Nichterfüllung eines Vertrags, zum Beispiel bei Vertragsbruch durch einen Schauspieler.
• Sustentationsgage: Eine Art Erhaltungs- oder Überbrückungsgehalt. Es wurde an Schauspieler gezahlt, die man für eine zukünftige, noch besetzte Stelle halten wollte, oder als eine Art Probeengagement.
• Wittwencasse: Eine Pensionskasse für die Witwen und Waisen von Theatermitgliedern, die oft mit der allgemeinen Pensionsanstalt verbunden war.
8 Gewäsch ist ein abwertender Begriff; für Frauenbasen(gewäsch) sind im Internet keine Hinweise zu finden, ist aber durch den Kontext klar abwertend.
Ausgewählte Themenbereiche im Überblick
Das Theaterlexikon beschreibt, wie stark das Theaterwesen im 19. Jahrhundert reguliert gewesen ist. Die umfassende Reglementierung habe sich in der Verwaltung, den Gesetzen für das Personal und der (fehlenden) sozialen Absicherung manifestiert.
Verfall des Theaters
Die Autoren des Jahres 1841 diagnostizieren eine tiefgreifende Krise mit einem fünffachen Verfall des Theaters, der sich auf die dramatische Literatur, die Schauspielkunst, die Verwaltung, den Publikumsgeschmack und die Kritik erstreckt.
1. Verfall der dramatischen Literatur
Die Autoren betonen, dass der Verfall der Dramatik nicht an einem Mangel an begabten Schriftstellern liege, da seit der Ära Schiller und Goethe Hunderte von Talenten existierten. Das Hauptproblem sei die mangelnde Relevanz: Die Bühne schaffe es nicht mehr, den "Zeitgeist" und die inneren Konflikte der Epoche in ihren Stücken zu spiegeln, wie es die Klassiker Lessing, Schiller und Goethe mit ihren großen gesellschaftlichen und philosophischen Themen getan hätten.
Ein tatsächlicher Verfall liege vor, wenn Kunst ihren ursprünglichen Anspruch verliere und nur noch als Mittel zur politischen Agitation oder, schlimmer noch, zur vulgären Unterhaltung diene. Die Autoren kritisieren scharf, dass die breite, „dickhäutige Menge“ heute leeres Schaugepränge, Special Effects, opulente Beleuchtung und sogar Zirkusnummern (Affen- und Hundekomödien) den echten Gaben der Muse vorziehe. Äußerlicher Glanz, Lärm und Überraschung würden dazu genutzt, den Mangel an tiefem, menschlichem Inhalt zu vertuschen. Zudem erschwerten die beengenden Fesseln der Zensur die freie Entfaltung der deutschen Poesie.
2. Verfall der Kunst des Schauspielers
Bemerkenswerterweise sehen die Autoren die Kunst des Schauspielers als einzigen Bereich, der sich im Aufstieg befinde. Die alten, überstilisierten Schulen (wie die Iffland’sche9 oder Goethe’sche Plastik10) seien überholt und ihre Methoden als "unbrauchbar" abgetan. Das Publikum fordere heute wahrhafte Menschen und wirkliche Individuen sowie einen authentischen, natürlichen Ausdruck. Die jüngere Schauspielgeneration besitze viel Wissen und entwickle ein freies, frisches Leben auf der Bühne. Die Schauspielkunst müsse gerade deshalb außergewöhnliche Leistungen erbringen, weil die dramatische Poesie schwächer geworden sei.11
3. Verfall der Verwaltung u. Handhabung der Bühneninstitute u. scenischen Darstellungen
Die Hauptschuld am Verfall trügen die Theaterdirektionen. Der Direktor agiert nicht als Diener der Kunst und Vermittler, sondern als Ausbeuter: Er zapfe das Publikum ab, drücke die Schauspieler und ignoriere den Dichter, da er meist keine Kenntnis der dramatischen Literatur besitze.
Die Direktionen priorisieren die Geldspekulation und verschwenden Mittel für eine „unverhältnismäßige Pracht“ an Dekorationen und Kostümen. Dieser Fokus auf äußere Ausstattung anstelle von künstlerischer Substanz untergrabe den Geschmack des Publikums. Als Tiefpunkt wird angeführt, dass selbst Hoftheater Gaukler, Ringer und Athleten, teils in Affenmasken, Hauptrollen übernähmen.
4. Verfall des Geschmacks im Publikum und Verfall der Kritik
Die Autoren argumentieren, dass die Unkenntnis und Geldgier der Direktoren mehr Schuld am schlechten Repertoire trügen als der Geschmack des großen Publikums, das sich leiten lasse. Darüber hinaus wirke die Kritik nachteilig, da sie es selten verfolge, Kunstproduktionen nach wissenschaftlichen Kriterien zu bewerten. Stattdessen habe sie sich zu trivialem „Fraubasengewäsch“ erniedrigt.
Anstatt Kunst zu fördern, setzten viele auf leeres „Schaugepränge“ und Spektakel, um die Kasse zu füllen.
Ein Beispiel für den Konflikt zwischen Kunstanspruch und kommerziellen Zwängen sei die Anekdote über Goethe, der die Leitung des Weimarer Hoftheaters aufgegeben habe, weil gegen seinen Willen ein Hund auf der Bühne eine Rolle spielen durfte. Dies illustriere die Entweihung der Bühne, die die Autoren beklagen. Ebenso wird erwähnt, dass das Coventgarden-Theater in London 1811 mit „Kunstpferden“ 100.000 Pfund Sterling eingenommen habe, was als Beleg für den Sieg des Spektakels über die Kunst gilt12.
5. Verfall der Kritik
Darüber hinaus wirke die Kritik nachteilig, da sie es selten verfolge, Kunstproduktionen nach wissenschaftlichen Kriterien zu bewerten. Stattdessen habe sie sich zu trivialem „Fraubasengewäsch“ erniedrigt.
Trotz dieser überwiegend externen Hemmnisse schlussfolgern die Autoren optimistisch: Da das Theater so eng mit dem Leben verwoben sei und das Leben selbst täglich einen kühneren Aufschwung nehme, könne das Institut Theater nicht wirklich verfallen.
Kartenverkauf: Casse und Abonnement, die Freikarte als „zehrender Wurm jeder Direction“
Die Casse und die finanzielle Führung eines Theaters gelten als heikles Unterfangen, das von Redlichkeit und genauer Aufsicht abhänge. Die Autoren empfehlen dringend eine ordnungsgemäße Buchführung, idealerweise die doppelte (italienische) Buchhaltung. Viele Direktoren kleinerer Bühnen vernachlässigten dies, was oft zu ungeordneter Wirtschaftsführung, Zahlungsunfähigkeit und letztlich zum Ruin der Unternehmung führe. Die Verfasser warnen ausdrücklich davor, dass der Direktor selbst oder ein Familienmitglied die Kasse führe, da dies zu geheimer Kassenverkürzung und Verschwendung führen könne.
Ein besonders kritisierter Punkt ist die damals grassierende Vergabe von Freikarten13, die als „zehrender Wurm“ jeder Direktion bezeichnet wird. Die Praxis, Beamte mit Freikarten zu versorgen oder Dienstleistungen damit zu bezahlen, gilt als Zeichen einer schlechten wirtschaftlichen Lage und sei für die Kasse äußerst schädlich.
Das Abonnement sei ein zweischneidiges Schwert. An kleineren Orten mit einem festen Publikum sichere es eine regelmäßige und planbare Einnahme. In großen Städten sei das Abonnement allerdings finanziell nachteilig, da es die Einnahmen aus den teureren Einzelkarten erheblich geschmälert habe. Kritisch seien insbesondere Sonderformen wie das Militär- oder Studenten-Abonnement, da es die Plätze zu stark verbilligten Preisen fülle und zudem zur Bildung parteiischer Gruppen im Publikum führe.
Die Rolle der Frau im Theater
Die Einträge im Theaterlexikon zeigen einen tiefen Einblick in die komplexe und oft widersprüchliche Stellung von Künstlerinnen. Frauen galten zwar als integraler Bestandteil des künstlerischen Personals. Mädchen seien in der Regel „früher u. leichter“ fähig gewesen, kleine Rollen zu spielen, und stellten deshalb oft Knaben dar.
Dennoch sei der Karriereweg für Frauen von besonderen Herausforderungen geprägt. Die Karriere von Schauspielerinnen sei oft an Jugend und Attraktivität geknüpft. Der Übergang aus den jugendlichen Rollenfächern fiele namentlich den Damen schwer.
Trotz ihrer professionellen Tätigkeit sei die ökonomische Situation von Künstlerinnen prekär und ihre finanzielle Absicherung oft an Männer gebunden. Ein entscheidender Passus in den Statuten offenbare die Grenzen ihrer beruflichen Autonomie: Eine Frau verliere ihr Pensionsrecht, wenn sie heirate. Die Regelung impliziert, dass die Versorgung durch den Ehemann die berufliche Absicherung ersetze. Die finanzielle Sicherheit der Witwen leite sich direkt vom Status ihres Ehemannes ab.
Die Darstellung von Frauen auf der Bühne und ihr Verhalten unterliege strengen moralischen Maßstäben. Der Eintrag zum Thema „Küssen“ schreibt vor, dies habe auf der Bühne „stets mit der äußersten Decenz“ zu geschehen, und an manchen Hofbühnen sei das Küssen auf den Mund gesetzlich verboten gewesen.
Die Autoren spiegeln zudem ein tief verankertes, stereotypes Bild der weiblichen Natur wider, das sich in der sogenannten „Temperamentenlehre“ manifestiere. So wurde die Sanguinikerin als „flüchtig, eitel und kokett“ beschrieben, während die Melancholikerin als „stets ruhig denkend u. gelassen handelnd eine vortreffliche Mutter“ gelte.
Kritiker (Recensenten)
Das Theaterlexikon zeichnet ein düsteres Bild der deutschen Theaterlandschaft, die von einem umfassenden „Verfall“ erfasst sei, was sich u.a. entscheidend auch im „Verfall der Kritik“ manifestiere.
Das Ideal des Kunstrichters als jemandem, der nach festen Grundsätzen beurteile, stehe die Realität des Rezensentenwesens gegenüber, das als „nachtheilig“ und zu einem bloßen „Fraubasengewäsch“ herabgesunken sei. Der Begriff „Recensent“ selbst sei mit einer herabsetzenden Bedeutung versehen. Den „Tageskrittlern“ wird ein erheblicher Teil der Schuld am Verfall des Theaters zugeschrieben.
Besonders scharf wird die moralische Verkommenheit des Systems kritisiert. Viele Rezensionen basierten nicht auf einer fundierten Analyse, sondern seien käuflich erworben durch Schmeicheleien, Einladungen „auf der Bierbank“ oder schlicht durch Bezahlung. Dieses System bevorteile denjenigen, der die Mittel zur Bestechung habe, während das „unbemittelte Talent“ chancenlos bliebe. Ein weiterer Kritikpunkt sei die Feigheit der anonymen Rezensenten, die „wie Banditen“ aus dem Hinterhalt ihre „Giftpfeile“ abschössen.
Die Quellen beleuchten auch die Haltung der Schauspieler, die die Aufgabe des Kritikers als „undankbarstes aller Geschäfte“ betrachteten. Es wird beklagt, dass neunzehn von zwanzig Schauspielern sich für vollendete Meister hielten. Der Schauspieler könne nur durch ein „festes Zusammenhalten“ die „unnützen Anfeindungen und unmündigen Zurechtweisungen der Recensenten paralysiren“.
Soziale Absicherung
Angesichts der „zweifelhaften Zukunft des Schauspielerstandes“ entstehen Pensions- und Witwenkassen als frühe Versuche der sozialen Absicherung. Die Organisation der Leipziger Pensionsanstalt wird als mustergültig hervorgehoben. Diese sei als ein vom jeweiligen Theaterunternehmer unabhängiges Institut konzipiert worden. Die Finanzierung stütze sich auf jährliche Benefizvorstellungen, gestaffelte Mitgliederbeiträge, Abzüge von Gastrollen-Honoraren und Zinsen des Stammkapitals.
Der Anspruch auf eine Pension sei an strenge Kriterien gebunden: Ein Mitglied müsse ein „Aufnahmedekret“ des Komitees erhalten, das nach „Fleiße u. sittlichen Betragen“ urteile, und mindestens sechs Dienstjahre vorweisen.
Die weitsichtige Idee einer Allgemeinen Pensionsanstalt für deutsche Schauspieler sei jedoch an „fast unbesiegbaren Schwierigkeiten“ gescheitert. Ein zentrales Hindernis sei die Zersplitterung der deutschen Theaterlandschaft in preußische, sächsische und bayerische Theater mit je eigenen Gesetzen gewesen. Darüber hinaus wurde die mangelnde Professionalisierung des Standes beklagt, indem festgestellt wird, dass „nicht jeder davongelaufene Handlungsdiener od. Schneiderlehrling sich als Schauspieler herumtreiben dürfen“ solle.
Die Wittwen- und Waisencasse diene als weitere wichtige Säule der sozialen Absicherung. Am Hoftheater in München erhielt eine Witwe 20 Prozent des Gehalts oder der Pension ihres verstorbenen Mannes. Bei Wiederverheiratung erlösche der Anspruch.
Obrigkeit, Regulation und Zensur
Das Theaterwesen im 19. Jahrhundert in Deutschland ist geprägt von einem tief verwurzelten Spannungsverhältnis zwischen aufklärerischen und emanzipatorischen Bestrebungen des Bürgertums auf der einen Seite und der starken Kontrolle durch die Obrigkeit in Form von staatlicher Aufsicht, minutiösen Gesetzen und strikter Zensur auf der anderen. Die Bühnen, die von Schiller einst als Mittel zur „Überwindung der Standesschranken“ konzipiert wurden, blieben somit ein Ort, an dem Machtstrukturen und Reglementierung allgegenwärtig waren.
Die Macht der Obrigkeit und die Institutionalisierung
Die Obrigkeit, sei es in Gestalt der Fürsten, Könige oder staatlicher Behörden, definiert maßgeblich die Existenzbedingungen des Theaters. Historisch betrachtet sind Hoftheater privilegiert und finanziell abgesichert. Dies steht im Gegensatz zu den Stadt- und Provinztheatern, die oft mit mannigfachen Lasten und finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben.
Ein entscheidender Wandel im 19. Jahrhundert ist die gesetzliche Neuregelung des Theaterwesens. Im Jahr 1810 werden private Theater in Berlin erstmals als Gewerbe eingestuft. Dies ersetzt das unsichere feudale Privilegiensystem durch gesetzliche Regelungen. Theaterdirektoren müssen fortan einen polizeilichen Gewerbeschein beantragen, der nur bei Nachweis eines „rechtlichen Lebenswandels“ erteilt wird. Die staatliche Hand greift jedoch weiterhin regulierend ein, etwa indem der preußische Staat die Bühnenunterhaltung reglementiert, um die Hoftheater vor Konkurrenz zu schützen.
Trotz dieser Emanzipation vom Feudalwesen bleiben die Strukturen im Theater stark autoritär. Norbert Elias beschreibt den deutschen Habitus als historisch geprägt durch eine Orientierung an Hierarchien und Autoritäten14. Dies spiegelt sich sowohl im gesellschaftlichen Leben als auch in der Theaterkultur wider, wo Entscheidungen grundsätzlich von oben nach unten getroffen werden. Der Theaterdirektor, insbesondere der Intendant, fungiert in diesem Sinne als „Monarch“ oder „Alles-Entscheider“, dessen Autorität und Unantastbarkeit kultiviert wird. Die Schauspieler sind der Willkür der Bühnenvorstände und den Launen einflussreicher Adeliger oder Damen unterworfen.
Gesetze und Theaterpolizei: Die Reglementierung des Bühnenalltags
Die „Theatergesetze“ des 19. Jahrhunderts, wie sie etwa im Theaterlexikon von 1841 oder den Vorschriften für Bremen (1820) und Leipzig (1841)15 dokumentiert sind, zeigen eine feingliedrige, fast bizarre Reglementierung des Künstlerpersonals. Diese Regeln gelten hauptsächlich für die Angestellten, nicht für die Direktion, und sind mit strengen Strafzahlungen verbunden.
Die Gesetze enthalten spezifische Anweisungen, die das private und professionelle Leben der Schauspieler betreffen:
Intimität und Anstand: So wird beispielsweise vorgeschrieben, dass außer der Anweisung des Verfassers nicht geküsst werden darf; wenn ein Kuss erforderlich ist, muss dieser auf die Wange oder Stirn erfolgen. Besondere Berührungen, wie die Nähe zur Brust beim Umfassen eines Frauenzimmers, müssen vermieden werden.
Verhalten auf der Bühne: Es ist verboten, während der Proben zu stricken („Stricken verboten“). Auch Regeln wie das Verbot des Pfeifens im Theater oder des Betretens der Bühne in Straßenkleidung werden in diesen Gesetzen behandelt.
Disziplin und Pünktlichkeit: Es gibt minutengenaue Vorschriften für das Verlassen der Garderobe und harte Strafen für betrunkene Auftritte, die eine ganze Monatsgage kosten können. Die Künstler sind sogar verpflichtet, in erreichbarer Nähe zum Theater zu wohnen, um bei Ausfällen schnell zur Stelle zu sein - Abstände werden u.a. definiert durch die Entfernung zu Kirchturmuhren.
Die Bühnenpolizei ist für die Aufrechterhaltung dieser Ordnung und Ruhe hinter den Kulissen zuständig. Ihre exekutive Gewalt liegt oft in den Händen des Inspizienten oder, in größeren Theatern, eines eigens angestellten Theater-Feldwebels. Die Wachmannschaften, die in Hoftheatern oft aus Militär- oder Polizeiwachen bestehen, sorgen in den Zuschauerbereichen (Halle, Parterre, Galerien) für Ruhe und schreiten sofort ein, wenn Zuschauer „gegen die Befehle und Anordnungen des Fürsten“ verstoßen. In Stadt- und Provinzialtheatern agiert die Polizei zurückhaltender, bis „offenbare Skandale und Exzesse“ drohen.
Die scharfe Klinge der Zensur
Die Zensur ist das direkteste Instrument der Obrigkeit, um die freie Entfaltung des „Baumes deutscher Poesie“ zu hemmen. Sie zielt darauf ab, das bürgerliche und später revolutionärePotenzial des Theaters einzugrenzen.
Die Zensurbehörden, die idealerweise aus „gelehrten, aufgeklärten und billigen Männern“ bestehen sollte, haben die Befugnis, jedes neue Stück vor der Aufnahme in das Repertoire einzusehen und zu genehmigen. Ihre Handlungsweise ist von staats-, religions- oder bürgerlichen Verhältnissen bedingt.
Der Censor kann:
Die Aufführung komplett verbieten, oder
Stellen oder Worte streichen oder ändern. Verlieren Stücke durch diese Verstümmelung ihre wesentliche Schönheit oder Tendenz, steht es dem Bühnenvorstand frei, sie gar nicht erst aufzuführen.
Die Schärfe der Zensur variiert regional: In Österreich und Bayern gilt die Zensur als am schärfsten, während sie in Sachsen als am aufgeklärtesten und freiesten beschrieben wird. In Österreich ist die Kontrolle so umfassend, dass bei jedem neuen Stück ein Censor den Proben beiwohnt (mindestens der Generalprobe), um sicherzustellen, dass „kein in seinem Sinne anstößiger Gedanke, ja kein Wort den Schauspielern entschlüpfe“.
Die Direktoren und Regisseure tragen die volle Verantwortung für die Einhaltung der Zensurbeschlüsse. Auf zensurwidrige Extemporés (spontane Einfälle eines Schauspielers) stehen Polizeistrafen und Konventionalstrafen für jeden einzelnen Schauspieler. Dies ist besonders relevant, da Extemporieren zwar als Talent des Komikers gilt, aber nur dann geduldet wird, wenn es nicht gegen Staat, Religion, gute Sitten oder Persönlichkeiten verstößt.
Als Reaktion auf diese beengenden Schranken entstehen gegen Ende des 19. Jahrhunderts alternative Organisationsformen, wie die 1889 in Berlin gegründete „Freie Bühne“. Solche Vereine ermöglichten es, Stücke des Naturalismus zensurfrei in geschlossenen Veranstaltungen zu zeigen.
Die Bühnentechnik
Die Bühnentechnik um 1841 repräsentiert eine faszinierende Mischung aus Tradition und fortschreitender Professionalisierung, die die Grundlage für die Theaterillusion schafft. Obwohl die Maschinerie komplex und vielfältig erscheint, stützt sie sich im Kern auf die überlieferten Fundamente des Theaters seit der Antike, insbesondere aber seit der Barockzeit.
Kontinuität der Illusion und Mechanik
Die mechanischen Mittel, die zur Erzeugung der Bühnenillusion dienen, basieren auf elementaren physikalischen Prinzipien: dem Hebel, dem Rad an der Welle (wie Kurbeln und Flaschenzüge) und der Schraube. Diese Grundbestandteile sind seit Jahrhunderten bekannt und in bereits in älteren Theater-Werken beschrieben. Die Tradition, die Bühne mit aufwendiger Mechanik zu beleben, stammt aus der höfischen Theatertradition des italienischen Frühbarock.
Zentrale Illusionselemente sind die Versenkungen und Flugwerke. Das Maschinenwesen betreibt diese Mechanismen, wobei größere Theater zur Unterbringung der Mechanik bis zu drei unterirdische Ebenen, die sogenannten Höllen, besitzen. Solche Versenkungen ermöglichen das „zauberische Verschwinden“ von Gestalten, was beim Publikum einen „unbeschreiblichen Eindruck“ hinterlässt – etwa bei der Figur Vampyr in Marschners Oper. Auch die Gestaltung des Bühnenbilds mit Coulissen und Prospecten geht auf Techniken zurück, die bereits um 1530 von Serlio in Italien eingeführt werden. Selbst Spezialeffekte wie der Donner, der mittels Donnerblech oder herabprasselndem Geröll erzeugt wird, oder frühe Automaten sind keine Erfindung des 19. Jahrhunderts, sondern stellen verfeinerte, traditionelle Bühnentricks dar.
Der Modernisierungsschub durch Technik und Professionalisierung
Das 19. Jahrhundert führt jedoch drei wesentliche Neuerungen ein, die die alten Systeme professionalisieren. Erstens findet eine tiefgreifende Mechanisierung statt: Anstatt sich ausschließlich auf die vereinte Kraft des Personals zu verlassen, werden Räder- und Hebelwerke (häufig aus Eisen) in Kombination mit Gegengewichten genutzt, um Bewegungen zu erleichtern. Dies führt zu Personalersparnissen und ermöglicht „größte Veränderungen auf einmal, leicht u. präcis“.
Zweitens revolutioniert die Gasbeleuchtung die Bühne. Sie gilt als echte Neuheit des 19. Jahrhunderts (erste Versuche 1812 in London) und ersetzt die bisher verwendeten Kerzen oder Argand’schen Lampen. Die Gasbeleuchtung bietet eine größere Klarheit und Intensität, was den Effekt der Dekorationen außerordentlich verbessert. Die Steuerung des Lichts erfolgt unter anderem über die Rampe (Ribalta), ein Gestell am vorderen Podiumsrand, das versenkt werden kann, um die Bühne zu verdunkeln. Bei Nachtbeleuchtung zieht man blaue Schirme auf.
Drittens fordert die Zeit die Abkehr vom „alten Schlendrian“. Maschinisten wie Dorn, Roller und Mühldörfer werden für ihren „reichen Erfindungsgeist“ gelobt, da sie das Maschinenwesen perfektionieren und Erstaunliches inszenieren.
Sicherheit und Kritik am Spektakel
Die Feuergefahr ist aufgrund der Bauweise und Beleuchtung immens. Strenge Vorschriften reglementieren den Theaterbetrieb. Die logistische Priorität liegt auf dem Brandschutz, wobei im Brandfall sogar die Schnüre des Schnürbodens durchschnitten werden müssen, damit die Dekorationen herabfallen und das Gebäude gerettet werden kann.
Während der Wunsch nach dramatischem Effect zeitlos ist, existiert auch Kritik am Spektakel. Der Einsatz von Feuerwerk, wie Raketen und Kanonenschlägen, wird als „unstatthaft“ verurteilt und gilt lediglich als „Zugpflaster“ zur Spiegelfechterei.
Fazit
Das 19. Jahrhundert ist für das deutsche Theater eine Phase der organisationalen Institutionalisierung und zugleich der permanenten Kontrolle. Die Obrigkeit nutzt Gesetze, die Theaterpolizei und die Zensur als Mittel, um politische Sprengkraft zu bändigen und die Bühne vor einer „liederlichen Unterhaltung“ zu bewahren, die den ästhetischen Ansprüchen der Zeit (oder dem Geschmack des Hofes) widerspricht. Erst mit der Gewerbefreiheit von 1871 und dem Aufkommen neuer, zensurfreier Bühnenformen beginnt sich das Theaterfeld weiter zu liberalisieren und professionalisieren, wodurch die starren Ketten der obrigkeitlichen Regulierung allmählich gelockert werden. Die tief verwurzelten autoritären Muster setzen sich jedoch in den internen Hierarchien der Direktionen fort und prägen die Arbeitsverhältnisse der Künstler nachhaltig – zum Teil bis heute, wie aktuelle Untersuchungen von Thomas Schmidt16 zeigen.
9 August Wilhelm Iffland, 1759 – 1814, bedeutender Schauspieler, Dramatiker (63 Bühnenwerke) und Regisseur; Gründer der Berliner Schule der Schauspielkunst; weitere Informationen: https://de.wikipedia.org/wiki/August_Wilhelm_Iffland
11 „Daß unter den Tausenden von Schauspielern, die jetzt existiren, – denn jedes Städtchen will im Winter sein Theater haben – viel Schlechtes sich fimdet, ist ebenso gewiß, als daß wir eben deswegen viel tüchtige Künstler aufzuweisen haben …“, Theaterlexikon, Artikel „Verfall des Theaters“
12 2007 hatte am Royal National Theatre das Stück „War Horse“ Premiere. Die Pferde waren große bewegliche Puppen, die von der südafrikanischen Handspring Puppet Company hergestellt worden waren. https://www.theatre-news.com/news/UK/106521/The-National-Theatre-s-multi-award-winning-production-of-War-Horse-to-embark-on-Major-UK-tour#:~:text=This%20powerfully%20moving%20and%20imaginative,has%20inspired%20a%20generation%20of
13 Frei-, Gebühren-, Steuer- und sonstige rabattierte Karten machen mittlerweile im deutschen Theaterwesen 17% aus. S: Glaap, Rainer: „Publikumsschwund? – Ein Blick in die Theaterstatistik seit 1949“, Springer, 2024
14 Nach: Schmidt, Thomas: Das Theater und die Theaterlandschaft aus Feldtheoretischer und Institutionenkritischer Sicht, 2025 in: Handbuch Soziologie der Künste, Springer, 2025, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-34083-4_3-1
15 S. Glaap, Rainer: Stricken verboten. Die Theatergesetze von 1820 und 1841 für Bremen und Leipzig. 2024, Selbstverlag
16 Schmidt, Thomas: Macht und Struktur im Theater - Asymmetrien der Macht, Springer VS Wiesbaden, 2019,https://doi.org/10.1007/978-3-658-26451-2
Ausgewählte Einträge aus dem Theaterlexikon von 1841
Vorwort der Herausgeber von 1841
Practische Anweisungen in den verschiedenen Zweigen der dramatischen Kunst sind nur sehr zerstreut und unvollständig – in der Technik des Bühnenwesens gar nicht gedruckt zu finden. – Dies der Impuls zu unserm Unternehmen.
Das practische Bühnenleben stets im Auge, beabsichtigen wir mit der Herausgabe dieses Werkes – zur Erleichterung des Nachschlagens und wegen der Bequemlichkeit schneller Belehrung in lexicalischer Form geschrieben – nicht nur für jeden Vorstand der Bühnen, für jeden Regisseur, Inspicienten, Balletmeister, Maschinisten, Garderobier c., sondern hauptsächlich auch für jeden Schauspieler ein Handbuch hinzustellen, das in allen Zweigen seines Berufes ihm theoretischen Aufschluß und practische Anweisung geben wird, mit Hinweisung auf die Quellen, worin nöthigenfalls erschöpfendes über einen oder den anderen Gegenstand zu finden; ebenso wird unser Werk, dessen Ausführung sich theils auf jahrelange Erfahrung gründet, theils mit Zuziehung der bedeutendsten Notabeln der Wissenschaft und Kunst vollendet, jedem Liebhabertheater, wie jedem Dilettanten als practischer Leitfaden, jedem angehenden dramatischen Dichter, indem es ihm die so nöthige Kenntniß der Bühne erleichtert, höchst willkommen sein. Dieses erhelle aus folgendem Summarium:
Theoretisch-practische Anweisungen in allen Zweigen und einzelnen Theilen der Schauspielkunst, der Bühne überhaupt wie der Einrichtung des Theatergebäudes
Erklärung aller technischen Gegenstände und Ausdrücke – (des alten und ausländischen Theaters nur insofern sie mit dem jetzigen deutschen in Beziehung stehen).
Wissenschaftliche und ästhetische Notizen, welche in die Praxis der Regie und der Künstler eingreifen (hierher gehört ein Theil der Mythologie – wesentlich die Allegorie).
Kurzer Abriß der allgemeinen Geschichte des Theaters mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Bühne.
Aufschlüsse über Verhältnisse der Direction, Regie, Künstler, Unter- und Dienstpersonale, Oeconomie.
Abhandlungen über Arrangement, Scenerie, Maschinerie, Malerei, Verwaltungszweige, Garderobe (mit Angabe der billigsten zweckmäßigsten Zeuge, deren Fabriken c.); Costums (hierher gehört z. B. die Uniformirung des Militärs in verschiedenen Ländern, ebenso die auf der Bühne vorkommenden Nationaltrachten).
Schminkkunst (Bereitung der ungewöhnlichen aber zweckdienlichen Schminken und Farben mit Bezugnahme auf besondere stereotype Charaktere und verschiedenfarbige Völkerstämme).
Ballet, Comparserie und Requisiten im weitesten Umfange, z. B. Orden, Fahnen, Nationalfarben, Waffen.
Musik, soweit sie in die Bühnentechnik eingreift – und endlich
Soll als Anhang des Werkes aus den jetzt existirenden Gesetzen der bedeutendsten Theater Deutschlands, verglichen mit den ersten und ältesten Theatergesetzentwürfen und denen der vornehmsten Bühnen des Auslandes, nebst nöthigen Zusätzen, ein
Normal- Gesetzbuch17
beigefügt werden, was möglichst die Lücken, welche der Praxis bei den einzelnen Bühnen sich mehr oder minder aufdringen, ausfüllen wird und für alle Theaterdirection en nothwendig von Wichtigkeit sein muß.18
Wo es zur Erklärung der Maschinerieen, Ordensketten u. dgl. nöthig, werden erläuternde Zeichnungen auf besondern Tafeln beigegeben.
Einige Bemerkungen in Bezug auf die Form mögen hier noch Platz finden:
Um unnöthige Verweisungen (namentlich im Maschinenwesen) zu ersparen, bemerken wir, daß, da alle gebräuchlichen technischen Ausdrücke im Laufe des Buches erklärt sind und also nachgeschlagen werden können, dieselben nur stattfinden: a) wenn der Ausdruck in der Theatersprache ungewöhnlich oder einer fremden Sprache entnommen, b) wenn die vollständige Erklärung eines Gegenstandes oder Begriffes es nothwendig macht, oder c) zur Vervollständigung eines Artikels das Nachlesen eines andern wesentlich nothwendig ist, auf welchem Wege es einzig möglich wird, ohne Wiederholungen, ein Ganzes über ein und denselben Gegenstand in einem Lexikon zusammenzufinden.
Die Benennung „Schauspieler“ ist oft in allgemeinen Beziehungen, natürlich nur da wo sie ein gemeinsames Interesse verfolgen, auch für Schauspielerinnen, Sänger und Sängerinnen zu nehmen.
Veraltete Requisiten, nicht mehr gebräuchliche Maschinerieen sind als unpractisch, da die neuen verbesserten vorhanden, ausgeblieben.
Die im Texte vorkommenden Abkürzungen bedürfen wohl keiner nähern Erwähnung, da die allgemein bekannten der gewöhnlichen Schriftsprache beibehalten und auch größtentheils in dem Artikel „Abbreviaturen“ erklärt sind.
Leipzig im December 1838.
Ph. J. Düringer,
Regisseur am Leipziger Theater
H. Barthels,
Inspicient desselben Theaters
Abbreviaturen (Abkürzungen)
So wie jede Kunst und Wissenschaft ihre besonderen stereotypen Abkürzungen in der Schrift und Zeichen für Worte hat, so auch das Theaterwesen und selbst da haben wieder die einzelnen Geschäftszweige verschiedene und in verschiedener Bedeutung. Z. B. der Soffleur hat seine besonderen Zeichen und Buchstaben, die er im Soufflierbuche (s. d.) an den Stellen verzeichnet, wo ihm etwas Besonderes zu thun obliegt; der Inspicient (s. d.) über gebraucht deren, um das Scenarium (s. d.) übersichtlicher und nicht so voluminös werden zu lassen; der Maschinist bezeichnet die Decorationen mit angenommenen Zeichen und abgekürzten Worten und trägt sie wieder mit eben diesen in die Bücher ein. – So zeichnet der Regisseur seine Arrangements, Entwürfe (s. Regie), der Balletmeister seine Gruppen und Tänze (s. Choregraphie) in nur ihnen oder den Eingeweihten verständlichen Zeichen und Abkürzungen auf. Ebenso hat die Musik ihre gebräuchlichen Abbreviaturen. – Viele finden sich in den betreffenden Artikeln (u. s. Zeichen), die gewöhnlichsten sind:
A. u. Ac. – Act.
A. ab – Alle ab.
Ab. susp. – Abonnement suspendu.
abr. – abräumen.
a. b. S. – auf beiden Seiten.
Adgio., Ado. - Adagio.
Ad lib. – ad libitum.
a. d. Tsch. – auf den Tisch.
Afzg. u. Aufz. – Aufzug.
Allo. – Allegro.
Allto. – Allegretto.
Altd. – altdeutsch.
Altfr. – altfränkisch.
Andte. – Andante.
Andno. – Andantion.
Anf. – Anfang.
Anhg. – Anhang.
a. t. – a tempO.
aufr. – aufräumen.
Auftr. – Auftritt.
ausgeschr. Brf. – ausgeschriebener Brief.
Ball. – Ballet.
b. d. – bei dem.
bearb. – bearbeitet.
Bem. – Bemerk.
Bm. – Baum.
bes. – besonders.
bl. – bleibt.
bl. Sch. – blaue Schirme.
Bllt. – Billet.
Brf. – Brief.
b. S. – bei Seite.
Bß. – Baß.
Bsch. – Busch.
Ch. Pr. – Chorprobe.
Clsse. – Coulisse.
Comp. – Comparsen.
Convers. Zmmr. – Conversations-Zimmer.
cres. – crescendo.
Esse. – Casse.
D. C. – Da Capo.
D. S. – Dal Segno.
Dem. u. DIl. – Demoiselle.
d. h. – das heißt.
d. i. – das ist.
dol. – dolce.
Dr. – Drama.
Dr. Anek. – Dramatische Anekdote.
Dr. Gem. – Dramatisches Gemälde.
etc. – et caetera. c. u. s. w
F. – Forte.
f. – für.
ff. – fortissimo.
fr. – französisch.
fr. bearb. – frei bearbeitet.
fr. Ggd. – freie Gegend.
Gard. – Garderobe.
Gard. – Gardine.
Gllr. – Gallerie.
gr. – groß.
gr. Brf – großer Brief.
grsch. – griechisch.
Gespr. Stz. – Gesperrter Sitz.
Gsse. – Gasse.
h. – hinten.
h. L. – hinten Links.
h. R. – hinten Rechts.
Hr. – Herr.
Hs. – Haus.
kl. Tsch. – kleiner Tisch.
kmmt. – kommt.
K. Op. – Komische Oper.
krz. Bnk. – kurze Bank.
L. – Links.
Lge. – Loge.
Lnge Bnk. – lange Bank.
Lse. Pr. – Lese-Probe.
Lst. – Lustspiel.
M. – Mitte.
m. A. ab. – mit Allen ab.
Md. – Madame.
Melodr. – Melodrama.
M. L. – Mitte Links. *)
M. n. R. – Mitte nach Rechts
M. n. L. – Mitte nach Links.
M. R. – Mitte Rechts.
Msk. Pr. – Musik-Probe.
M. v. L. – Mitte von Links
M. v. R. – Mitte von Rechts
Ncht. – Nacht.
ob. – oben.
od. – oder.
O. Lst. – Original-Lustspiel.
Op. – Oper.
Orch. Pr. – Orchester-Probe.
Ord. – ordinär. -
P. – Posse. Pause. Piano.
Parq. – Parguet.
Parr. – Parterr.
Pers. – Person.
PP.- panissimo.
Prosp. – Prospect.
qr. – queer.
R. – Rechts.
Req. – Requisiten.
Rg. Lge. – Rang-Loge.
rit. – ritardanto.
röm. – römisch.
Rpe. – Rampe.
rth. – roth.
Rttr. – Ritter.
S. L., – Seite Links.
S. R. – Seite Rechts.
Sc. – Scene.
Sch. – Schauspiel.
Sch. – Scherzando.
Schw. – Schwank.
schw. – schwarz.
sd. - siehe dieses oder siehe da.
Soff. Soffiten.
Sopr. – Sopran.
sp. – später.
Sprrsz. – Sperrsitz.
Stat. – Statist.
Stck. – Stück oder Stock.
S. Th. – Seiten-Thüre.
st. L. – steht Links.
st. R. – steht Rechts.
T. – Tenor, tutti.
Tfl. – Tafel.
Tg. – Tag.
Th. Pr. – Theater-Probe.
Thrn. – Thron
Tr. – Trauerspiel.
tr. – trillo.
trem. – tremulando
U. – Und.
U. s. w. – c. und so weiter.
UI1S. – UllSOIO.
Unt. – Unten.
V. – vorn. Verte. Voce.
V. – VON.
v. A. – von Außen.
Var. – Variation.
Vaud. – Vaudeville.
Vers. – Versenkung.
vi. – vide (siehe.)
Vorh. – Vorhang.
Vorst. – Vorstellung.
V. S. – Volti Subito.
wg. – weg.
Wld. – Wald.
w. ob. – wie oben.
w. Sch. – weiße Schirme.
wß. – weiß.
Zl. – Zeichen. *)
z. B. – zum Beispiel.
z. b. S. – zu beiden Seiten.
z. E. – zum Exempel.
Z. Mähr. – Zaubermährchen.
Z. Op. – Zauber-Oper.
Verfall des Theaters19
Es ließe sich überdiesen Gegenstand ein Buch schreiben, und die vielseitig darüber öffentlich ausgesprochenen, theils gesunden, theils irrigen u. einseitigen Ansichten mögen manches Buch Papier füllen; wir geben die unsrigen, wie solches Raum und Zweck dieses Werkes bedingt, nur in Umrissen, die sich Jeder leicht weiter ausmalen kann. – Der Verfall des Theaters zerfällt in den der dramatischen Literatur, der Kunst des Schauspielers, der Verwaltung u. Handhabung der Bühnen - Institute u. scenischen Darstellungen, den des Geschmacks im Publikum u. den Verfall der Kritik.
I. Verfall der dramatischen Literatur
Hier fragt es sich zunächst: Liegt der, vorläufig angenommene, Verfall der dramat. Literatur a) im Mangel an talentvollen Schriftstellern? oder b) in der Ungunst der augenblicklichen Verhältnisse? Die Behauptung des Ersteren ist nicht aufzustellen, denn wir zählen seit Schiller u. Göthe nach flüchtiger Zusammenstellung 247, mehr od. minder begabte deutsche Dichter u. Schriftsteller, welche im dramatischen u. dramaturgischen Felde bis heute öffentlich thätig waren (vgl. Ausbildung, Theater (Geschichte u. die einzelnen Gattungen dramat. Dichtungen, als Lustspiel, Tragödie). Außerdem beschäftigen sich unglaublich viel Studenten und Schüler mit Erzeugung von Dramen jeder Gattung, u. es ist nicht übertrieben, wenn man vermuthet, daß mehrere tausend Deutsche ihre sonntägige Muse mit Vermehrung ihrer Schauspiel-Manuscripte feiern, die niemals zu Tage kommen, u. eine Anzahl Berufener wählen andere Formen der Poesie, weil ihr erstes Drama nirgends angenommen u. aufgeführt wurde. – Klagt man nun bei diesem Reichthum strebender Talente gleichwohl über Verfall, so geschieht damit, was immer und überall geschehen, wenn die Zeit einer hohen Blüthe vorüber war. – Es kann nicht gleich wieder eine Blüthenzeit folgen. – Man kann hier den Klagesängern Aehnliches zurufen, wie Rosenkranz hinsichtlich der Philosophie: „Wer nicht einsieht, daß die Philosophie nach ihrer Culminirung nicht gleich wieder culminiren kann, sondern ihre Fortentwickelung zunächst in der architektonischen Durchbildung ihres Standpunctes finden muß, mag sich's im Schweiße seines Angesichts sauer werden lassen, schon wieder eine Periode heranzuarbeiten.“ – Um, wie Schiller, der Sänger u. Prophet seiner Zeit zu sein, muß man erst wieder eine solche Zeit haben! u. was die rechte Zeit zum Verständniß eines Dichterwerkes thut, das – unbeschadet der Größe unserer Dichter sei es gesagt – das haben wir an Beckers einfachem Rheinliede gesehen. Wenn die Bühne ein Spiegel des Menschenlebens ist, eine gedrängte Darstellung der Geschichte des Menschen – nicht der äußeren, sondern der inneren, – so muß sie die Zeit- Ideen in dramat. Handlung manifestiren, sie muß, was eine Zeit bewegt, in den Prismen ihrer Persönlichkeiten wieder strahlen lassen, sie muß das Ganze im Einzelnen, das Einzelne im Ganzen geben. So Lessing in seinem Nathan die religiöse Frage, Schiller in seinem Moor, Walter, Posa, Tell die politische seiner Zeit, welche dieses edeln Mannes eigenes Wesen in's Tiefste bewegte, Göthe im Faust, die letzte, menschlichste, den Zwiespalt zwischen Wissen und Leben, das Ringen der Geschlechter und ihre endliche Bestimmung. – Wenn so der Genius des Dichters, was eine große Zeit bewegte, vor uns aufrollt im Sturme einer reichbewegten u. doch natürlich sich entwickelnden, einfach zusammengehörigen Handlung – geschmückt durch rhythmische Schöne, Pracht und Kraft des Ausdrucks – getragen von Characteren menschlicher Individualitäten (die hier wie zufällig im Conflict ihrer Situationen goldene Körner der Weisheit finden und streuen), hervorgegangen u. genährt von einem großen Gedanken, aus welchem – wie aus dem Senfkorn die Staude – das Ganze organisch sich entwickelt: – – wenn dies der große Dichter vollbrachte, so ist allerdings geleistet, was nicht gleich wie der geleistet werden kann. In solchen Fällen erhält die Bühne eine Bedeutung, die ihr bald darauf genommen zu sein scheint. Die Enthusiasten erkalten, die Gebildeten (eigentlich Dressirten) – folgen dem Beispiel, die Kritik geht dieselbe Richtung und wird zur Medisance, und man übersieht, wie viel Schönes, Gutes, Menschlich-Befriedigendes – wie viel Heiteres, Komisches, Geißelnd Belehrendes die Bretter noch immer vorführen: wie reiche Talente die Bahnen verfolgen, die ein großer Dichter eröffnete, und so nach allen Seiten hin erfüllt wird, was in jenen Epoche machenden Werken von vornherein bedingt war. – Bei diesem naturgemäßen Hergang läßt sich nicht über Verfall klagen. Der Weltgeist spricht sich zu - jeder Zeit durch eine Individualität am lebendigsten, vollständigsten aus – in Kunst u. Leben; doch diese besondere Organisation des Einzelnen, die ihn zum bevorzugten Vermittler macht, schließt Andere nicht aus, noch macht sie dieselben entbehrlich: – sondern durch sie findet die Zeit ihre volle Ergänzung, Abrundung, Erfüllung. Von einem Verfall kann erst die Rede sein, wenn in den Werken der Kunst Absichten verfolgt werden, welche der hohen Bedeutung der selben widersprechen, wenn eine Faction sie zu politischen Umtrieben benutzt, wenn sie den Entsafteten das Mittel einer liederlichen Unterhaltung abgibt, wenn die dickhäutige Menge, „die doch nur hört, was sie versteht“ und die auf allen Plätzen des Theaters zu finden ist, den Sieg davon trägt, und leeres Schaugepränge, Spektakel, bunte Beleuchtung, tropische Pflanzenwelten in pappendekelner Naturtreue, goldene Paläste unterirdischer Bergmönche aus purem Flittergold auf Leinwand, Affen- u. Hunde-Komödien, Ringer und Gaukler, ja selbst seltene Gerüche von verdampftem Rosenöl u. anderem Räucherwerk für die Gaben der Muse hält. Dies geschieht besonders in einer Zeit, die anderen Kunstformen (z. B. der Malerei) holder ist, als der theatralischen. – Aus den angegebenen Gründen, der voreiligen Geringschätzung und Entfremdung, der Unmöglichkeit, nach Form und Inhalt immer glänzend zu sein, dem gleichwohl empfundenen Bedürfniß der Steigerung, der Geldspeculation, die in Letzterem ihre alleinige Zuflucht findet und nicht abgewiesen werden kann von der realen Bühne – aus all diesem erklärt sich, wie vom Angenehmen zum Piquanten, vom Erschütternden zum Schauderhaften, vom Rührenden zum Jammer, vom Lächerlichen zum Tölpischen, vom Scherz zur Zweideutigkeit, von der Geißel des Witzes zur Persiflage und zum Pasquill fortgeschritten wird: – wie äußerlicher Glanz, Effect, Ueberraschung, Lärm den Mangel des erhabenen menschlichen Inhalts verbergen sollen, – wie Opern, Rouladen, Cadenzen und Fermaten rhetorisch immitirt werden, – u. solch' äußerliche Bilderjagd für Poesie verkauft wird. – Dieses Unwesen, wenn es die Spitze erreicht hat, weckt sein Extrem, und nüchterne glatte Natürlichkeit kommt an die Reihe, bis unter den Wehen einer neuen Zeit – neue Dichterwerke geboren werden. – Wie schnell, wie langsam kann man nicht beantworten (vgl. Melodrama).
In unserer Zeit, wo die Conservativen sorgfältig darauf bedacht sind, daß im Gedränge der vorwärtsstrebenden Völker nicht heilsam Bestehendes mit Verbrauchtem u. Morschem zugleich gestürzt u. vernichtet werde, sind der Oeffentlichkeit unseres Instituts viele Adern des befruchtenden Quells entzogen, u. die beengenden Schranken des Erlaubten hemmen die freie Entfaltung des Baumes deutscher Poesie (vgl. Censur). – Kann das Podium der Bühne einst seine hohe Bestimmung, die es in Deutschland durch Schiller sich selbst voraus nahm, uneingeschränkt behaupten, – werden in dem Ruhme der Völker, in dem Ringen der Jahrhunderte, in der freien Darlegung alles Menschlich - Großen, Schönen und Guten, die in den Amphitheatern versammelten Deutschen ihre eigene Nationalität u. Bestimmung fühlen, erkennen, für sie erglühen; – ist es dem Jocus erlaubt, die Parteien zu geißeln, wie es Aristophanes konnte – so werden auch die Klagen über Armuth, Flachheit, fade Thee-Unterhaltung aufhören ! Allerdings fehlt es – um auf diesem Wege das so vielfach ersehnte Nationaltheater zu gewinnen – an einem Concentrationspuncte, wie ihn Frankreich in Paris besitzt, an einer großen Stadt, wo alle deutschen Elemente mit einander in die lebendigste Wechselwirkung treten könnten, wo der kritische Preuße mit dem gemüthlichen Schwaben, der derbe Hesse mit dem lebensfrohen, drolligen Oesterreicher, der ruhige, arbeitsame Sachse mit dem enthusiastischen Rheinländer in der unmittelbarsten stätigen Berührung wären. Es ist hier der Platz, die ganz äußerlichen Hemmungen der schlechten Bezahlung, der geringen Sicherstellung der Autoren vor den corsarischen Directionen mancher kleinen Theater noch ein Mal u. zwar aus einem anderen Gesichtspuncte zu berühren (vgl. Drama p. 332). Ein großes Talent wird davon gewiß weniger gehindert, als man gewöhnlich annimmt. – Man erinnere sich an Schiller's edeln Stolz einem Frankfurter Buchhändler gegenüber. Im Besitze weniger Kreuzer, vernichtete er ein Gedicht lieber, als daß er um's Honorar mit sich feilschen ließ; nichts destoweniger dichtete er frischweg an Cabale und Liebe. – Man kann mit ebensoviel Recht behaupten, daß glänzende Verhältnisse den Dichter, wie den Künstler (vgl. Engagement p. 354) abziehen u. erschlaffen. – Es ist indeß mit jenem Vorwurf überhaupt nicht so großer Ernst. Die bedeutenden Bühnen honoriren anständig; die Stücke von Raupach, die besseren Erzeugnisse der Madame Birch-Pfeiffer, Töpfer's Arbeiten, Carl Blum's Lustspiele, Halm's Griseldis, Schenk's Belisar und viele andere bühnengerechte Stücke haben dies überall erfahren. Holbein nimmt durchschnittlich für ein großes Stück 1000 Thaler ein, u. Hr. Georg Harrys hat mit der Uebertragung von „Sohn oder Braut“ in einem Acte, die er natürlich in acht Tagen besorgte, 300 Thlr. verdient. – Wenn Kloppstock, Apel, Grabbe nicht auf der Bühne erschienen, so lag es darin, weil sie es verschmähten, den unabweislichen Forderungen der Ausführbarkeit sich zu fügen. Das hat Shakespeare nirgends gethan- Kein Componist verschmäht es, die Instrumente, ihre Fähigkeiten und Wirkung zu studiren; diese Herren sind darin sorglicher, weil ihre Werke nur durch Aufführung in Concerten zum Publikum sprechen können, – während sich gewisse Dichter damit trösten, daß ihre Werke „von den Gebildeten gelesen werden“, u. eine theatralische Aufführung doch nichts als „Stückwerk“ sei. – Schiller war anderer Meinung, und wir wissen, wie oft er seine Stücke änderte, um sie bühnenrecht zu machen, u. daß er den Eindruck auf die Masse, auf eine Volksversammlung keineswegs gleichgültig fand, wie wohl unsere Stubengelehrten pflegen. – Ein Miniaturbild gehört nicht an die Wölbung eines Domes, sondern ein Freskogemälde. – Wie Lessing im Laokoon die Grenzen der Künste studirte, so müssen die Autoren mit den Möglichkeiten, den Hindernissen und den Wirkungen der Bühne vertraut sein (vgl. Drama u. Decoration). Man muß nicht, wie Grabbe in Napoleon, das Schlachtfeld von Waterloo verlangen, nicht, wie Deinhardtstein in Maximilian's Brautzug, ein Epos schreiben, nicht, wie der Verfasser des circassischen Paares zu Hamburg, in Lyrik zerfließen. – Auf der Bühne muß vor Allem geschehen – Handlung ist nöthig, aber kurz, scharf, in starken Lichtern und Schatten. – Aus Theorien entspringen keine Kunstwerke, sondern aus diesen jene; – Speculation macht keinen Dichter, dazu gehören leidenschaftliche, gewaltige Naturen, und nur derjenige Theil der dramatischen Literatur hat sich von der Bühne ganz getrennt, der seine Existenz nicht Dichtern, sondern Gelehrten verdankt, die einen philosophischen Cursus vornehmen u. ihn „durch Mägde-Arbeit der Phantasie“ in dramatische Form bringen, wobei sie nicht über die Allegorie hinauskommen, und nirgends warmblutige, lebendige Menschen verwandte Saiten im versammelten Volke rühren. – Das Princip der Dichtkunst ist eben der Genius, – u. der formt sich Bühne, Schauspieler u. Publikum! – (Vgl. Drama, Geschmack, Publikum).
II. Verfall der Kunst des Schauspielers
Diese Kunst an sich möchte augenblicklich eher im Steigen, als Fallen begriffen sein. – Haben wir bei so vielen Gelegenheiten die Schwächen und Vernachlässigungen des heutigen Schauspielers zur Erreichung des Zweckes der Aufklärung, Belehrung u. Besserung aufdecken u. geißeln müssen, so ist es hier doppelt Pflicht, nicht sowohl gegen das allgemeine Streben unseres Standes, als auch gegen unsere Zeit ein Vorurtheil anzugreifen, obige Behauptung aufzustellen und möglichst zu verfechten. – Wenn in der Epoche, welche Eckhof u. Schröder bezeichnen, aus der Natur der Haupt- und Staatsactionen und der Derbheit der Hannswurstiade, eine Spielweise sich entwickelte, die den einfach menschlichen Ausdruck der Seelenzustände gab, u. in Begrenzung u. Maaß die Meisterschaft suchte, so entstand darauf durch die Fortentwickelung der Iffland'schen Schule eine glatte Natürlichkeit, ein Streben der äußerlichsten Wirklichkeit, während als Gegensatz die Göthe'sche Schule in Plastik u. Declamation ausbildete u. Veranlassung zu einer großen Manier gab, die in süßlicher Geziertheit, Tonsprüngen u. Declamirkunststückchen, Schönheitslinien u. Stellungen, aller Innerlichkeit baar ward. – Wir stehen auf dem Puncte, wo all' dieser Komödienplunder farblos u. unbrauchbar geworden ist, und das Bedürfniß sich geltend gemacht hat, wahrhafte Menschen auf der Bühne zu sehen, – nicht blos Costume u. Character - Masken, sondern wirkliche Individuen, die eine individuelle Weise des Seins u. Lebens haben, – man verlangt jetzt bei großen tragischen Darstellungen den wahren ursprünglichen Ton und Ausdruck einer gewaltigen gesunden Menschennatur, wie sie früher Schröder u. Fleck zeigten – man verlangt in der Freiheit des Schaffens Begrenzung, in der Fülle Maaß – man will ein Lustspiel, nicht mehr Carricatur und äußere Gebrechen, man will Menschen aus dem Leben u. eine Darstellung voll Phantasie und Scherz, aber zugleich auch voll Wahrheit, u. überwacht von Besonnenheit, Geist u. Verstand. Es ist allerdings nicht zu leugnen, daß beim Anblicke einer so großen Zahl leerer Effecthascher u. Coulissenhelden, wie sie leider an bedeutenden Bühnen sich vorfinden, bei der abschreckenden Erscheinung humorloser Possenreißer es wohl leicht geschehen kann, daß ein in der gesammten Theaterwelt u. mit den oft ungewöhnlichen, aber verborgenen Talenten unbekannter gescheiter Mann (denn der große Haufe gewöhnt sich an Alles) an dem gänzlichen Verfall unserer Kunst nicht mehr zweifelt, aber – man müßte ungerecht sein gegen die Jetztzeit, und das Verdienst vieler tüchtiger Künstler absichtlich verleugnen, wollte man die strebenden Kräfte im Gebiete der heutigen Schauspielkunst im Vergleiche zu der sogenannten classischen Epoche am Schlusse des vorigen Jahrhunderts nicht anerkennen (s. Theater, Gesch. d., p. 1050, u. vgl. den Art. Schauspieler im Brockhaus'schen Conversations-Lexikon der Gegenwart). – Während wir Schauspieler erster Fächer aus der Iffland'schen Schule nennen können, die nicht einmal ihre Muttersprache construiren u. aussprechen konnten, ist jetzt viel Wissen unter der jüngeren Generation derselben zu finden; das vielseitige Streben in den bildenden Künsten, wie der Literatur, und die größere Oeffentlichkeit unseres Lebens haben tausend Beziehungen hervorgerufen, eine Wechselwirkung, die auch dem Schauspieler gedeihlich werden mußte! – Die inhaltlosen Formen der Manier sind zertrümmert, und ein freieres, frisches, poetisches Leben entwickelt sich. – Daß unter den Tausenden von Schauspielern, die jetzt existiren, – denn jedes Städtchen will im Winter sein Theater haben – viel Schlechtes sich fimdet, ist ebenso gewiß, als daß wir eben deswegen viel tüchtige Künstler aufzuweisen haben, u. Napoleon verbannte die 6000 Maler Frankreichs nicht, weil ohne sie auch die vier großen Künstler seines Reichs nicht dagewesen wären. – Daß die Kunst des Schauspielers gerade dann große Anstrengungen machen muß u. Bewunderungswürdiges leistet, wenn die dramatische Poesie schwächer geworden ist, liegt in der Natur der Sache, und Seydelmann's Vatel kann hier als schlagendes Beispiel dienen. – Die Schauspielkunst blüht noch und die Poesie ist nicht gestorben, es lahmt am meisten an den Directionen.
III. Verfall der Verwaltung u. Handhabung der Bühneninstitute u. scenischen Darstellungen
Die Aufgabe des Directors ist es, sämmtliche Geldmittel zum Gedeihen der Anstalt zu verwenden, sich als Diener der Kunst zu betrachten, ein Vermittler zu sein zwischen Publikum, Dichter u. Schauspieler; stattdessen zapft er das Publikum ab, drückt u. ermüdet den Schauspieler u. vergißt den Dichter, den er überhaupt gar nicht kennt, – denn er folgt nur dem Zuge des gewöhnlichen Repertoirs. – Es wäre zu wünschen, daß jede bedeutende Stadt ihr Theater garantirte20, daß sie einen angestellten Director wählte, und daß dieser immer ein Mann wäre, der mit Kunstliebe hinlängliche Besonnenheit im Gebrauche der vorhandenen Mittel besäße (vgl. Verwaltung), vor Allem aber die Dichter kennte, u. es verstände, junge Talente aufzufinden und zu stimuliren. Daß der Director die dramatische Literatur der Deutschen wie anderer Völker kenne, ist das erste Erforderniß, und das wird in der Regel nicht erfüllt21. – Welchen Gehalt kann dann ein solcher Director dem Repertoir geben! Wie Vieles bedürfte nur einer zeitgemäßeren Form, um willkommen zu sein! Aber was ist von den deutschen Schauspieldirectoren zu erwarten, die nicht einmal das deutsche Drama in der ganzen Ausdehnung unserer dramat. Literatur kennen, und das Mögliche für die Darstellung thun; im Gegentheil in dem trägen Geschäftstritte warten, bis andere Directionen, die auch, nicht schneller zum Guten sind, aus irgendeiner äußerlichen Veranlassung ein Mal etwas Gutes versucht haben, was dann endlich auch gemächlich zur Ausführung kommt. – Am meisten fehlen indessen unserer Bühne jene Schriftsteller mit dem leichten, schaukelnden Talent für Vaudevilles und Lustspiele, die ins moderne Leben greifen u. die z. B. ein Director der Königsstadt in Berlin heranzuziehen hätte, wenn dieses Theater wäre, was es sein sollte, ein Volkstheater. – Gewiß würden auch die Hoftheater dergleichen Piecen nicht unbeachtet lassen, deren Aufgabe, zumal wenn sie allein in einer Stadt stehen, mehr oder minder auch sein muß, ihren nächsten Zweck der Volksbildung und Volksbelehrung durch Stücke in volksthümlicher Form und Fassung zu erreichen. Ein zweites Erforderniß ist die Humanität und redliche Absicht, mit der ein Director die vom Publikum gegebenen Mittel uneigennützig für die Anstalt, d. h. für Schauspieler und Dichter und – jedoch mit weiser Sparsamkeit, Einsicht u. Mäßigung für Decoration u. Costume verwendet, nicht aber die äußere Ausstattung (s. d.) zur Hauptsache macht, das Publikum an unverhältnißmäßige Pracht und kostspielige Außendinge gewöhnt, wodurch er den Geschmack für das Wahre und Schöne untergräbt und die Bühne entweihet. Ein drittes ist jene ruhige Beharrlichkeit, die unerschütterlich ihren Weg geht, weil sie aus der Erkenntniß ihrer Lebensaufgabe hervorgegangen u. sich bewußt ist, ihre Kraft den edelsten Zwecken zu widmen. – Wie sehr hierbei die Verhältnisse der Hoftheater von jeher gehemmt haben, da sie dem Geschmacke Einzelner unterlagen, ist bekannt (ebenso daß Göthe die Leitung des Weimar'schen Hoftheaters aufgab, weil man gegen seinen Willen einen Hund auf der Bühne eine Rolle spielen ließ – Hund des Aubry) –; sehen und lesen wir nicht noch täglich, wie die namhaftesten Hofbühnen Gaukler und sogenannte Athleten, Ringer, ja Springer, welche in Affenmasken die Hauptrolle spielen, auftreten lassen? Wer sollte da noch den Stab über Privatdirectionen brechen, wenn sie der gleichen Affenkomödien u. Meßbudenstückchen ihrer Casse wegen dem neugierigen Haufen vorführen. – (1811 brachte das Coventgarden-Theater zu London die ersten Kunstpferde auf die Bühne – sie brachten ihm damals 100,000 Pfd. Sterl. ein!). – Ein Theaterunternehmer müßte ganz selbstständig – natürlich kann dies nur in großen Städten der Fall sein – bestehen; das Théâtre français zu Paris, das sich unter solchen Verhältnissen lange in Glanz und Ruhm erhalten hat, kann als schönes Beispiel dienen. Statt jener drei Erfordernisse finden sich nur gar zu häufig 1) Unkenntniß, 2) Geldspeculation (welche es nicht verschmäht, Café-Theater – in Paris – zu etabliren, wo während der Vorstellung Kaffee servirt wird; die Sommertheater in Berlin, Lübeck, Hamburg scheinen einen ähnlichen Weg einschlagen zu wollen), und 3) Unzuverlässigkeit, welche gegen das Gedeihen der Kräfte wirken, die sich der dramat. Kunst mit Liebe zuwenden (vgl. Theaterdirector u. viele einschlagende Artikel).
IV. Verfall des Geschmacks im Publikum
Wenn die Bühne den Interessen, die eine Zeit bewegen, fremd bleibt, so wird auch sie das Gesammtpublikum kalt lassen, sie wird ein nationales, wenigstens nicht zeitgemäßes Institut sein. – Wendet sie sich aber solchen Interessen zu, wird sie Sympathien wecken, gesucht sein, u. Großes wirken können. – Unter solchen Umständen wird es ihr leicht werden, die Menge für das Edle u. Große zu bestimmen und zu Kunstgenüssen zu locken, denen die Besseren von selbst sich zuwenden. – Ueberhaupt sind wir der Meinung, daß Unkenntniß u. Geldgier der Directoren mehr Schuld hat am schlechten Repertoir als der Geschmack des großen Publikums, das sich leiten läßt (vgl. Geschmack u. Publikum). – Die größte Schuld an dem sogenannten Verfall daher, wie aus Obigem hervorgeht, fällt den Zeitverhältnissen und den Theaterdirectionen zu.
V. Verfall der Kritik
Nicht wenig nachtheilig wirkt die Kritik, der nur selten daran liegt, die gegebenen Kunstproductionen nach Principien zu vermitteln und ins wissenschaftliche Bewußtsein zu bringen! – Sie hat sich zum Fraubasengewäsch erniedrigt u. die Schauspieler können nur durch ein festes Zusammenhalten die unnützen Anfeindungen und unmündigen Zurechtweisungen der Recensenten paralysiren! – (Vgl. Kritik u. Recensent).
Wir sehen im deutschen Gemüthe die Schätze dramatischer Poesie noch täglich und vielfach zu Tage kommen, Jünglinge u. Jungfrauen voll Talent, Lebenskraft, Kenntniß u. gutem Willen noch immer in reicher Zahl sich zur Bühne wenden, u. aus der vorhergegangenen Besprechung, die es sich zum Vorwurfe gemacht hat, ebenso das Gute anzuerkennen, als die Hemmungen zu bezeichnen, geht hervor, daß die letzteren doch eigentlich nur äußere Fesseln sind, die nach und nach von der Kraft des Inhalts gesprengt u. abgeschält werden müssen. Wie möchte auch ein Institut verfallen, welches so eng mit unserem Leben verzweigt ist, während das Leben selbst sich täglich kräftigt u. einen kühneren, freieren Aufschwung nimmt.
Vorderhaus
Verkauf, Kasse, Abonnement, Karten
Abonnement
Abonnement, fr., die Vorausbezahlung auf eine bestimmte Anzahl von Vorstellungen. Abonniren. Die Miethe für den Besitz einer Loge oder eines Platzes monatlich, viertel- oder halb jährig, oder auch auf das ganze Jahr vorausbezahlen. Daher der Ausdruck: Abonnement suspendu (Aufgehobenes Abonnement). Bei Vorstellungen, wo es der Vortheil der Theater-Direction, als ersprießlich für ihre Kasse, erheischt, vorausgesetzt, daß sie für dergleichen Fälle sich es in den Contracten mit den Abonnenten ausbedungen hat, wird mitunter das Abonnement für einen der Theaterabende aufgehoben, das heißt, die Abonnenten haben kein Recht, für den geringeren Preis, den ihnen das Abonnement bietet, ihren Platz zu fordern oder einzunehmen, und müssen, wollen sie ihn für eine solche Vorstellung beibehalten, nicht allein das volle Legegeld bezahlen, sondern auch noch gewöhnlich spätestens um 11 Uhr Vormittags am Tage der Vorstellung dies an der Casse melden oder bestellen lassen, im Gegenfalle sie dann nach dieser Zeit auch noch überhaupt den Anspruch auf ihren bestimmten Platz verlieren. Mitunter wird in den Abonnements-Contracten auch noch die Bedingung, zum Vortheil der Direction, vorbehalten, daß wenn die festgesetzte, und als Norm angenommene Anzahl von Vorstellungen für ein Abonnement-Jahr abgespielt ist, die Theater-Direction die noch nachfolgenden Vorstellungen als Nachtrag, jedoch für den Preis des Abonnements berechnen, und von den Abonnenten als Nachzahlung einfordern darf. In ökonomischer Hinsicht ist das Abonnement für eine Bühnenverwaltung nur an kleinern Orten vortheilhaft, wo ein sogenanntes stehendes Theater Publikum minder zahlreich und wohlhabend ist, und wodurch dem Schauspiel ein mehr regelmäßiger Besuch, als ihm sonst zu Theil werden würde, zugesichert wird. In großen Städten hingegen, wo dies Publikum oft wechselt, ist es, wegen der mit sich führenden Verringerung eines bedeutenden Theils der Legegelder, für die Theaterfinanzen jedesmal nachtheilig, wenn es nicht, wie in London, durch eine öffentliche Versteigerung an die Meist bietenden stattfindet.
Buchhaltung (Buchführung)
Buchhaltung ist das Geschäft der Berechnungen über einen Haushalt, oder das ordnungsmäßige Verfahren, Ausgabe und Einnahme in Büchern zu verzeichnen, so daß man stets den Stand jeder einzelnen Rechnung und des ganzen Geschäftes übersehen kann; sie ist für jeden Geschäftsmann höchst wichtig und rathsam. Sie theilt sich mit entscheidender Einwirkung auf ihre innere Einrichtung durch ihr Verhältniß zu dem Eigenthümer des Haushaltes. Es ist nämlich der Eigenthümer entweder sein eigener Buchhalter, legt sich selbst Rechnung ab, und ist sich also selbst für ihre Richtigkeit verantwortlich; wie der Kaufmann, also auch der Theater-Unternehmer (die Unternehmung als kaufmännisches Geschäft betrachtet) nicht allein thun soll, sondern auch nach den Gesetzen thun muß, um sich nöthigenfalls über seine Einnahmen und Ausgaben ausweisen zu können; oder der Eigenthümer läßt sich Rechnung ablegen, und wer sie ablegt, ist für die Richtigkeit der Buchführung verantwortlich und muß sie nachweisen, wie bei Hoftheatern oder bei den Unternehmern, wo die verschiedenen Geschäftszweige, als Casse, Oekonomie einem angestellten besonderen Geschäftsführer untergeordnet sind. Das kaufmännische Buchhalten läßt sich zu allen Berechnungen als Muster aufstellen, die mit ihm gleiche Bedingung und gleichen Zweck haben. Man unterscheidet bei ihm zwei Hauptsysteme, die einfache und die doppelte Buchführung. Die einfache notirt Activ- und Passivposten in besonderen Büchern, nachdem sie im Allgemeinen in ein Memorial eingetragen sind. Sie verschafft nicht die nöthige augenblickliche Uebersicht, läßt begangene Fehler nicht bemerken, und ist daher nur für ein ganz kleines Geschäft anwendbar. Bei der doppelten oder italienischen (im 15ten Jahrhundert von Luc. Pacciolus, einem ital. Mönche erfunden) wird jeder Posten doppelt notirt, einmal als Debet (activ) und einmal als Credit (passiv), so daß Debitor und Creditor in beständiger Beziehung bleiben. In genauer Unterscheidung dieser beruht die Hauptkunst des Buchhaltens. (Bücher zur Belehrung im Buchhalten sind: Wagners neues vollständiges und allgemeines Lehrbuch des Buchhaltens; Berghaus selbstbelehrender doppelter Buchhalter; Dr. J. W. Ouarch's Kunst des Buchhaltens, 2te Aufl. Leipzig 1823.) Die Buchführung für die Theatergeschäfte kann jedoch nach Umständen sehr vereinfacht werden, weil in der