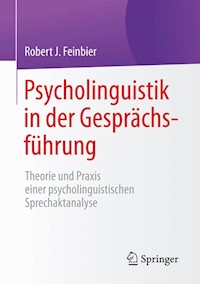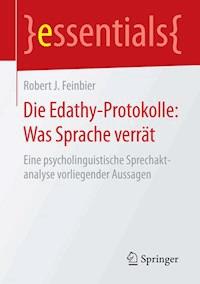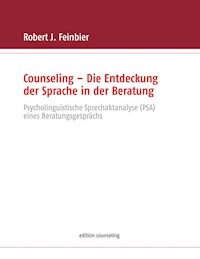
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. (emerit.) Robert J. Feinbier widmet sich in seinem neuen Buch "Counseling - Die Entdeckung der Sprache. Psycholinguistische Sprechaktanalyse (PSA) eines Beratungsgesprächs" erneut aus psycholinguistischer Sicht der Gesprächsführung in der Beratung. Der Fokus liegt in diesem Buch auf Anwendung und Übung der psycholinguistischen Sprechaktanalyse (PSA). Am Beispiel eines Beratungsgesprächs wird gezeigt, wie mit dieser Methode erreicht werden kann, wirklich alles zu verstehen, was in einem Beratungsgespräch gesprochen und vor allem auch, was nicht direkt gesagt wird. An einem Modellgespräch wird Schritt für Schritt demonstriert, wie man eine PSA ausführt. Der Leser kann sich dabei selbst in die Methode der PSA einüben. Berufliche Gesprächsführung ist zielorientiert und verlangt deshalb Methodik. Übliche Ausbildungskonzepte für die Gesprächsführung in der beruflichen Beratung konzentrieren sich vor allem auf systemische oder kommunikations- und interaktionspsychologische Aspekte der Gesprächsführung. Dem umfassenden Verstehen jedes einzelnen Wortes, jedes Satzes und jedes Sprechakts im Gespräch wird nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Dem soll mit diesem Buch Abhilfe geschaffen werden. Es schließt an das 2015 erschienene Buch "Psycholinguistik in der Gesprächsführung - Theorie und Praxis einer psycholinguistischen Sprechaktanalyse" (Feinbier, Springer, 2015) an, das sich vornehmlich mit sprachwissenschaftlichen Grundlagen, der Gesprächsführung im beruflichen Umfeld wie der Einführung in die psycholinguistische Sprechaktanalyse befasst. Zielgruppen sind: Studierende und Dozierende der Psychologie und Sozialen Arbeit Praktiker in Bereichen: Beratung, Psychotherapie, Soziale Arbeit
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 779
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Weihnachten – Eine Erzählung
La veille de Noël – Un conte de Noël
Christmas Day – A family tale
Festa di Natale – Una storia di Natale
Navidad – Una historia de Navidad
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung
Wo versteckt sich die Psychologie in den Worten?
Die Werkzeuge der PSA
Modellgespräch
Transkript Modellgespräch
Legende
PSA Modellgespräch
Sprechakt A
1
Sprechakt B
1
Sprechakt A
2
Sprechakt B
2
Sprechakt A
3
Sprechakt B
3
Sprechakt A
4
Sprechakt B
4
Sprechakt A
5
Sprechakt B
5
Sprechakt A
6
Pause
Sprechakt A
7
Sprechakt B
6
Sprechakt A
8
Sprechakt B
7
Sprechakt A
9
Sprechakt B
8
Sprechakt A
10
Sprechakt B
9
Sprechakt A
11
Sprechakt B
10
Sprechakt A
12
Sprechakt B
11
Sprechakt A
13
Sprechakt B
12
Sprechakt A
14
Sprechakt B
13
Sprechakt A
15
Sprechakt B
14
Vorbemerkung zu den Sprechakten A
16
– A
18
Sprechakt A
16
A
17
Pause
Sprechakt A
18
Sprechakt B
15
Sprechakt A
19
Pause
Sprechakt B
16
Sprechakt A
20
Nachwort
Vorwort
In der 2015 erschienenen Monografie Psycholinguistik in der Gesprächsführung – Theorie und Praxis einer psycholinguistischen Sprechaktanalyse1 habe ich die Methode Psycholinguistische Sprechaktanalyse (PSA) vorgestellt, die zeigt, wie man besser verstehen kann, was in einem Gespräch tatsächlich gesagt wird. Besonders erforderlich ist dies in beruflichen Gesprächen. Berufliche Gesprächsführung ist zielorientiert und verlangt deshalb Methodik. Nicht irgendeine Methode, sondern am besten jene, die wissenschaftlich begründet ist und die Effizienz der Gesprächsführung steigert.
Relevant wird dies in vielen beruflichen Handlungsfeldern im Bereich Beratung, Coaching, Organisations- und Personalführung, Consulting und Vernehmung. Diese 2015 erschienene Monografie hat entsprechend zu zahlreichen Rückmeldungen von Lehrenden und Studenten wie von Juristen, Psychologen, Sozialpädagogen, Coaches usw. geführt. Eine zentrale Frage war dabei, wie und wo man psycholinguistische Sprechaktanalyse lernen kann.
Nun gibt es wahrlich eine kaum noch überschaubare Fülle an Literatur zur Gesprächsführung in der Beratung, wie es zahlreiche Angebote an Trainingsseminaren gibt, in denen man Gesprächsführung lernen kann. Übliche Ausbildungskonzepte für die Gesprächsführung im Bereich von Beratung konzentrieren sich allerdings vor allem auf systemische oder kommunikations- und interaktionspsychologische Aspekte der Gesprächsführung. Neben dem längst inflationären Hinweis auf Empathie stehen meist einzelne technical skills und vor allem taktische Verhaltensweisen im Umgang mit klassischen Gesprächssituationen im Fokus der Anleitungen und Ausbildungen.
Dem umfassenden Verstehen jedes einzelnen Wortes, jedes Satzes und jedes Sprechakts im Gespräch wird nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Bei der psycholinguistischen Sprechaktanalyse (PSA) geht es genau darum, im Detail wirklich alles zu verstehen, was in einem beruflichen Gespräch gesprochen und vor allem auch, was nicht direkt gesagt wird.
Frei nach T. S. Eliot (1888-1965) soll eine PSA ein wenig mehr Licht in die verdeckte Welt des nicht direkt Gesprochenen bringen. Eine Welt, die wir allzu oft in der Fülle der Informationen in einem Gespräch überhören. Eine PSA soll Sie auf die dunkle Seite in den Sprechakten führen. Wenn Sie so wollen, zu jenen dunklen Löchern, die jeder offen gesprochene Satz birgt, wie jene, von denen die Astrophysiker berichten, wenn sie das Weltall erklären. Gemeint sind jene Stellen im Fluss der Worte und Sätze, von denen Sie eher meinen, etwas zu spüren oder zu fühlen, ohne dass Sie gleich erkennen, was da jetzt wirklich gesagt wurde.
Unterrichtet habe ich diese Methode jahrzehntelang im Rahmen meiner Lehrtätigkeit. Seit 2012 emeritiert, habe ich nun nach einem anderen Weg der Vermittlung gesucht. Entstanden ist das Material für ein multimediales, interaktives E-Book mit Video-Film und parallel laufendem Text, Übungen zum Lernen, Popup Einblendungen mit weiteren Erklärungen und Theoriebausteinen, Glossar, Datenbank usw.
Dieses komplexe System zum heute so bedeutsam gewordenen Selbstlernen mit Bild und Ton am PC2 konnte nicht umgesetzt werden. Weder mein bisheriger Verlag (Springer, Wiesbaden) noch andere Verlage sahen sich in der Lage, dies technisch umzusetzen. Um die an mich gerichteten Anfragen, übrigens auch von vielen meiner Studenten, nicht ohne Antwort zu lassen, ist nun mit diesem Book on Demand eine Print-Version entstanden,3 ohne Video, ohne interaktive Übungen, ohne Datenbank usw., und nur mit wenigen Theorie-Exkursen. Ein wenig können Sie dieses Buch als Drehbuch wie zu einem Film verstehen.
Ich schlage Ihnen damit vor, sich einmal abseits Ihres kommunikations- und interaktionspsychologischen Wissens über Gesprächsführung ausschließlich auf das gesprochene Wort, den einzelnen Satz eines Sprechakts in einem realen Beratungsgespräch zu konzentrieren. Zu lesen und zu verstehen, was tatsächlich gesagt wird und was ungesagt bleibt, aber doch vorhanden ist.
Dieses Buch ist geschrieben für Fährtensucher in der Welt der Worte, die im Gespräch an Ihnen vorbeirauschen. Es soll Ihnen helfen, nicht nur im beruflichen Gespräch ein Fährtenleser in der Welt der Sprache zu werden.
Straubing 2019, Robert J. Feinbier
1 Feinbier RJ (2015) Psycholinguistik in der Gesprächsführung. Theorie und Praxis einer psycholinguistischen Sprechaktanalyse. Springer-Verlag Wiesbaden.
2 Einen Vorgänger hierfür hat es bereits gegeben: FEINBIER RJ (1999) VTS – Videotrainingssystem. FH Landshut. Das Programm war leider nicht absturzsicher und läuft auf den heutigen PCs nicht mehr.
3 Ein kleines, sehr verkürztes Beispiel für eine PSA finden Sie auch hier: Feinbier RJ (2015) Die Edathy-Protokolle: Was Sprache verrät. Eine psycholinguistische Sprechaktanalyse vorliegender Aussagen. Essentials. Springer Verlag. Wiesbaden.
Einführung
„Gesprächsführung lernt man doch am besten im Gespräch.“
„Wohl wahr“, werden Sie sagen und fragen: „Wozu braucht es dann noch dieses Buch?“ Nun, ich als Autor spreche auch jetzt zu Ihnen als Leser und Sie versuchen zu verstehen, worauf ich hinaus will. Sie hören mir zu … STOPP: Verzeihung, Sie lesen, was ich schreibe und analysieren vielleicht schon meine Worte, so als würden Sie mich hören.
Dem eigenen Sprechen geht das Hören bzw. das Lesen und das Verstehen des Gehörten oder Gelesenen voraus. Im Gespräch haben Sie dazu sehr wenig Zeit. Das gesprochene Wort kommt meist schneller als der Wind und eilt oft davon, bevor Sie Zeit hatten, Luft zu holen. So viel Zeit wie der letzte Mohikanern Chingachgook (Cooper 2013)4, um vom Pferd zu steigen und in Ruhe die Spuren am Boden zu untersuchen, haben Sie im Gespräch nicht.
Verstehen verlangt gerade im beruflichen Gespräch jederzeit konzentrierte Aufmerksamkeit auf das, was gesprochen wird. Das sorgfältige Gestalten des nachfolgenden eigenen Sprechakts, verlangt von Ihnen noch mehr Konzentration, weil es gerade im beruflichen Gespräch darauf ankommt, dass Sie umfassend verstanden haben, was Sie zuvor gehört haben. Sonst sprechen Sie, ohne ausreichend verstanden zu haben und werden selbst nicht mehr richtig verstanden. Wozu dies im Alltag führt, wissen wir alle. Im professionellen, auf Effizienz gerichteten Gespräch kann sich das niemand leisten.
Und genau hier liegt der Vorteil des Buchs. Sie gewinnen Zeit beim Lesen und müssen nicht gleich selbst einen Sprechakt bilden. Wie wenn Sie einem plätschernden Bach lauschen, so hören Sie auch im Gespräch nicht einfach ein Wort, einen Satz nach dem andern. Wie am Bach ein einzelnes Geräusch, so fällt Ihnen auch im Gespräch nur manchmal ein einzelnes Wort oder eine einzelne Bemerkung auf. Gleichzeitig läuft Ihnen die Zeit davon, während Sie noch grübeln, was Ihr Klient gerade gesagt hat. Sie können dann nicht einfach eine STOPP-Taste drücken und analysieren, was ihr Gesprächspartner gesagt hat. Und schon gar nicht können Sie lange überlegen, was und wie Sie jetzt darauf antworten. Im Beruf fordert das dialogische Gespräch von Ihnen, dass Sie möglichst prompt und in jedem Fall sorgfältig adaptiert Ihren eigenen Sprechakt zielorientiert bilden.Das Gefühl, dass da doch noch etwas war, was ein Gesprächspartner gesagt hat und Sie wissen nicht mehr, was genau Sie irritiert hat, dieses Gefühl kann Sie schon nach einem kurzen Satz packen. Nach einigen Minuten werden Sie vielleicht unruhig, weil das Gespräch nicht so läuft, wie Sie es sich vorgestellt haben und manchmal gehen Sie nach einer Stunde auseinander und nehmen sich vor, dass das Gespräch das nächste Mal aber anders verlaufen muss. Wenn Sie bis dahin nicht verstehen, was im ersten Gespräch tatsächlich geschehen ist, werden Sie im nächsten Gespräch nur mehr von demselben machen.
Worte und Sätze überraschen uns manchmal wie die Blätter im Wind und manchmal hebt auch im Gespräch ein Sturm an und beutelt uns, und dann ist plötzlich wieder Flaute und wir halten Ausschau, was jetzt wohl kommen mag, bis wir uns am Ende gestört fühlen, weil Stille herrscht. Die Analyse eines Wortes oder eines Satzes erfordert mehr Zeit, als ihn zu sprechen und manchmal irritiert uns eine Pause im Gespräch mehr als jedes Wort.
Diesem Problem der Gleichzeitigkeit von rezeptivem Verstehen und proaktivem Gestalten des eigenen Sprechakts kann man beim Lösen praktischer Handlungsaufgaben durch Routinebildung begegnen. In der Raumfahrt wurden von Sigmund Jähn über Ulf Merbold bis Alexander Gerst angehende Astronauten durch jahrelanges, intensives Training auf alle vorstellbaren Problemsituationen vorbereitet.
Zu was solche Einübung in Handlungsroutinen der Gesprächsführung bei Autoverkäufern, Politikern, Journalisten oder Führungskräften in der Industrie führt, überlasse ich Ihrer eigenen Einschätzung. Spätestens, wenn solchermaßen geschulte Gesprächsführer nicht mehr auf unbedarfte Zuhörer treffen, wird es abenteuerlich, manchmal amüsant oder wie in Talkshows oft ärgerlich.
Dieses Buch soll Ihnen deshalb Zeit verschaffen. Zeit zu begreifen, wie Sprechakte gestaltet sind, und Zeit zu überlegen, was ein Wort, ein Satz an Informationen beinhaltet. Kurz, dieses Buch regt sie an und begleitet Sie, besser verstehen zu lernen. Und nicht nur dies. Wenn Sie gelernt haben, mehr zu verstehen, dann lernen Sie auch rechtzeitig zu verstehen, was gesagt wird. Ja - Sie lernen im laufenden Gespräch sogar zu verstehen, was gleich gesagt werden wird. Wenn Sie sich jetzt Zeit für dieses Buch nehmen, dann gewinnen Sie Zeit für Ihr nächstes Gespräch. Dieses Buch ist auch ein Zeit-Investment.
Ich stelle Ihnen hierzu ein klassisches Beratungsgespräch vor. Es stammt aus einem meiner eigenen Erfahrungsbereiche, der psycho-sozialen Beratung. Dieses Gespräch ist nur kurz (10 Minuten), aber real und kein übliches Rollenspiel.
Weil Gegenstand, Zweck und Verlauf beruflicher Gespräche in den vielen Berufsfeldern höchst unterschiedlich sind, habe ich ein Gespräch über ein Thema ausgewählt, das gar keinen Bezug zu einem bestimmten Berufsfeld erkennen lässt: Weihnachten in der Familie. Dieses Thema kennt nun wirklich jeder, ob Pädagoge, Psychologe, Mediator oder Coach usw. aus eigener Erfahrung.
Es handelt sich bei diesem Gespräch jedoch nicht um einen alltäglichen Plausch im Freundes- oder Bekanntenkreis, bei dem jeder im Smalltalk ein wenig von sich erzählt. Bei diesem Gespräch besteht ein berufliches Rollensetting mit Aufgabenverteilung zwischen professioneller Beraterin und Klientin, wie es bei psycho-sozialen Beratungsgesprächen der Fall ist.
In diesem Buch werden Sie zu diesem zehnminütigem (10!) Gespräch, auf drei (3!) Seiten transkribiert, mehrere hundert Seiten Analyse finden. Richtig! Eine solch umfangreiche Analyse macht in der beruflichen Praxis kein Mensch und im laufenden Alltagsgespräch hat eh niemand die Zeit dafür. Verstehen Sie deshalb dieses Buch auch als ein didaktisches Mittel, das realitätsbasiert versucht, einmal so umfassend wie möglich aufzuzeigen, was mit einer sorgfältigen Analyse der Worte und Sprechakte im Gespräch möglich ist.
Diese zehn Minuten Gesprächsdauer enthalten ausreichend Dialogwechsel, um den Verlauf des Gesprächs zu erkennen und um die relevanten Merkmale im Detail zu analysieren. Wir werden dem Gespräch folgend, Sprechakt für Sprechakt, Satz für Satz und Wort für Wort analysieren und Sie werden danach mehr von beiden Gesprächsteilnehmern wissen, als denen im Gespräch selbst bewusst geworden ist. Und Sie werden nach und nach verstehen, wie Sie zu solchem Wissen gelangt sind.
Dass einstündige Beratungsgespräche noch unter ganz anderen Gesichtspunkten analysiert werden können, bleibt unbenommen. Ziel der langen Analyse dieses kurzen Gesprächs ist es nur, einmal modellhaft aufzuzeigen, wie eine solche Analyse durchgeführt werden kann. Deshalb spreche ich von einem Modellgespräch. Es liefert uns nicht nur ein praktisches Modell dafür, wie Sie in einem Gespräch einzelne Sprechakte besonders tiefgehend analysieren können. Die fortlaufende psycholinguistische Analyse der einzelnen Sprechakte dieses in sich abgeschlossenen Gesprächs wird Sie zu einem ganz neuen Verständnis der Menschen führen, die sich in diesem Gespräch begegnen. Zudem werden Sie Sprechakt für Sprechakt begreifen, wie eine solche PSA funktioniert. Ja Sie werden sich Schritt für Schritt einüben, eine solche psycholinguistische Analyse selbst zu betreiben.
4 Cooper JF (2013) Der letzte Mohikaner. Hanser-Verlag München
Wo versteckt sich die Psychologie in den Worten?
Wenn wir als professionelle Berater ein psycho-soziales Beratungsgespräch Wort für Wort und Satz für Satz analysieren, dann tun wir das weder als Germanist oder als Deutschlehrer noch als Sprachwissenschaftler oder als Linguist. Was uns interessiert, sind vor allem die psychologisch interessanten Inhalte in den Sprechakten unserer Klienten. Sie sollen uns helfen, unser Beratungsziel zu erreichen, und sie helfen uns im Beratungsgespräch, unser eigenes Verhalten, also das, was wir selbst sagen, zielorientiert und effizient zu gestalten.
Da wir alle sprechen, sprachliche Äußerungen als Instrument nutzen, geht es bei einer psycholinguistisch geleiteten Gesprächsführung darum, aus einer linguistischen Analyse der Sprechakte zu psychologischen Erkenntnissen zu gelangen. Es geht also darum, über eine Sprachanalyse zu psychologischen Erkenntnissen zu gelangen. Genau dies ist eine psycholinguistische Sprechaktanalyse PSA.
Möglich wird dies, wenn wir Sprechakte als menschliche Verhaltensweisen verstehen. Genauso wie andere menschliche Handlungen auch. Worte und Sätze werden getan, wenn sie gesprochen werden. Auch wenn wir manchmal glauben, es wäre so, sie fallen nicht einfach aus dem Mund oder gehen unterwegs mal eben verloren. Sprechakte haben wie andere menschliche Verhaltensweisen eine Ursache und eine Wirkung.
In den Sprechakten werden Dinge, Zustände, Geschehnisse, Gedanken, Empfindungen, Erlebnisse, Objekte und Personen usw. mit Worten und Sätzen beschrieben. All das, was wir hören, kann jetzt gerade da sein oder geschehen, es kann aber auch viel früher gewesen sein oder später oder nie kommen. Sprechakte können vom Sprecher selbst berichten oder von ganz anderen Menschen, die wir gar nicht kennen, und manchmal kann ein Sprecher von Geschehnissen berichten, die wir uns nie vorstellen konnten.
Im Beratungsgespräch ist dabei immer nur der Klient anwesend und wir hören nur, was er sagt. Seine Sprechakte, seine Worte und Sätze stehen stellvertretend, symbolhaft für das, was er in sprachlichen Zeichen beschreibt, erlebt und erfahren hat, erwartet oder sich vorstellt und ausdenkt. Es ist die Wirklichkeit des Sprechers, so wie er will oder meint zu wissen, dass sie ist. Die Sprechakte führen uns deshalb stets auch dazu, wer dieser Sprecher ist. Ja allzu oft erfahren wir mehr davon, wer der Sprecher ist, und weniger davon, wie das tatsächlich ist oder war, was er berichtet.
Da unsere Sprache keine willkürlich verwendbare Ansammlung von Zeichen ist, sondern ein regelhaft geordnetes System, und weil dieses in einem Sprachraum einigermaßen vergleichbar verwendet wird, können sprachliche Informationen im Gespräch auch verstanden und ausgetauscht werden. So können wir auch versuchen, Sprechakte so zu verstehen, wie sie vom Sprecher verwendet werden. Wir können verstehen, was die Worte und Sätze dieses Sprechers beschreiben, und wir können verstehen, wie sie beschreiben, wovon der Sprecher spricht. Wir können erfahren, wie der Sprecher sich und seine Welt erlebt.
Voraussetzung hierfür ist allerdings nicht nur, dass wir hören, was wir meinen gehört zu haben. So wie wir mit unseren Sinnen nur einen geringen Teil dessen wahrnehmen, was um uns gerade geschieht, so bleibt uns im Gespräch vieles verborgen, was gesagt wurde.
Im Alltag haben wir im kaum endenden Fluss der sprachlichen Informationen längst verlernt, auf jedes Wort, jede Satzstellung, jedes nicht gesprochene Wort zu achten.
Aufmerksame, möglichst umfängliche Wahrnehmung, nicht einmal mit allen Sinnen, erfordert erhebliche Anstrengung und so entgehen uns selbst im beruflichen Gespräch viele Informationen. Allzu oft sprechen wir selbst achtlos und achten nicht ausreichend darauf, was wie gesagt wird. Dabei haben wir schon als Kind gelernt: Es kommt stets darauf an, wie etwas gesagt wird. Wir glauben, nur weil wir etwas nicht ganz bewusst und willentlich sagen, regiere der Zufall, wie wir sprechen. Genau dies ist falsch. Eben weil die Sprache ein geregeltes System von Zeichen ist, bleibt nie bedeutungslos wie ein Sprechtakt gebildet wird und wie etwas gesagt wird.
Die grundsätzliche Regelhaftigkeit einer gemeinsam geteilten Sprache erlaubt uns, dass wir uns im Gespräch austauschen können. Gleichzeitig ist gerade die deutsche Sprache außerordentlich reichhaltig an Variationsmöglichkeiten, Informationen sprachlich zu übermitteln. Es ist eben nicht dasselbe, ob ich einen Sachverhalt mit einem Substantiv oder einem Verb beschreibe: Das Rennen läuft noch – Sie rennen noch. Einmal interessiert den Sprecher mehr das Rennen und einmal mehr, wer rennt. So ist es auch nicht egal, mit welchem Wort ich einen Satz anfange: Müller ging dann auf das Podium – Auf das Podium ging dann Müller. Einmal interessiert den Sprecher mehr, dass es Müller war, der dann auf das Podium ging, das andere Mal beachtet der Sprecher, dass Müller auf das Podium ging. In der Eile des Alltags fällt uns das selten auf, und selbst Journalisten bemerken manchmal nicht, dass sie verraten, aus welcher Perspektive sie berichten: Er kam heraus – Er ging hinaus. Gegangen ist immer Er, aber wir wissen jetzt auch, wo der Beobachter stand. In einer Vernehmung könnte sich ein Tatverdächtiger damit sogar selbst in Schwierigkeiten bringen.
Hörbare und selbst nicht hörbare (Schweigen, Pausen) sprachliche Äußerungen legen wie sichtbare menschliche Handlungen und Verhaltensweisen oder ihr Ausbleiben stets auch Fährten zu all dem, was wir nicht direkt hören oder sehen können. Interessant ist nicht nur, wenn jemand seine Sprechakte sorgsam überlegt formuliert wie Politiker oder Diplomaten. Interessant ist stets auch, wenn genau dies missglückt und Unregelmäßigkeiten oder Sprech- und Sprachstörungen, Selbstkorrekturen, Repetitionen und gebrochene Syntax im freien Erzählen auftreten. Eine linguistische Analyse der Sprechakte eröffnet uns die Möglichkeit, jene Fährten zu finden, welche die Sprechakte noch hinterlassen. Erst wenn wir jene diskreten Fährten lesen lernen, die vom Sprecher meist unbemerkt noch gelegt werden, gelingt uns der nächste Schritt: Sprechakte umfassender auszuwerten und in ihrer Entstehung und Auswirkung zu verstehen. Kurz: Umfassender zu verstehen, was noch gesagt wurde. Und manchmal ist dies auch das, was der Sprecher selbst nicht weiß oder bemerkt oder gar nicht sagen wollte.
Besonders interessant wird eine solche vertiefte Analyse dann, wenn wir über ein Referenzwissen darüber verfügen, wie menschliches Verhalten und Erleben entsteht, verläuft und wozu es führt. Dieses Referenzwissen kann aus einem fachlichen Wissen stammen, es kann aber auch aus einem allgemeinen wie ganz persönlichen oder einem beruflichen Erfahrungswissen stammen. In der psycho-sozialen Beratung kommt psychologischem Fachwissen besondere Bedeutung zu.
Im Bereich beruflichen Counselings geht es darum, die psychologische Relevanz der sprachlichen Signale in den Sprechakten zu erkennen. Genau deshalb sprechen wir von einer psycho-linguistischen Sprechaktanalyse PSA. Sie führt nicht nur zu dem, wovon der Sprecher spricht. Sie führt auch direkt zum Sprecher selbst.
Um die Methodik einer PSA zu verstehen, bedarf es jedoch weder einer akademischen Ausbildung als Psychologe noch müssen Sie Sprachwissenschaftler sein. Der DUDEN hilft dem Psychologen beim Schreiben, nicht unbedingt beim Verstehen seines Gesprächspartners. Und der reine Linguist wird ohne psychologisches Grundwissen mehr über eine Textkonstruktion erfahren, aber wenig über die Persönlichkeit dessen, der ihn gesprochen oder geschrieben hat.
Bei einer PSA verstehen wir Sprechakte in einem Gespräch als menschliche Handlungen wie Lachen, Schlagen, Weggehen, Stirnrunzeln, Aufstehen usw. auch. Und so, wie wir versuchen, menschliches Verhalten psychologisch zu verstehen, so suchen wir in den psycho-sozialen Beratungsgesprächen zu verstehen, was die Sprechakte, die Worte und Sätze uns noch an Informationen über unseren Klienten liefern.
Wenn Menschen nichts tun, außer zu sprechen, ist es genauso möglich, Menschen zu verstehen, wie wenn Sie Menschen bei dem, was sie tun, lange genug genau beobachten. Ja häufiger gelingt es im beruflichen Gespräch sogar noch viel besser, einen anderen Menschen zu verstehen, wenn Sie ihn nur reden hören. Die Kunst der Psychotherapeuten und Berater gründet ganz wesentlich darauf, dass sie hören, was nicht direkt gesagt wird.
Richtig: Ganz ohne psychologische und sprachwissenschaftliche Grundkenntnisse kommt eine psycho-linguistische Sprechaktanalyse nicht aus. Andererseits haben auch meine Studenten das Handwerk einer PSA gelernt, ohne mein Buch Psycholinguistik in der Gesprächsführung zu kennen. Auch sie haben sich auf die Analyse ihrer eigenen Gespräche einlassen müssen und das theoretische Rüstzeug hierfür erst nach und nach kennen gelernt. Diese Lehrmethode ist keine Erfindung von mir, sondern stammt schon von Célestin Freinet (1896 – 1966). Heute würden wir sagen: Learning by doing. Wir machen das, was wir lernen sollen und lernen beim Machen, wie wir es tun sollen.
Die Werkzeuge der PSA
Wie bei jeder Untersuchung in der Medizin am Patienten oder, Pardon, wie in der Autowerkstatt am Motor, bedarf es auch bei der psycholinguistischen Analyse eines methodischen Rüstzeugs. Eine PSA ist wie jede Analyse im Kern ein diagnostischer Prozess. Diagnostik besteht aus Beobachten, Beschreiben, Bewerten, Erklären, Einordnen usw. All dies dient dem gründlichen Verstehen dessen, was beobachtet wird und dazu, aus diesem Verständnis weitere Handlungsfolgen abzuleiten.
Die genaue Beobachtung und die exakte Beschreibung gehen der Bewertung, Erklärung und Einordnung voraus. Ich habe es hundertfach vorgeführt: Wenn Sie jemanden auffordern, exakt zu wiederholen, was Sie gesagt haben, erhalten Sie schon bei einem einzigen Satz mit fünf (5!) Worten nur noch wenige richtige Antworten. Schon für die PSA unseres aufgezeichneten und schriftlich vorliegenden Gesprächs bedeutet dies, die Sprechakte mit ihren Sätzen und Wörtern viel genauer zu betrachten, als wir es gewohnt sind. Umso mehr als wir im realen Gespräch gewohnt sind, auf die vermeintlichen Inhalte dessen zu achten, was unser Klient sagt. Wie unser Klient was und wann sagt, mit welchen Worten und wie er seine Sätze formuliert, das fällt uns allenfalls dann auf, wenn es uns ungewöhnlich erscheint, will sagen, weil wir nicht gewohnt sind, es so zu hören.
Als Erstes gilt es deshalb, die Bedeutung der Worte und der Konstruktion der Sätze zu erkennen, zu prüfen, wie ein Sprechakt gebildet ist. So wie die Worte gewählt und gesetzt werden, so wie ein Satz gebildet wird, so wie ein Satz gesprochen oder nicht gesprochen wird, all dies hinterlässt Spuren, die zu verborgenen, zu verdeckten Informationen hinter dem scheinbar Offensichtlichen führen. Erst wenn Sie diese Spuren zu deuten wissen, können Sie in einem dialogischen Gespräch auch Ihren eigenen Beitrag wohlüberlegt so adaptiert gestalten, dass zielorientiert eine angestrebte Wirkung eintritt. Dann, aber meist nur dann gilt, was wir schon immer wussten: Sprache wirkt!
Um diese Werkzeuge der PSA näher kennenzulernen, wird Ihnen hierfür ein in sich abgeschlossenes Modellgespräch in Form eines vollständigen Transkripts vorgestellt. Lesen Sie es in Ruhe einmal als Ganzes durch. Meine Studenten haben sich auch ihre eigenen, auf Video aufgezeichneten Gespräche erst angeschaut und wir haben sie dann gemeinsam, Schritt für Schritt analysiert. Und bei jedem Schritt haben sie gelernt, was zu beachten ist, wie linguistisch zu beschreiben ist, was sie hören, und welche psychologische Bedeutung den Worten und Sätzen zukommt. Meine Studenten haben sich bei dieser Analyse selbst begleitet und mehr über sich selbst erfahren, wie sie sich gleichzeitig eingeübt haben in eine psycholinguistische Sprechaktanalyse.
Auf der Basis dieses Transkripts werden auch wir in diesem Buch dann die eigentliche PSA Modellgespräch durchführen. Sie werden mehr erfahren über die beiden Gesprächsteilnehmerinnen, und sie werden Schritt für Schritt mehr erfahren, mit welchen Mitteln Sie ein Gespräch psycholinguistisch analysieren können. Sicher müssen Sie auf die Videobegleitung verzichten, aber das didaktische Prinzip ist das gleiche. Weil wir nicht an einzelnen, zusammenhanglosen Sprechaktbeispiele üben, sondern an einem realen, in sich geschlossenen Gespräch, kann sich ein vergleichbarer Lern- und Übungsfortschritt wie bei videogestütztem Analysieren im Trainingsseminar entwickeln. Dies bedarf der Zeit, aber das ist bei allem Üben ebenso.
Wenn Sie als erstes das gesamte Gespräch lesen, wird Ihnen das Transkript dieses Textes befremdlich vorkommen. Der gesprochene Text ist im freien Fluss fortlaufend ohne Satzzeichen wie Kommata usw. geschrieben. Dies soll vermeiden, dass durch Satzeichen usw. bereits ein Sinn vorgegeben wird. Formulierungsfehler, Sprechstörungen usw. wurden entsprechend auch nicht korrigiert. Die Textstellen werden deshalb auch original so in die Einzelanalysen übernommen.
Nach der etwas beschwerlichen Lektüre des Transkripts werden Sie außer einem vielleicht verwirrenden Eindruck ohne Nachlesen nur wenige Informationen im Gedächtnis behalten. Das macht gar nichts und ging meinen Studenten nicht anders, wenn sie ihr Video angeschaut haben.
Wenn Sie schon einmal eine der heute so beliebten Kochsendungen im Fernsehen angeschaut haben, könnte es Ihnen ebenso ergangen sein. Auch dort wird Ihnen erst einmal ein Menü als Ganzes vorgestellt, dann werden die einzelnen Gänge präsentiert und erst danach wird die Zubereitung jedes einzelnen Bestandteils des Essens detailliert vorgeführt. Wenn Sie dabei genau zuschauen, lernen Sie auch die Kochwerkzeuge kennen und wie man damit umgeht. Sie lernen, wie man Fleisch oder Fisch zerteilt, wie man Zwiebeln schneidet oder sanft anbrät oder dünstet usw. Gar nicht so unähnlich gehen wir auch bei der nachfolgenden PSA in mehreren Schritten vor.
Um im Bild zu bleiben werden wir nach der Vorstellung des ganzen Menüs (Transkript des Gesprächs) die einzelnen Gänge (Sprechakte) vorstellen.
Sprechaktbestimmung
In unserer PSA Modellgespräch wird deshalb als Erstes das Gespräch in einzelne Sprechakte aufgeteilt. Die Sprechaktfolge ist dabei vorgegeben durch den Sprecherwechsel (A → B → A →). Danach werden wir die einzelnen Teile jedes Gangs im Menü (Sprechakt) vorstellen.
Segmentierung
Diese Sprechakte werden im nächsten Schritt in einzelne Aussageinhalte (Propositionen) unterteilt (segmentiert). Das können einzelne Worte, ganze Sätze und manchmal auch mehrere Satzteile oder einfach eine Pause sein. Die hier von mir vorgenommene Segmentierung ist als Vorschlag zu verstehen. Sie muss bei jedem Transkript neu überlegt werden, folgt hier aber wie bei Beratungsgesprächen üblich, inhaltlich weitgehend den auftretenden Propositionen, berücksichtigt aber stellenweise auch Pausen usw. Daran anschließen wird sich die Detailanalyse jedes Segments. Jedes einzelne Segment eines Sprechakts wird dabei in zwei Schritten linguistisch analysiert. In einem ersten Schritt erfolgt eine Deixis-Analyse.
Deixis-Analyse
Für viele Leser wird der Begriff der Deixis ein fremder Begriff sein. Deixen (vom Griechischen abgeleitet in der Mehrzahlform eigentlich Deixeis) sind in Sprechakten Indikatoren, sprachliche Hinweiszeichen. Man spricht deshalb auch von Zeigewörtern oder Verweiswörter. Sie verweisen auf implizierte Personen (P), Orte (O) oder Zeiten (Z). In einem Sprechaktsegment helfen solche Hinweiszeichen dem Hörer nicht nur, den Aussageinhalt konkreter zu erfassen, sie helfen auch zu verstehen, wie und aus welcher Perspektive ein Sprecher seine Wahrnehmungs- und Erlebenswelt beschreibt.
In der PSA unterscheiden wir eine Persondeixis (PD), eine Ortsdeixis (OD) und eine Zeitdeixis (ZD). Diese drei Deixen liefern uns ein dreidimensionales Strukturschema, mit dem wir ein Sprechaktsegment zunächst einmal als Ganzes betrachten können.
Beispiele:
Ich
bin jetzt
hier
Otto
war gestern
in München
PD
ZD
OD
Im Sommer fliegen
wir
nach Mallorca
ZD
PD
OD
Nicht immer enthält jedes Segment alle drei deiktischen Verweise und manchmal finden wir auch gar keinen.
Otto
lachte
PD
ZD
Ein Baum
fällt um
ZD
Und manchmal, bei unbestimmten Hinweisen, werden deiktische Hinweise nur indirekt erkennbar und manchmal lassen sich gleich mehrere finden.
Keiner lachte mehr
PD ZD
Nirgendwo
war er
zu finden
OD
ZD PD
Niemals habe
ich ihn
geschlagen
ZD
PD PD
Interessant an deiktischen Begriffen ist, dass man sie wie auf einem Richtstrahl anordnen kann. Diese Ordnung entsteht, wenn Sie als zentralen Ausgangspunkt den Sprecher (Ich) hier und jetzt nehmen. Dabei ordnen wir Verallgemeinerungen wie: alle, überall, nirgends, immer, nie usw. als besonders distal zum Ausgangspunkt zu, weil sie so verallgemeinert sind, dass sie keine singuläre Kennzeichnung mehr darstellen.
PD
Ich – Du – der – die – alle – keiner …
OD
Hier – da – dort – nirgendwo – überall …
ZD
Vorher – jetzt – nachher immer – nie …
In einem Gespräch haben Sie damit ein Maß dafür, wie zentral fokussiert ein Sprecher, jetzt und an diesem Ort des Gesprächs, von sich spricht oder von Dingen, Situationen oder Geschehnissen irgendwo zu anderer Zeit berichtet.
Erkennbar wird mit dieser Anordnung, wie fokussiert jetzt und hier der Sprecher von sich selbst spricht oder allgemein und unbestimmt von örtlich und zeitlich fernen oder abstrakten Ereignissen.
Für unsere PSA liegt die wirkliche Bedeutung dieser linguistischen Merkmale jedoch darin, dass die deiktische Kennzeichnung eines Segments mit dem psychologischen Merkmal der Ich-Nähe und ICH-Ferne korrespondiert, mit der ein Sprecher berichtet.
So sind sie halt alle schon immer gewesen
Ich zittere jetzt bloß noch vor lauter Aufregung
Deiktische Zentrierung im Hier und Jetzt des Augenblicks im Gespräch lässt Erlebnisnähe, Ego-Involvement, Unmittelbarkeit im Erleben erwarten. Sie kennzeichnet eine proximale, problemnahe und erlebnisfundierte Schilderung, welche die aktuelle persönliche Bedeutung dessen offenbart, wovon der Sprecher berichtet.
Deiktische Verweise auf allgemeine Umstände, Verallgemeinerungen, Berichte zu längst vergangenen Zeiten an ganz anderen Orten mit externalen Personen, sachliche Schilderungen von fernen Objekten und allgemeinen Ereignissen führen in eine distale Ferne. Sie führen weg vom Sprecher und seinem augenblicklichen Erleben selbst. Erlebnisnähe wird dann allenfalls am Sprechverhalten und an nonverbalen Signalen erkennbar.
Für unsere Deixis-Analyse legen wir ein psycholinguistisch geordnetes Raster zugrunde:
PD Ich, mir, mich Hörer wir die, der - alle, man, andere, niemand …
ICH-nah ………………………………………..………………….. ICH-fern
Proximal …………………………………………………………….. Distal
OD hier nah dort, fern - überall, nirgends …
ICH-nah ………………………………………..………………….. ICH-fern
Proximal …………………………………………………………….. Distal
ZD vorher ← jetzt → nachher – andere, immer, manchmal, nie …
ICH-fern …………………………ICH-nah …………………………………ICH-fern
Distal . ..…………………………Proximal .……………..…………………..… Distal
Ein Sprechaktsegment mit deiktischen Hinweisen kann damit dreidimensional eingeordnet werden. Die deiktische Einordnung kennzeichnet aber nicht nur, wie ICH-nah sich ein Sprecher einem bedeutsamen Inhalt nähert oder sich davon entfernt. Diese Einordnung hilft dem Berater auch, seinen eigenen Sprechakt adaptiert zu setzen und den Weitergang des Gesprächs zielorientiert zu steuern.
Im Verlauf eines Sprechtakts wie im gesamten Verlauf aller Sprechakte sind extrem proximale, ICH-nahe Äußerungen eher selten. Extrem distale, ICH-ferne Schilderungen finden sich oft zu Beginn eines Gesprächs, kommen aber immer wieder vor und bedürfen eines sorgfältigen conversonal managements durch den Berater. Viele Sprechaktsegmente oszillieren in einem mittleren Bereich zwischen deiktisch proximalen und distalen Verweisen. Gerade sie lassen dem Berater zahlreiche Möglichkeiten, das Gespräch mit diskreten deiktischen Variationen in seinen Verbalisierungen zu lenken.
Nach der Deixis-Analyse bedarf es einer detaillierten Analyse der Satzgestaltung und der Worte in jedem Segment. Sie erfolgt in der Semiotik-Analyse.
Semiotik-Analyse
Darunter verstehen wir im Rahmen der PSA die Analyse der sprachlichen Zeichen in einem Sprechakt. Zu einer Semiotik-Analyse gehörten drei Teile:
Syntax-Analyse
Im Rahmen der PSA verstehen wir unter Syntax-Analyse zunächst die Analyse des Aufbaus eines Sprechaktsegments und der Wortstellungen im Satz (z. B. Linksherausstellung). Zur weiteren Satzanalyse zählen wir aber auch Merkmale des Satzes wie die Ellipse (Auslassungen, nicht gesprochener Textteil), die Rekurrenz (Rückverweisung auf zuvor gesprochenen Inhalt), die Konnexion (implizite Verknüpfungen), Implikation (unausgesprochen mitimplizierte Sachverhalte usw.) und Subjunktion, Präsuppositionen (unausgesprochene Vorwegannahmen), Negation (Ausschluss, Umkehrung) usw.
Linksherausstellung
Rechtsherausstellung
Ellipse
Rekurrenz
Konnexion
Implikation/Präsupposition
Negation/Umkehrung
Passiv
…
Nach der Analyse der Konstruktion eines Segments betrachten wir jedes einzelne Wort für sich in der Semantik-Analyse.
Semantik-Analyse
Hierunter verstehen wir die Analyse der Bedeutung einzelner Worte (Substantiv, Adjektiv, Verben usw.) und ihre Verbindung untereinander (z. B. Oxymoron) im Sprechakt.
Substantiv
Substantivierung
Adjektiv
Adverbien
Partizipien
Präpositionen
Partikel
Verb
Oxymoron
Tätigkeitsverben
Reflexivverben
Kommunikationsverben
Zustandsverben
Verben der Gefühle, Affekte und Empfindungen
Geschehensverben
…
Da in der Beratung jedes dialogische Gespräch auch ein sozialer Austausch der Gesprächspartner in einem spezifischen Kontext ist, können wir die pragmatische Bedeutung von Sprechakten nicht außer Acht lassen. Wenn Ihnen morgens beim Frühstück Ihr Partner oder Ihre Partnerin sagt: Du es ist 10 nach sieben, dann wissen Sie vielleicht auch, dass Sie sich sputen müssen, um den Zug nicht zu verpassen.
(Pragmatik-Analyse)
Unter der Analyse der Pragmatik eines Sprechakts verstehen wir die vom Gesprächskontext abhängige Zweckanalyse eines Sprechaktsegments. Dies ist bei der schriftlichen Analyse eines fremden Gesprächs nur eingeschränkt möglich. Sie erfolgt deshalb bei diesem Modellgespräch nur, wenn sich aus dem Dialoggeschehen und dem Kontext des Gesprächs Hinweise auf eine pragmatische Funktion des Sprechakts nachvollziehbar ergeben.
Da wir in diesem Buch ein in sich geschlossenes Gespräch zur Gänze analysieren, ist es bei mehreren Dialogwechseln möglich, den Verlauf des Gesprächs mit zu kommentieren. Dies hilft auch, den einzelnen Sprechakt an jeder Stelle des Gesprächs besser zu verstehen.
Wie jedes längere Gespräch verläuft auch dieses Gespräch nicht ohne Besonderheiten beim Sprechen. Es kommt zu Sprechstörungen, Pausen usw., die wir ebenfalls als bedeutsame Signale im Erzählfluss verstehen und bewerten müssen.
All dies führt zu einer ungewöhnlich langen Analyse eines vergleichsweise kurzen Gesprächs über ein letztlich triviales Alltagsthema. Sie werden aber schon im ersten Sprechakt überrascht sein, was Sie nach den ersten Analyseschritten entdeckt haben. Sprechakt für Sprechakt, und wirklich bis zum letzten Sprechakt, wird Sie diese Überraschung begleiten.
Und so ganz nebenbei werden Sie neue Analyseschritte kennenlernen und sich in bereits bekannte einüben. Sie werden bereits nach wenigen Sprechakten den nächsten schon ganz anders anschauen, Bekanntes wieder finden und bei neuen Worten neue Entdeckungen machen.
Vor allem aber werden Sie staunend verstehen, wie sich nach und nach ein völlig neues Bild von diesem Gespräch ergibt. Sie werden eine andere Wirklichkeit entdecken, die Sie sich bei der ersten Lektüre des Transkripts zu diesem Gespräch nicht vorstellen konnten. Lassen Sie sich deshalb nicht abschrecken von der Länge dieser Analyse. Niemand erwartet von Ihnen, gleich alles auf einmal zu lesen.
Ich habe in meiner eigenen beruflichen Gesprächsführung bei jedem neuen beruflichen Gespräch erlebt, wie ich aufmerksamer geworden bin, welche Worte mein Gesprächspartner verwendet und wie er seine Sätze bildet und schildert, was er mir mitteilen will. Und ich habe auch gelernt, mehr auf meine eigenen Gesprächsakte zu achten und sie bewusster zu gestalten.
Ich bin sicher, Sie werden schon nach der Analyse des ersten Sprechaktsegments neugierig werden und den Verlauf des Gesprächs mit wachsender Spannung verfolgen. Und so nach und nach wird Ihnen so manche Unbefangenheit abhandenkommen, wenn Sie das nächste Mal im Berufsleben wie im Privatleben ein Gespräch führen. Sie werden mir nachsehen müssen, dass ich mich für diesen Kollateralschaden nicht entschuldigen mag.
Modellgespräch
In der Folge wird Ihnen ein in sich geschlossenes Gespräch vorgestellt. Zunächst finden Sie das wörtliche Transkript dieses Gesprächs. Daran anschließen wird sich die PSA dieses Gesprächs.
Transkript Modellgespräch
A Also bei mir gestaltet sich Vor die Vorweihnachtszeit meistens ziemlich problematisch und des deshalb auch direkt an Weihnachten ist es ist bei uns eine Unruhe drin die äh die die je nachdem den einen oder andern zum Explodieren bringt man muss sich also sehr man muss von vorneherein sehr darauf achten ja das äh Weihnachten selbst verbringe ich im Schwarzwald bei meinen Eltern eigentlich einer schönen Landschaft ruhig ist die Umgebung sehr gefällt mir immer mich freut es immer dass ich da hin fahren kann
B Aber die
A Ich kann mich auch verhältnismäßig gut da ausruhen
B Aber die Unruhe belästigt Dich oder Du fühlst Dich auf jeden Fall durch die Hektik nicht wohl
A Ja ja da bin ich schon das ist man man geht angespannt in die Weihnachtsfeiertage dadurch dass man vorher schon praktisch auch einfach schon überarbeitet ist
B Und die Überarbeitung wird also durch die Feiertage bei Dir keineswegs besser
A Doch doch das ist dann schon das ist dann schon in der Regel so dass das ruhiger ist nur man muss auf den ein das eine oder andere Rücksicht nehmen zum Beispiel dass ich meiner Mutter sehr dann beim Kochen helfe auch dass sie da wenig belastet ist oder mein Vater da ist es auch sehr wichtig dass ich das richtige Geschenk für ihn finde und nicht das verkehrte das könnte ihn zum Beispiel sehr stören das weiß ich aus der Erfahrung heraus wenn man ihm zum Beispiel etwas schenkt was ihm nicht Freude macht oder was oder ein buntes Hemd das in der Farbe ihm nicht passt das kann sehr die die ganzen Feiertage beeinflussen das weiß ich inzwischen und danach richte ich mich oder und dann ist ganz wichtig bei uns dass wir was unternehmen das macht alles auch einfach viel harmonischer dass wir zum Skifahren fahren wenn das Wetter entsprechend ist oder dass wir kleine Wanderungen machen oder äh natürlich auch bisschen Verwandtenbesuch das machen wir immer was gehört auch immer dazu gehört und worüber wir uns alle einig sind das ist Kirchenbesuch das ist so das ist schon im Schwarzwald da ist nichts dran auszusetzen das will einer wie der andere
B Für Dich ist von Bedeutung dass das alles richtig und gut organisiert abläuft
A Vor allem harmonisch organ harmonisch dass es keinen Streit gibt denn dass die Erfahrung habe ich auch schon häufig gemacht das ist einfach dann dass man dass der eine wie der andere zu aufgeregt ist zu schnell aufregt auch über Kleinigkeiten und dann verläuft Weihnachten nicht schön also nicht so wie man wie ich mir es wünsche aber das ist durch man kann da in gewisser Weise habe ich hab ich’s gelernt mich auf das eine oder andere einfach vorzubereiten oder einzustellen so ist das sonst brauch ich nicht nachhause zu fahren sonst sonst gibt’s sonst kann ich sonst brauch ich gar nicht nachhause zu fahren
B Du fühlst Dich durch den Streit beunruhigt
A Ja das würde mich das wären keine schönen Weihnachten das würde ich nicht aber ich fahr wieder so gerne nachhause dass ich äh dass ich das gerne dass ich gerne von vornherein mir überlege wie kann ich das äh was kann ich tun dass ich äh nichts dass sich keine Unruhe ergibt mit den Geschenken da meine Mutter legt sehr großen Wert drauf dass schön geschenkt die ganze Familie mit Sachen die die Freude machen dass ich also äh da geh ich auch insofern auf sie ein und sag gut dann gehen wir mal zum Einkaufen weil sie würde mir nicht deshalb weiß ich auch dass sie mir nicht den richtigen Geschmack findet wenn sie von sich aus mir Geschenke kauft die gefallen mir in der Regel nicht aber ist schon wieder die die Vorweihnachtszeit in der Vorweihnachtszeit ist viel Hektik hier und da das das ist ja das weiß ich auch nicht wie sich das mal ändern könnte
B Du fühlst Dich aber insgesamt wohl in der Vorweihnachtszeit und in Weihnachten
A Vorweihnachtszeit weniger weniger weil äh weil wegen der vielen Hektik aber es hängt auch es hängt von mir selbst ab ich will ja schließlich auch viel Post bekommen oder viel oder freu mich über Geschenke > und umgekehrt muss ich da auch was dazu beitragen ich kann ja nicht nur nicht ohne Gegenleistung da kann ich ja nichts kann ich auch nicht so viel erwarten im Grunde freue ich mich ja darüber aber es bedeutet ja eine Mehrbelastung und Arbeit und und an Weihnachten direkt da will dann aber weniger haben da will ich mich dann auch entsprechend ausruhen da bin ich auch nicht zuhause da bin ich auch nicht im Schwarzwald da bin ich ja in S dann S ist hektisch S ist Stress dann im Schwarzwald ist auch ne andere Umgebung mag auch ne Rolle mit spielen da bin ich auch weniger zu erreichen da ist das echt die richtigen Weihnachten
B Ich hab das jetzt schon richtig verstanden Du verbringst nur die Vorweihnachtszeit
A In S
B Bei Deinen Eltern
A Nein in S
B In S und die eigentlichen Weihnachtstage bei Deinen Eltern
A In der Regel ja meistens meistens wie es auch höchstwahrscheinlich dieses Jahr verlaufen wird.
B Und wie sind Deine Gefühle jetzt in Hinblick auf das diesjährige Weihnachtsfest
A Auf Weihnachten direkt die Weihnachtsfeiertage direkt gut da freue ich mich drauf Vorweihnachten das in der Regel ist da ziemlich Stress dabei ja so wie im vergangenen Jahr wünsch ich es mir eigentlich nicht im vergangenen Jahr wurde ich außerdem auch noch krank ne Erkältungskrankheit und hat das alles auch noch beeinflusst die Vorweihnachtszeit Weihnachten selbst
B War die Krankheit im letzten Jahr wesentlich für
A Ja ja das wars
B Dass Du das Weihnachtsfest nicht so gefeiert hast wie Du es wolltest
A Weihnachtsfest war gut aber die Vorweihnachtszeit dass die dadurch gestört war dass die dadurch beeinflusst war hmhm stimmt hing vielleicht sogar damit zusammen dass ich dass mir alles zuviel wurde und dann war ich auch anfälliger für eine Erkältungskrankheit Erkältungskrankheit war das also schlimmere Erkältung dass ich sogar nicht zum Dienst kam
B Du fühlst Dich durch die Vorweihnachtszeit auf jeden Fall belastet
A Die ja die ja eine Belastung die ich einerseits gern in Kauf nehme man hört so von Vielen von denen letztes Jahr nicht wenig nicht von denen ich nicht höre ich freu mich schon wenn die Post aus allen auch aus allen möglichen Gegenden und auch Ländern zum Teil das ist schon das hat sich so eingespielt und das möcht ich auch gern aufrechterhalten so
B Viel Freude auch dabei
A Doch das Wetter spielt auch eine Rolle im Schwarzwald das kann ich ja nicht beeinflussen
B Das Wetter ist von Bedeutung für Dich
A Hmhm vom Skifahren her von Unternehmungen her
B Waren im letzten Jahr Deine Gefühle nach dem Weihnachtsfest gut
A Alles war gut bis auf ein Erlebnis mit dem Auto zum Schluss zum Schluss kam ich nicht weg ich kam nur am am nach Weihnachten am Dienstag kam ich nur mittags zum Dienst weil mein Auto nicht funktioniert hat weil mit meinem Auto Tamtam war das hat dann hinterher das wars sonst war alles gut sonst wüsste ich nicht dass es Aufregung gegeben hätte sonst sonst ist mir nichts Nachteiliges mehr in Erinnerung jedenfalls so dass ich es ganz gerne wieder so haben möchte machen möchte
Ende
Legende
Ganz allgemein:
Die nachfolgende eigentliche PSA des Modellgesprächs folgt durchgängig einem gleichen Aufbau. Als Erstes wird jeder Sprechtakt, exakt so wie Sie ihn original aus dem Transkript kennen, in einzelne Segmente unterteilt und aufgereiht dargestellt. Jedes einzelne Segment wird dann noch einmal separat präsentiert. Dann erfolgen zu jedem Segment zunächst eine Deixis-Analyse und danach eine Semiotik-Analyse.
Ergänzend werden Prosodie und Sprechstörungen sowie der Sprechaktverlauf und die Gesprächsentwicklung kommentiert. Gelegentliche Hinweise und Erläuterungen zu Fachbegriffen und fachpsychologischen Konstrukten, Theorien usw. vervollständigen die eigentliche PSA.
Im Detail finden Sie als Erstes den segmentierten Sprechakt.
Beispiel:
Sprechakt A1
A
1
00:00 S1
Also bei mir gestaltet sich
00:03 S2
Vor die Vorweihnachtszeit
00:05 S3
Meistens ziemlich problematisch
00:07 S4
Und des deshalb auch direkt an Weihnachten ist es <
…
Um deutlich zu machen, wer spricht, wird jeder Sprechakt gekennzeichnet:
A
Klientin
B
Beraterin
Da Sie nur lesen, was gesprochen wird, finden Sie an manchen Stellen Hinweise darauf, dass Besonderheiten (Kurze Pausen, lauter oder leisere Sprechweise usw.) beim Sprechen auftreten.
_, _ _, _ _ _
Sprechpausen von 1 – 3 Sekunden
>, >> <, <<
erhöhte/verlangsamte Sprechgeschwindigkeit
↓↑
leiser/lauter werdender Sprechton
BETONUNG
prosodische Betonungen in Großschrift
Beispiel:
S8
Man muss sich also sehr _> man muss von vorneherein sehr darauf achten↓_
Damit Sie bei diesem Gespräch den zeitlichen Verlauf nicht aus dem Blick verlieren, finden Sie links vorangestellt einen Hinweis auf die laufende Gesprächszeit mit Minuten und Sekundenangaben 00:00.
Beispiel:
00: 20 S8
Man muss sich also sehr _> man muss von vorneherein sehr darauf achten↓_
Bei den ersten Sprechakten finden Sie diese Zeitangaben zu jedem Segment. Der Übersichtlichkeit willen, finden Sie Zeitangaben später nur noch zu jedem Sprechaktbeginn.
Danach finden Sie zu jedem Segment als Erstes die Deixis-Analyse. Jene Worte, die für die Deixis-Analyse relevant sind, werden mit einem hochgestellten Signierungszeichen versehen.
Beispiel:
Segment S1
A
Also bei mir
PD
gestaltet
ZD
sich
Diese Signierungszeichen machen deutlich, welche deiktischen Verweise in einem Segment auftreten.
Deiktische Verweise:
PD
Persondeixis Hinweise auf Personen
OD
Ortsdeixis Hinweise auf Geschehensorte
ZD
Zeitdeixis Hinweise auf Geschehenszeiten
Beispiel Deixis-Signierung:
Segment 1
A
Also bei mir
PD
gestaltet
ZD
sich
Deixis-Signierung:
PD Ich, mir, mich Hörer wir die, der - alle, man, andere, niemand …
ICH-nah ………………………………………..………………….. ICH-fern
Proximal …………………………………………………………….. Distal
OD hier nah dort, fern - überall, nirgends …
ICH-nah ………………………………………..………………….. ICH-fern
Proximal …………………………………………………………….. Distal
ZD vorher ← jetzt → nachher – andere, immer, manchmal, nie …
ICH-fern ……………………...……..ICH-nah …………………………ICH-fern
Distal . …………………………...…Proximal .……………..………..… Distal
Grau unterlegt wird jeweils, wie die deiktische Einordnung dieses Segments vorgenommen wurde.
Im Anschluss an die Deixis-Analyse jedes Segments erfolgt die Semiotik-Analyse für jedes Segment separat. Hierzu wird jedes Segment noch einmal vorgestellt.
Beispiel:
A
Also bei mir gestaltet sich
Das Segment wird dann auf Merkmale des Satzbaus (Syntax) hin untersucht und jedes Wort wird auf Wortart und Bedeutung (Semantik) hin analysiert.
Beispiel:
Adverb
also
Konnektor
Linksherausstellung
bei mir
Präposition
bei
Verb
gestaltet
transitiv, telisch
Reflexivpronomen
sich
Passiv
Diese Aufstellung mag manchen zunächst an den Deutschunterricht in der Grundschule erinnern. Wie die Worte gestellt sind und welche Worte gewählt wurden, legt jedoch Fährten zu einem weiteren psychologischen Wissen, das sich nicht gleich auf dem ersten Blick erkennen lässt. Genau dies wird anschließend in der semiotischen Analyse gezeigt werden.
Wir wissen bereits, dass es nicht ohne Auswirkung bleibt, an welcher Stelle im Satz ein Wort steht oder ob ein Sachverhalt mit Verben oder mit Partizipien oder Substantiven usw. geschildert wird. Die Information, die wir erhalten ändert sich jedes Mal.
Beispiel:
Das Vieh steht im Stall und brüllt
Das brüllende Vieh steht im Stall
Das Brüllen des Viehs im Stall war bis ins Dorf zu hören
Wie man diese zahlreichen Feinheiten im Satzbau wie in der Wortwahl eines Sprechaktsegments erkennen und analysieren kann, das wird ausführlich in der Semiotik-Analyse dargestellt.
Soweit ein Sprechaktsegment in der sinnhaften Zusammenschau (Kohärenz) mit anderen Segmenten oder Sprechakten, oder vor dem Hintergrund der Gesprächssituation (Kontext) dies ermöglicht, wird dabei auch auf die funktionalpragmatische Bedeutung einer Äußerung (Pragmatik-Analyse) eingegangen.
Allgemeine Gesprächssituation:
Klientin A:
53 Jahre, berufstätig, ledig, keine Kinder, alleinlebend
Beraterin B:
34 Jahre, berufstätig, verheiratet, mit zwei Kindern in ihrer Familie lebend
Ort:
Das Gespräch fand an einem Ort statt, der weder der Wohnort der Klientin ist, noch der Ort, wo sie Weihnachten verbringt.
Dauer:
ca. 10 Minuten
Zeitpunkt:
Das Gespräch fand Ende Oktober statt.
Die hier verwendeten person-, zeit- und ortsbezogenen Angaben wie die Angaben zur Gesprächssituation sind modellhafte Angaben.
PSA Modellgespräch
Sprechakt A1
A
1
00:00 S1
Also bei mir gestaltet sich
00:03 S2
Vor die Vorweihnachtszeit
00:05 S3
Meistens ziemlich problematisch
00:07 S4
Und des deshalb auch direkt an Weihnachten ist es <
00:13 S5
Ist bei uns >> eine UNRUHE drin
00:15 S6
Die <äh _ die _
00:18 S7
Die je nachdem den einen oder andern zum EXPLODIEREN bringt >
00: 20 S8
Man muss sich also sehr _> man muss von vorneherein sehr darauf achten↓_
00:25 S9
_ Ja _ das äh
00:27 S10
Weihnachten selbst _ verbringe ich im Schwarzwald bei meinen Eltern
00:32 S11
Eigentlich in einer schönen Landschaft ruhig ist _ die Umgebung sehr <
00:36 S12
gefällt mir immer > mich freut↑ es immer dass ich da hin fahren kann
Segment S1
A
Also bei mir
PD
gestaltet
ZD
sich
Deixis-Analyse
PD
ich,
mir,
mich
Hörer
wir
die, der – alle, man, andere, niemand …
OD
hier
nah
dort, fern – überall, nirgends …
ZD
vorher
←
jetzt
→
nachher – andere,
immer,
manchmal, nie …
Das Segment bezieht sich persondeiktisch auf die Sprecherin mir und verweist im Präsens gesprochen gestaltet sich zeitdeiktisch auf eine allgemeine Zeit. Im Kontext des Gesprächs, das im Oktober stattfindet, bezieht sich die ZD damit nicht auf die Jetzt-Zeit des Gesprächs, sondern ist allgemein auf ein wiederkehrendes Ereignis gerichtet und muss zunächst als indifferenter zeitdeiktischer Hinweis im Sinne von ‚immer’ oder ‚üblicherweise‘ verstanden werden. Ein einmaliger Zeitraum, gar ein bestimmter Zeitpunkt wird nicht angesprochen.
Eine OD findet sich nicht. Die zum mir gehörende Präposition bei kennzeichnet nur vage persönliche Umstände, die eine konkrete Lokalität nicht erkennen lassen.
Der persondeiktische Verweis mir auf A bleibt schwach und ist nur annähernd proximal, weil er abgeschwächt wird mit der lokalen Präposition bei. Wirkliche deiktische Zentralität mit ICH-Nähe ist damit noch nicht erreicht.
Ohne konkreten ortsdeiktischen Hinweis und bei gleichzeitig indifferentem zeitdeiktischem Hinweis täuscht der abgeschwächte persondeiktische Hinweis mir mehr ICH-Nähe vor, als vorhanden ist.
Tatsächlich oszilliert A in diesem ersten Sprechaktsegment persondeiktisch zwischen einer relativen Nähe und Ferne. Der Sprechakt beginnt persondeiktisch mit einer Annäherung der Sprecherin an sich selbst bei mir, und wendet sich dann aber von der Sprecherin ab.
A spricht eben nicht weiter von sich selbst, schon gar nicht von sich als handelnden Aktanten, sondern sie führt quasi einen weiteren Aktanten ein und spricht dann von dem weiter, was gewissermaßen neben ihr sich gestaltet. A hätte auch sagen können: „Ich feiere Weihnachten bei mir zuhause“.
Ort und Zeit des angedeuteten Geschehens bleiben unerwähnt. Aus einer Außenperspektive schildert A, was außerhalb von ihr bei mir und quasi ohne ihr Zutun geschieht. (vgl.: „Bei mir im Garten, da regt sich was“).
A ist gewissermaßen da, aber nur bei mir (dabei), und sie handelt nicht selbst. Man kann dies als Distanz zum Thema verstehen oder allenfalls als deiktische Annäherung an ein die Sprecherin persönlich betreffendes Thema. Diese Gesprächseröffnung zeugt von einem vorsichtigen Gestaltungsbemühen, das kontrollierte Äußerungen erwarten lässt.
Für B ist dies bereits ein zu beachtendes Signal. Solche Vorsicht bei den ersten Äußerungen verweist auf Vorsicht oder auf Vorbereitung und verlangt von B ein adaptiertes Gesprächsverhalten.
Semiotik-Analyse
Adverb
also
Konnektor
Linksherausstellung
bei mir
Präposition
bei
Verb
gestaltet
transitiv, telisch
Reflexivpronomen
sich
Passiv
A beginnt ihren allerersten Sprechakt, im allerersten Wort überhaupt, mit dem konnektiven Adverb also. Damit schließt A an etwas an, was vorhergegangen sein muss. Wiewohl als Erstes Wort gesprochen, macht also deutlich, dass A schon still mit sich gesprochen hat. Also ist kein totaler Anfang, weil A damit gewissermaßen nur laut weiterspricht.
Dies ist kein spontaner ad hoc Einstieg in das Gespräch. Mit also macht A also (sic!) deutlich, dass sie das Thema des Gesprächs schon im Kopf hatte, wenn sie jetzt anfängt, laut zu sprechen. Wir können erwarten, dass A gedanklich vorbereitet ist. Nicht ausschließbar nur auf das Thema, sondern auch darauf, wie sie es angehen wird. So bestätigt sich in diesem kurzen Sprechaktsegment semiotisch, was sich deiktisch schon angedeutet hat. A hat das Gespräch nicht ohne vorsichtige (vorhersehende) Überlegungen begonnen.
Abgesehen von diesem einleitenden also wird in diesem ersten Sprechaktsegment dieses ersten Sprechakts der Bezug zur eigenen Person an den Beginn des Sprechakts gestellt. Der mit der Präposition bei versehene, persondeiktische Verweis mir wird links vorangestellt und erfährt damit eine doppelte Betonung, weil das mir eine fokussierende Singularisierung auf eine bestimmte Person darstellt. A ist sehr bewusst, dass sie jetzt von sich sprechen wird.
Impliziert ist mit einer solchen hervorgehobenen Singularisierung allerdings auch eine Tilgung, die in der Umkehrung der Präposition bei mir zu „bei anderen“ erkennbar wird. Schon zu Beginn des Gesprächs, mit dem ersten Sprechakt und dem ersten Segment überhaupt, deutet A auch eine mögliche Differenz von sich zu anderen Personen an.
Noch wissen wir nicht, worin sich A von anderen Menschen unterscheiden könnte, doch wissen wir bereits, dass A vorweg eine Differenz markiert. Ob A ihre Situation selbst als ungewöhnlich erlebt, wissen wir auch noch nicht. Vielleicht hat A auch Wissen über B (verheiratet, zwei Kinder) und hegt deshalb eine Differenzerwartung. Manche Menschen kommen auch in eine Beratung und fragen sich schon vorab, ob der Berater ihre Situation überhaupt verstehen kann.
Die Geschehenskennzeichnung erfolgt in S1 zunächst über ein transitives, telisches, also auf ein Ziel oder Ergebnis verweisendes Verb des Schaffens und Handelns gestaltet, das die Veränderung einer Situation erwarten lässt. Das Handlungsverb gestaltet wird hier allerdings an das Reflexivpronomen sich gebunden, ist jedoch selbst kein echtes Reflexivverb (z. B. sich vorsehen).
Wo das Geschehensverb ‚geschieht’ weder auf einen Aktanten noch auf ein Ziel verweist, und nicht einmal an eine Person gebunden ist, verweist das Handlungsverb gestalten auf einen gerichtet handelnden Aktanten, auch wenn es eher das Ergebnis des Handelns, eine Gestalt, anspricht.
Eine proaktiv ‚gestaltende’ Person folgt in S1 jedoch nicht. A beschreibt mit einer Reflexivformulierung gestaltet sich einen Vorgang. Gewissermaßen wird aus einem Handlungsverb ein Geschehensverb gemacht.
Was bei der Wahl eines anderen Verbs zur Geschehenskennzeichnung (geschieht, verläuft usw.) nicht weiter auffallen würde, darf bei einem Handlungsverb gestaltet nicht unbemerkt bleiben: Geschehen kann etwas; gestalten kann nur jemand. Die von A gewählte Reflexivformulierung gestaltet sich lässt somit einen personal gestaltenden Aktanten getilgt. Dass es sich um eine Tilgungstransformation handelt, wird deutlich, weil in diesem Segment ein möglicher Aktant einleitend bereits aufgetaucht ist: mir. Sich selbst schreibt A aber nicht zu, dass sie gestalten würde, weil sich gewissermaßen etwas von selbst nur bei, gewissermaßen neben ihr gestaltet.
Hätte A nicht ein Geschehen bei mir, sondern an oder in ihr selbst beschrieben, würden wir von einem Vorgangsverb sprechen. Vorgangsverben sind jene Verben, die sich nur auf das Subjekt (z. B. eine Person) an dem der Vorgang geschieht, beziehen, ohne dass dieses Subjekt selbst tätig wird. Vorgangsverben beschreiben, was an einer Person selbst geschieht.
In S1 wird A nicht mehr als handelndes oder selbst erfahrendes Subjekt erkennbar. A beschreibt mit gestaltet sich einen quasi autonomen Prozess außerhalb von ihr, ganz so, als verlaufe alles ohne Mitwirkung der Sprecherin. Wer käme da noch auf den Gedanken, dass, was auch immer geschieht, auch von der Sprecherin mitgestaltet sein könnte?
In diesem Sprechaktauftakt taucht die Sprecherin zu Beginn noch auf bei mir, und verschwindet im zweiten Teil dieses kurzen Segments wieder, wenn die Sprecherin aus einem agentiven, telisch gerichteten Handlungsverb durch die Reflexivformulierung sich ein aktantloses Geschehensverb macht.
Dieser Extrahierung eines Aktanten kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu, die in einem Gespräch Beachtung verdient: Die präsente Sprecherin, die hier von sich berichtet, lässt getilgt, was sie selbst tut und spricht erst einmal weiter von dem, was nur bei ihr geschieht.
Agentive, telische, also auf ein Ziel gerichtete Bewegungsverben oder Verben des Schaffens oder Vernichtens von Zuständen implizieren stets die Frage nach der Herkunft einer Handlung und damit auch nach der Verantwortung für eine Handlung.
Wenn in diesem Sprechaktsegment S1 alle personalen Aktanten getilgt werden, dann werden auch Willentlichkeit und Verantwortung für Handlungen getilgt, wie die mit intentionalem Gestalten und seinem Gelingen oder Misslingen verbundenen Bedürfnisse und Emotionen.
So bestätigt sich auch semiotisch die schon deiktisch erkennbar gewordene ICH-Ferne dieser Gesprächseröffnung. Kaum hat A die ersten Worte gesprochen, entfernt sie sich schon wieder von sich selbst.
Exkurs
Wenn wir von Tilgungen sprechen, sollten wir nicht vergessen: Auch ‚tilgen‘ ist ein agentives, telisch gerichtetes Verb des (Ab-, Weg-) Schaffens. Auch das Tilgen wird getan von einer Person. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, wie ich oben formuliert habe:
Original:
Wenn in diesem Sprechaktsegment S1 alle Aktanten getilgt werden, dann werden auch Willentlichkeit und Verantwortung für Handlungen getilgt …
Alternative 1:
Wenn in diesem Sprechaktsegment S1 alle Aktanten getilgt bleiben, dann bleiben auch Willentlichkeit und Verantwortung für Handlungen getilgt …
In meiner Originalformulierung bleibt getilgt, dass ich, Ihr Autor, mit meinem sprachlichen Handeln meinen Sprechakt zwar willentlich so formuliert habe, doch habe ich dabei mit dem hier als Hilfsverb verwendeten werden mit einer Passivkonstruktion im Partizip II werden … getilgt einen Schaffensprozess beschrieben, der mich als Aktanten dieses Tilgens bereits nicht mehr benennt.
In der Alternative 1 bleibt mit dem zustandsorientierten, nicht agentiven Verb bleiben neben dem sprechenden Aktanten auch noch getilgt, dass der Sprecher handelt, wenn er spricht. Aus einem Schaffensprozess werden getilgt verschwindet mit dem Zustandsverb bleiben zusätzlich der sprechende (hier schreibende) Aktant (Autor dieses Textes) und dass er handelt, wenn er sprich, bzw. schreibt. Beschrieben wird mit dem Verb bleiben nur noch ein Zustand, der nicht mehr erkennen lässt, wer (Aktant) mit welchem Handeln (tilgen) etwas getan, formuliert hat.
Wer dies für eine völlig überzeichnete Spitzfindigkeit hält, möge sich an die öffentliche Diskussion über die Äußerungen mancher Politiker (AfD usw.) erinnern. Im günstigsten Fall hören Sie danach allenfalls noch, was der Sprecher angeblich nicht sagen wollte.
Sprechakte, die Zustände beschreiben und nicht mehr erkennen lassen, dass Handlungen und Prozesse zu den beschriebenen Zuständen geführt haben, verweisen oft auf bedeutsame Tilgungen.
Sprechakte, die Handlungen und Prozesse beschreiben und nicht mehr erkennen lassen, dass ein Aktant gehandelt oder mitgewirkt hat, verweisen ebenfalls oft auf bedeutsame Tilgungen.
In besonderem Maße gilt dies, wenn ein Sprecher für ihn bedeutsame Informationen über sich selbst berichtet und dabei weder Handlungen oder Prozesse noch Aktanten benennt. Dann kumulieren Tilgungen.
Ich hätte meinen obigen Satz auch noch ganz anders formulieren können:
Alternative 2:
Wenn A in diesem Sprechaktsegment S1 keinen Aktanten benennt, dann tilgt A willentlich oder nicht auch ihre Verantwortung für ihre eigenen Handlungen …
Bedeutsam werden persönliche Informationen ohne Handlungs- und ohne Aktantenkennzeichnung aber nicht nur, weil sie zu bedeutsamen Tilgungen führen können. Vergessen wir nicht, dass Sprechen in einem Gespräch auch eine Form verbalen Handelns ist. Wer beim Gespräch über sich selbst Zustände schildert und keine Aktanten kennzeichnet, offenbart dabei auch nicht, dass er es ist, der seinen Sprechakt so gebildet hat.
Ich unterscheide deshalb den Akt des Tilgens von seinem Ergebnis und spreche von Tilgungstransformation und Tilgung. Mit Tilgungstransformationen werden Tilgungen geschaffen.
Wichtig ist diese Unterscheidung, weil sie zu der Frage führt, warum sie entstehen.
In meinen obigen Beispielen habe ich sehr bewusst und überlegt unterschiedlich formuliert. Der Unterschied zwischen meinen Tilgungstransformationen werden und bleiben in den ersten beiden Beispielen und der im Sprechaktsegment A1S1 gefundenen Tilgungstransformation der Klientin A gestaltet sich, besteht darin, dass meine verschiedenen Tilgungstransformationen hier überlegt und willentlich für Sie als Leser gesetzt wurden. Die Sprecherin A hat wohl gar nicht bemerkt, dass und was sie gerade tilgt.
Sprechakte überlegt mit Tilgungstransformationen zu gestalten, ist eine Methode, die haben auch Politiker gelernt, und vergessen Sie bitte nicht, auch mancher sonstige Gesprächspartner, dem Sie begegnen könnten. Für Vernehmungsbeamte ist dies eine alltägliche Erfahrung.
Andere Gesprächspartner wie Klienten oder Patienten oder im Alltag merken kaum noch, wie sie ihre Sprechakte bilden. Ihnen ist nicht hinreichend bewusst, wie sie gerade sprechen. Weder ist ihnen bewusst, welche Fährten sie mit Tilgungstransformationen zu Tilgungen legen, noch, was sie dabei erkennen lassen.
Eine solche doppelte Unbewusstheit über den Inhalt der Tilgung wie über den Vorgang der Tilgungstransformation ist im tiefenpsychologischen Verständnis das Kernmerkmal einer Verdrängung. Eine Person, die etwas, z. B. eine belastende, Konflikt geprägte Erfahrung, verdrängt hat, weiß weder um den Konflikt noch, dass sie ihn verdrängt hat.
Wenn wir Tilgungstransformationen als eine agentive Handlung verstehen, dann macht es auch Sinn, sie auf ihre telische Gerichtetheit zu prüfen. Sicher: Wir alle reden auch manches, ohne zu wissen, wie wir es gerade gesagt haben oder ohne gerade ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Auch ist nicht alles, was gesprochen wird, besonders bedeutsam, wie nicht alles, was uns gerade nicht einfällt, verdrängt sein muss. Und schon gar nicht muss jeder Hinweis auf eine Tilgung auf eine krankhafte Störung verweisen. Das, was die Tiefenpsychologie als das psychodynamische ‚Unbewusste‘ bezeichnet, kann auch als momentane kognitive Nichtbewusstheit verstanden werden.
In der beruflichen Gesprächsführung ist es jedoch aus psychologischer Sicht immer sinnvoll, bei Tilgungstransformationen die Sprechhandlung, ihre mögliche Bedeutung und ihre Funktionalität zu bedenken. Manchmal verweisen Tilgungstransformationen auf eine verdeckte Intentionalität oder auf verdeckte psychodynamische Konflikte und Belastungen und manchmal auf beides gleichzeitig.
Tilgungstransformationen können bewusst und willentlich gestaltet werden. Propaganda, politische Äußerungen, Verkaufsverhandlungen, Aussagen in Anhörungen und Vernehmungen usw. sind voll von solchen willentlichen Versuchen, Sprechakte zu gestalten. Ihre Funktion ist durch den Kontext bestimmt und die damit verbundenen Intentionen können analysiert werden.
Tilgungstransformationen können in Sprechakten aber auch unwillentlich entstehen, ohne dass dies dem Sprecher selbst bewusst wird. Intentional, im Sinne bewusster Willentlichkeit einen Zweck erfüllend, sind sie dann nicht mehr. Wohl aber können solche Tilgungstransformationen funktional sein und eine Folge bewirken.
Die Prüfung von Tilgungstransformationen in Sprechakten wirft stets mehrere Fragen auf:
Auf welchen getilgten Inhalt verweist die Tilgungstransformation?
Funktionalität der Tilgungstransformation (Intention, Ursache, Wirkung, Nutzen)?
Willentlich – unwillentlich?
Bewusst – unbewusst?
Verdrängung?
Wenn wir den ersten Satz dieser Klientin Also bei mir gestaltet sich nach diesen Überlegungen noch einmal betrachten, dann können wir bereits resümieren: Angesichts der semantischen Bedeutung des in diesem Segment gewählten Verbs gestaltet wie der Reflexivform sich und dieser deiktischen (persondeiktisch nicht wirklich zentral, zeit- und ortsdeiktisch unbestimmt) und syntaktischen Konstruktion (Linksherausstellung), muss von Tilgungstransformationen ausgegangen werden. Diese können auf getilgt bleibende Belastungen und Befürchtungen und damit möglicherweise auch auf Verdrängungsprozesse verweisen.
Schon nach den ersten drei (3) Sekunden Sprechzeit im ersten Segment des ersten Sprechakts werden noch zwei weitere Informationen erkennbar:
Einmal, dass B noch weitere Aussagen über Differenzerfahrung und vielleicht sogar verdeckte Belastungserfahrungen erwarten kann. Zum anderen, wie die Sprecherin A mit belastenden Inhalten umgeht (Kontrollbemühen, oszillierend).
Selbst wenn B noch nicht weiß, dass in diesem Gespräch auch problematische Erfahrungen zur Sprache kommen, wird diese Möglichkeit bereits jetzt offenbar. Der Umgang mit Belastungserfahrungen und Kontrollbemühen beim Berichten, eventuell sogar mit möglichen Verdrängungsprozessen, verlangt von B bereits jetzt ein besonderes conversonal management. Sie sollte vorgewarnt sein.
Nun kann es uns grundsätzlich nicht überraschen, wenn eine Person nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt. Gerade in beruflichen Gesprächen mit langjährig von Problemen belasteten Klienten wie leidende Patienten kommen die Menschen oft nicht zum Gespräch, um sich rückhaltlos zu offenbaren. Und selbst wenn sie von