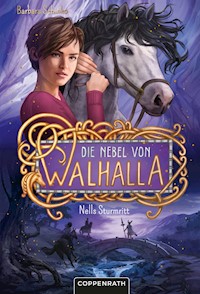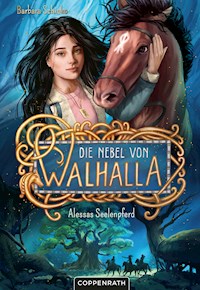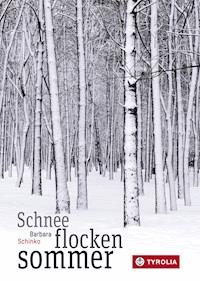2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
American Summer Love: Romeo & Julia in der Wüste von Arizona - fantastisch, gefühlvoll und bezaubernd! Nach drei Jahren kehrt die 17-jährige Faye für einen Sommer in die flirrende Hitze Arizonas zurück. Hier, inmitten von Kakteen, herrscht seit Generationen eine erbitterte Feindschaft zwischen ihrer Familie, den reichen Hillingsleys, und dem mittellosen Farmer-Clan der Crockers. Nie hätte Faye damit gerechnet, selbst in diese Fehde hineingezogen zu werden ... bis sie dem charmanten Chase begegnet. Zwischen ihr und dem gut aussehenden Cowboy funkt es sofort. Doch Chase ist ausgerechnet ein Crocker! Alle Bände der romantischen Reihe "Kiss of your Dreams": -- Kirschkernküsse -- Kolibriküsse -- Cowboyküsse Alle Bände können unabhängig voneinander gelesen werden und haben ein abgeschlossenes Ende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Epilog
Danksagung
Weitere Bücher von Barbara Schinko
Impressum
1. Kapitel
Hinter uns erstreckte sich der Highway ins Unendliche. Wir hatten Apache County erreicht, den nordöstlichsten Teil des US-Bundesstaats Arizona. Weit und breit gab es nichts zu sehen – außer kargem braunem Wüstenboden und den kugeligen Kakteen, die man Teufelsklauen nannte.
Und uns: Zwei siebzehnjährigen Mädchen in einem knallpinken Cabrio.
Meine Freundin Belinda saß am Steuer. Mit der übergroßen Sonnenbrille und dem Seidenschal, der ihre knallrot gefärbte Lockenmähne verbarg, ähnelte sie Susan Sarandon in Thelma & Louise, einem Roadtrip-Movie aus den Neunzigern, das uns gestern Abend einen Vorgeschmack auf die heutige Autofahrt gegeben hatte. Ich saß neben ihr und meine rötlich-blonde Haarfarbe war, im Gegensatz zu Belindas, echt – trotzdem hätte mich niemand für Geena Davis aus demselben Film gehalten. Als Schutz vor dem Fahrtwind trug ich einen Strohhut mit breiter Krempe und Seidenband am Kinn. Er stammte von Mikko Moh, unserem jungen Lieblingsdesigner, doch es war nicht mein allerbester Look.
Belinda warf mir einen abwägenden Seitenblick zu. Verglich sie das Bild, das sie von mir hatte, mit der kargen Wüstenlandschaft? Ein bisschen bereute ich jetzt schon, dass ich sie für den Sommer zu mir nach Hause eingeladen hatte. Belinda kam aus einer anderen Welt, ihre Eltern besaßen ein Penthouse inklusive eigenem Lift in New York City – einer Metropole mit mehr als acht Millionen Einwohnern! Mein Heimatstädtchen Hillings bestand aus ein paar Häusern, keinen Shopping Malls und keinem Broadway, ja, nicht einmal einem Park. An Belindas Stelle hätte ich die Einladung abgelehnt.
»Faye, Darling, ich will meinen Horizont erweitern«, hatte sie mir in einer gedehnten Imitation meines Südstaatenakzents versichert. »Und wer weiß, vielleicht angle ich mir bei euch einen süßen Cowboy oder Indianer?«
»Beides gleich unwahrscheinlich«, hatte ich entgegnet. Nicht weil ich Belindas Flirtfähigkeiten misstraute, sondern weil es in Hillings weder Cowboys noch Indianer gab. Die Pächter unserer Farmen waren alte Männer, sie bauten Bohnen, Kürbisse und Kartoffeln an – was, wie mir Belinda zugestimmt hatte, alles andere als sexy klang. Und obwohl acht von zehn Einwohnern des Apache Countys Indianer waren, lebte kein einziger in Hillings. Außer man zählte die Familie Crocker, in deren Adern angeblich indianisches Blut floss.
»Wie weit noch?«, unterbrach Belinda meine Gedanken.
Durch die Sonnenbrille musterte ich den Highway. Er verlief zu einer Hügelkuppe mit dem Namen The Ridge und führte dahinter in eine Senke, The Dip. Hillings lag am Ende des Dip.
»Wir sind gleich da.«
Belinda trat abrupt auf die Bremse und fuhr rechts ran. Das Motorengeräusch erstarb.
»Bell, was …?«
Sie öffnete die Tür und stieg aus. Ohne den Fahrtwind nahm uns die Nachmittagshitze sofort gefangen. Erbarmungslos brannte die Wüstensonne herab und anstelle des Cabriomotors hörte ich zum ersten Mal seit langem wieder den schrillen Gesang der Zikaden.
Ich verrenkte mir den Hals, um mich umzuwenden. Belinda stand hinter dem geöffneten Kofferraum. »Was tust du?«
»Na, mich frisch machen. Oder glaubst du, ich trete deinen Eltern so unter die Augen?« Theatralisch verzog sie das Gesicht.
War das ein Witz? Bevor ich fragen konnte, beugte sie sich über ihr Gepäck und hielt mir zwei Designerfummel entgegen. »Für den ersten Eindruck: das grüne Kleid oder das weiße?«
»Das weiße – aber willst du dich mitten auf dem Highway umziehen?«
Sie warf mir einen mitleidigen Blick zu. »Darling, wir sind nicht in New York.« Sie hatte recht, statt acht Millionen Menschen umringten uns nur Kakteen und rotbraune Felsen. Trotzdem.
Unbekümmert zerrte sich Belinda ihr pinkes Seidenkleid über den Kopf. Dazu trug sie beige Kalbsleder-Pumps von Mikko Moh, ich die gleichen in Weiß mit einem echt schrägen blau-gelben Spiralmuster. Allein für die Schuhe hatte ich mein monatliches Kreditkartenbudget um zweihundert Dollar überschritten, doch Belinda hatte mir versichert, dass sie es wert waren.
Als ich Mom am Telefon wegen der Rechnung vorgewarnt hatte, war sie weniger begeistert gewesen. Sie hatte mir ihre übliche Predigt gehalten: Mein Bruder Baron und ich müssten den verantwortungsvollen Umgang mit Geld lernen, bla, bla, bla – als würde nicht jeder von uns später halb Hillings erben und nur noch in Tausend-Dollar-Beträgen rechnen! Zum Glück hatten weder Belinda noch Jasper bei dem Telefonat mitgehört. So ein Drama wegen Schuhen im Wert von zweihundert Dollar! Belindas Dad hatte ihr das Cabrio zum Geburtstag geschenkt und nicht mit der Wimper gezuckt, als sie auf weiße Ledersitze und die knallig pinke Speziallackierung bestanden hatte.
Kaum war Belinda in das weiße Kleid (ebenfalls von Mikko Moh) geschlüpft, kreischte sie los: »O mein Gott!«
Ich sprang aus dem Auto und raste zu ihr, weil ich dachte, dass sie womöglich einen Rotweinfleck auf dem Stoff entdeckt oder eine Schlange sie gebissen hatte. Aber sie wies nur auf eine Gruppe von Kakteen.
»Was ist damit?«, fragte ich, bevor es mir klar wurde. Auf dem größten Kaktus wuchsen kleinere und wenn man das Ganze aus genau dem richtigen Blickwinkel betrachtete, wirkte es wie ein sehr stacheliger Hund oder Kojote.
»Ein Chupacabra!«, entfuhr mir.
Belinda starrte mich an. »Chupa-was?«
»Chupacabra. So eine Art Vampirmonster.« Ich fragte mich plötzlich, woher ich das wusste. Von unseren mexikanischen Hausangestellten? Oder von Baron? Er war sechs Jahre älter als ich und hatte es immer geliebt, mich mit Horrorgeschichten zu erschrecken. »Sie sehen aus wie stachelige Kojoten. Sie töten Schafe, Kaninchen, alle möglichen Tiere.« Auch Kinder, doch das verschwieg ich besser.
Belinda lachte und wandte sich ab. »Wir sollten für Jasper ein Foto machen.«
»Von den Kakteen?« Er würde mich garantiert für kindisch halten.
»Nein, Darling, von dir! Ein Modelfoto vor diesem hinreißenden Hintergrund.« Mit einer ausschweifenden Geste wies sie auf die felsige Wüste und zückte das neueste iPhone. »Wie wär's mit dieser Pose: Leg dich auf die Motorhaube.«
»Damit ich wie ein Hühnchen gebraten werde?«, gab ich zurück, obwohl mir der Gedanke, Jasper ein Bild von mir zu schicken, ein wohliges Bauchkribbeln verursachte. Beim Schulball im April hatten wir uns zum ersten Mal geküsst. »Du siehst wahnsinnig sexy aus«, hatte er mir zugeflüstert.
Belinda musste zugeben, dass der Brathühnchen-Look nicht Jaspers Ding wäre. Also lehnte ich mich nur ans Heck des Cabrios und versuchte so wenig wie möglich von dem heißen Lack zu berühren. Belinda erklomm einen Felsen und wackelte gefährlich, während sie mir Anweisungen gab. Ich lächelte in ihre Richtung, raffte den Saum meines Kleids, nahm auf Belindas Befehl den Hut ab und warf den Kopf zurück, sodass meine rotblonden Locken in alle Richtungen flogen. Das Klicken der Kamera verschwamm mit dem Zirpen der Zikaden.
Belinda ließ das iPhone sinken. »Faye, was ist das?«
»Was denn?« Noch ein Kaktusmonster? Ich trat zu ihrem Felsen, aber selbst auf Zehenspitzen erkannte ich nicht, was sie meinte.
»Na, das da. Ich dachte, bei euch gibt es keine Parks? Oder ist das euer Garten?«
Ich kletterte zu ihr und hielt mich an ihrer Schulter fest, um nicht zu stürzen. Von oben sah ich in der Senke das Grün der Orangen- und Zitronenbäume und der Melonenfelder.
Halb sprang, halb stolperte ich vom Felsen. »Das ist die Eden-Farm.«
»Eine von euren?«
Fast alle Farmen in Hillings gehörten meiner Familie. Alle bis auf eine, um genau zu sein.
Ich schüttelte den Kopf. »Erwähn die Eden-Farm bitte nicht vor meinen Eltern.«
»Warum nicht? Steckt dahinter eine Geschichte?« Belinda senkte die Stimme. Sie war in unserer privaten Highschool die Präsidentin des Drama-Clubs und spielte bei allen Theateraufführungen die Hauptrolle. »Mysteriös und tragisch? Vielleicht sogar romantisch?«
»Nicht romantisch«, wehrte ich ab.
Ihr Blick wurde noch erwartungsvoller.
»Die Farm gehört der Familie Crocker. Sie ist nicht groß, aber es ist das einzige fruchtbare Land in der Gegend. Und die Crockers sind nicht mal gute Farmer, sie lassen alles verwildern. Sie könnten viel effizienter arbeiten, wenn sie roden und Spritzmittel verwenden würden.«
Das ungeduldige Wedeln ihrer Hand verriet mir, dass sich Belinda nicht für Landwirtschaft interessierte. »Und was ist daran tragisch und mysteriös?«
»Als mein Ururgroßvater Hillings gründete …«
»Es war einmal. Vor langer, langer Zeit …«, übertönte mich Belinda und grinste nur, als ich sie genervt anfunkelte.
»Vor langer, langer Zeit«, wiederholte ich gehorsam, »bekam er von den Indianern das Land hier geschenkt. Er hatte einen Bekannten namens Crocker. Der wollte ihm die Eden-Farm abkaufen. Mein Ur…«
»…ur…«
»…großvater lehnte natürlich ab. Dieser Crocker war kein Farmer, bloß ein fahrender Schausteller. Er tingelte mit einem Wagen durch die Gegend und pries Wundermittel an. Als ihm mein Ururgroßvater die Farm weder verkaufte noch verpachtete, wurde er sauer und schwor: ›Wenn ich die Eden-Farm nicht bekomme, raube ich dir dein Liebstes.‹«
»Und dann?«, warf Belinda gespannt ein.
»Er entführte die Tochter meines Ururgroßvaters. Oder verführte sie, ich weiß nicht genau. Jedenfalls wurde sie schwanger, was damals ein echter Skandal war, und er wollte sie nur unter der Bedingung heiraten, dass er dafür die Farm bekäme. Er bekam sie. Seitdem herrscht zwischen den Crockers und meiner Familie dicke Luft.«
»Wegen dieser alten Geschichte?« Belinda klang ungläubig.
Ich hatte das Gefühl, uns Hillingsleys verteidigen zu müssen. »Das Land ist wertvoll! Und nein, nicht nur deshalb. Meine Tante Vera-Lynn ist vor ein paar Jahren mit Hitch Crocker davongelaufen.«
Das war ein noch größerer Skandal gewesen als die schwangere Tochter. Mom, Dad und natürlich Tante Vera-Lynns Ehemann, Onkel Tib, hätten am liebsten alles totgeschwiegen, aber der Rest von Hillings hatte mit Begeisterung darüber getratscht. Es hieß, die Crockers wollten etwas von meinem Onkel und er wäre nicht bereit gewesen, es ihnen zu geben. Also habe ihn ihr Fluch getroffen.
Das mit dem Fluch hätte Belinda sicher gefallen, doch ich erwähnte es ihr gegenüber lieber nicht. Es klang einfach allzu sehr nach einem Märchen.
Wir entschieden uns für ein Foto und schickten es Jasper. Belinda legte ihren Schal ab und brachte mit einem batteriebetriebenen Föhn ihre Mähne in Form, während ich meinen Lipgloss erneuerte. Die Eden-Farm lag vor der eigentlichen Stadt Hillings und kaum waren wir über die Ridge und auf dem Weg in den Dip, kam der Rest davon in Sicht: der Trailer unter ein paar Pinyon-Kiefern am Ende des Zitrushains und davor auf der Weide der windschiefe Verschlag für Kühe und Schafe. In den drei Jahren, seit ich das letzte Mal zu Hause gewesen war, hatte sich an dem Anblick nicht viel geändert. Neu war nur der rostige Pick-up hinter dem Trailer.
Onkel Tib würde fluchen. Er nannte schon den Trailer einen »Schandfleck« und hasste Farmer, die ihr Land als Schrottplatz missbrauchten. Besonders wenn dieses gleich neben dem Highway lag und das Erste war, was Touristen von Hillings sahen.
Parallel zur Straße verlief der Weidezaun der Eden-Farm, ein Patchwork aus Stacheldraht, morschen Holzlatten und einem eisernen Tor. Wir waren fast auf dessen Höhe, als ich das Trommeln von Hufen hörte. Ich wandte den Kopf und sah – einen Cowboy! Er galoppierte auf einem gescheckten Pferd über die Weide in unsere Richtung. Statt zu wenden oder vor dem Zaun anzuhalten, spornte er sein Reittier sogar noch an.
Sie sprangen über das hohe Tor, er so tief über den Pferderücken geduckt, dass ich von ihm nur seine Jeans, ein weißes T-Shirt und pechschwarze Haare unter einem dunklen Cowboyhut sah.
Und das Verrückte: In dem Moment, als sie sprangen, tat auch mein Herz einen Satz. Als wäre ich eins mit Pferd und Reiter! Ein Windstoß fegte durch meine Haare. Das Kribbeln in meinem Bauch fühlte sich an wie ein leichter elektrischer Schock.
Hufe klapperten auf Asphalt, dann waren der Cowboy und sein Pferd über den Highway und im kargen Niemandsland zu unserer Linken verschwunden. Ich reckte den Hals und sah ihnen nach, bis der aufgewirbelte Staub sie verschluckte.
Der Wind wurde zu ganz normalem Fahrtwind. Mein Herz schlug wieder im gewohnten Takt. Nur das Kribbeln blieb.
Belinda brach das Schweigen. »Hast du nicht behauptet, es gebe bei euch keine Cowboys?«
Ich riss meinen Blick von der Wüste los. »Es gibt auch keine. Jeder kann einen Cowboyhut tragen!«
»Immerhin ist er ein ziemlich guter Reiter.« Sie klang nachdenklich.
»Woher willst du das wissen?«, entschlüpfte mir. »Du wohnst in New York!«
»Darling, in New York gibt es alles.« Den Satz hatte ich schon oft von Belinda gehört! »Zum Beispiel Reitschulen«, fuhr sie fort und grinste über meine verblüffte Miene. »Ich hatte sieben Jahre lang mitten in Brooklyn Reitunterricht, von meinem sechsten Geburtstag, bis ich dreizehn war. Und glaub mir, an der Reitakademie waren einige gute Springer – aber keiner von denen hätte sich über das Tor gewagt.«
Eine Reitakademie. Mitten in Brooklyn. Wieder einmal war mir nicht klar, ob Belinda mich auf den Arm nahm. Vor allem aber wusste ich genauso wenig wie sie, wer dieser Cowboy in einem Städtchen gewesen war, in dem es keine Cowboys geben sollte. Und warum ich noch immer ein so flaues, kribbeliges Gefühl in mir spürte, als schwirrten tausend Schmetterlinge durch meinen Bauch.
Welcome to Hillings, Arizona. Ich sah das Schild und wies Belinda an, die nächste Ausfahrt zu nehmen. Während ich sie durchs Zentrum lotste, kehrten meine Sorgen zurück. Was würde Belinda von meinem Zuhause halten? Ich war mit vierzehn zuletzt hier gewesen. Den Sommer nach meinem ersten Jahr an der Highschool hatte ich bei meiner damaligen Zimmerkollegin in San Diego verbracht. Und voriges Jahr hatte mich Belindas Familie mit nach Europa genommen. Drei Monate in ihrem Anwesen an der Côte d'Azur – angeblich, damit Belinda und ich dort Französisch üben könnten. In Wahrheit hatten wir die ganze Zeit über in Cannes, Nizza und Monaco Ausschau nach Filmstars gehalten. Belinda schwor, ihr wäre einmal auf dem Weg zur Toilette im Planet Hollywood von Cannes Johnny Depp begegnet, aber das glaubte ich ihr nicht.
Belindas Eltern hatten sehr viel mehr Geld als meine, auch wenn sie mich immer tröstete, es seien »New Yorker Dollars« und man dürfe nicht vergessen, dass dort alles sehr viel teurer war. Ihr Dad hatte mal für die Regierung kandidiert, ihre Mom saß im Vorstand einer internationalen Fast-Food-Kette. Ich wusste, dass Belinda als Kind ihr Au-Pair-Mädchen »Mommy« und den Portier am Empfang des Penthouses »Daddy« genannt hatte, weil von ihren Eltern keiner je zu Hause gewesen war.
Und in New York gab es alles!Beschämt wandte ich mich ab, als wir zwischen den niedrigen, staubigen Holzhäusern hindurchfuhren. Der Supermarkt war zugleich Bank und Apotheke. Beim Kino bewarben vergilbte Plakate die Filme, die ich schon vor einem halben Jahr gesehen hatte. Gegenüber lag die Highschool, ein brauner Backsteinklotz mit Graffitis an den Mauern und einem Basketballplatz, an dessen Körben die Netze fehlten. Obwohl man mit dem Auto nur ein paar Minuten bis zu unserem Anwesen brauchte, hatten Mom und Dad keine Sekunde daran gedacht, mich oder Baron hierherzuschicken. Niemand, der Geld hatte, ging in Hillings zur Schule.
Wir bogen in die Hillingsley Palace Road ein. Mein Urgroßvater, der Sohn des Siedlungsgründers, hatte unser Haus in den Zwanzigerjahren ein wenig außerhalb der Stadt errichten lassen. Wegen seiner extravaganten, mit fossilem Holz verkleideten Fassade hatten es die Stadtbewohner Hillingsley-Palast getauft. Die Vertäfelung gab es längst nicht mehr, doch der Name war geblieben.
Kurz vor der Zufahrt zum Anwesen befand sich neben der Straße ein Teich. Er war mit blühendem Laichkraut überwuchert und völlig verschlammt. Aber derzeit reichte der Pegelstand noch für die Bewässerung unseres Gartens. Der Rasen entlang der Zufahrt strahlte so grün wie die Felder der Eden-Farm. Die Seidenakazien blühten pink, die Magnolien schneeweiß und lila und die Kronen der beiden hohen Tipubäume sahen aus wie mit Goldschmuck behangen.
Ich dirigierte Belinda zum Carport neben der Garage. Ein Tor stand offen, ich sah Moms und Dads Cadillacs und den alten Hummer – nur Barons importierter Porsche fehlte. Kein Wunder, mein Bruder hasste die Sommerhitze in Hillings. Er verbrachte seine College-Ferien viel lieber in der Blockhütte unseres Großvaters beim Becker Lake, wo man fischen, jagen und ungestört Partys feiern konnte.
Belinda stellte den Motor ab. Ein letzter rascher Blick in den Spiegel. Wir stiegen aus und kaum berührten meine Absätze die Steinfliesen, kaum atmete ich den süßen Duft der Magnolien ein, durchfuhr mich die Erkenntnis wie ein Blitz: Ich war zu Hause.
»Nette kleine Hütte«, kommentierte Belinda, als wir unter dem Dach des Stellplatzes hervortraten.
»Was meinst du mit ›klein‹? Und mit ›Hütte‹?« Zu spät bemerkte ich ihr Grinsen.
Der Hillingsley-Palast sah nicht mehr aus wie in den Zwanzigern. Mein Großvater hatte die Holzverkleidung der Fassade durch eine griechisch inspirierte Säulenfront ersetzt. Mom und Dad hatten das von ihm hinzugefügte Türmchen wieder wegreißen und das gesamte Obergeschoss erneuern lassen.
Ich wies auf eines der Fenster. »Dort wohnst du. Mein Zimmer liegt gleich nebenan. Und weil mein Bruder nicht da ist, haben wir das Stockwerk für uns allein.«
»Perfekt. Das heißt, wir feiern drei Monate lang eine Pyjamaparty?«, zog Belinda mich auf. Ein Witz? Oder plante sie wirklich, den ganzen Sommer im Negligé abzuhängen? Vermutlich würde sie damit sogar durchkommen. Mom und Dad wagten sich nie ins Obergeschoss. Wir bräuchten also nur die Hausmädchen zu bestechen …
Die Stufen der Veranda knarzten leise. Wie immer. Die hohen, schmalen Fenster zu beiden Seiten der Haustür waren mit weißen Rollläden verhangen. Obwohl ich einen Schlüssel hatte, klingelte ich. Es fühlte sich richtig an.
Während wir warteten, drehte ich mich zur Seite und sah über die Oleanderhecke, die das Haus von der Straße abschirmte. Die öde, staubige Wüste dahinter zog sich bis zu den ebenso schmutzigen Häusern und vereinzelten Neonschildern von Hillings. Der Garten mit seinem satten grünen Rasen und den duftenden, blühenden Bäumen war ein privates Paradies, unser eigenes Eden. Nie zuvor war mir aufgefallen, wie sehr mein Zuhause und die Farm der Crockers einander ähnelten.
Schritte näherten sich, die Tür schwang auf. Ich wandte den Kopf und blickte in ein sehr vertrautes, sonnengebräuntes Gesicht.
Schwarze Augen musterten erst mich, dann Belinda. Die plumpe, ältliche Mexikanerin in einem geblümten Kleid runzelte die Stirn, als wisse sie nicht, welche der beiden Rothaarigen die Tochter des Hauses war.
Ihr Blick blieb an mir hängen und ein Lächeln erschien. »Buenas tardes, Miss Faye. Du warst lange fort.«
»Buenas tardes, Lupe.« Guadelupe war unsere Perle und so etwas wie der gute Geist des Hauses. Als Kind hatte ich Mühe gehabt, ihren Namen richtig auszusprechen, deshalb hatte sie mir erlaubt, sie einfach »Lupe« zu nennen. Und dabei war es geblieben.
»Bell, darf ich dir Guadelupe, unsere Haushälterin, vorstellen? Und Lupe, das ist meine beste Freundin und Zimmerkollegin an der Highschool, Belinda d'Argento-Travers.«
»Buenas tardes, Miss Bell«, begrüßte Lupe sie herzlich.
Das »Miss Bell« war sicher gut gemeint, trotzdem zuckte ich zusammen. Würde sich Belinda durch die mangelnde Förmlichkeit beleidigt fühlen? Ich öffnete den Mund, aber sie war schneller.
»Buenas tardes, Lupe«, erwiderte sie mit einem Südstaaten-Akzent, der exakt wie meiner klang. Zu Beginn unserer Freundschaft hatte sie fast einen Monat damit verbracht, mich beim Sprechen zu studieren – für ihre spätere Bühnenkarriere.
»Wie geht es dir, Lupe?«, warf ich hastig ein. »Und wie geht es Fernando?« Lupes Enkel, den ich als Kind immer nur »Do« genannt hatte, war ein Jahr älter als ich. Sie ließ keine Gelegenheit aus, von ihm zu erzählen.
Lupe strahlte. »Gut, sehr gut, Miss Faye! Fernando ist hier. Er wird sich freuen, dass du nach ihm gefragt hast.« Ein spitzbübisches Lächeln erschien auf ihren Lippen. Als Zehnjähriger war Do in mich verknallt gewesen und Lupe hatte ihn sogar beim Planen unserer Hochzeit ertappt. Erst Jahre später hatte sie mir das gebeichtet.
»Er ist hier? Lebt er nicht bei deiner Tochter in Kalifornien?«
»Sí, sí. Nur für den Sommer. Er arbeitet auf der Pine-Cone-Farm.« Sie rieb Daumen und Zeigefinger aneinander. »Muss Geld verdienen. Schule ist teuer.«
Die Farm war eine der unseren. Do würde den Sommer mit der Aufzucht von Piniensetzlingen verbringen und ich beneidete ihn nicht. Mein Bruder Baron hatte mit siebzehn beschlossen, die Schule zu schmeißen und Holzfäller zu werden; daraufhin hatte Dad ihn für eine Woche als Aushilfe auf die Pine-Cone-Farm geschickt. Schon nach drei Tagen war Baron reumütig zurückgekehrt. »Nie wieder Pinien. Ich hasse Bäume«, hatte er noch Monate später gestöhnt.
»Sind meine Eltern da?«
»Sí, Miss Faye. Sie erwarten euch im Salon.«
Unauffällig sah ich mich um, als Lupe uns am Speisezimmer vorbei durch den langen Flur führte. Die cremefarben gestreiften Tapeten waren neu – Mom hatte sie beim Skypen mal erwähnt – und ebenso die Bilder: Aquarelle in Orange-, Grün- und Purpurtönen.
Der Salon mit seinen dicken Teppichen sah dagegen aus wie immer, auch die Gemälde waren dieselben: Werke indianischer Künstler aus den umliegenden Reservaten. Meine Eltern saßen am Mahagonitisch. Mom sprang auf, als wir das Zimmer betraten. Sie umarmte mich und drückte mir ein Küsschen auf jede Wange, während sich Dad schwerfälliger erhob.
Belustigt musterte er Belinda, dann mich. »Und welche rothaarige Schönheit ist nun meine Tochter?«
»Christopher!«, ermahnte ihn Mom. Sie nannte Dad als Einzige bei seinem vollständigen Vornamen und das auch nur, wenn er irgendwo aneckte. Für alle anderen, sogar für seine Anwaltskollegen und Klienten, hieß er immer »Kip«.
Dad fuhr sich durch die schütteren rotblonden Haare. »Willkommen in unserem bescheidenen Heim«, wandte er sich an Belinda. »Faye hat uns schon viel von dir erzählt und ich hoffe, du fühlst dich bei uns wie zu Hause.«
Ihr Seitenblick auf mich war argwöhnisch, bevor sie ihr strahlendstes Lächeln aufsetzte und sich für die Einladung bedankte. Dad übertrieb maßlos, ich hatte ihm kaum etwas über Belinda erzählt. Aber natürlich wusste er, wer sie war und vor allem, wer ihre Eltern waren. Genau deshalb hatte er mich schließlich auf eine private Highschool geschickt – damit ich Kontakte knüpfen konnte.
Wir machten Smalltalk. Wie war die Fahrt? Verbrachten Belindas Eltern diesen Sommer in New York oder an der Côte d'Azur? Baron schickte seine lieben Grüße, ebenso Onkel Tib, der zum morgigen Willkommensdinner eingeladen war.
»Ich hoffe, du magst Austern und Garnelen«, wandte sich Mom an Belinda – als hätte sie mich nicht schon am Telefon nach Belindas Lieblingsspeisen befragt und als wären Meeresfrüchte etwas, das man seinen Gästen hier in der Wüste ganz selbstverständlich servierte. Ob unsere Köchin Mercedes wusste, woran man frische Austern erkannte, geschweige denn, wie man sie zubereitete? Eine Lebensmittelvergiftung wäre sicher kein guter Start für Dads geschäftliche Beziehungen mit den d'Argento-Travers'.
***
Nach einem frühen Abendessen zogen sich Mom und Dad in den Salon und wir uns ins Obergeschoss zurück. Belinda folgte mir in mein Zimmer und sank aufs Bett.
»Was genau hast du deinem Dad über mich erzählt?« Sie drapierte ihre langen Beine in einer Modelpose.
»Ach, fast nichts«, tat ich ahnungslos. »Nur dass dein Spitzname Hell's Bells ist, du beim Schulball mit Oliver Livingstone und mit Sloane Leighton geknutscht hast und ein Tattoo auf der linken …«
Wenn Blicke töten könnten, wäre ich glatt aus den Pumps gekippt.
»Gar nichts, großes Ehrenwort«, versicherte ich ihr. »Dad wollte bloß Eindruck schinden, weil er weiß, wer deine Eltern sind.«
Sie nahm das als Erklärung hin und schien besänftigt.
»Dein Onkel Tib, der morgen kommt – ist das der, dessen Frau weggelaufen ist?«, wechselte sie das Thema.
Als ich nickte, wurde ihr Lächeln schelmisch. »Darf ich ihn fragen, wie es ihr geht?«
»Nur, wenn du gleich wieder nach Hause fahren möchtest«, warnte ich sie. Was Tante Vera-Lynns Verschwinden anging, verstand mein Onkel keinen Spaß.
Sie lachte. »Sonst noch Themen, die ich meiden sollte, damit mich deine Eltern nicht auf die Straße setzen?«
»Die Eden-Farm. Und die Familie Crocker.« Onkel Tib verglich Letztere gern mit kläffenden Kötern, die einem Mann ans Bein pinkeln wollten. Meine Familie hatte Bürgermeister, Schul- und Stadträte hervorgebracht; Old Walker Crocker, der Inhaber der Eden-Farm, war in seiner Jugend ein Wanderprediger gewesen und sein Sohn Hitch hatte als Stunt-Reiter beim Zirkus gearbeitet.
»Ach ja: Und frag nicht, wann mein Bruder endlich seinen Abschluss macht«, fiel mir noch ein. Trotz Dads Einflussnahmen war Baron auch an seinem dritten College weit davon entfernt, die nötigen Kurse zu schaffen. Mein Onkel nannte ihn einen »Dummkopf« und manchmal sogar »schwachsinnig«, aber ich war mir sicher, dass sich Baron bloß so dumm stellte. Er liebte Partys und seine Studentenverbindung und hatte schlicht und einfach keine Lust, in Dads Kanzlei einzutreten.
Ich auch nicht, doch mir blieb es zum Glück erspart. Die Anwaltskarriere war in meiner Familie Männern vorbehalten. Ich würde natürlich auf ein Elite-College gehen, aber ich konnte studieren, was ich wollte – sogar Englisch, Literatur oder Philosophie –, denn mein späterer Job bestünde darin, mein Anwesen samt dem Haus- und Gartenpersonal zu managen, Smalltalk mit Besuchern zu machen und nebenbei so wie Mom und Tante Vera-Lynn im Vorstand irgendwelcher Wohltätigkeitsvereine zu sitzen.
Und möglichst nicht mit einem Mitglied der Familie Crocker durchzubrennen.
»Erde an Faye!« Eine perfekt manikürte Hand wedelte vor meinen Augen. »Was machen wir jetzt?«
»Äh, schlafen?« Es war kurz nach neun. »Oder fernsehen«, bot ich an. Beides klang gleich lahm, aber viel mehr gab es hier nicht zu tun. »Ich habe dich gewarnt: kein Broadway, keine schicken Restaurants und keine Clubs.«
Das trug mir einen ungläubigen Blick ein. »Du meinst, ganz Hillings hockt um neun vor der Glotze und geht dann ins Bett? Irgendwas muss hier doch los sein.«
»Im Stadtzentrum gibt es ein paar Bars.«
»Aber?«
»Wir gehen da nicht hin.« Die Menschen dort seien nicht der passende Umgang für uns, predigte Dad immer. Baron hatte sich mal in ein Lokal geschlichen und dafür Hausarrest bekommen.
»Weil?«
»Weil die Leute dort nicht der passende Umgang für uns sind?« Ich klang wie ein kleines Mädchen und hätte im Boden versinken können.
Belinda hielt meine Worte zum Glück für einen Witz. »Umso besser. Denk dran, du hast mir einen Cowboy oder Indianer versprochen.«
»Habe ich nicht«, hielt ich dagegen – aber sie sprang vom Bett.
»Worauf wartest du? Schwingen wir das Lasso, fangen wir uns einen Cowboy!«
Es war zwecklos mit Belinda zu diskutieren, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. »Meine Eltern -…«, versuchte ich es dennoch. Und verstummte. Falls sie uns erwischten, könnte ich sagen, Belinda habe auf den Barbesuch bestanden. Mom hielt große Stücke auf Gastfreundschaft und Dad würde nicht wollen, dass ich seine Chance auf eine Geschäftsbeziehung mit Belindas Familie ruinierte.
»Okay«, gab ich auf. »Wir müssen aber leise sein.«
Belindas Augen funkelten. Heimlich in eine Bar zu schleichen war noch besser, als einfach nur auszugehen.
»Wir brauchen passende Outfits«, beschloss sie. »Was trägt man bei euch?«
»Woher soll ich das wissen?« Ich duckte mich unter ihrem vernichtenden Blick. »Flanellhemden?«, riet ich ins Blaue.
»Und sonst?«
»Keine Ahnung, ich war seit drei Jahren nicht hier!« Das genügte ihr nicht. »Was man eben in einer Kleinstadt so trägt: spießige Klamotten, die irgendwann modern waren.«
Prompt befahl mir Belinda, mein Gepäck nach entsprechenden Klamotten zu durchsuchen. Als ob ich so was besitzen würde. Sie schlich theatralisch auf Zehenspitzen zur Tür, wandte sich um und warf mir einen Verschwörerblick zu, bevor sie im Flur verschwand.
Halbherzig durchstöberte ich meinen Schrank. Unser Hausmädchen Flores hatte meine Koffer ausgepackt, aber die einzigen Klamotten, die für eine Bar in Hillings infrage kamen, waren ein Jeans- und ein kariertes Gingham-Kleid.
Gerade als ich mich für Ersteres mit dazu passenden Riemchensandalen entschieden hatte und diesen Look im Spiegel betrachtete, kehrte Belinda zurück.
»Ta-daa!« Sie warf sich in Pose. Mit den superknappen schwarzen Hotpants wäre sie in jeder Bar der Hingucker – auch ohne die Karobluse, die sie unter der Brust so gebunden hatte, dass ihr ganzer Bauch frei lag. Hohe Reitstiefel vervollständigten das Outfit.
Ich glotzte. »Woher hast du …?«
»Darling, ich sagte doch: sieben Jahre Reitunterricht. Natürlich habe ich die Stiefel dabei. Und da dachte ich beim Einpacken, warum nicht auch gleich mein Show-Cowgirl-Outfit?«
»Aus welcher Show?« Belinda war mal Statistin in irgendeiner Broadway-Produktion gewesen, doch sie lächelte nur geheimnisvoll und bewunderte sich in meinem Spiegel.
»Du hast nicht zufällig einen Cowboyhut? Oder ein Lasso?«
»Nein! Gehen wir bitte«, flehte ich, bevor sie auf weitere Ideen kommen konnte.
Wir schlichen aus dem Zimmer, über die Treppe und durch die Hintertür. Von dort war es nicht weit zum Carport, trotzdem klebte mein Blick am Haus, während Belinda den Motor startete. Jemand musste uns gehört haben! Mom oder Dad würde herbeistürmen und …
Niemand kam.
Wir fuhren los und als wir bei der Oleanderhecke auf die Straße bogen, stieg ein Kichern in mir hoch. Zum ersten Mal in meinem Leben verstand ich, warum mein Bruder andauernd die Regeln unserer Eltern brach. Nie zuvor hatte ich mich so wagemutig, so frei gefühlt!
Das schwindelige Freiheitsgefühl hielt bis zu den ersten Häusern von Hillings. Dann stürmten mit jeder Sekunde neue Sorgen auf mich ein. Was, wenn wir in eine Barschlägerei gerieten? In eine Drogenrazzia? Wenn die Cops unsere Ausweise verlangten? Wenn mich einfach so jemand erkannte – eine von Moms Wohltätigkeits-Freundinnen, einer von Dads Klienten?
Belinda fuhr langsam, fast Schritttempo. Ich sah zwei, drei Bars, aber ich wies sie nicht darauf hin. Die Häuser wirkten in der Dunkelheit noch heruntergekommener als bei Tageslicht. Von allen Schildern blätterte die Farbe ab oder die Neonbuchstaben flackerten. Auf dem Gehsteig vor dem letzten Lokal stritt ein betrunkenes Pärchen.
Belinda sah zu mir, doch ich schüttelte den Kopf.
Ein Schild zog vorbei. You are leaving Hillings. Come back soon!
Belinda brach das Schweigen. »Wenn du nicht willst …« Sie hielt mich für feige. Sie hatte ja auch recht.
»Nein, nein«, log ich. »Ich suche … Da ist es!« Knallrot leuchtete der Neonschriftzug BAR durchs Dunkel. Hier draußen gab es nicht mal mehr Straßenlaternen und das Holzgebäude, das ein wenig nach zu groß geratener Blockhütte aussah, hob sich nur als Schatten von der Wüste ab. Ich konnte mich nicht erinnern, es jemals schon bemerkt zu haben.
Umso besser. Mit etwas Glück wüsste hier niemand, wer ich war.
Belinda bog auf den Parkplatz und lenkte das Cabrio in eine Lücke zwischen einem alten Ford und einem noch älteren, total verbeulten Pick-up einer undefinierbaren Marke. Wir stiegen aus. Unter dem neonroten BAR auf dem Dach hing über der Tür ein weiteres gemaltes Schild. Zwei Scheinwerfer beleuchteten den Schriftzug Desert Bar und ein grinsendes Skelett, das durch die Wüste ritt.
»Bitte sehr.« Ich versuchte mutig zu klingen. »Sieht das etwa nicht nach Cowboys und Indianern aus?« Das Skelett trug sogar den passenden Hut mit breiter Krempe.
Belinda musterte mich zweifelnd, doch sie stieß die Tür auf – eine dieser zweiteiligen Saloontüren, die beim Öffnen gefährlich hin und her schwangen. Hastig schob ich mich hinter Belinda durch. Laute Rockmusik dröhnte uns entgegen. Vorn bei der Bar saßen ein paar ältere Männer und Frauen an billigen Plastiktischen, im hinteren Teil des Raums scharten sich die Gäste um zwei Pooltische und eine Dartscheibe. Auch eine alte Jukebox stand dort.
Belinda hielt auf die Theke zu und schenkte dem Bartender ihr breitestes Lächeln. Er war etwa in Barons Alter, Mitte zwanzig.
»Ein Gläschen Rotwein bitte. Für meine Freundin das Gleiche. Cabernet Sauvignon, wenn du ihn dahast.« Ihre perfekte französische Aussprache schien den Bartender nicht zu beeindrucken. Angesichts seiner strähnigen blonden Haare und des fleckigen grünen T-Shirts, auf dem WHATEVER, DUDE stand, bezweifelte ich, dass er die Worte »Cabernet Sauvignon« schon mal gehört hatte.
Sein Blick glitt von Belindas knallrotem Lippenstift zu ihren Hotpants. »Uh-uh. Und ich schätze, du bist einundzwanzig.«
Sie kramte in ihrer Geldbörse. »Willst du meinen Ausweis sehen?«
Als er nickte, schob sie ihm einen gefalteten Hundert-Dollar-Schein über die Theke.
»Gratuliere zum einundzwanzigsten Geburtstag.« Der Bartender steckte das Geld in eine Tasche seiner Cargoshorts und wandte sich ab. Ich sah nicht, was er tat, hörte nur das Klirren von Gläsern, bevor er sich bückte und erst irgendwelche Kisten am Boden, dann den Kühlschrank hinter der Theke öffnete. Belinda hob eine Augenbraue.
Nach einer Weile drehte er sich wieder um. In einer Hand hielt er zwei Cognacgläser, in der anderen eine Weinflasche ohne Etikett. Er schenkte uns Rotwein ein, behauptete frech »Das macht neun Dollar« und reichte uns die Gläser tatsächlich erst, als ihm Belinda einen weiteren Schein gab.
Wir hatten es eilig, wegzukommen. Ich hielt auf einen der Tische zu, doch Belinda packte mich am Arm.
»Willst du nicht …?«
»… zu den alten Knackern? Nein danke.« Sie zog mich in den hinteren Teil des Raums. Hier war es erstaunlich ruhig – die Musik kam nicht von der Jukebox, diese diente offenbar nur als Deko – und auch nicht so schummrig wie vorn. Belinda lehnte sich an den Musikautomaten. Ich ahmte ihre Pose nach und schnupperte argwöhnisch an meinem Wein, der so gar nicht wie Cabernet Sauvignon roch.
»Hey, du Hübsche!« Erschrocken riss ich den Kopf in die Höhe. Aber natürlich galt die Anrede Belinda. Ein blonder Mittzwanziger baute sich vor ihr auf. Er trug einen Overall, als käme er gerade von einer Baustelle oder vom Feld. Wenigstens das um die Hüften gebundene Flanellhemd hatte ich richtig erraten.
»Hab dich noch nie gesehen. Neu hier?«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht«, erwiderte Belinda mit einer perfekten Imitation meines – und seines – Akzents. Sie nickte in Richtung der Pooltische, ließ dabei ihre rote Mähne fliegen. »Du spielst?«
»Klar.« Der Typ grinste. »Nur leider verlässt mich gerade mein Glück. Glaubst du, es würde helfen, wenn mir die Glücksfee über die Schulter guckt?«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht.«
Er lachte und bot ihr seinen Arm an. Belinda zögerte und ruckte mit dem Kinn in meine Richtung. Erst als ich den Daumen hob, um ihr zu zeigen, dass es okay war, ließ sie sich davonziehen.
Allein nippte ich an meinem Garantiert-kein-Cabernet-Sauvignon und sah den Poolspielern zu.