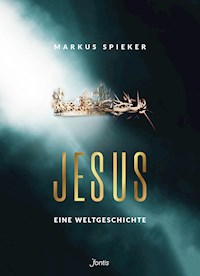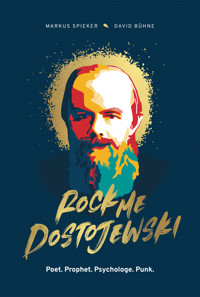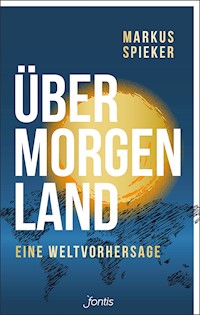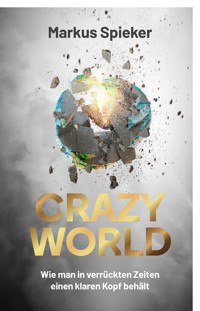
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In „Crazy World“ gibt Markus Spieker 21 Lektionen für Resilienz und Orientierung in der Zeitenwende – ein kluger Leitfaden für Wandel, Krise und Neubeginn. Die Welt ist aus den Fugen geraten – wütender, nationalistischer, chaotischer. Unsere vertraute Ordnung zerfällt und wir stehen vor Jahrzehnten der Krise. Doch mitten im Sturm lauern auch Chancen! Bestsellerautor und ARD-Journalist Markus Spieker hat den Wandel in «Übermorgenland» vorhergesagt – jetzt zeigt er, wie wir mit ihm umgehen. Statt im sicheren Zoo leben wir nun in der Wildnis: riskanter, aber auch freier. In 21 kraftvollen Lektionen liefert Spieker eine Strategie für das Überleben in der neuen Welt. Basierend auf persönlichen Erfahrungen, psychologischen Erkenntnissen und bewährtem Geschichtswissen entwirft er eine Roadmap für kluge Anpassung, Resilienz und Erfolg. Ein Buch für alle, die sich nicht treiben lassen, sondern das Chaos meistern wollen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus SpiekerCrazy World
www.fontis-verlag.com
Für meine Nichten Anna, Charlotte, Marie, Miriam, Persis, Priska und für meine Neffen Amos, Boas, Elias, Joel, Jonathan, Jonathan Alexander, Josias, Josua, Lukas, Noah, Silas, Simeon:
Die Welt ist verrückt.Lasst euch nicht anstecken.
Markus Spieker
CRAZYWORLD
Wie man in verrückten Zeiten einen klaren Kopf behält
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Der Fontis-Verlag wird von 2021 bis 2025vom Schweizer Bundesamt für Kultur unterstützt.
© 2025 by Fontis-Verlag Basel
Fontis AGSteinentorstr. 234051 [email protected]
Verantwortlich in der EU:Fontis Media GmbHBaukloh 158515 Lü[email protected]
Umschlag: Carolin Horbank, LeipzigBildnachweis Umschlag: © Sergey Nivens – stock.adobe.comE-Book-Vorstufe: InnoSET AG, Justin Messmer, BaselE-Book-Herstellung: Textwerkstatt Stefan Jäger
ISBN 978-3-03848-491-2
Inhalt
Titel
Impressum
Prolog – Operation «Klarer Kopf»: Wie man in 21 Schritten über das Chaos hinauswächst
Erste Etappe: GET REAL! Die Welt verstehen
21 Die Welt geht unter. Lass sie.
20 Keine Angst vor künstlicher Intelligenz. Eher schon vor natürlicher Blödheit.
19 Black Rainbow: Sei wach, nicht woke – aber auch nicht reaktionär.
18 Lazy World: Die Masse macht’s eben doch.
17 Trau keinem über A13. Trau dich.
16 Vertrauen ist Chefsache: Die 3C-Regel
15 Küss mich, Krise! Abbruch zu neuen Ufern
Zweite Etappe: GET TOUGH AND GET TOGETHER! Den Standort verbessern
14 Jajaja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt … Leitkultur Leistungskultur
13 Go Home: Liebling, ich habe das Sozialkapital geschrumpft.
12 Aristodiakonie: Suchet der Stadt Beste.
11 Go East: Im Westen nichts Neues – im Osten schon
10 Go Back: Erst zurück, dann in die Zukunft
9 Die Kirche und die Zukunft: Mit 66 ist hoffentlich noch lange nicht Schluss.
8 Aus «frei» mach «neu»: Warum wir uns erst losreißen müssen, bevor wir aufbrechen.
Dritte Etappe: GO DEEP, GET HIGH! Uns selbst verändern
7 Ambivalenztoleranzkompetenztraining: Die Weisheit ist ein Trampolin.
6 D-Übungen: Das richtige Maß finden
5 Geh nicht aufs Ganze – Geh aufs Gute!
4 Du musst kein Held oder Heiliger sein. Wär’ aber schön.
3 Größtes Kino: Wie man sich in unsicheren Zeiten unzerstörbar macht
2 True Love Stays: Über die Liebe, die wir brauchen
1 Team Hoffnung: Ewig währt am längsten
Epilog: Lage, Lage, Lage – Auf das Umfeld kommt es an.
Anmerkungen
Personenregister
Prolog
Operation «Klarer Kopf»: Wie man in 21 Schritten über das Chaos hinauswächst
Der Kluge tut gleich anfangs,was der Dumme erst am Ende tut.Der eine und der andere tun dasselbe,nur in der Zeit liegt der Unterschied:Jener tut es zur rechten, dieser zur unrechten Zeit.
Balthasar Gracián, Der Held
«Die Welt dreht durch.»
Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Monaten diesen Seufzer von mir gegeben habe.
Wahlweise auch: «Alle irre!» – «Die haben sie nicht alle!» – «Darf nicht wahr sein!» – «Komplett gaga!» – «UN-FASS-BAR!!!»
Aber vielleicht ist es nicht die Welt, die am Rad dreht, sondern ich selbst? Bin ich zu wenig resilient, zu dick in Watte gepackt, von jeder Mikroaggression leicht aus der Fassung zu bringen?
Generation Selbstbezogen, Generation Wohlstandsverwöhnt, Generation Überempfindlich, Generation Mimimi.
Da könnte was dran sein.
Ich bin gelernter Historiker. Mir ist klar: So viel Grund zu meckern haben wir gar nicht, jedenfalls nicht im Vergleich mit unseren Vorfahren.
Man muss nur ein halbes Jahrhundert zurückgehen. Ins Jahr 1975: Alles «happy-go-lucky»? In vielen Teilen der Welt galt da schon eher «no-luck-at-all».
Meine älteren Leser erinnern sich vielleicht: Deutschland war geteilt und der Westen vom RAF-Terror heimgesucht. In Europa waren Hunderte Millionen Menschen hinter dem Eisernen Vorhang eingesperrt. In China fraß Maos Kulturrevolution Kinder und Eltern. Der Krieg in Vietnam ging zu Ende, und im benachbarten Kambodscha ging das Massenmorden los. In Chile und Uruguay regierte das Militär. In Uganda herrschte der halb wahnsinnige Diktator Idi Amin, in Zaire der Ausbeuter Mobutu, in Südafrika die Apartheid und in Namibia Bürgerkrieg.
Die gesamte menschliche Zivilisation ging laut der Prognose des «Club of Rome» aus dem Jahr 1972 ohnehin dem baldigen Ende entgegen. Im Ruhrgebiet gab Smog-Alarm bereits einen Vorgeschmack darauf; als Duisburger Junge kann ich mich noch gut daran erinnern. Morgenstund’ hatte für mich Ruß, Staub und Schwefel im Mund.
Seitdem ging es trotz aller schrecklichen Vorzeichen dennoch aufwärts.
Und heute?
Zugegeben: Da häufen sich die negativen Nachrichten wieder in alarmierender Geschwindigkeit. Allerdings nicht nur – wie in den Siebzigern – auf den drei Kanälen des Schwarz-Weiß-TVs, sondern in den unzähligen Angeboten des World Wide Web. Von allen Seiten bläst der Wind of Change in Orkanstärke.
Die Rede ist von Dauerkrise, Omnikrise, Multikrise, Megakrise.
Wir kriegen die Krise nicht. Wir haben sie. Wir sperren staunend die Münder auf, während das Unheil sich als unverdaulicher Doppel Whopper in unsere Rachen schiebt: zum einen als ökologische, wirtschaftliche, politische, militärische Umwälzung. Und zum anderen als schleichende Machtübernahme der Künstlichen Intelligenz, die am Ende womöglich unsere einzige Rettung ist.
K. O. sein oder von K. I. beherrscht sein, das könnte bald die Frage sein.
Anders als vor fünfzig Jahren sind wir auf die äußeren Herausforderungen nicht gut vorbereitet. Denn es bröckelt auch im Inneren. Unsere demokratischen Institutionen sind weniger robust, und wir als Individuen auch nicht in Kampflaune. Noch nie gab es – glaubt man den Krankenkassen – mehr Depressive und Ausgebrannte.
Was uns droht, sind deshalb nicht bloß Nadelstiche in eine ansonsten stabile Ordnung, sondern die Auflösung dieser Ordnung. So jedenfalls fühlt sich viel von dem an, was heute als Transformation verheißen wird.
Passend zum allgegenwärtigen Change-Gedöns sind wir auch noch demografisch in den Wechseljahren, mit einem Altersdurchschnitt, der sich in Deutschland den 50 annähert.
Wenn ich in kleinen Ortschaften unterwegs bin, sehe ich immer mehr Menschen mit Rollatoren – und immer weniger Kinderwagen.
Mit dem Alter verschwindet die Lust auf Neues, wird man automatisch konservativer, auch zunächst missmutiger. Der Glücks-Tiefpunkt der Menschen in Europa liegt angeblich durchschnittlich bei 46 Jahren.
Ich selber fühle mich immer öfter wie der betuliche Polizistenveteran Roger Murtaugh in der Hollywood-Reihe «Lethal Weapon». Auf die Eskapaden seines jüngeren Kollegen Martin Riggs reagiert er immer wieder mit dem erschöpften Mantra: «Ich bin zu alt für diesen Sch***!»
So ähnlich entwickelt sich das Verhältnis zwischen dem in die Jahre gekommenen Westen und dem teilweise sehr viel agileren Rest der Welt. Die einen wollen runterfahren und sind genervt davon, dass die anderen aufdrehen.
Richtig überrascht davon bin ich nicht.
Vor knapp sieben Jahren habe ich ein Buch fertiggestellt, «Übermorgenland», in dem ich mich zu einer «Weltvorhersage» erkühnt habe. Einige meiner damaligen Prognosen lauteten:
Die Welt wird härter, vor allem der internationale Wettbewerb.
Die Welt wird nationalistischer.
Die Welt wird wütender und militanter.
Die Welt wird populistischer.
Die Welt wird autoritärer.
Die Welt wird ungleicher.
Die Welt wird künstlicher.
Die Welt wird religiöser – außer im Westen Europas.
Für die Zeitspanne zwischen den Jahren 2020 und 2050 prophezeite ich eine krasse Umwälzungsperiode. Krisenverschärfend würde sich dabei in Deutschland die grassierende Wirklichkeitsblindheit auswirken: das Festhalten an politischen Prozessen, die in die falsche Richtung führen.
Mit meinen Thesen stand ich 2018 zwar nicht völlig alleine da, aber doch abseits des Mainstreams. Mein ursprünglicher Verlag forderte Änderungen, bei denen ich nicht mitgehen wollte. Ein anderer Verlag, nämlich dieser hier (Fontis), hatte mehr Lust und den richtigen Riecher. Das Buch wurde ein Bestseller und meine Vorhersage von der Wirklichkeit nicht nur bestätigt, sondern sogar eingeholt. Pandemie, Putins Angriff auf die Ukraine, Nahostkrieg und ChatGPT hatte ich zwar nicht auf dem Schirm, aber die großen Trends ziemlich treffsicher beschrieben.
Notiert, passiert. – Mit einem sechsten Sinn hat das nichts zu tun. Ich habe einige der im Westen und Osten aufziehenden Gewitterwolken früher gesehen. Und ich habe die Erfahrungen, die ich als Korrespondent und Vielreisender in Asien und Amerika gemacht habe, auf die Zukunft hochgerechnet.
Was mich seit der Veröffentlichung von «Übermorgenland» konsternierte, war die an Borniertheit grenzende Realitätsverweigerung im eigenen Land. Das pseudo-progressive «Vorwärts immer, rückwärts nimmer» nahm zunächst immer manischere Züge an. Unter der Regierung einer vermeintlichen «Fortschrittskoalition» trat die Bundesrepublik die Flucht in die ideologischen Wunschträume der sechziger und siebziger Jahre an: absolute Freiheit für die bürgerliche Boheme, Gleichheit für den Rest; dazu eine vermurkste Energiewende, eine desaströse Migrationspolitik, eine einseitig an Inklusion statt an Exzellenz orientierte Bildungsagenda, eine feministische statt realistische Außenpolitik, ganz zu schweigen von Gender-Gaga, Trans-Hype, Diversitäts-Pathos, Klima-Katastrophismus.
Lauter weitgehend verschenkte Jahre und im Ergebnis ein geschwächtes, gespaltenes, geschlauchtes Land.
Und nun?
Was tun?
Nachkarten und Rechthabenwollen bringt nix, ebenso wenig ein Fortsetzungsbuch à la «Übermorgenland II: Noch mehr Weltvorhersagen», denn mir fallen schlichtweg keine grundsätzlich neuen ein. Die Trends sind ja immer noch die gleichen, nur hat sich deren Wucht verstärkt.
Jetzt geht es darum, dass wir selbst wieder Rückenwind bekommen, vom Doom zum Boom kommen, von «I have a nightmare» zu «I have a dream».
Am Anfang steht dabei die zutreffende Analyse.
Ich halte hierfür die folgende Analogie für hilfreich:
Unsere alte Welt war ein Zoo: mit klar umzäunten Gehegen und festen Fütterungszeiten. Vorhersehbar und sicher. Überlebensprinzip: Hauptsache, artig sein, dann gibt’s die Verköstigung.
Die neue Welt gleicht eher einem Dschungel. Überlebensprinzip: Hauptsache, stark sein, sonst wirst du gefressen. – Wobei zu Stärke auch Umsichtigkeit und Kooperationsbereitschaft gehören.
Ich muss gestehen: Besonders dschungeltauglich bin ich im normalen Leben nicht. Ich weiß nicht, wie man Fallen stellt, einem Tier das Fell abzieht, und Feuer kann ich auch nicht machen, jedenfalls nicht ohne Feuerzeug oder Streichhölzer. Etwas besser bin ich darin, Karten zu lesen. Deshalb sehe ich in diesem Buch keinen Masterplan zum Erringen der Dschungelkönig-Krone, sondern eine Mindmap, eine geistige Karte zur besseren Orientierung und Krisenbewältigung. Ich stelle auch einige Wunderwaffen vor, mit denen man sich gegen die Kompliziertheit der Dinge wappnen kann, allen voran die Ambivalenztoleranzkompetenz (siehe Kapitel 7).
Ein paar meiner Klar-Stellungen werden manche Leser womöglich vor den Kopf stoßen, statt ihn geradezurücken. Mein Ansatz ist essayistisch: Das Wort «Essay» kommt von «Probe». Ich verstehe mein Buch deshalb nicht als selbstbewusstes Manifest, sondern als demütigen Versuch, gegenwärtige Probleme zu beschreiben und lösen zu helfen. Wenn jemand diese Probe für misslungen hält: Sei’s drum, es war den Versuch wert.
Was meine eigene politische Überzeugung angeht, ziehe ich gerne bereits an dieser Stelle blank. Ich bezeichne mich selbst als christlich-humanistischen Realisten – im christlichen Glauben verankert, dem Menschenwohl verpflichtet, aber auch dem Realitätsprinzip. «So isses» schlägt «Wünsch dir was». Extremistische Positionen jeder Art sind mir zuwider. Wer die sehr persönlichen Gründe dafür wissen will, muss sich bis zum zehnten Kapitel gedulden.
Ich sehe in den Neo-Faschisten und Links-Revoluzzern eher Symptome als Ursachen der momentanen Krisen. Ich glaube deshalb nicht, dass man diesen Tendenzen mit drakonischen Anti-Radikalen-Erlassen zu Leibe rücken kann.
Mein Leitfaden für die freie Wildbahn des 21. Jahrhunderts gliedert sich in 21 Ratschläge, die sich auf drei Abschnitte verteilen:
Verstehen. Nämlich die Welt.
Verbessern. Nämlich unser Land.
Verändern. Nämlich uns selbst.
Meine Tipps gehen vom Allgemeinen zum Persönlichen, vom Ernüchternden zum Erhabenen, vom Wichtigen zum Noch-viel-Wichtigeren, von Nummer 21 bis zu Nummer 1.
Der Countdown zum klaren Kopf kann beginnen.
Erste Etappe
GET REAL!
Die Welt verstehen
Ich glaub, ich geh in ’n Wald.
Sagte sich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg der Schriftsteller Ernst Jünger (1895–1998). An ihn denke ich manchmal, wenn ich einen Gottesdienst in der Leipziger Thomaskirche besuche. Denn hier feierte Jünger schließlich seine Hochzeit. Ich denke neuerdings aber auch aus anderen Gründen immer öfter an ihn.
Der Jahrhundert-Autor, der er (quantitativ mit seinen insgesamt 102 Jahren) definitiv war, kannte sich nämlich aus mit heftigen Zeiten. Er stand im Ersten Weltkrieg «In Stahlgewittern» (so der Titel seines bekanntesten Buchs), erlebte und prägte die wilden zwanziger Jahre und lavierte sich durchs Dritte Reich (unter anderem als Besatzungsoffizier in Frankreich). Wie groß seine Nähe beziehungsweise Distanz zum Hitler-Regime war, darüber gehen die Meinungen auseinander. In Paris sah er mit an, wie Juden erst zusammengepfercht und dann in die Konzentrationslager deportiert wurden. Ganz tatenlos blieb er nicht. In einigen Fällen warnte er Juden vor Razzien.
Mit den Welteroberungsfantasien der Nazis konnte er nichts anfangen. Davor schützte ihn schon seine prinzipielle Fortschrittsskepsis. Drei Jahre vor dem Beginn der braunen Diktatur fragte er in seinem «Sizilischen Brief an den Mann im Mond»:
Ist eine einzige Faust voll Erde nicht mehr als eine ganze Welt, die auf der Landkarte steht?1
Nach dem Zweiten Weltkrieg verfasste der Mitte-50-Jährige eine Schrift, in der er aufzeigte, wie auch im falschen Leben ein richtiges möglich ist. Er plädierte für eine Haltung der inneren Emigration, des klugen Nonkonformismus, der geistigen Unabhängigkeit. Er nannte dieses mentale Heraustreten aus den Zumutungen und Zwängen einer heillosen Gegenwart den «Waldgang», und so hieß auch sein 1951 erschienenes Buch. Die Lektüre lohnt immer noch, schon alleine wegen der stilvollen Prosa.2
Unter dem «Wald» versteht Jünger den Rückzugsort des eigenen Gewissens – zugleich aber auch einen Ort der Gemeinschaft mit seelenverwandten Denkern der Vergangenheit, nicht zuletzt auch der Rückbindung an Gott. Seinen «Waldgänger» charakterisiert er folgendermaßen:
Er lässt sich durch keine Übermacht das Gesetz vorschreiben, weder propagandistisch noch durch Gewalt. Und er gedenkt sich zu verteidigen, indem er nicht nur Mittel und Ideen der Zeit verwendet, sondern zugleich den Zugang offen hält zu Mächten, die den zeitlichen überlegen und niemals rein in Bewegung aufzulösen sind.
Konkret nennt Jünger die «drei großen Mächte der Kunst, der Philosophie, der Theologie». Er empfiehlt außerdem die Kontaktaufnahme zu literarischen «Wellenbrechern, an denen der Irrtum der Zeit zerstäubt», etwa zu dem von ihm verehrten Fjodor Dostojewski (1821–1881).
Dostojewski war allerdings im Unterschied zu Jünger ein Fan des einfachen Volkes, und deshalb fühlte er sich im großstädtischen Menschengetümmel wohler als im Wald. Jünger zog es hingegen weg von der Masse, die aus seiner Sicht ohnehin nicht für den «Waldgang» taugte. Er war – nicht zuletzt nach seinen Erfahrungen während der Nazi-Diktatur – davon überzeugt, «dass eine große Mehrzahl die Freiheit nicht will, ja, dass sie Furcht vor ihr hat. Frei muss man sein, um es zu werden».
Wer einen klaren Kopf will, muss ihn erst freibekommen. Darin bin ich mit Ernst Jünger einig. Frei von Konformitätsdruck, Denkvorschriften, von modischem Hype und zeitgeistiger Hysterie.
Wer denkt, was alle denken, denkt gar nicht.
Ich finde aber nicht, dass wir in der aktuellen Situation mehr latent-subversive Wald-Weise brauchen. Wir leben schließlich nicht in einer Diktatur, sondern in einer Demokratie – auch wenn sich in dieser laut Umfragen ein Drittel der Bundesbürger zunehmend gegängelt und bevormundet fühlt.
Wie jedes Machtorganisationssystem hat auch die Volksherrschaft ihre Tücken und Schwächen, aber vor allem viele Mitgestaltungsmöglichkeiten, zum Beispiel die freie Meinungsäußerung. Gegen die gibt es naturgemäß Widerstände, mal mehr, mal weniger.
Neuerdings wieder weniger.
Die Cancel-Culture hat ihr Haltbarkeitsdatum überschritten, das offene Wort wieder Konjunktur. Nicht nur im einsamen Wald, sondern gerade auf öffentlichen Plattformen.
Gerne mehr davon. Es gibt nichts Wahres, außer man sagt es.
Aber bitte mit Anstand und Verstand. Schweigen ist so lange Gold, bis man zu einer vernünftigen Einschätzung der Dinge des Lebens gekommen ist.
Aber wie bekommt man die?
Jedenfalls nicht, indem man sich in die eigenen Seelenabgründe zurückzieht und sich in der vertrauten Meinungs-Bubble einnistet. Im Wald besteht das Risiko, dass man sich darin verirrt und vor lauter Bäumen am Ende weder Wald noch Welt sieht.
Mein favorisierter Krisenbewältigungstyp ist deshalb ein anderer.
Der Bergsteiger.
Angst vor zu vielen Strapazen braucht man keine haben. Ich leide selbst unter Höhenangst. Ich denke also nicht an halsbrecherische Freeclimber. Die gemütliche Gebirgswanderung tut es auch. Nur hoch hinaus muss es gehen. Denn da hat man die reinste Luft, die beste Übersicht und gefühlt den besten Draht nach oben.
Ein paar entscheidende Einfälle für die nächsten Kapitel habe ich denn auch bei einer Wanderung in den Walliser Alpen rund ums Matterhorn bekommen. Dazu einen atemberaubenden Eindruck von der Herrlichkeit dieser Welt. Mag sie noch so «crazy» erscheinen, sie ist es gerade von oben betrachtet wert, sich für sie die Hände schmutzig zu machen.
In den antiken Religionen vermutete man die Götter auf den höchsten Berggipfeln. Und auch in der Bibel beginnen viele Neuanfänge weit oben: Abraham auf dem Morija, Mose auf dem Sinai, Elia auf dem Horeb. Im Neuen Testament zieht sich Jesus zur Sammlung seiner Kräfte und zum Gespräch mit seinem göttlichen Vater regelmäßig in die Anhöhen über dem See Genezareth zurück. Seine wichtigsten programmatischen Ansprachen, die Bergpredigt und den Missionsbefehl, hält er ebenfalls im Hochland.
Der Bergsteiger ist dem Klein-Klein der Alltagszumutungen entrückt und sieht das Big Picture, das die Probleme und Herausforderungen ins richtige Verhältnis rückt.
Anders als bei einer normalen Wanderung geht es hier im Buch gleich oben los, mit dem Panoramablick, und dann allmählich ins Tal. Denn auch das kennzeichnet den Bergsteiger: Er muss wieder herunterkommen, allerdings reicher als vor dem Anstieg, nämlich mit frischen Eindrücken im Gepäck und einer neuen Gelassenheit.
21
Die Welt geht unter.Lass sie.
Das Feuer ist zu Asche verbrannt,und die Sterne sind von Tränen verdunkelt –kalt und ängstlich, die Geister all dessen, was wir waren.Wir stoßen mit den letzten Tropfen auf unsere Leere anund auf die Vögel, die aus unseren Himmeln fallen,und auf die Worte, die aus unseren Köpfen fallen,und auf die Liebe, auf all die Liebe,die aus unserem Leben fällt.Hoffnungen und Träume, sie sind fort.Das Ende jedes Liedes.
The Cure, Alone
Waren das noch Zeiten: als ich eines Tages im Urlaub zufällig an einem Marathon-Startbereich vorbeikam, spontan mitlief und sogar mit einer für mich ordentlichen Zeit ins Ziel kam.
Fünfzehn Jahre und einen Meniskusschaden später reicht es gerade mal für ein paar schmerzfreie Kilometer, vorausgesetzt, ich habe mich vorher ausführlich aufgewärmt.
Wir werden eben alle älter. Nicht nur ich und wir, sondern auch meine Heimat Deutschland. Mit der Zeit verstärkt sich der Systemverschleiß, häufen sich die Ermüdungsbrüche.
Und zwar buchstäblich.
Kein Monat, ohne dass irgendwo eine Brücke einstürzt oder wegen Einsturzgefahr vorübergehend gesperrt wird. Traditionsunternehmen melden Bankrott an. Kirchen machen dicht.
Unsere kognitiven Kräfte lassen auch nach. Im Land von Gauß und Goethe beherrscht heute jeder fünfte Erwachsene nicht die Grundrechenarten und scheitert beim Lesen einfacher Texte. Und bei den Kindern ist es nicht besser: Bei der letzten Pisa-Erhebung aus dem Jahr 2022 lag Deutschland, die einstmals weltweit führende Bildungsnation, gerade mal auf Platz 22. Auch in der Spitzen-Forschung werden wir nach unten durchgereicht.
Der Blick auf das Spitzen-Personal der Parteien, Verbände und Kirchen ernüchtert ebenfalls. «Nie gehört. Muss man die kennen?», zuckt es mir immer wieder durch den Kopf. Mich beschleicht der Verdacht, dass nicht nur die Universitäten, sondern auch die wichtigsten gesellschaftspolitischen Institutionen immer weniger Talente produzieren.
Die Kaufkraft der meisten Deutschen schwindet, die Lohnerhöhungen werden von der Inflation mehr als ausgeglichen. Immer mehr junge Familien erleben die prosaische Wirklichkeit von Rainer Maria Rilkes lyrischem Seufzer: «Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.»
Das Niedergangs-Narrativ hat in den Talkshows mittlerweile Tinnitus-auslösende Ohrwurm-Qualität. Manche Bürger reagieren wütend, die meisten eher müde und melancholisch. Die Stimmung ist herbstlich. Die Trendfarbe ist Beige. Time to say goodbye. Zum Wirtschaftswunder und zum Wohlstand für alle.
Für die nächsten Jahre in Deutschland gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht.
Die gute Nachricht: Was uns an Turbulenzen passiert, ist historisch gesehen nichts Besonderes, sondern eine Episode im wiederkehrenden Auf- und Abwärts der Menschheit.
Die schlechte Nachricht: Dass es für uns jetzt erst mal abwärtsgeht. Fragt sich nur, wie weit, bevor der Gegentrend einsetzt.
80 Jahre nach Kriegsende fällt Deutschland in dasselbe Muster vieler großer Völker und Nationen.
Ich meine das Drei-Generationen-Prinzip.
Die erste baut auf, die zweite baut aus, die dritte baut ab. Man kennt das aus der Geschichte prominenter Familienunternehmen wie Kodak.
Auch Bibelkenner sind damit bestens vertraut.
Der Patriarch Abraham bricht in das Gelobte Land auf. Sein Sohn Isaak richtet sich dort ein. Der Enkel Jakob muss mit seinem ganzen hungernden Clan nach Ägypten auswandern.
Ein paar Jahrhunderte später: neue Akteure, gleicher Entwicklungsbogen. Mose führt das Volk Israel zurück zum Gelobten Land, Josua erobert es, die Generation danach versinkt im Chaos.
Wieder ein paar Hundert Jahre später: David erringt die Königskrone, Sohn Salomo sonnt sich in deren Glanz – und unter Enkel Rehabeam zerfällt das Reich.
Auch außerbiblisch erzählen uns die Geschichtsbücher von vielen weiteren Beispielen: Imperator Augustus top, Nachfolger Tiberius noch halbwegs passabel, Caligula ein Desaster. Und schließlich die preußischen Hohenzollern-Kaiser: Wilhelm I. begründet das Deutsche Reich; Sohn Friedrich III. kommt zwar nur auf 99 Regierungstage, richtet aber wenigstens keinen großen Schaden an; Enkel Wilhelm II. startet einen Weltkrieg, beerdigt das Kaiserreich und hinterlässt einen Aschehaufen, aus dem der böse Phönix Hitler aufsteigt.
Seit 1945 rollen wir den in den Abgrund gerasselten Stein des Fortschritts wieder mühsam bergan. Nun müssen wir wie Sisyphos zusehen, wie der Stein wieder talwärts zu rollen droht.
Was hochgeht, geht auch runter. C’est la vie.
Am eigenen Leib miterlebt hat den «Aufstieg und Fall»-Zyklus ein ehemaliger italienischer Spitzenpolitiker, der im Jahr 1525 sein letztes Werk fertigstellte: «Die Geschichte von Florenz». Niccolò Machiavelli (1469–1527) hatte die Renaissance-Blütezeit seiner Heimatstadt Florenz erlebt und sie als Politiker mitgestaltet. Dann wendete sich das Blatt. Florenz schlitterte von einer Krise in die andere, und Machiavelli landete erst im Gefängnis und auf der Folterbank, dann im Exil. Seine ernüchternde Bilanz lautete:
In stetem Wechsel geht es abwärts zum Bösen, aufwärts zum Guten. Denn Tugend zeugt Ruhe, Ruhe Trägheit, Trägheit Unordnung, Unordnung Zerrüttung, aus der dann wieder Ordnung entsteht, aus der Ordnung Tugend, aus der Tugend Ruhm und Glück.3
Deutschland, so fürchte ich, befindet sich gerade in der «Von der Trägheit zur Unordnung»-Phase.
Man kann das biochemisch erklären. In der Aufbruchsphase schütten unsere Gehirne den Motivations-Botenstoff Dopamin aus. Da sind die Eindrücke frisch, die Herausforderungen eindeutig, die Ziele klar vor Augen.
Jahrzehnte später klammert man sich an das, was man erreicht hat. Wenn dann notwendige Veränderungen anstehen, wird eher das Stresshormon Kortisol aktiviert. In der Pop-Psychologie spricht man auch vom Gewinner-Fluch. Wer oben auf dem Siegertreppchen steht, muss sich doppelt anstrengen, wenn er oben bleiben will. Die Wahrscheinlichkeit beziehungsweise die Unlust, sich erneut zu quälen, sprechen dagegen.
Analogien gibt es auch in der Physik. 1850 entdeckte der in Halle promovierte Pfarrerssohn Rudolf Clausius (1822–1888) das Phänomen der Entropie. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie «Umwandlung». Nämlich von Ordnung zu Unordnung. Gemeint ist die natürliche Tendenz physikalischer Systeme zum Zerfall. Auf gesellschaftliche Strukturen übertragen: Die Aufrechterhaltung einer Ordnung ist anstrengend. Irgendwann fehlt schlichtweg die Kraft dafür, oder der äußere Druck ist zu groß.
Ich wundere mich, warum sich Politiker nicht öfter mit dieser Erklärung herausreden. Nach dem Motto: «Ich bin nicht schuld. Es war die Entropie.»
Eine rein naturwissenschaftliche Erklärung reicht für gesellschaftliche Prozesse selbstverständlich nicht aus. Die Dynamiken sind komplexer. In den letzten Jahren habe ich mich ausführlich mit historischen Vorläufern zu unserer jetzigen Situation beschäftigt. Dabei ist mir das folgende Abstiegsschema aufgefallen:
Erstens: Die Gesellschaft geht nicht mit der Zeit.
Sie verbraucht mehr Energie für Selbsterhalt als für Weiterentwicklung. Es wird mehr konsumiert als investiert. Auf Herausforderungen reagiert man nicht kreativ, sondern defensiv. Was auch kein Wunder ist. Mein eigener Lehrsatz lautet:
Die Mächte von heute stützen sich auf die Ideen von gestern und sind deshalb oft nicht fähig, die Probleme von morgen in den Griff zu kriegen.
Zweitens: Auf- und Abstieg einer Gesellschaft ist nicht zuletzt ein Elitenproblem.
In einer Gesellschaft mögen alle Menschen dem Verfassungsbuchstaben nach gleich sein. Gleich wirkmächtig sind sie aber definitiv nicht. Manche gesellschaftlichen Gruppen und Individuen sind kraft ihrer Skills, Vermögen, Netzwerke besonders einflussreich. So wie kreative Minderheiten den Weg nach oben bahnen, so verursachen sie häufig auch die Talfahrt. Sie verlieren allmählich ihr Genius, produzieren keine neuen Ideen mehr, agieren zunehmend autoritär. Macht deformiert die Besten – gutwillige Menschen wie demokratische Parteien. Der deutsch-italienische Soziologe Robert Michels (1876–1936) hat aus dieser Beobachtung sein «ehernes Gesetz der Oligarchie» abgeleitet. Er resümiert:
Sobald die Demokratie ein gewisses Stadium ihrer Entwicklung erreicht hat, setzt ein Entartungsprozess ein, sie nimmt damit aristokratischen Geist […] an und wird dem ähnlich, gegen das sie einst zu Feld zog. […] Gegen sie erheben sich nun namens der Demokratie wieder neue Freiheitskämpfer. Und dieses grausamen Spieles zwischen dem unheilbaren Idealismus der Jungen und der unheilbaren Herrschsucht der Alten ist kein Ende. Stets neue Wellen tosen gegen die stets gleiche Brandung.4
Drittens: Die demokratische Mitte schrumpft, die Ränder wachsen.
Die Volksschichten, die unzufrieden sind, und diejenigen Spitzenkräfte, die im bisherigen System bei der Machtverteilung außen vor geblieben sind, gewinnen in einer Art Zangenbewegung immer mehr Einfluss. Richtig gefährlich wird es für ein System, wenn seine Gegner ungefähr ein Drittel des Volks hinter sich versammeln. Diese starke Minderheit bringt, angestachelt durch Abstiegsfrust und Aufstiegslust, oft mehr PS auf die Straße als die phlegmatischen und wenig charismatischen Status-quo-Verteidiger. Der Kipppunkt, an dem die alte Ordnung sich auflöst oder abgeschafft wird, ist in Reichweite.
Und warum das alles?
Inertie.
Oder auch: Trägheit.
Wieder so ein physikalisches Prinzip. Ein Körper bewegt sich nur in eine neue Richtung, wenn Druck auf ihn ausgeübt wird. Nichts ändert sich, wenn es nicht muss. Solange es nicht wehtut, tut sich oft nichts. Gerade in der Politik.
Genau das gibt mir wieder Hoffnung. Ich glaube an den freien Willen und nicht an eine mechanische Vorherbestimmtheit politischer Entwicklungen. Historische Muster sind keine Gesetze. Und eine Krise ist immer auch eine Chance. Wenn man daraus die richtigen Schlüsse zieht und die eigene Energie in die richtige Richtung kanalisiert.
Menschen unterscheiden sich von anderen Lebewesen darin, dass sie sich nicht nur immer wieder selbst Probleme schaffen, sondern diese auch lösen können. Dafür braucht es Fantasie und Erfahrung. Das gilt insbesondere für alternde Gesellschaften wie die unsere. Nicht mehr so fit im Schritt, aber mit der besseren Übersicht als das Jungvolk. Wir haben weniger Power, aber einen Sinn für Dauer, das heißt: für das, was wirklich zählt. Unser vielleicht größter Schatz ist unser Erfahrungsschatz, der uns umsichtiger und vorausschauender handeln lässt. Oder unflexibler und halsstarriger. Das Alter kann schließlich nicht nur weise machen, sondern auch senil.
Hilfreich finde ich die Ausführungen, die der christliche Philosoph und Theologe Romano Guardini (1885–1968) in seinem Alterswerk «Die Lebensalter»5 gemacht hat. Für Guardini ist die Grenzerfahrung eine notwendige Station im Reifungsprozess des Lebens. Für die Mittvierzigerjahre – also dem aktuellen deutschen Durchschnittsalter – konstatiert er ein immer deutlicheres Gefühl für die Grenze der eigenen Kraft:
Die Erfahrung der Müdigkeit stellt sich ein: dass es zu viel wird; dass man ruhen möchte; dass man anfängt, vom Kapital zu zehren.
Aus dieser Krisenzeit kann der Mensch mit einem schärferen Sinn für die Wirklichkeit und seine eigene Wirksamkeit herauskommen. So wird der Mensch schließlich «weise», er lernt unter anderem «die Unterscheidung für wichtig und unwichtig; für echt und unecht; für den Zusammenhang des Daseins und für die Bedeutung, die die einzelnen Momente in ihm haben».
Manche Menschen werden allerdings weder durch Krise noch durch Schaden klug. Sie überspringen die «weise» Lebensphase und landen im Alter gleich in der Senilität.
Die entsprechenden Passagen in Guardinis Buch habe ich mehrfach gelesen. Weil ich darin frappierende Parallelen zur derzeitigen weitverbreiteten Realitätsverweigerung gefunden habe. Hier ein paar Auszüge:
Der senile Mensch wird schwach und fühlt sich bedroht. So besteht seine Gegenwehr im Behaupten dessen, was er ist und hat: seines Besitzes, seiner Rechte, seiner Gewohnheiten, Ansichten, Urteile. Der senile Eigensinn entsteht; eine Zähigkeit des Festhaltens und Widerstehens, die bis zum Kleinlichsten und Törichsten gehen kann. […] Es wird schwer, sich an neue Situationen anzupassen. […] Alles ist nur noch «da», und die Lebensbemühung geht darauf, das noch Vorhandene zu halten und den Vorgang des Abnehmens zu verlangsamen.
Klingt ein wenig nach Deutschland im Jahr 2025. Noch immer sträuben sich viele, die unangenehmen Wahrheiten zur Kenntnis zu nehmen.
Wie der sterbende Friedrich Schiller. Am Tag vor seinem Tod antwortete der erst 45-Jährige auf die Frage nach seiner Befindlichkeit: «Immer besser, immer heitrer.» Dabei waren seine inneren Organe schon in Auflösung, wie die Ärzte bei der Obduktion feststellten.
Mit trotzig-senilen Durchhalteparolen wie: «Alles nicht so schlimm» und: «Wird schon wieder» ist dem schwächelnden Gesellschaftskörper nicht auf die Beine zu helfen.
Im Auf-und-ab-Zyklus, den jede Gesellschaft durchläuft, befinden wir uns in der Abwärtsbewegung. Das ist nicht Mutmaßung, sondern Fakt. Die sich daraus ergebenden Umwälzungen und Transformationen erleben wir als Krise, übersetzt: Entscheidungspunkt.
1930 notierte der von den italienischen Faschisten inhaftierte Schriftsteller Antonio Gramsci (1891–1937) in sein Gefängnisheft:
Die Krise besteht darin, dass das Alte stirbt und das Neue noch nicht geboren werden kann. In diesem Interregnum ereignen sich morbide Phänomene unterschiedlichster Art.6
Wir dürfen gespannt sein. Vor allem aber müssen wir klug sein. Wir sollten auf jeden Fall Panik vermeiden und gegen das Gefühl der eigenen Hilflosigkeit ankämpfen. Dabei sollten wir den Ratschlag befolgen, den Krisenpsychologen akut Traumatisierten geben: sich auf die nächstliegenden umsetzbaren Aufgaben fokussieren. Selbstwirksamkeit wiedergewinnen.
Und dringend zu erledigende Aufgaben gibt es genug.
20
Keine Angst vor künstlicher Intelligenz.Eher schon vor natürlicher Blödheit.
Der Dumme ist vor allem ein Mensch der Gewohnheit und der überkommenen Entschlüsse.
Georges Bernanos, Die großen Friedhöfe unter dem Mond
Vor Kurzem bin ich auf den Spuren von Odysseus unterwegs gewesen.
Wie der mythische Held und wie Millionen von Reisenden habe ich die Meerenge von Messina überquert, vom italienischen Festland auf die Insel Sizilien. Anders als der legendäre Grieche war ich nicht auf einem Segelschiff, sondern auf einer riesigen Fähre unterwegs. Deshalb habe ich den plötzlich über uns hereinbrechenden Sturm gut überstanden.