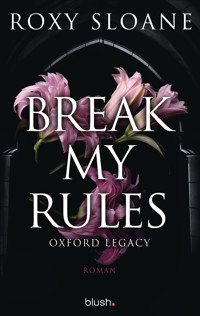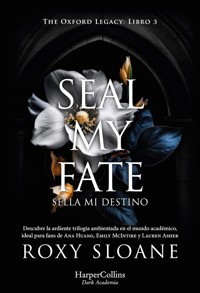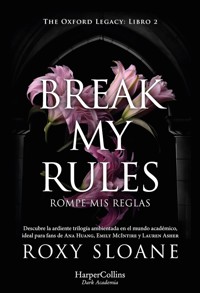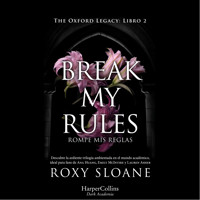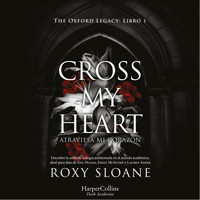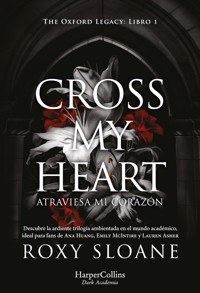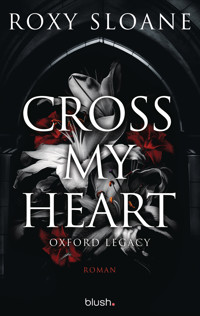
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Oxford Legacy
- Sprache: Deutsch
Willkommen in Oxford – der Stadt mächtiger Geheimgesellschaften, dunkler Geheimnisse und des nie gekannten Verlangens ...
Tessa hat es geschafft: Sie wurde am Ashford College in Oxford angenommen! Aber sie plant dort nicht zu studieren. Tessa will dem rätselhaften Tod ihrer Schwester Wren auf die Spur kommen. An Ablenkung ist nicht zu denken – bis sie auf Anthony St. Clair trifft. Um den gut aussehenden Professor ranken sich allerlei Gerüchte. Er soll sogar Teil einer dunklen Geheimgesellschaft sein, die mit Wrens Tod zu tun haben könnte. Tessa kann sich der Anziehungskraft Anthonys nicht entziehen. Aber kann sie ihm wirklich trauen?
Dark Academia meets teacher x student, forbidden love und enemies to lovers – Band 1 der Oxford-Legacy-Reihe endlich auf Deutsch!
Books that make you – blush.
Du suchst Liebesgeschichten mit reichlich Spice, mitreißenden Tropes oder morally grey book boyfriends? Dann entdecke weitere Bücher von blush.!
Enthaltene Tropes: Dark Academia
Spice-Level: 4 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Tessa hat es geschafft: Sie wurde am Ashford College in Oxford angenommen! Doch sie hat nicht vor, dort zu studieren. Tessa will dem rätselhaften Tod ihrer Schwester Wren auf die Spur kommen. An Ablenkung ist nicht zu denken – bis sie auf Anthony St. Clair trifft. Um den gut aussehenden Professor ranken sich allerlei Gerüchte. Er soll sogar Teil einer dunklen Geheimgesellschaft sein, die mit Wrens Tod zu tun haben könnte. Tessa kann sich der Anziehungskraft Anthonys nicht entziehen. Aber kann sie ihm wirklich trauen?
Autorin
Roxy Sloane ist das Pseudonym einer erfolgreichen USA-Today-Bestsellerautorin. In England geboren und aufgewachsen, hat Roxy ihren Bachelor an der University of Oxford abgeschlossen. Im Gegensatz zu ihrer Protagonistin Tessa hat sie dort aber ernsthaft studiert und keinerlei skandalöse Partys oder Veranstaltungen von Geheimgesellschaften besucht. Derzeit lebt sie in Los Angeles und gibt sich ihrer Leidenschaft hin, süchtig machende Romance-Welten zu erschaffen und an öffentlichen Orten ganz ungeniert super-spicy Szenen zu schreiben.
ROXY SLOANE
CROSS MY HEART
OXFORD LEGACY
Roman
Deutsch von Luzi Bast
Die Originalausgabe wurde 2023 unter dem Titel Cross My Heart von AAHM, Inc/Roxy Sloane veröffentlicht.Die erste Verlagsausgabe erschien 2024 bei Avon, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2023 by AAHM, Inc/Roxy Sloane, published by arrangement with Avon, an imprint of HarperCollins Publishers LLC.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by blush. Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Ulrike Gerstner
Covergestaltung: bürosüd nach einer Vorlage von Roxy Sloane und unter Verwendung von Bildmaterial von Adobe Stock (BortN66, Mel) und Getty Images (Michael Duva)
Innengestaltung unter Verwendung der Bilder von: © Adobe Stock (Gizele)
StH · Herstellung: DiMo · SaVo
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-33326-3V002
Für alle Leser*innen, die sich für Dark Academia mit einem Schuss wilder Sexpartys und prickelndem Spice entschieden haben:Der Professor empfängt Sie jetzt …
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält einen äußerst versauten Protagonisten, extrem pikante Szenen und viele Momente zum Erröten (uhhhh, Kapitel 7).
Außerdem wird auf einen vorangegangenen Suizid, eine Entführung und einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf eine Nebenfigur Bezug genommen, aber nichts davon findet im Buch oder während der aktuellen Romanhandlung statt.
Nun seid ihr gewarnt!
KAPITEL 1 Tessa
Oxford. Die Stadt der träumenden Türme sowie uralter Vermächtnisse … und Geheimnisse.
Außerdem ist Oxford der letzte Ort, an dem ich je gedacht hätte zu landen, einen Ozean entfernt von meinem normalen Leben in Philadelphia, ordentlich in Rock und Bluse gekleidet, Tee trinkend in den Gärten der fünfhundert Jahre alten Gebäude des Ashford College. Das älteste und renommierteste aller Oxford Colleges.
Und das mit den meisten Geheimnissen.
»Ist es nicht unglaublich?«, gurrt eine der anderen Geladenen. Lacey heißt sie, glaube ich, mit weit aufgerissenen Augen bewundert sie jedes Detail dieses Ortes. »Es wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Sie ließen den Sandstein für die Kreuzgänge aus Florenz bringen. Spürst du das Gewicht der Geschichte?«
»Mhm.« Ich deute ein Nicken an, lasse den Blick über die Menge schweifen. Es ist die Willkommensfeier für alle neuen Masterstudenten am College, und wir sitzen hier schon seit einer Stunde fest: Wir flanieren um den mit der Nagelschere gestutzten Rasen herum, trinken dünnen Tee und begrüßen Professoren und andere Mitarbeiter. Alle um mich herum sind ganz aus dem Häuschen, weil sie endlich hier sind, und wenn ich ehrlich bin, sind meine Nerven auch zum Zerreißen gespannt.
Aber aus einem anderen Grund.
Ich sehe mich um, warte auf meine Chance. Die Menge ist ein buntes Gemisch aus zwanzig- bis dreißigjährigen Masterstudenten und intelligent aussehenden Dozenten. Alle haben diesen unbeholfenen »Erster Schultag«-Look, lachen zu laut über schlechte Witze, wollen imponieren.
»Hallo«, grüßt eine Unimitarbeiterin und holt mich damit zurück in die Unterhaltung. Sie ist groß, eine seriöse Erscheinung in Tweed, und ihr graues Haar ist zu einem strengen Bob frisiert. »Und wer sind Sie?«
»Tessa«, stelle ich mich höflich vor. »Ich bin für ein Jahr hier, um die sozialpolitischen Aspekte in der Literatur des 18. Jahrhunderts zu studieren.«
»Ah, unsere Ashford-Stipendiatin«, sagt sie. Und ja, dank dieses Stipendiums kann ich meinen Aufenthalt hier finanzieren. »Willkommen, willkommen. Wir freuen uns, Sie bei uns zu haben.«
»Und ich freue mich, hier zu sein«, lüge ich mit einem gezwungenen Lächeln.
»Es war immer mein Traum, in Oxford zu studieren«, schwärmt Lacey. »Ich kann gar nicht glauben, dass ich jetzt tatsächlich hier bin!«
Ich kann es auch nicht glauben. Aber es war nicht mein Traum, es war ein Plan.
Ein sorgfältig ausgeklügelter, akribisch Schritt für Schritt ausgeführter Plan, der mich hierherbringen sollte, zum Ashford College und all seinen Geheimnissen.
Und diese Geheimnisse werde ich enthüllen, um jeden Preis.
»Sind Sie Professorin?«, frage ich die Frau.
»Nein, ich bin in der Verwaltung. Geraldine Wesley«, antwortet sie.
Den Namen kenne ich. »Dann waren Sie die Person hinter all den hilfreichen E-Mails«, sage ich und lächele sie an.
»Stimmt.« Sie lächelt ebenfalls. »Ich betreue die Studenten und kümmere mich hier in Ashford um alles, was nichts mit dem Studium zu tun hat. Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich also einfach an mich.«
»Sehr gern«, sage ich und weiß schon, dass diese Geraldine eine große Hilfe sein wird. Denn ich habe tausend Fragen, und sie wird sie mir beantworten …
Allerdings nicht so, wie sie denkt.
Jemand schlägt ein Glas an, und alle werden still. Der Collegeleiter, ein etwas linkischer, konservativ wirkender Typ, tritt in die Mitte des Gartens. »Willkommen, willkommen«, sagt er strahlend. »Es ist so schön, Sie alle hier begrüßen zu dürfen. Ich möchte ein paar Worte über das Vermächtnis unseres College verlieren, und welch großartige Gelegenheit Sie hier haben …«
Die anderen Gäste gehen näher heran, um ihm zu lauschen, alle Blicke gebannt auf ihn gerichtet. Auf diesen Moment habe ich gewartet.
Niemand bemerkt, wie ich mich vorsichtig von der Menge löse und aus dem Garten schleiche, durch einen Torgang auf den gepflasterten Hof im Zentrum des Campus.
Ich habe nicht viel Zeit, daher laufe ich schnell über das Collegegelände, den Weg entlang, den ich mir vorher eingeprägt habe. Es ist Ende September, das Semester hat gerade erst begonnen, also sind viele andere Studenten unterwegs, genießen den Tag oder lernen im Hof. Das Ashford College sieht aus wie aus einem Magazin entsprungen, mit dem Herbstlaub, das sich langsam verfärbt, und all den adretten, fleißigen Studenten. Exklusiv. Glanzvoll.
Gefährlich.
Die Verwaltungsbüros liegen auf der anderen Seite des Innenhofs, am Ende einer schmalen, knarrenden Treppe. Ich setze darauf, dass in einem so alten Gebäude nicht viele moderne Alarmanlagen und Sicherheitsvorrichtungen eingebaut wurden, und ich habe Recht. Geraldines Tür hat nur einen Knauf und ein altmodisches Schlüsselloch. Und in einem kleinen, exklusiven College wie diesem, das von hohen Mauern umgeben ist, mit Sicherheitskontrolle am Eingang, gibt es keinen Grund, sie abzuschließen, wenn sie rausgeht, um bei der Gartenparty die neuen Studierenden zu begrüßen …
Ich halte den Atem an, als ich langsam den Knauf drehe.
Die Tür geht auf.
Yes!
Ich atme aus, gehe hinein und lasse die Tür hinter mir einen Spalt offen stehen. Schnell sehe ich mich um. Es ist ein vollgestopfter, L-förmiger Raum unter dem Dach, mit Schreibtisch, Computer und einer langen Reihe Aktenschränke.
Ich versuche, eine Schublade aufzuziehen. Abgeschlossen.
Wo würde ich den Schlüssel aufbewahren? In der Nähe, der Bequemlichkeit halber, also durchwühle ich den Schreibtisch und – da. In der oberen Schublade liegt ein Schlüsselbund. Damit gehe ich zum ersten Schrank. Geraldine wirkt wie jemand, der alles gut strukturiert, und ja: Die Studentenakten sind nach Jahr und dann alphabetisch sortiert. Ich finde die Akten von letztem Jahr, sehe sie schnell durch, bis ich zu der Schublade komme, die ich suche.
»O’Hara, Patrick … Peterson.«
Ich halte inne, dann ziehe ich die Akte heraus. Wren Peterson. Ihr Name steht in ordentlicher Schrift darauf, mein Puls rast.
Meine Schwester.
Ich öffne die Akte mit klopfendem Herzen, doch sie ist frustrierend dünn. Nur ihr Vorlesungsplan, ihre Bewerbungsunterlagen. Ein Blatt mit ihren Internetzugangsdaten und ihrer Zimmernummer.
Nichts mit nützlichen Informationen.
Nichts, das ich verwenden kann.
Mir entfährt ein Seufzer der Enttäuschung, doch ich mache mit dem Handy schnell ein paar Fotos vom Inhalt, lege dann die Akte zurück und schließe den Schrank ab. Gerade als ich die Schlüssel wieder in der Schreibtischschublade verschwinden lasse, höre ich, wie die Tür knarzt, und fahre erschrocken herum.
»Was zum Teufel?«, rufe ich panisch aus. Dann kneife ich die Augen zusammen. Im Türrahmen lehnt ein dunkelhaariger Mann und mustert mich eindringlich. Er sieht nicht einfach nur gut aus, sondern ist höllisch sexy: ungefähr Anfang dreißig, dunkle Hose, weißes Hemd, die Jackettärmel lässig hochgekrempelt; markantes Kinn, perfekter Dreitagebart.
»Suchen Sie etwas?«, fragt er mit hochgezogener Augenbraue.
Ich schlucke. Er sieht mich mit seinen graublauen Augen direkt an. Entblößt mich bis auf die Knochen.
Ertappt.
Ich trete vom Schreibtisch weg. »Mein Willkommenspaket«, stammele ich. »Es war nicht in meinem Briefkasten, und Geraldine hat gesagt, ich könnte es hier abholen.«
»Hat sie das?« Er lässt seinen Blick über mich wandern, unverhohlen genüsslich. Mir stellen sich alle Haare auf, und meine Nippel werden hart, doch ich zwinge mich, ruhig zu bleiben.
Er weiß nichts. Du bist nur eine dumme neue Studentin.
»Ich kann mich nicht einloggen, verstehen Sie?«, sage ich mit einem hilflosen Lächeln. »Und, na ja, ich komme keinen Tag ohne Internet klar. Ich meine, ich weiß, das hier ist ein historischer Ort und so, aber ohne E-Mails und Social Media funktioniere ich einfach nicht. Das ist wie mit dem Baum, der im Wald umfällt, oder?«, füge ich in dem atemlosen Ton hinzu, den ich mir bei Lacey abgeguckt habe. »Wie soll irgendwer wissen, was für eine tolle Zeit ich hier habe, wenn ich nichts posten kann?«
Es tut mir körperlich weh, vor diesem Gott von einem Mann vorzugeben, ich sei eine hohle Nuss, aber ich habe keine andere Wahl. »Wissen Sie, wo es sein könnte?«, frage ich rehäugig. »Also, ich meine den Zettel mit meinen Zugangsdaten?«
»Ich fürchte, nein.« Er sieht sich im Büro um, mit einem süffisanten Lächeln auf den Lippen, er glaubt mir kein Wort. Fuck. Aber gerade, als ich mich frage, ob ich aufgeflogen bin, bevor ich überhaupt mit der Suche angefangen habe, tritt er zur Seite und weist zur Treppe. »Sie möchten sicher zur Feier zurückkehren. Damit Sie alle kennenlernen können und so.«
Er ahmt mich nach, und ich würde angesichts seines herablassenden Tonfalls die Augen verdrehen, wenn ich nicht so erleichtert wäre, entkommen zu können.
»Stimmt. Ja. Danke!«
Ich flitze an ihm vorbei, die Treppe hinunter, bleibe keine Sekunde stehen, bis ich wieder im Garten bin. Mein Herz rast.
Wie konnte ich so unvorsichtig sein? Ein falscher Schritt und mein ganzer Plan wäre hinüber gewesen.
Ich nehme mir ein Glas kalte Limonade und stürze es herunter, ich wünschte, ich hätte etwas Stärkeres, um meine Nerven zu beruhigen. Mein Herz hämmert nicht nur wegen der Aufregung so, sondern auch beim Gedanken daran, wie dieser Typ mich angesehen hat.
Und wie mein Körper darauf reagiert hat. Mit Verlangen.
Es heißt ja, Angst sei ein Aphrodisiakum. Offenbar habe ich eine heimliche Neigung für Gefahr- und In-flagranti-Fantasien.
»Wo warst du?«, fragt Lacey. »Du hast alle Reden verpasst.«
»Toilette«, antworte ich vage. Mein Körper steht immer noch unter Adrenalin.
»Die Profs hier sind einfach wunderbar«, fährt Lacey fort, während sie an einem Scone kaut. »Ich hoffe so, dass ich in das Seminar von Professor St. Clair komme.«
»Mhm …« Ich höre ihr kaum zu, denke an das süffisante Grinsen des Mannes und daran, wie es ihn fast zu amüsieren schien, mich beim Herumschnüffeln ertappt zu haben.
»Redet ihr über Saint?« Eine weitere neue Studentin kommt zu uns. »Anthony St. Clair, er ist der nächste Duke of Ashford, wusstet ihr das? Seine Vorfahren haben dieses College gegründet.«
»Ein Duke?« Lacey bleibt der Mund offen stehen.
»Ja. Er ist kein echter Professor. Er hält nur manchmal ein paar Vorlesungen. Ein Privileg seiner Abstammung. Wahrscheinlich kommt er deshalb auch damit durch.«
»Womit?«
»Mit allem«, sagt die Studentin empört. »Er datet ständig Studentinnen, feiert wilde Partys, er ist überhaupt nicht wie die anderen Profs. Da ist er.« Sie deutet mit dem Kinn über den Rasen.
Ich spähe hinüber zu diesem berüchtigten Dozenten – und wen sehe ich? Ihn. Den Mann, der mich gerade erwischt hat. Er steht etwas abseits der Menge, das Jackett hat er sich jetzt über die Schulter geworfen, er wirkt so cool und gelassen, dass ich sofort an den Song »You’re so vain« von Carly Simon denken muss. Ein Typ, der auf eine Party kommt, als würde er gerade seine Yacht betreten …
Denn dieser Mann war ganz offensichtlich schon auf vielen Yachten unterwegs. Er hat diese selbstbewusste »Ich bin reich«-Ausstrahlung und betrachtet uns alle leicht amüsiert.
Attraktiv. Dunkel. Sinnlich.
Ein Mann, der genau weiß, wie er dich zum Stöhnen bringt …
Unsere Blicke kreuzen sich, und er sieht mich direkt an, ganz unverhohlen abschätzend. Ich erschauere, bin mir plötzlich meiner selbst sehr bewusst, als könne er einfach durch die unschuldige Rolle hindurchsehen, die ich hier spiele.
Aber das kann nicht sein. Ich sehe aus wie alle anderen eifrigen neuen Studierenden hier. Niemand weiß, warum ich wirklich hier bin – und so soll es auch bleiben.
Ich wende mich ab.
»Nicht dein Typ?«, fragt Lacey.
Ich zucke mit den Schultern, gebe mich unbeeindruckt. Denn auch wenn dieser Saint wohl jedermanns Typ ist … meiner ist er ganz bestimmt nicht. Ich bin zwar in Oxford auf der Suche nach einem Mann, aber nicht für eine ungehörige Affäre.
Mich interessiert nur ein Mann, und den werde ich zur Strecke bringen, um jeden Preis.
Der Mann, der meine Schwester angegriffen und sie dazu gebracht hat, sich das Leben zu nehmen.
KAPITEL 2 Tessa
Was ist bloß mit dir passiert, Wren?
Meine Turnschuhe pochen rhythmisch über das Kopfsteinpflaster, während ich an malerischen Cafés und Buchläden vorbei durch die Stadt jogge, die gerade erst erwacht. Es ist noch nicht mal sechs Uhr morgens, und der Himmel ist noch dämmrig, aber ich konnte nicht mehr schlafen. Ich schlafe wenig in letzter Zeit, in meinem Kopf kreist die immer gleiche Frage, die mich nun schon das ganze Jahr quält.
Ich bin um die halbe Welt gereist, um diese Frage zu beantworten, um jeden Preis.
Ich renne weiter und versuche, die pulsierende Sorge aus meinen Adern zu vertreiben. Ich biege in die High Street ein, laufe vorbei an den alten Colleges mit ihren hohen Mauern und uralten Erkern. Oxford ist wie ein föderales System, das aus fast drei Dutzend einzelnen Colleges besteht, jedes mit eigenem Personal, Regeln und Studenten. Wie kleine ummauerte Königreiche liegen sie in der Stadt verstreut.
Und das Ashford College ist das reichste und exklusivste von allen.
Ich weiß noch, wie Wren triumphierend den Brief hochhielt, als sie das Angebot bekam, dort ihre Forschung fortzusetzen. Ein hypermodernes biomedizinisches Programm, irgendein neurowissenschaftliches Zentrum, das das Forschungsfeld revolutionieren würde. Ich hatte nie ganz verstanden, was sie eigentlich genau erforschte. Meine große Schwester war immer das Genie der Familie gewesen, nicht ich.
Sie schrieb immer glatte Einsen, während ich eine durchschnittliche Zweier-Schülerin war. Sie bekam ein Vollstipendium fürs College und dann für ihr Medizinstudium, während ich verschiedene Geisteswissenschaften ausprobierte, ständig das Hauptfach wechselte und mich mehr auf Partys als an der Uni rumtrieb. Nach dem Abschluss wurde sie von einem bedeutenden Pharmakonzern angeworben, während ich von einem Job zum nächsten tingelte. Ich arbeitete als Kellnerin in einem Café, als Freiwillige für eine Wohltätigkeitsorganisation und für gemeinnützige Vereine in Philadelphia, verliebte mich in toxische gequälte Künstlertypen und entliebte mich wieder.
Aber Wren hat mich nie verurteilt oder sich herablassend verhalten, weil sie ihr Leben im Griff hatte. Sie liebte es, von meinen missglückten Abenteuern zu hören, wenn ich sie besuchte. »Du lebst wirklich«, sagte sie neidisch, und dann fühlte ich mich ausnahmsweise nicht wie eine komplette Verliererin, obwohl ich mein Leben, anders als sie, einfach nicht auf die Reihe kriegte.
Sie war mein Leben lang der Mensch, zu dem ich aufsah, die Erste, die ich nach einer schlimmen Trennung oder einem kleinen Erfolg anrief. Meine brillante, gütige, optimistische Schwester. Noch keine dreißig und schon drauf und dran, die Welt zu verändern. Das dachten wir jedenfalls alle, als sie ihre Sachen packte und nach Oxford ging, eine strahlende Zukunft vor sich.
Ein Jahr später war sie tot. Sie ist ins Wasser gegangen, in den Michigansee, und hat mir nur ein tränenverschmiertes Briefchen mit einer hingekritzelten Entschuldigung hinterlassen.
Es tut mir leid. Ich kann so nicht weitermachen.
Es tut zu weh, es nicht zu wissen.
Verzeih mir.
Ich schlucke den Kloß im Hals hinunter und jogge weiter. Biege von der Hauptstraße ab, laufe durch die Tore von Ashford und nicke den uniformierten Securityleuten am Haupteingang zu. Ein Ashford-College-Sweatshirt zu tragen, scheint ein bisschen überzogen, aber ich dachte mir, so werden mir wenigstens keine Fragen gestellt, wenn ich komme und gehe.
Und in der Tat winken sie mich einfach durch. Ich überquere den Hof bis zur Hinterseite der Gebäude, von wo sich ein Pfad zum Fluss hinunterschlängelt. In den ersten Tagen habe ich das Collegegelände ganz genau erkundet und festgestellt, dass es sich hinter Wohnheim und Bibliothek über mehrere Meilen hin erstreckt, über Wald und Wiesen. Die liegen in der Morgendämmerung so still und schön da, dass der Anblick den Sturm in meiner Brust fast beruhigen könnte.
Aber nur fast.
Wer hat dir das angetan, Wren?
Das ist die Frage, die mich bis zur Besessenheit verfolgt. Nein, sie treibt mich sogar noch weiter. Zur Rache. Seit Wren vor meinem Wohnhaus aufgetaucht ist, nur wenige Monate nach ihrer Abreise nach Oxford. Sie hatte gekündigt. War früher nach Hause gekommen. Und sie wollte mir ewig nicht sagen, warum.
Ich wusste, dass etwas Schreckliches passiert war, ich konnte es auf den Tag genau bestimmen. Ihre Anrufe und Videochats von Oxford aus waren am Anfang so fröhlich gewesen, voller Geschichten über ihre wunderbaren Laborpartner und historische und architektonische Fakten über die Stadt. Sie lernte neue Freunde kennen, hatte Spaß, liebte ihre Arbeit.
Und dann … hatte sich etwas verändert. Sie rief immer seltener an, und wenn wir redeten, dann wirkte sie erschöpft. Leer. Sie versuchte, die Fassade aufrechtzuerhalten, tat so, als wäre alles super, aber mir konnte sie nichts vormachen.
Ich kannte sie besser als alle anderen.
Der Job in Oxford sollte zwei, vielleicht drei Jahre dauern, doch plötzlich war Weihnachten, und sie stand vor meiner Tür. Mit einer lahmen Ausrede, von wegen, sie hätte ihr Ziel aus den Augen verloren und wäre von zu viel Arbeit ausgebrannt.
Sie war ausgebrannt, erloschen, das stimmte. Aschfahl und brüchig. Dunkle Ringe unter den Augen. So angespannt, dass sie bei jeder zuschlagenden Tür zusammenzuckte. Und die heitere, herzliche, ehrgeizige »Das Glas ist halb voll«-Schwester, die ich mein Leben lang gekannt hatte?
Es gab sie nicht mehr.
Diese Wren erkannte ich nicht wieder. Sie blieb die ganze Nacht weg, feierte mit Fremden. Trank bis zur Besinnungslosigkeit. Und Alkohol war nicht das Einzige. Pillen verklärten ihren Blick. Pülverchen ließen sie überlaut lachen. Sie fuhr schnell aus der Haut, und in ihr glomm die Wut.
Sie war wie eine Fremde, der ich nicht mehr in die Augen sehen konnte.
Die Bäume ziehen verschwommen an mir vorbei, als ich den Pfad hinunterlaufe. Unten werde ich langsamer und bleibe stehen. Die Hände auf die Oberschenkel gestützt, ringe ich nach Luft. Mein Herz wummert mir in den Ohren, ich lasse den Blick über die Flussufer schweifen und habe jenen Abend wieder allzu klar vor Augen.
Den Abend, an dem Wren schließlich zusammengebrochen ist und mir alles erzählt hat.
Ich hätte eigentlich arbeiten sollen, kellnern in einer schäbigen Bar bei mir um die Ecke. Aber der Inhaber kam nicht, und ich hatte keinen Schlüssel, also ließ ich das Lokal geschlossen und ging nach Hause.
Wren lag im Bad auf dem Boden, völlig weggetreten vom Alkohol. Ihr linkes Handgelenk von einer Rasierklinge aufgeschlitzt.
Ich hatte noch nie zuvor solche Angst gehabt, wie in dem Moment, als ich sie dort zusammengesackt in einer Blutlache liegen sah. Aber sie atmete. Der Schnitt war offenbar nicht so tief. Ich verband sie und duschte sie kalt ab, damit sie zu sich kam, und als sie endlich wieder bei Sinnen war, zitternd, mit roten Augen, habe ich sie gezwungen, mir endlich die Wahrheit zu sagen.
Sie war mit Freunden ausgegangen, Mitte Oktober. Einfach was trinken in der Collegebar, wo sie schon ein Dutzend Mal gefeiert hatten. Aber irgendwer kannte irgendwen, der von einer Riesenparty irgendwo auf dem Land gehört hatte. Wren musste einfach mitkommen. Es würde ein Abenteuer sein.
Und das war alles, woran sie sich erinnerte. Alles danach war einfach … weg. Mit wem sie gefahren ist, ob sie überhaupt bei der Party ankam … Wrens brillantes Hirn, das sich Daten, Fakten, Zahlen völlig problemlos merken konnte, war nur ein schwarzes Loch ohne die kleinste Erinnerung, die irgendwie hätte helfen können. Sie schwor, dass sie nicht getrunken hatte. Vielleicht ein Glas Wein. Ich glaubte ihr. Damals war Wren immer die Fahrerin, sie blieb nüchtern und klar und sorgte dafür, dass alle heil nach Hause kamen, hielt den Mädels beim Kotzen die Haare und brachte am nächsten Morgen Kaffee und Snacks.
Ein Glas Wein, aber an mehr erinnerte sie sich nicht. Sie wachte in ihrem Zimmer im Collegewohnheim auf, angezogen auf dem Bett, in ihrem besten Partykleid. Ihr tat alles weh. Blaue Flecken an Handgelenken und Schenkeln. Ihre Mitbewohner wussten nicht, wo sie nach der Bar hingegangen war, und auch nicht mit wem, ob mit Freunden oder Fremden.
Es waren vierundzwanzig Stunden vergangen.
Ein ganzer Tag. Einfach weg. Für meine Schwester, die es gewohnt war, alles zu wissen, alles zu planen, war das das Schlimmste. Was war passiert? Wo war sie gewesen?
Mit wem?
Sie ging ins Krankenhaus, aber welche Drogen auch immer ihr verabreicht worden waren, sie wurden nicht nachgewiesen. Die Untersuchung auf Spuren von Vergewaltigung brachte kein Ergebnis. Das Krankenpersonal hielt eine Predigt über die Gefahren des Alkohols und schickte sie weg. Sie versuchte, den Abend zu rekonstruieren, aber niemand hatte auf sie geachtet, alle waren zu sehr mit ihren eigenen Deadlines oder Beziehungsdramen und fröhlichem Feiern beschäftigt gewesen. Wohin sie sich auch wandte, niemand wusste etwas.
Und dann begannen die Flashbacks.
Nichts Konkretes, keine Namen oder Gesichter oder sonst irgendetwas Nützliches. Nur kurze Bilder. Menschen in Abendgarderobe, die in einem Garten tanzen. Eine schmutzige Zelle irgendwo, keine Fenster. Eine nackte Matratze. Fesseln an Fuß- und Handgelenken. Ein bedrohlich über sie gebeugter Mann mit einem markanten Tattoo auf dem Schenkel: eine Krone, umkränzt von einer Schlange.
Einerseits wünschte Wren, sie könnte sich erinnern, erzählte sie mir schluchzend. Das Nichtwissen machte sie wahnsinnig. Aber andererseits … wusste sie, dass unser Gehirn auf Selbstschutz programmiert ist.
Vielleicht gab es einen Grund dafür, dass es die Wahrheit verdrängte, sie unterdrückte.
Vielleicht wollte es sie vor dem Horror schützen, der ihr in dieser Zelle widerfahren war.
Nach diesem Abend habe ich versucht, ihr zu helfen, so gut ich konnte. Ich suchte Therapeuten, Selbsthilfegruppen, Rehabilitationsprogramme. Aber Wren lehnte alles ab. Endlich alles laut ausgesprochen zu haben, schien ihr den Rest gegeben zu haben, sie wollte nur noch vergessen. Sie drehte völlig durch, verschwand wochenlang. Unsere Eltern waren außer sich vor Sorge, und ich lag jede Nacht wach und fragte mich, wo sie war. Ob sie wiederkommen würde.
Bis es tatsächlich passierte. Und wir eines Tages stattdessen den schrecklichen Anruf von der Polizei bekamen.
Sie war gegangen.
***
Ich wende mich vom Fluss ab und gehe zum College zurück. Meine Glieder schmerzen vom schnellen Joggen, aber ich spüre es kaum. Ich denke schon an meinen nächsten Schritt. Den nächsten Teil des Plans, um den zu finden, der meiner Schwester das angetan hat – und ihn büßen zu lassen.
Denn der, der sie unter Drogen gesetzt, eingesperrt und in den vierundzwanzig fehlenden Stunden Gott weiß was mit ihr getrieben hat, der hat sie auf dem Gewissen. Er hat Leben und Hoffnung aus dem Blick meiner Schwester gesaugt, sie in einen Schatten ihrer selbst verwandelt, bis sie es nicht mehr ertragen konnte, noch einen weiteren Atemzug zu tun.
Im Grunde hat er meine Schwester ermordet, und ich werde nicht ruhen, bis ich ihn ausfindig gemacht habe, und dann lasse ich ihn leiden, so wie er es bei ihr getan hat.
Darum habe ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um hierherzukommen, nach Oxford, ans Ashford College. Den Ort des Verbrechens. Ich lüge, schnüffele herum und gebe vor, jemand zu sein, der ich nicht bin. Ich werde alles über Wrens Leben hier herausfinden: ihre Freunde, ihre Lover, wer diese Party gegeben hat, und jede einzelne Person, die dort war. Jedes verdammte Detail, bis ich ihren Tod rächen kann.
Ich habe noch nicht viele Hinweise, aber die Informationen aus dem Verwaltungsbüro sind ein Anfang. Ihr Stundenplan und ihr Wohnheimzimmer. Da fange ich an. An Orten wie diesem bleiben die Menschen länger als nur ein paar Monate. Es muss Leute geben, die sie gekannt haben, die mir einen Schubs in die richtige Richtung geben können.
Ich bin so in Gedanken, dass ich kaum darauf achte, wohin ich gehe. Bis ich Gesicht voran in einen Mann hineinrenne, der aus Stahl gebaut sein muss.
»Hey, Vorsicht!«, erklingt es mit britischem Akzent. Ich sehe auf und blicke in ein mir nur allzu bekanntes Gesicht.
Er. Anthony St. Clair. Der zukünftige Duke of Ashford, von dem alle so geschwärmt haben. Der Mann, dessen Familienname in den Stein der Tore dieses Colleges gemeißelt ist.
Der Mann, der gefährlich nah daran war, meine Tarnung auffliegen zu lassen, bevor meine Mission überhaupt begonnen hat.
»Sorry«, stammele ich und taumele zurück, »ich habe Sie nicht gesehen.«
»Gut«, sagt er mit strahlendem Lächeln. Er trägt noch die gleichen Klamotten wie gestern, aber der leicht zerknitterte Look steht ihm natürlich wunderbar. »Bitte bleiben Sie auch bei dieser Version, sollte der Direktor nach mir fragen.«
»Warum?«, hake ich nach, ohne es zu wollen. »Was haben Sie denn diesmal verbrochen?«
Trotz allem bin ich neugierig. Was hat dieser Typ hier verloren? Er ist der unpassendste Oxford-Dozent in der Geschichte der Uni. Saint hatte das eine Mädel ihn genannt.
Aber dieser Typ ist ganz sicher kein Heiliger, er ist ein Sünder, durch und durch.
Saints Lippen kräuseln sich zu einem sinnlichen Lächeln. »Wie ich sehe, eilt mein Ruf mir voraus.«
Er sieht so gut aus, dass es mir die Sinne vernebelt. Vermutlich ist er es gewohnt, dass die Frauen ihm zu Füßen liegen. Oder gleich vor ihm niederknien, um ihm einen zu blasen.
Allerdings werde ich keine davon sein.
»Oh, ja, ich habe alles über Sie gehört«, sage ich geradeheraus. »Partys, Alkohol, Frauen. Ziemlich klischeehaft, finden Sie nicht?«, füge ich hinzu, als Rache dafür, dass er am ersten Tag so verächtlich auf mich herabgeschaut hat. »Bad-Boy-Prof, der keine heiße Studentin in der Stadt auslässt. Das lässt Sie nicht halb so cool aussehen, wie Sie glauben. Lassen Sie mich raten, Sie fahren einen schicken Sportwagen? Rot oder silbern? Da sieht doch jeder, dass Sie mit Ihrer Männlichkeit hadern.«
Saint bleibt vor Überraschung der Mund offen stehen. Ob es daran liegt, dass ich ihn durchschaut habe, oder daran, dass ich mich getraut habe, es ihm ins Gesicht zu sagen, weiß ich nicht. Und ich will es auch gar nicht herausfinden.
»Ich will Sie nicht aufhalten«, schließe ich lächelnd. »Sie sollten vor dem Unterricht duschen. Man kann den Sex an Ihnen förmlich riechen.«
Dann drehe ich mich um und laufe davon.
KAPITEL 3 Tessa
Ich gehe zurück in meine Unterkunft, eine gemütliche Wohnung in einem alten roten Backsteinhaus, direkt gegenüber vom Gelände des Ashford Colleges. Ich habe Vorlesungen mit den Bachelorstudenten, aber zum Glück wohne ich mit anderen Masterstudenten in meinem Alter zusammen und stecke nicht im Wohnheim mit den Erstsemestern in einem Zimmer. Als ich die Tür öffne, höre ich fröhliches Gezanke aus der Küche. Meine neuen Mitbewohner sitzen an unserem alten wackeligen Esstisch und streiten über ein Glas Pickles.
»Bist du wahnsinnig? Das trinke ich nicht!«, weigert sich Jia und fährt sich jammernd durch das nasse dunkle Wuschelhaar.
»Es ist ein Wundermittel gegen Kater!«, schwört Kris, ein langer, schlaksiger Typ, der gerade mit angezogenen Knien auf dem Stuhl sitzt. »Ein Schluck saures Gurkenwasser, eine kalte Dusche und boom, du fühlst dich, als hättest du nie getrunken.«
Ich schlüpfe aus meinen Laufschuhen und dehne mich. Jia und Kris sind britische Masterstudenten, und bisher scheinen sie ihre Zeit entweder in der Bibliothek oder in einem der vielen Pubs und Bars der Stadt zu verbringen.
»Glaubst du diesen Quatsch?«, fragt Jia mich.
»Es stimmt. Hat irgendwas mit der Säure zu tun, glaub ich. Ich habe von Chemie keine Ahnung.«
»Ha! Siehst du? Funktioniert wunderbar«, sagt Kris strahlend.
»Dann trink du das doch«, verlangt Jia.
»Ich habe ja nicht den ganzen Abend lang Whiskey-Shots gekippt«, wehrt Kris ab.
Ich hole eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank und trinke die Hälfte in einem Zug, während Jia gequält seufzt.
»Der Typ aus meinem Lyrikseminar hat sie ausgegeben. Der war so heiß, Tessa. Mit so einem melancholischen edwardianischen Vibe. Genau mein Typ. Du hättest dabei sein sollen.«
»So heiß, dass er mir seine Nummer gegeben hat«, wirft Kris süffisant ein.
»Was? Dann ist dieser schreckliche Kater ganz umsonst?« Jia seufzt, schüttelt den Kopf und trinkt dann einen Schluck Gurkenwasser. »Igitt! Scheiße. Ich trinke nie wieder.«
»Nur gehen wir heute Abend zu dieser Willkommensparty«, erinnert Kris sie.
»Ach ja. Aber danach trinke ich nie wieder«, sagt Jia lachend. »Komm doch mit, Tessa. Das wird lustig!«
»Vielleicht«, sage ich ausweichend, während die beiden mühsam aufstehen und Jacken, Bücher und Uniunterlagen zusammenraffen. »Ich muss noch Unmengen lesen, um für meinen ersten Kurs vorbereitet zu sein. Ich meine für mein Tutorial.« So heißen in Oxford die Kleingruppenseminare.
»Du weißt ja, was man sagt«, bemerkt Kris scherzhaft mahnend. »Arbeit allein macht nicht glücklich. Oxford ist mehr als nur verstaubte Bücher. Du bist doch für das Gesamterlebnis hier!«
Unter Getöse verlassen sie die Küche, zurück bleibt die friedliche Morgenstimmung der Altbauwohnung. Sonnenstrahlen fallen durch die verstrebten Fenster und wärmen den abgewetzten Holzboden.
Kris hat recht. Ich bin nicht nur zum Studieren hier. Das bedeutet, dass ich keine Zeit für die normalen studentischen Vergnügungen habe. Ich dusche schnell, ziehe bequeme Jeans und ein T-Shirt an, nehme meine Tasche und gehe wieder zum College.
Das erwacht jetzt langsam, und Studenten und Touristen, die Fotos von den berühmten Gebäuden und dem akkurat gemähten Rasen machen, wuseln über den Vorhof.
»… 1583 gegründet durch den ersten Duke of Ashford, als Hommage an seine Gönnerin Queen Elizabeth I.«, erzählt der Tourguide. »Das Ashford College hat Dutzende Führungspersonen hervorgebracht, in den Bereichen der Medien, Industrie und sogar in der Regierung. Drei britische Premierminister haben hier studiert, und bald sind es vier, wenn Lionel Ambrose den Wahlkampf gewinnt …«
Ich schlängele mich an den Menschen vorbei durch das schmiedeeiserne Tor zum kleinen Pförtnerhaus, wo die Collegeaufseher in ihren schicken rotbraunen Uniformen und Schirmmützen auf dem Kopf Besucher und Post an die richtigen Stellen weiterleiten. Sie heißen hier Porters, ich setze das Wort auf meine Liste von Oxford-Vokabular. Ich sehe in mein Postfach. Es ist vollgestopft mit Flyern für Studentenpartys, Werbung und, ja, meinem offiziellen Stundenplan.
Ich sehe mir die Liste von Seminaren und Vorlesungen an, und meine Nerven flattern ein wenig.
Als ich beschlossen hatte, herauszufinden, was mit Wren passiert ist, war mir klar, dass ich nicht einfach in ein Flugzeug nach England steigen konnte. Orte wie das Ashford College lassen Außenstehende nicht rein. Wäre ich einfach hingegangen und hätte Fragen gestellt, wäre es für mich so gelaufen wie für die Touristen: Ich hätte von draußen durchs Tor gelugt und wäre nicht einmal ansatzweise in die Nähe der Geheimnisse gekommen, die hinter diesen alten, efeubewachsenen Mauern liegen.
Nein, ich musste hinein. Musste selbst durch die steinernen Hallen wandeln wie Wren. Sehen, was sie gesehen hat. Jeder noch so kleinen Spur folgen, die sie eventuell hinterlassen hat.
Und dafür musste ich als Studentin hier sein.
Meine akademischen Leistungen waren nie besonders gut. Mir waren Sport, außerschulische Aktivitäten und ehrenamtliche Arbeit immer wichtiger. Aber es stellte sich heraus, dass ich nur die richtige Motivation brauchte. Denn als ich einmal mein Ziel ins Auge gefasst hatte, konnte mich nichts mehr stoppen. Ich suchte wochenlang, bis ich ein wenig bekanntes Stipendium für »unübliche« – sprich durchschnittliche, ältere – Studenten fand. Es ist ein besonderes einjähriges individuelles Studienprogramm, bei dem ich an Vorlesungen und Übungen mit den regulären Bachelorstudenten teilnehme. Ich habe allen ansatzweise bedeutenden Personen, die ich kenne, jubilierende Empfehlungsschreiben abgetrotzt und mich – ich kann es nicht anders sagen – durch sämtliche Bewerbungsgespräche gelogen. Mit hinter dem Rücken gekreuzten Fingern schützte ich Begeisterung für die Literatur des 18. Jahrhunderts, Schauerromane und subversive Philosophie vor und versuchte, dabei nicht allzu sehr wie jemand zu klingen, der sich sein Wissen in einer Nacht auf Wikipedia angeeignet hat.
Und irgendwie hat es funktioniert. All die Lügen und Übertreibungen zahlten sich aus, als ich die Zusage aus Ashford erhielt, Studienplatz und Vollstipendium für ein Jahr. Aber jetzt stehe ich hier mit dem Stundenplan in der Hand, und mir wird klar, dass ich das alles rund um die Uhr weiter vorspielen und irgendwie auch all meine Seminare meistern muss.
»Oh-oh.« Eine heitere Stimme reißt mich aus meiner Panik. Es ist einer der Porter, die die Post in die Fächer verteilen. »Ich kenne diesen Blick«, fährt er zwinkernd fort. »Es ist der typische ›Wo um Himmels willen bin ich hier hineingeraten‹-Blick der Erstsemester.«
Ich seufze und zeige ein klägliches Lächeln. »Ja, es ist ganz schön viel.«
»Am Anfang haben alle Panik, keine Sorge«, sagt der Mann freundlich. Er hat ein wettergegerbtes Gesicht und spricht mit regionalem Akzent. Auf seinem glänzenden Namensschild steht »Bates«. »Ich bin seit zwanzig Jahren hier. In der ersten Woche seht ihr alle aus wie verängstigte Mäuse, aber das gibt sich.«
»Hoffentlich«, erwidere ich, als er bei meinem Postfach ankommt.
»Peterson?«, fragt er und hält mir noch einen Brief hin.
Ich nicke, und er mustert mich einen Augenblick, dann schnipst er mit den Fingern.
»Peterson, die Amerikanerin. Ein kurzer Vorname …«
Ich kneife überrascht die Augen zusammen. »Wren?«
»Ja, genau.« Er lächelt. »Ich vergesse nie ein Gesicht. Sind Sie mit ihr verwandt?«
»Schwestern«, antworte ich langsam, während mein Hirn rast. Der Name Peterson ist so verbreitet, dass ich es nicht für nötig hielt, ihn bei meiner Bewerbung zu ändern. »Kannten Sie sie?«
Bates nickt. »Nettes Mädchen, immer früh auf, um sich ihren Kaffee zu holen.«
Ich folge ihm zurück in den Empfangsbereich, wo ein reges Kommen und Gehen herrscht.
»Wie geht es ihr?«
»Super«, lüge ich fröhlich, doch es versetzt mir einen Stich in die Brust. »Sie ist wieder zu Hause in den Staaten, mitten in einem großen Forschungsprojekt.«
»Das freut mich«, sagt Bates. »Richten Sie ihr Grüße von mir altem Knacker aus, und sie soll auf ihren Blutdruck achten, mit dem ganzen Espresso.«
»Das mache ich.« Ich halte inne in diesem Gedränge. »Sie sind der Erste, den ich hier treffe, der Wren gekannt hat, als sie hier war«, sage ich in möglichst beiläufigem Ton. »Wissen Sie noch, mit wem sie befreundet war? Ich würde so gern ein paar peinliche Storys über sie hören, damit ich sie in den Ferien damit aufziehen kann.«
Er lacht leise. »Tut mir leid, ich erinnere mich nicht. Gucken Sie doch mal in die Jahrbücher.«
Jahrbücher! Natürlich. Gute Idee. »Wo finde ich die denn?«
»Versuchen Sie’s in der Bibliothek«, sagt er. Meine Unwissenheit steht mir wohl ins Gesicht geschrieben, denn er fügt hinzu: »Über den Haupthof, dann rechts, dann links. Sie werden da viel Zeit verbringen, glauben Sie mir.«
»Danke«, sage ich, aber das geht in der Frage nach einer Essenslieferung eines anderen Studenten unter, also verdrücke ich mich und folge der Wegbeschreibung zur Bibliothek. Das ist ein weiteres wunderschönes imposantes Gebäude mit efeubedeckten Mauern, Buntglasfenstern und einem hohen Gewölbedach mit Glockenturm.
Ich bin erst seit ein paar Tagen auf dem Campus, aber es kommt mir vor, als würde ich ihn bereits kennen, dank Wren. Sie hat diesen Ort geliebt. Von dem Tag an, als sie zum ersten Mal einen Fuß nach Oxford setzte, schrieb sie mir ständig über die alte Architektur und berichtete immer wieder über neue niedliche Details und Kunstwerke, die sie auf dem Campus entdeckte. Jetzt versetzt mir der Gedanke wieder einen Stich, wie glücklich sie hier immer noch sein könnte, wenn die Dinge anders gelaufen wären.
Wenn sie nicht auf diese Party gegangen wäre. Wenn sie stattdessen bis spät in die Nacht gelernt oder mit ihren Freunden im Gemeinschaftsraum einen Film angesehen hätte.
Wenn nicht irgendein Ungeheuer ihr Unaussprechliches angetan und ihr gutes, reines Gemüt für immer gebrochen hätte.
Ich schlucke die schwelende Wut hinunter und betrete das stille, dämmrige Gebäude. Eine Bibliothekarin schickt mich zu einer Regalwand, wo unter anderem haufenweise verstaubte Jahrbücher stehen, die mindestens vierzig Jahre zurückreichen. Ich suche das Buch von Wrens Jahrgang heraus und setze mich damit an ein Pult in einer Ecke. Ich blättere durch die Seiten mit Fotos von Studenten. Es durchfährt mich wie ein Blitz, als ich auf ein erstes Bild von Wren stoße. Sie steht hinten in einer Gruppe von Studenten, die auf dem Vorplatz in die Kamera strahlen. Sie sieht so glücklich aus, dass ich einen langen Augenblick einfach nur ihr lächelndes Gesicht anstarre, meine Schwester, wie ich sie gekannt habe.
Meine verlorene Schwester.
Der Bildunterschrift entnehme ich, dass das Foto bei einer Willkommensparty zu Beginn dieses verhängnisvollen Unijahres aufgenommen wurde. Ich lasse das Foto auf mich wirken, versuche, mir jedes Gesicht einzuprägen, stürze mich verzweifelt auf jeden kleinen Krümel. Ich will wissen, mit wem sie geredet hat, mit wem sie Zeit verbracht hat, wer irgendetwas darüber wissen könnte, was ihr zugestoßen ist.
Ich blättere zurück, durchleuchte alle Fotos nach dem kleinsten Schimmer von ihr. Es gibt ein paar: ein Gruppenpicknick im Innenhof, ein formales Dinner in der großen Halle. Da ist sie, im Hintergrund eines Fotos von anderen Studenten, im Schatten einer alten Ulme, den Kopf über ein Buch gebeugt.
Das Stechen in meiner Brust wird stärker. Sie fehlt mir so.
Doch ich zwinge mich, weiterzusuchen, notiere die Namen der Leute, die unter den Fotos stehen, auf denen ich sie entdecke. Ein paar Studenten tauchen immer wieder zusammen mit ihr auf. Eine kleine Rothaarige mit Grübchen steht auf einem Foto Arm in Arm mit Wren, auf einem anderen hält sie bei einem Gruppendinner das Glas zum Toast erhoben. Lara Southerly. Ihren Namen schreibe ich auf. Da ist auch ein großer flachsblonder Kerl, der Wren mit offenkundiger Bewunderung anstrahlt. Phillip McAllister.
Vielleicht greife ich nur nach Strohhalmen, wenn ich hoffe, dass sie sich an mehr erinnern als Wren selbst, aber ich werde jedem noch so kleinen Hinweis folgen. Irgendwie werde ich zusammenpuzzeln, was ihr passiert ist. Und vielleicht kann ich dann ein paar Antworten finden – und meinen Frieden.
Ich bin ganz am Ende des Jahrbuchs angekommen, da sehe ich es: Wren in einem fließenden pinkfarbenen Cocktailkleid, verschwommen in einer Drehbewegung festgehalten. Ihr Gesicht ist hinter einem Vorhang dunkler Haare verborgen, und es steht kein Name unter dem Bild, aber ich würde sie immer erkennen.
Ich erinnere mich an das Kleid. Wir haben es zusammen ausgesucht, in einer teuren Boutique, als sie ihre Reise vorbereitete. Wren hatte der Preis abgeschreckt, aber ich hatte sie überzeugt. Denn – neckte ich sie – wer wüsste schon, auf was für schnieke Partys sie in Oxford eingeladen würde, wo sich die Crème de la Crème des englischen Adels die Klinke in die Hand gibt?
Und kein Zweifel, auf diesem Foto befindet sie sich im großen Garten eines nicht gerade bescheidenen Landhauses. Sie sieht aus, als hätte sie den Spaß ihres Lebens.
Sie hatte ja keine Ahnung, dass es bald vorbei sein würde.
Ich starre auf das Foto und erschaudere. Ein prächtiges Haus auf dem Land … ein elegantes Event …
War das der Abend, an dem sie entführt wurde?
Mir klopft das Herz bis zum Hals, als ich das Bild nach Informationen absuche. Wren hatte keine nützlichen Erinnerungen an diese Party, wie sehr sie auch in ihrem Gedächtnis kramte. Wo sie stattgefunden hatte, wer dort gewesen war, wie sie überhaupt dort hingekommen war … Sie hatte sich gefragt, ob sie sich die flüchtigen Bilder von Abendkleidern und Champagnergläsern nur einbildete, aber dieses Foto im Jahrbuch passt zu ihren Erinnerungsfetzen.
Das ist es, wird mir klar: Der erste Beweis dafür, dass sie überhaupt auf dieser Party war.
Was war das für ein Event?
Meine Hoffnung wächst. Wenn ich wüsste, wo das Foto aufgenommen wurde, könnte ich versuchen, an eine Gästeliste zu kommen, Fotos, den zeitlichen Ablauf rekonstruieren und herausfinden, wann sie entführt wurde.
Begierig suche ich das Jahrbuch nach weiteren Informationen ab, aber der Fotograf wird nicht genannt und Wrens Name auch nicht. Man sieht ihr Gesicht nicht, also würde sie außer mir niemand erkennen.
Mich verlässt der Mut. Eine Sackgasse. Aber es ist nicht nichts, gemahne ich mich: Es ist ein Puzzleteil. Und da ich so wenig habe, kann jedes Detail wichtig sein. Ich fotografiere die Jahrbuchseite. Dann will ich gerade die anderen Namen googeln, da dringt gedämpftes Glockenläuten an mein Ohr. Es ist zwölf Uhr.
Shit.
Ich springe auf, krame den zerknitterten Stundenplan aus meiner Tasche. 12:00 Uhr, Freidenker und das Gesetz: Kreuzgang 5.
Doppelshit.
Ich raffe meine Sachen zusammen, schiebe das Jahrbuch zurück ins Regal und renne aus der Bibliothek. Die Kreuzgänge liegen auf der entgegengesetzten Seite des Campus, also rase ich durch Studierendengruppen auf dem Innenhof.
»Pass doch auf!«, ruft jemand, als ich ihn anrempele, aber ich werde nicht langsamer. Ich bin außer Atem, als ich beim Raum ankomme, am Ende einer engen Treppe über den kühlen Kreuzgängen. Die alte schwere Tür klemmt.
Komm schon! Ich werfe mich noch einmal mit meinem ganzen Gewicht dagegen …
… und purzele in den Raum, als die Tür plötzlich nachgibt. Um nicht auf dem Hintern zu landen, greife ich nach dem erstbesten soliden Gegenstand, einem Kleiderständer neben der Tür. So solide ist er aber leider nicht. Jacken und Mäntel fallen zu Boden.
»Shit, tut mir leid«, fluche ich und sammele sie schnell auf. Dann sehe ich auf, schwer atmend, mit rotem Kopf. Ich stehe in einem eleganten Studierzimmer mit Bücherregalen an den Wänden, und fünf grinsende Studierende starren mich an.
Und ein gut aussehender, geheimnisvoller Professor, der breiter grinst als alle anderen.
Ich bin schockiert beim Anblick der mir inzwischen schon vertrauten breiten Schultern und des durchdringenden, süffisanten Blicks.
Natürlich er. Wer sonst.
»Miss Peterson, nehme ich an?« Professor Saint Clair sieht mich belustigt an. Seit unserer frühmorgendlichen Begegnung hat er sich offensichtlich rasiert und umgezogen. Jetzt sieht er makellos zurechtgemacht aus, das feuchte dunkle Haar lockt sich über den stechend blauen Augen. Er sitzt lässig in einem Bürosessel, in schlichtem Hemd und dunklen Jeans. Er würde glatt als einer der Studenten durchgehen, wenn er nicht solche Macht und pures Selbstvertrauen ausstrahlen würde.
Niemand würde bezweifeln, dass er in diesem Raum das Sagen hat.
»Professor.« Ich muss schlucken, versuche zu Atem zu kommen und meinen Puls, der bei seinem Anblick zu rasen beginnt, zu ignorieren. »Ja. Hallo.«
Am anderen Ende des Raums gibt es einen freien Platz, über Taschen und ausgestreckte Beine klettere ich dorthin.
»Was haben Sie vor?« Saints Stimme klingt ruhig, gelassen.
Ich stutze. Ist das ein Test? »Ich wollte mich setzen.«
»Sie sind zu spät«, fährt er dazwischen.
»Nur vier Minuten«, sage ich zu ruppig. Er zieht eine Augenbraue hoch, und mir fällt ein, dass ich ja nicht auffallen darf.
Vor allem nicht diesem Typen.
»Tut mir leid«, werfe ich hastig ein. »Ich war in der Bibliothek und habe die Zeit aus den Augen verloren. Kommt nicht wieder vor.« Endlich bin ich in der Ecke angekommen und lasse mich auf den wackeligen Stuhl sinken.
»In der Tat«, stimmt Saint freundlich zu. »Ich dulde keine Unpünktlichkeit. Daher muss ich Sie bitten, zu gehen.«
»Was? Jetzt?«
»Wenn Sie so freundlich wären, Miss Peterson.« Er lächelt wieder sein träges Lächeln. »Sie haben diesen Kurs schon genug gestört, denken Sie nicht?«
»Aber jetzt bin ich ja hier. Bereit und begierig zu lernen.« Die anderen Studenten tauschen Blicke und stoßen sich untereinander an, ich warte darauf, dass mir einer zu Hilfe kommt und sagt, es sei schon in Ordnung.
Doch nein, sie sitzen nur da und schauen eingebildet, als sei das hier eine Art Wettbewerb und ich sei in der ersten Runde disqualifiziert worden.
»Bitte, Professor?«, sage ich gewollt zerknirscht. Angesichts seines Rufes versuche ich es mit einem unschuldigen Lächeln und klimpere sogar ein wenig mit den Wimpern. Klar, ich bin kein verschämter Erstsemester, aber wenn er auf Studentinnen steht, kann ich ihn ja vielleicht bezirzen. »Könnten Sie eine Ausnahme machen? Nur dieses eine Mal? Ich wäre Ihnen so dankbar«, füge ich atemlos hinzu.
Aber Saint trinkt langsam einen Schluck Kaffee, zuckt ungerührt mit den Schultern. »Was wäre das denn für ein Beispiel, wenn ich Sie bleiben ließe?« Er mustert mich von oben bis unten, als könne er in mich hineinblicken, als könne er sehen, dass ich nicht hier hingehöre.
»Sie können nicht mit Verspätung hier reinplatzen und dank Ihres hübschen Augenaufschlags erwarten, dass sich alle Ihren Launen beugen«, fährt er fort. »Ziemlich klischeehaft, finden Sie nicht? Es lässt Sie nicht halb so cool aussehen, wie Sie glauben.«
Die Worte kommen mir bekannt vor, o nein: Er zitiert mich, übertrumpft mich mit meiner eigenen Schlagfertigkeit!
Ich kneife die Augen zusammen, treffe seinen selbstgefälligen Blick. Darum geht es also. Ich habe heute Morgen sein fragiles männliches Ego verletzt, und jetzt dreht er den Spieß um und zeigt mir, wer hier am längeren Hebel sitzt.
»Na los.« Er weist mit dem Kinn zur Tür. »Husch, husch!«
Husch, husch? Als wäre ich ein Haustier, das er durch die Gegend scheuchen kann!
Ich kann meine wütende Antwort gerade noch zurückhalten. Vergiss nicht, du bist undercover. Ich will nicht auffallen. Das heißt, ich sollte mich nicht gleich am ersten Tag mit dem Starprofessor anlegen.
Also stehe ich auf, zwinge mich zu langsamen, gelassenen Bewegungen. Als würde unter den höhnischen Blicken meiner Kommilitonen nicht brennende Scham meinen Körper fluten. Ich stiefele zurück und achte dabei diesmal deutlich weniger darauf, nicht auf Taschen zu treten und die anderen anzurempeln.
Doch trotz der Stimme in meinem Kopf, die mich mahnt, still zu sein und die öffentliche Demütigung durch dieses verboten gut aussehende Arschloch einfach hinzunehmen, bleibe ich dennoch an der Tür stehen. »Gilt die Verbannung aus Ihrem Seminar für das ganze Semester oder nur für heute?«, frage ich und bedenke ihn mit einem eisigen Blick. »Ich würde nämlich wirklich gern irgendetwas lernen«, füge ich unfreiwillig sarkastisch hinzu. »Das ist schließlich Ihr Job, oder? Also, im Gegensatz zu Ihren Aktivitäten außerhalb des Lehrplans?«
Ich warte keine Antwort oder neuerliche Demütigung ab, sondern drehe mich um und gehe.
Und ja, ich lasse die Tür hinter mir zuknallen. Ist das unreif? Vielleicht. Aber irgendetwas an diesem Saint-Typen nervt mich einfach ganz gewaltig.
Zum Beispiel, dass es ihn offensichtlich antörnt, Leute herumzukommandieren, als habe er die totale Kontrolle.