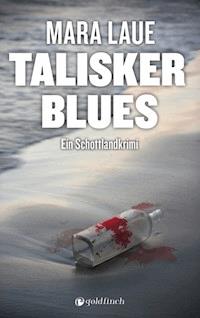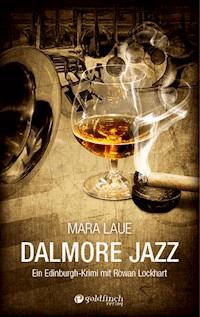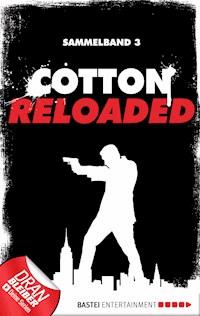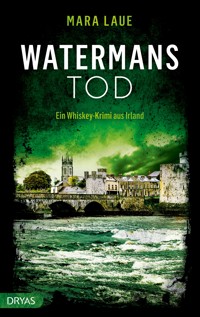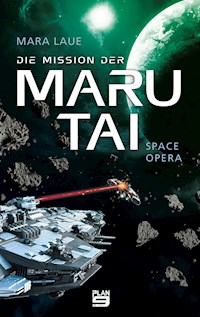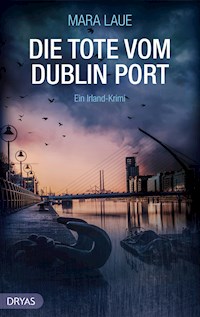4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: vss-verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: D.O.C.-Agents
- Sprache: Deutsch
FBI-Agent Wayne Scott ist Telepath und deshalb ein wertvoller Mitarbeiter für die Sonderabteilung DOC – Department of Occult Crimes. Was ihm beruflich nützt, macht ihn privat zu einem einsamen Mann. Als er eine Serie von Fällen aufklären muss, bei denen Menschen auf unerklärliche Weise in Katatonie versetzt werden, begegnet er im Zuge der Ermittlungen Kianga Renard und stellt fest, dass sie eine ähnliche Gabe besitzt. Beide fühlen sich nicht nur deshalb sofort zueinander hingezogen. Doch Kia verbirgt ein Geheimnis und kennt offenbar den Täter. Als immer mehr Indizien darauf hindeuten, dass sie mit dem unter einer Decke steckt, gerät Wayne in einen tiefen Konflikt zwischen Liebe und Pflicht. Aber auch Kia steht vor einer schweren Entscheidung. Denn um an die Macht zu gelangen, über die sie seit ihrer Geburt verfügt, hat der Täter Wayne aufs Korn genommen und will nicht nur dessen und Kias Seele, sondern auch ihr Leben. Schattenspur ist der erste Band der Dark-Romance-Serie D.O.C.-Agents. Ebenfalls erschienen: Band 2 – Gefährliche Spur Band 3 – Sturmspur in Vorbereitung: Band 4 - Eisspur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
D.O.C.-Agents 1: Schattenspur
Vorspann
Schattenspur
D.O.C. - Agents 01
Mara Laue
Impressum
Schattenspur
DOC-Agents 01
Mara Laue
© 2018 vss-verlag, 60389 Frankfurt
Covergestaltung: Sabrina Gleichmann
Korrektorat: Hermann Schladt
www.vss-verlag.de
1.
Willard Drake bot seinem Klienten einen Platz an und wartete, bis dieser sich gesetzt hatte, ehe er ebenfalls Platz nahm. Er legte die Hände auf die Tischplatte vor sich und empfand die Berührung des massiven Holzes als beruhigend. Wie den Schutzwall einer Festung, hinter dem er sicher zu sein hoffte. Der Mann war ihm unheimlich. Was ganz sicher nicht daran lag, dass Louis Durant ein Hüne von fast sieben Fuß war und Willard um mehr als einen Kopf überragte. Es hatte auch nichts mit dem Spazierstock zu tun, den er trug. Ein exotisches Stück aus glatt poliertem schwarzem Holz, um das sich zwei geschnitzte Schlangen wanden, und dessen Knauf ein elfenbeinfarbener Schädel in Kindskopfgröße bildete. Willard hoffte, dass das Ding aus Plastik war und kein echter Schädel.
Sein Unbehagen lag auch nicht daran, dass Durant seine Handschuhe anbehielt, obwohl es alles andere als kalt draußen und erst recht nicht hier drin war, oder dass er Willards dargebotene Hand ignorierte. Es lag ebenfalls nicht daran, dass Durant ein Schwarzer war. Willard hatte einen Teil seines Lebens in Afrika verbracht und nicht nur dort eine Menge farbiger Freunde und keine Vorurteile gegen Menschen anderer Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Was ihm bei Durant einen kalten Schauder über den Rücken jagte, waren dessen Augen. Je nachdem, wie das Licht auf sein Gesicht fiel, waren sie pechschwarz und wirkten wie Löcher, die alles aufsogen, was sie anblickten. Weshalb Willard nach Möglichkeit direkten Blickkontakt vermied, weil er das irrationale Gefühl hatte, Durant würde ihm sonst die Seele aussaugen. In einem anderen Licht schienen die Augen wie die Feuer der Hölle zu glühen mit einem rötlichen Schimmer, der an Blut erinnerte. Durants Alter war schwer zu schätzen. Er wirkte alterslos und hätte alles zwischen dreißig und sechzig sein können.
„Darf ich Ihnen etwas anbieten, Mr. Durant? Kaffee, Tee, einen Frucht…“
„Nein. Haben Sie, was ich will?“
Willard zuckte beim Klang der kalten Stimme zusammen. „Ja, Sir, ich habe sie gefunden.“ Er schob ihm eine Akte hin, dankbar, dass Durant das Getränk abgelehnt hatte. Umso schneller war der unheimliche Mann wieder verschwunden. Hoffentlich.
Durant schlug den Ordner auf und blickte zufrieden lächelnd auf das Bild der jungen Frau, das dem obersten Blatt angeheftet war. Das Lächeln verstärkte Willards Unbehagen. Es besaß etwas Diabolisches. Er fragte sich, ob es richtig gewesen war, diesen Auftrag anzunehmen und dadurch, dass er die junge Frau ausfindig machte, sie diesem unheimlichen Mann auszuliefern. Normalerweise kannte Willard solche Skrupel nicht. Er war Privatermittler und wurde dafür bezahlt, Leute aufzuspüren, die seine Auftraggeber finden wollten. Durant zahlte fürstlich und feilschte um keinen einzigen Cent der Spesen, die Willard ihm jeden Monat berechnete.
Aber dieses dämonische Lächeln ließ ihn ahnen, dass der Mann mit ihr etwas anderes plante, als ihr das Erbe eines verstorbenen haitianischen Verwandten zukommen zu lassen, wie er behauptet hatte. Willard bezweifelte, dass Durant überhaupt Anwalt war, obwohl seine Nachforschungen ergeben hatten, dass es tatsächlich einen Anwalt namens Louis Durant auf Haiti unter der Adresse in Carrefour gab, die Durant ihm genannt hatte.
Durant schloss die Mappe. „Was schulde ich Ihnen?“
Willard reichte ihm die Rechnung. Durant warf einen Blick darauf, zückte sein Scheckbuch und schrieb ohne zu zögern einen Scheck über knapp zehntausend Dollar aus. Mit einer Geste, als würde er einem Hund einen Knochen hinwerfen, ließ er ihn vor Willard auf den Tisch fallen und stand auf.
Willard erhob sich ebenfalls. „Sie wollen der Frau wirklich ein Erbe auszahlen?“
Der Blick, den Durant ihm zuwarf, ließ Willards Atem stocken. Das kalte Lächeln schien die Luft im Raum zu gefrieren. „Würde ich mir sonst so viel Mühe machen, sie zu finden?“
Willard fielen dafür spontan zwei Dutzend andere Gründe ein, keiner davon angenehm für die Frau. Aber er hütete sich, das zu äußern. Er wollte, dass Durant verschwand und ihn nie wiedersehen. Der steckte die Akte und die Rechnung in seinen Aktenkoffer und wandte sich zur Tür.
„Ich hoffe, Sie waren mit meiner Arbeit zufrieden, Sir.“
„Ja, Sie sind Ihr Geld wert, Mr. Drake. Guten Tag.“ Er reichte Willard die behandschuhte Hand, die er widerwillig drückte. „Danke, ich finde allein hinaus.“
Willard atmete auf, als Durant die Bürotür von außen schloss. Er rieb sich die Hand. Auf der Innenfläche breitete sich ein unangenehmes Kribbeln aus. Das lag wohl an dem aufgerauten Leder von Durants Handschuh, das einen Juckreiz verursachte. Er ging zum Waschbecken und ließ kaltes Wasser darüber laufen. Seine Brust wurde eng. Ein Asthmaanfall? Unmöglich. Er hatte seit neun Jahren keinen mehr gehabt. Er versuchte, tief einzuatmen, aber ein eiserner Ring schien um seine Brust zu liegen, der nicht zuließ, dass seine Lunge sich dehnte und die benötigte Luft einsog. Verdammt, was war das?
Er wankte zum Schreibtisch, auf dem sein Smartphone lag, um den Notarzt zu rufen. Die Hand, die er Durant gereicht hatte, brannte wie Feuer und hatte begonnen anzuschwellen. Schlagartig begriff Willard. Gift! Durant hatte seinen Handschuh mit irgendeinem Gift präpariert, das durch die Berührung in seinen Körper drang und ihn umbrachte. Aber warum?
Er streckte die Hand nach dem Smartphone aus, dessen Konturen verschwammen. Die Hand griff ins Leere. Der Rest Luft in seiner Lunge war aufgebraucht. So sehr er versuchte, neuen Atem zu schöpfen, er schaffte es nicht. Er stürzte und fiel in die Dunkelheit.
*
Stille. Wayne Scott schloss die Tür seines Apartments, schloss gleichzeitig die Augen und lauschte. Er hörte den Lärm von den Straßen, ein Flugzeug und aus der Ferne die Musik eines Spielcasinos. Aber in seinem Kopf war wohltuende Stille. Kein Gedanke eines anderen Menschen drang zu ihm durch.
Er lächelte. My home is my castle. Und dieses Castle war von einem besonderen Schutz umgeben, der verhinderte, dass die Gedanken anderer Menschen in sein Bewusstsein sickerten, während er schlief. Solange er wach war, konnte er sie ausblenden, weil er schon lange gelernt hatte, seinen Geist gegen das Chaos von unzähligen Gedanken abzuschirmen, die in den Köpfen der Menschen um ihn herum kreisten. Aber im Schlaf wurde diese Barriere schwach und hörte ab einem gewissen Punkt auf zu existieren. Mit dem Ergebnis, dass er die Gedanken seiner Nachbarn mitbekam oder ihre Träume mitträumte. Seit eine gute Freundin diesen Schutz installiert hatte, herrschte himmlische Stille, was fremde Gedanken betraf. Von diesen hatte er vorhin mal wieder ungewollt mehr mitbekommen, als er sich gewünscht hätte.
Er legte die Autoschlüssel in die Schale auf dem Garderobentisch, hängte sein Jackett an den Kleiderhaken und ging ins Schlafzimmer. Eine heiße Dusche würde ihm guttun und vielleicht die Enttäuschung vertreiben. Dabei sollte er sich längst an diese Art von Enttäuschungen gewöhnt haben. Schließlich sind Telepathen einsame Menschen. Nicht nur, weil sie genau wissen, was die Leute um sie herum wirklich denken und in dem Zug ihre ständigen Lügen entlarven, sondern auch, weil nahezu jeder den Kontakt zu ihnen abbricht, sobald er erfährt, dass er es mit jemandem zu tun hat, der Gedanken lesen kann. „Monster“ war die gängige Beschimpfung, die darauf reflexartig entweder verbal oder in Gedanken erfolgte. So oder so, Wayne hatte immer noch nicht den Punkt erreicht, an dem ihn das kaltließ. Dazu hatte er diese Form von Verletzung zu oft erlebt.
Heute war es nicht ganz so weit gekommen. Er hatte nach dem Dienst noch einen Drink in The Lounge im Palms genossen. Dass eine schöne Frau, die sich ebenfalls dort aufhielt, Interesse an ihm zeigte, kam ihm alles andere als ungelegen. Das Gespräch mit ihr entwickelte sich positiv, und schon nach ein paar Minuten war klar, dass sie miteinander in irgendeinem Bett landen würden. So weit, so gut. Doch dann hatte sie so intensiv daran gedacht, Wayne KO-Tropfen beizubringen und in aller Ruhe seine Kreditkarten zu klonen, dass die Intensität ihrer Gedanken seinen mentalen Block durchdrungen hatte. Als er daraufhin beiläufig erwähnte, dass er FBI-Agent war, hatte sie sich unter dem Vorwand, die Toilettenräume aufzusuchen, aus dem Staub gemacht.
Inzwischen hatte er sie von den Kollegen des Las Vegas Police Department festnehmen lassen. In ihrem Hotelzimmer hatten sie eine Menge kopierte Kreditkarten und Rohlinge gefunden sowie Schmuck, der garantiert nicht ihr gehörte, wie etliche eingravierte Widmungen bewiesen. Las Vegas zog eben nicht nur Touristen aus aller Welt an, sondern auch Gauner aller Art.
Er zog sich aus, ging ins Bad und stellte das Duschwasser so heiß ein, wie er es ertragen konnte. Er stützte die Hände gegen die gekachelte Wand und genoss die Hitze. Sie gab ihm das Gefühl, in einen schützenden Mantel eingehüllt zu sein, in den die Welt nicht einzudringen vermochte.
Nur das Klingeln eines Smartphones durchdrang nahezu alles.
Wayne seufzte, wickelte sich ein Handtuch um die Hüften und nahm den Anruf entgegen. Da ihm schon der Klingelton verraten hatte, dass der Anruf von seiner Chefin SAC – Special Agent in Charge – Cecilia O’Hara kam, hielt er sich nicht damit auf, sich zu melden.
„Ich nehme an, Sie wissen, wie spät es ist, Ma’am?“
„Natürlich, Agent Scott. Erzählen Sie mir nicht, Sie hätten schon geschlafen.“
„Nein, Ma’am, geduscht. Was liegt an?“
„Unregelmäßigkeiten in Savannah, die in unser Ressort fallen könnten. Agent Halifax wird Sie briefen, sobald Ihre Maschine gestartet ist. Nämlich in einer Stunde vom McCarran Airport.“
O’Hara wartete Waynes Antwort nicht ab, sondern unterbrach die Verbindung. Wayne legte das Phone zur Seite, trocknete sich ab und zog sich an. Da er ständig auf Abruf bereitstand, hatte er immer einen Koffer fix und fertig gepackt. Den holte er aus dem Schrank, vergewisserte sich, dass alles drin war, was er brauchte, und verließ die Wohnung.
*
„Ich hoffe, O’Hara hat dich nicht auch mitten aus der schönsten Sache der Welt gerissen mit ihrem Anruf.“ Travis reichte Wayne die Hand, als er im FBI-Flugzeug ihm gegenüber Platz nahm.
„Nein. Aber wenn alles gelaufen wäre, wie ich es eigentlich geplant hatte, wäre genau das passiert.“
Travis gab sich schockiert. „Was denn – du hast dir einen Korb geholt? Und ich war bei diesem denkwürdigen Ereignis nicht dabei.“
„Die drei Buchstaben ‚FBI’ wirken leider nicht nur auf Männer wie eine kalte Dusche.“
„Demnach hatte die Dame Dreck am Stecken.“
Wayne winkte ab. „Was gibt es diesmal?“
Travis schob ihm eine Akte hin. „Drei Fälle von unerklärlicher Katatonie.“
Wayne schüttelte den Kopf und schlug die Akte auf. „Das allein wäre nichts für unsere Spezialeinheit. Wo ist der Haken?“
„Bei den verschwundenen Amuletten oder Talismanen. Bei ihrer Einlieferung in die Klinik hatten alle drei einen kleinen Beutel mit einem undefinierbaren Symbol darauf um den Hals. Das Personal konnte glaubhaft versichern, dass sie die Dinger zu den persönlichen Sachen der Leute gelegt haben. Das ist auch dokumentiert. Exakt einen Tag nach dem Auftreten der Katatonie ist der Beutel in allen drei Fällen verschwunden. Die Klinik hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.“
Und diese Anzeige wegen verschwundener Talismane in Zusammenhang mit einer Häufung von Katatoniefällen, für die es keine medizinische Erklärung gab, wie Wayne in der Akte las, hatte ihre Spezialabteilung auf den Plan gerufen. Schließlich gab es eine Reihe von Mitarbeitern, die den ganzen Tag nichts anderes taten, als sich in jeden Krankenhausserver und die Server aller Polizeidienststellen landesweit einzuklinken und nach genau solchen ungewöhnlichen Vorkommnissen zu suchen. Vielmehr taten das die Computerprogramme selbstständig und gaben Alarm, sobald sie etwas gefunden hatten.
Wayne konnte sich denken, warum SAC O’Hara ausgerechnet ihn und Travis nach Savannah schickte. Er als Telepath sollte versuchen, Zugang zum Geist der Betroffenen zu bekommen, um aus ihren Gedanken zu entnehmen, was ihnen zugestoßen war. Travis besaß die Gabe der Retrospektion. Er konnte dadurch vergangene Ereignisse sehen, sofern sie nicht länger als vierundzwanzig Stunden zurücklagen. Zwar würde diese Gabe ihm nichts mehr offenbaren, was die drei vorliegenden Fälle betraf, aber falls es sich, wie O’Hara vermutete, tatsächlich um den Beginn einer Serie handelte – anderenfalls sie kaum zwei Agents vor Ort schicken würde –, würde es weitere Fälle geben. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass die Ursache dafür nicht im okkulten Bereich im weitesten Sinn zu suchen wäre und damit kein Fall für O’Haras Spezialeinheit war, konnten sie die Fälle möglicherweise aufklären. Bevor sie in Savannah ankamen, sollten sie sich jedoch eine plausible Erklärung einfallen lassen, warum die „Special Cases Unit“ des FBI sich für die Fälle interessierte.
Dabei war die SCU nur eine Tarnung für das DOC, das Department of Occult Crimes. Das war so geheim, dass nicht mal der Präsident von seiner Existenz wusste. Zumindest war er nicht über die wahren Hintergründe der Arbeit der Abteilung informiert. Schließlich glaubte auch der Präsident nicht an die reale Existenz von Geschöpfen wie Dämonen, Werwölfen, Vampiren und echter Magie. Die waren jedoch laut den Wissenschaftlern des DOC keine mystischen übernatürlichen Dinge, sondern ließen sich wissenschaftlich erklären, wenn auch die genauen Zusammenhänge immer noch nicht vollständig erforscht waren.
Fest stand jedenfalls, dass die besagten nichtmenschlichen Wesen keineswegs unnatürliche, von irgendwelchen Teufeln erschaffenen Kreaturen waren, sondern das Ergebnis natürlicher, wenn auch sprunghaft aufgetretener Genmutationen. Da sich bestimmte Gebiete lokalisieren ließen, in denen diese Mutationen nachweislich zuerst und in gehäufter Zahl aufgetreten waren, ließen sich dadurch Rückschlüsse auf die Ursachen ziehen. Die ersten Werwolfpopulationen hatte es in Osteuropa und Sibirien gegeben, und zwar in einem Gebiet, in dem es vor Jahrtausenden einen Meteoreinschlag gegeben hatte. Die ersten Vampire waren ungefähr zeitgleich in Südamerika und Ägypten entstanden, nachdem es dort ähnliche Naturkatastrophen gegeben hatte.
Dämonen dagegen existierten schon so lange, dass sich ihre Entstehung nicht mehr mit einem besonderen Ereignis in Verbindung bringen ließ. Aber der Verdacht lag nahe, dass sie auf ähnliche Weise entstanden waren. Außergewöhnliche Strahlungsvorkommen riefen offenbar solche Mutationen hervor, zu denen auch die „magischen“ Kräfte gehörten. Nach den bisherigen Forschungsergebnissen der Wissenschaftler war Magie nichts anderes als die Beeinflussung von Materie auf atomarer Ebene beziehungsweise der elektromagnetischen und sonstigen natürlichen Ströme in der Atmosphäre und der Erde mithilfe besonderer, ebenfalls durch Mutationen entstandenen geistigen Fähigkeiten. Weil sich diese Fähigkeiten dominant auf alle Nachkommen vererbten, kumulierten sie sich, wenn zwei Mutanten miteinander Kinder zeugten. Das erklärte, warum die Dämonen mit dem längsten Stammbaum über die stärksten dieser Kräfte verfügten und die geborenen Werwölfe und Vampire stärker, schneller und weniger verwundbar waren als Menschen, die von ihrem mutierten Blut oder Speichel infiziert wurden und dadurch mutierten.
Die unwissenden frühen Menschen hatten in Ermangelung wissenschaftlicher Kenntnisse und vernünftiger Erklärungen für diese Phänomene Menschen mit solchen Fähigkeiten zu Hexen und die besagten anderen Kreaturen zu mystischen Teufelsgeschöpfen erklärt.
Die Hauptaufgabe des DOC lag zwar in der Aufklärung von im Rahmen von Schwarzen Messen begangenen Tierquälereien und Ritualmorden bis hin zum Unschädlichmachen von Leuten, die ihre paranormalen oder tatsächlich magischen Fähigkeiten benutzten, um Verbrechen zu begehen, sowie aller anderen Verbrechen mit okkultem Hintergrund. Seine zweite, noch wichtigere Aufgabe bestand jedoch darin zu verhindern, dass die Menschheit von der Existenz echter Magie und jener nichtmenschlichen Geschöpfe erfuhr, die die Mythen und Legenden bevölkerten. Trotz der inzwischen existierenden wissenschaftlichen Erklärungen gäbe es eine Hexenjagd und einen Genozid ohnegleichen, weil die Menschen die Anderswesen, wie einige von ihnen sich selbst bezeichneten, wegen ihrer Fähigkeiten fürchteten und ablehnten. Und die Überzeugung, dass diese Wesen ein Gräuel in Gottes Augen und eine Verhöhnung seiner Schöpfung wären, steckte zu tief in zu vielen von ihnen.
Wayne hatte oft genug am eigenen Leib die Reaktionen erfahren, denen Leute wie er ausgesetzt waren, nur weil sie eine Gabe besaßen, die andere Menschen als bedrohlich empfanden. Seine Eltern hatten sie ihm erst prügelnd auszutreiben versucht und ihn, als das nichts half, schon als Kind in die Psychiatrie gesteckt, wo man seine Gabe mit heftigen Medikamenten kastriert hatte, bis er sich wie ein Zombie fühlte. Er hatte schnell gelernt, die Medikamente verschwinden zu lassen, statt sie einzunehmen und so zu tun, als hätte er durch die Einnahme die Gabe nach einiger Zeit verloren. Ohne Erfolg, was sein Verhältnis zu seinen Eltern betraf. Als er nach Hause entlassen worden war, hatten sie ihn immer noch behandelt wie einen Aussätzigen. Sein Vater hatte ihn weiterhin bei jeder Kleinigkeit geschlagen, aus Angst, dass Wayne seiner Mutter noch einmal verraten könnte, dass er sie betrog. Mutter quälte sich mit Selbstvorwürfen und Selbsthass für ihren Mangel an Glauben, den sie dafür verantwortlich machte, dass der Teufel in sie hatte fahren können, um ein Monsterkind mit ihr zu zeugen. Wayne war überaus dankbar gewesen, als sie ihn in ein Internat abgeschoben hatten. Und sie waren dankbar gewesen, dass er die Ferien freiwillig in irgendwelchen Feriencamps verbrachte, für die sie mit Freuden jede Summe zahlten, wenn er nur nicht mehr nach Hause kam.
Eines dieser Camps befand sich im Navajo-Reservat in New Mexico. Wayne wusste immer noch nicht, wodurch er die Aufmerksamkeit der alten Frau erregt hatte, aber Nona Sunraven suchte seine Nähe, lud ihn in ihr Haus ein und offenbarte ihm schließlich, dass er keineswegs der Einzige war, der außergewöhnliche Fähigkeiten besaß. Dass Magie ebenso real war, wie ein yéé naaldlooshii – „der in Tiergestalt wandelt“, ein Wergeschöpf – Geister und Dämonen. Nona hatte ihm gezeigt, wie er seinen Geist verschließen konnte, damit er nicht alles hörte, was um ihn herum gedacht wurde. Seitdem nahm er nur die wirklich intensiven Gedanken wahr. Leider dachten sehr viele Menschen sehr laut. Er hatte es Nona zu verdanken, dass er seine Fähigkeit als Gabe sah und nicht mehr als Fluch, der ihn aus der Gemeinschaft der Menschen ausschloss. Er besuchte die alte Schamanin immer noch regelmäßig, wenn er Urlaub hatte.
Allerdings hatte er sich nicht immer so gut im Griff, wie er wollte, denn ab und zu reagierte er in einer Weise, die einem aufmerksamen Beobachter oder jemandem mit messerscharfem Verstand verriet, dass er eine besondere Gabe besaß. Zum Beispiel Otis Delacroix, der das DOC vor vierzig Jahren gegründet hatte. Er bestellte alle FBI-Agents zum persönlichen Gespräch, die besonders erfolgreich waren, und unterzog sie verschiedenen Tests. Selbst diejenigen wie Wayne, die sich die größte Mühe gaben, sich nicht zu verraten, hatten früher oder später unwillkürlich ihre Fähigkeiten offenbart; spätestens, wenn sie in Lebensgefahr gerieten und sie benutzen mussten, um zu überleben. Erst im Nachhinein hatten sie erfahren, dass diese lebensgefährlichen Situationen von Delacroix und seinen Leuten inszeniert waren.
Die positiv auf eine paranormale Gabe getesteten Agents hatte er ins DOC geholt. Zwar besaßen bei Weitem nicht alle DOC-Mitarbeiter solche Fähigkeiten, aber mindestens ein Agent der Teams im Außendienst verfügte über eine dem jeweiligen Fall angemessene besondere Fähigkeit.
Als Cecilia O’Hara nach Delacroix’ Pensionierung vor ein paar Jahren die Leitung des DOC übernommen hatte, war sie noch einen Schritt weitergegangen und hatte Operation Spinnennetz ins Leben gerufen. Da man Feuer am besten mit Feuer bekämpft, hatte sie sich nicht wie Delacroix darauf beschränkt, Agents mit paranormalen Fähigkeiten zu beschäftigen, sondern begonnen, Leute zu rekrutieren, die über dieselben oder ähnliche Fähigkeiten verfügten wie die Verbrecher, die sie jagten. Wie ein immer größer werdendes Spinnennetz zogen sich die so geknüpften Verbindungen mittlerweile über die gesamten Vereinigten Staaten.
Phase 1 bestand in der Gewinnung von Informanten aus der okkulten Szene, die Augen und Ohren und sonstige Sinne offenhielten und dem DOC meldeten, wenn sich irgendwo etwas zusammenbraute. Phase 2 stellte die Einbindung von Freelancern aus den Reihen der Anderswesen und der magischen Gemeinschaft dar, die mit dem DOC zusammenarbeiteten, aber ihm nicht angehörten. In Phase 3 wurden solche Leute regulär als FBI-Agents ausgebildet oder als Berater beim DOC fest angestellt. Leider waren bisher nur wenige geneigt, dieses Angebot anzunehmen.
Immerhin verdankte Wayne einem der Freelancer die gedankensichere Abschirmung seines Apartments. Samantha Tyler war ein Sukkubus, eine Dämonin, die sich von Sex ernährte, aber sie verfügte auch über immense magische Kräfte. O’Hara hatte sie engagiert, um mit Wayne und Travis einen Geheimbund auszuheben, der magisch begabte Kinder entführt hatte. Eigentlich in der besten Absicht, sie im Gebrauch ihrer Fähigkeiten zu unterweisen, um ihnen ein weitgehend normales Leben unter Menschen zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz war Entführung ein Kapitalverbrechen, zu dem am Ende noch Mordversuche an zwei Halbdämonen gekommen waren. Egal, in welchem Loch sich die Bande sicher wähnte, Sam hatte sie alle mit ihren magischen Fähigkeiten aufgespürt.
Dass Wayne im Zuge der Zusammenarbeit in den Genuss ihrer Verführungskünste gekommen war, betrachtete er als ausgesprochenen Glücksfall in mehr als einer Hinsicht. Sam wusste von seiner Gabe und ging völlig unbefangen mit ihm um. Was ihn nicht zum ersten Mal hatte wünschen lassen, dass es irgendwo auf der Welt eine Frau unter den Menschen gäbe, die seine Gabe ebenfalls nicht fürchtete. Doch in dem Punkt machte er sich keine Illusionen mehr und hatte sich nach drei Fehlversuchen in Sachen Beziehung damit abgefunden, dass er wohl ewig Junggeselle bleiben würde. Er konnte einer Frau, mit der er leben wollte, auf Dauer seine Fähigkeit nicht verschweigen. Spätestens, wenn er ihre Träume ungewollt mitbekam, würde sie das irgendwann merken und ihn dann zu Recht der Unaufrichtigkeit bezichtigen. Er hatte bei seiner zweiten Beziehung gewagt, sich seiner Freundin zu offenbaren, als er sich sicher war, dass sie dauerhaft zusammenbleiben würden. Obwohl sie behauptet hatte, dass es ihr nichts ausmachte, hatte dieses Geständnis ihr Verhältnis zerstört. Genau wie seine Eltern hatte sie das Bewusstsein nicht ertragen, dass er theoretisch jederzeit ihre Gedanken lesen könnte, wenn er wollte, und war gegangen.
Eine andere Beziehung war gescheitert, weil seine Freundin eines Tages zu intensiv über ihren Plan nachgedacht hatte, Wayne zu heiraten, um ihn in den häufigen Zeiten seiner beruflichen Abwesenheit ungestört mit ihrem Lover betrügen zu können, mit dem sie schon seit einer Weile hinter seinem Rücken ein Verhältnis hatte. Und sein dritter und letzter Versuch hatte schon bei der Erwähnung die Flucht ergriffen, dass er deduktive Fähigkeiten wie The Mentalist besaß, mit der er Menschen analysieren konnte. Auf einen vierten verzichtete er und beließ es bei One-Night-Stands. Obwohl auch die, so wie heute, manches Mal in die Hose gingen. Er seufzte.
„Dein Seufzen scheint sich nicht auf den Fall zu beziehen.“ Travis grinste.
Wenigstens sein Partner fürchtete seine Gabe nicht. Als Einziger in der Abteilung. Selbst andere DOC-Agents fühlten sich in Waynes Gegenwart unwohl; außer O’Hara. „Stimmt. Ich dachte an Sam.“
„Dann war das also ein sehnsuchtsvolles Seufzen. Ja, man kann nach ihr süchtig werden. Da unser Flug ein paar Stunden dauert, rufen wir sie an und laden sie ein, uns die Zeit zu vertreiben. Sie erwähnte mal, dass sie einem flotten Dreier nicht abgeneigt ist. Sie kann teleportieren und wäre in Sekunden hier.“
Sam mochte einem Jeu à trois nicht abgeneigt sein, Travis auch nicht, aber Wayne zog die Zweisamkeit vor. Davon abgesehen wusste er zwar, dass Sam ihrer Natur gemäß mehr als ein Mal auch mit Travis geschlafen hatte, aber er wollte nicht unbedingt daran erinnert werden und sich der Illusion hingeben können, dass er für sie etwas Besonderes gewesen war; zumindest ein winziges bisschen.
„Nein danke. Mir reicht es, wenn ich deinen Hintern – und alles andere – nach unseren Trainingsstunden im Umkleideraum zu sehen bekomme.“
Travis lachte. „Nur kein Neid, mein Freund.“
Wayne grinste. Er und Travis waren einander beim Kampftraining und auch beim Gewichtstemmen ebenbürtig. Das hinderte sie aber nicht daran, miteinander zu wetteifern, wer noch ein oder zwei Kilo mehr schaffte und mehr Muskeln aufgebaut hatte. Er tippte auf den Bericht. „Ob das verschwundene Amulett tatsächlich was mit der Katatonie zu tun haben könnte? Immerhin wäre es wohl kaum aufgefallen, wenn es nicht in allen drei Fällen aus rotem Stoff bestanden hätte.“
Travis nickte. „Ist nicht auszuschließen. Nehmen wir an, dass der katatonische Zustand tatsächlich okkulte Ursachen hat. Dann erscheint es wahrscheinlich, dass den Opfern eine entsprechende Bedrohung bewusst war, und sie sich von jemandem ein Amulett besorgt haben, das sie davor schützen sollte. Da die Dinger wohl mehr oder weniger gleich aussahen und alle Fälle in Savannah stattfanden, liegt der Verdacht nahe, dass sie sich an denselben Amulettmacher gewandt haben.“
„Hat nur nichts genützt.“ Wayne überflog die Berichte. „Alle drei Opfer sind Schwarze, stammen aber aus unterschiedlichen Schichten.“
Travis schenkte sich einen Kaffee aus einer Thermoskanne ein und schob auch Wayne einen Becher hin. „Ich hatte zuerst den Verdacht, dass die Gemeinsamkeit in der Zugehörigkeit zur selben Religionsgemeinschaft liegen könnte. Das würde auch die identischen Amulette erklären. Aber sie gehören ganz verschiedenen Richtungen an. Die eine ist Mitglied der First African Baptist Church, der andere bei den Independent Presbyterians, die dritte ist Atheistin.“
Wayne nickte. Bedauerlicherweise gab es kein Foto von einem der Amulette oder Talismane, anhand dessen sie in den DOC-Datenbanken hätten nachforschen können, woher es stammte oder welcher religiösen oder magischen Richtung es zuzuordnen war. Sie mussten mit den Angehörigen sprechen. Vielleicht konnte einer von denen ihnen eine genauere Beschreibung liefen. Er legte die Akte zur Seite. „Was sagen wir dem schwarzen Chief der Savannah Metro Police, warum zwei weiße FBI-Agents einer Sondereinheit in Fällen ermitteln, die oberflächlich betrachtet ausschließlich medizinisch-psychiatrischer Natur sind?“
„Dass wir gerade nichts Besseres zu tun haben und uns langweilen. Ich wette, das glaubt er uns aufs Wort.“
Wayne lachte. Auch wenn Travis das als Scherz gemeint hatte, war doch etwas Wahres daran, weil viele Cops das Vorurteil hegten, FBI-Agents hätten tatsächlich nichts Besseres zu tun, als dem Cop von der Straße das Leben schwer zu machen.
Travis trank einen Schluck Kaffee. „Ich glaube, hier könnte die Ausrede mit dem experimentellen Medikament plausibel klingen, das aus dem Versuchslabor entwendet wurde und dessen Spur nach Savannah führt, wo der Dieb es offensichtlich an den drei Opfern ausprobiert hat. Bei allem anderen berufen wir uns auf die übliche Notlüge von ‚top secret’.“
Wayne verzog das Gesicht. „Womit wir uns mal wieder so richtig schön unbeliebt machen. Auch bei den Kollegen des örtlichen FBI Field Offices.“
Travis zuckte mit den Schultern. „Unser Auftrag ist ‚to protect and defend’, zu schützen und zu verteidigen, nicht, uns beliebt zu machen.“
Damit hatte er natürlich recht, aber für Wayne schloss das Beschützen und Verteidigen der Bürger und des Landes nicht zwangsläufig aus, dass man bei eben diesen Bürgern und den Kollegen einen gewissen Respekt genoss. Er hatte das kleinliche Kompetenzgerangel sowieso nie verstanden. Klar, jeder schrieb sich gern einen Ermittlungserfolg auf die eigene Fahne. Aber wo es um die Aufklärung von Verbrechen ging, zählte für ihn nur, dass die Verantwortlichen aus dem Verkehr gezogen wurden. Wer sie dingfest machte, war letztendlich egal. Er persönlich hatte keine Probleme damit, den Erfolg jemand anderem zu gönnen, solange eine Tat aufgeklärt und der Schuldige bestraft wurde.
Leider war in einem Fall wie diesem manchmal das größte Problem, die dem normalen Verstand unerklärlichen Dinge plausibel zu begründen, damit man weder von den Beteiligten noch den eigenen Kollegen für verrückt gehalten wurde. Oder noch schlimmer das Geheimnis offenbarte, das die ahnungslose Bevölkerung auf keinen Fall wissen durfte. Aus diesem Grund mussten die DOC-Agents jedes Mal, wenn ein Fall tatsächlich auf einem okkulten Phänomen basierte, für die Menschen, besonders die Behörden, eine vernünftige Erklärung finden.
Der DOC-Jet startete. Obwohl das Hauptquartier in New York lag, gab es an jedem Ort, an dem eine Zweigstelle stationiert war, einen einsatzbereiten Jet. Las Vegas gehörte dazu. Wayne lehnte Travis’ Angebot ab, eine Partie Scrabble zu spielen, nachdem er die Akte gründlich durchgelesen hatte. Er ging in den hinteren Bereich des Jets, wo sich eine Kammer mit vier Liegen befand und versuchte, ein bisschen zu schlafen. Der morgige Tag würde anstrengend genug werden.
*
Kianga Renard beendete ihre Pirouette und ließ sich in einem perfekten Spagat zu Boden gleiten, die Fußspitze so weit gestreckt, dass sie mit ihrem Unterschenkel eine gerade Linie bildete. Sie schwang die Arme in weitem Bogen zur Seite und nach vorn in Richtung Zehenspitzen, beugte den Oberkörper und kam auf dem letzten Ton von Stravinskys Feu d’artifice zur Ruhe. Wie ein erloschener Funke eines grandiosen Feuerwerks.
Sie richtete sich auf und kam geschmeidig auf die Beine. Nicht schlecht, aber noch nicht gut genug, dass sie diese Choreografie mit ihrer Klasse einstudieren konnte. Aber bis zum nächsten Frühjahr, in dem die Klassen von The Ballett School Savannah ihr Können vor Publikum präsentierten, vergingen noch Monate. Schließlich lag das letzte Spring Festival erst sieben Wochen zurück. Sie hatte also noch viel Zeit, zu experimentieren und ihre Choreografie zu verfeinern. Dies war ohnehin nur der erste Versuch gewesen, um zu sehen, ob der grobe Ablauf funktionierte.
Sie schaltete den CD-Player aus, nahm ein Handtuch aus der Sporttasche, die sie neben die Tür gestellt hatte, und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Etwas fiel mit einem leisen Plumps zu Boden. Sie hob das rote Stoffsäckchen auf und hängte es sich um den Hals. Augenblicklich fühlte sie sich wohler. Sicher und beschützt. Beim Tanzen wurde grundsätzlich kein Schmuck getragen, weil er störte und die Gefahr von Verletzungen barg. Gerade als Lehrerin musste sie auch in diesem Punkt mit gutem Beispiel vorangehen. Außerdem durfte niemand diesen Beutel sehen, sonst verlor er seine Kraft. Deshalb legte sie ihn vor Beginn jeder Stunde notgedrungen ab. Sofort danach legte sie ihn wieder an, denn ohne diesen Schutz war sie angreifbar.
Sie nahm ihre Tasche, ging zu den Umkleideräumen und unter die Dusche. Bevor sie das Wasser aufdrehte, steckte sie den Beutel in eine undurchsichtige Plastiktüte und legte ihn in die Seifenschale in Griffweite. Anschließend trocknete sie sich noch in der Duschkabine ab, hängte sich den Beutel wieder um und wickelte sich das Handtuch um die Brust, unter dem er den Blicken anderer entzogen war. Die Maßnahme erwies sich als unnötig, denn die Waschräume der Ballettschule waren um diese Zeit nicht mehr besetzt. Die regulären Unterrichtsstunden waren vorüber und nur noch der Hausmeister, das Reinigungspersonal und wahrscheinlich die Direktorin im Haus.
Kia zog sich an und ging zum Parkplatz. Als sie das Gebäude verlassen hatte, fegte ein eisiger Hauch durch die warme Abendluft, der sie frösteln ließ und absolut nicht zur Jahreszeit passte. Erst recht passte er nicht zu der herrschenden Windstille. Sie legte die Hand auf die Brust, wo sie unter der Bluse den Ouanga-Beutel trug und murmelte ein Gebet. Das Gefühl von Kälte verschwand. Ihr Unbehagen blieb.
Sie stieg in ihren Wagen und fuhr in die East River Street, in der ihre Großmutter einen Laden für Gewürze, Tee und Kaffee besaß, über dem sie auch wohnte. In einem abgetrennten Nebenzimmer des Ladens bot sie zusätzlich Lebensberatung an. Sie las den Leuten aus dem Fa-Orakel, aus der Hand oder auch mal aus den Karten. Bei Bedarf fertigte sie Talismane und Amulette wie Ouanga-Beutel als Schutzzauber an. Erstaunlicherweise stammte ihre Kundschaft nicht nur aus dem afroamerikanischen Teil der Bevölkerung, sondern auch aus nahezu allen anderen. Wahrscheinlich, weil ihre Vorhersagen zutrafen und die Amulette und Talismane tatsächlich wirkten.
Als Kia nach Savannah gezogen war, hatte sie zunächst ebenfalls über dem Laden gewohnt, in einem bescheidenen Zimmer, das ihren Ansprüchen vollkommen genügte. Sie war von Haiti Schlimmeres gewohnt. Nachdem sie sich einen Job an der Ballettschule gesucht und ein bisschen Geld gespart hatte, war sie in eine Wohnung in der Abercorn Street umgezogen. Was sie nicht daran hinderte, ihre Großmutter jeden Tag zu besuchen; schließlich war die East River Street nicht weit von der Abercorn entfernt.
Als sie den Laden erreichte, stand ihre Großmutter in der Tür und blickte über die Straße auf den Fluss dahinter. Ihr Gesicht hatte einen entrückten Ausdruck, als befände ihr Geist sich nicht in dieser Welt. Kia störte sie nicht, sondern setzte sich in den Schaukelstuhl neben der Tür auf der Straße und wartete geduldig, dass ihre Großmutter ihre Kommunikation mit dem Fluss beendete. Schließlich seufzte sie und wandte sich zu Kia um. Ihr Gesicht war ernst.
„Großmutter? Ist alles in Ordnung?“
Sie lächelte. „Ja, mein Kind. Ich denke schon. Es sind nur viele neue Leute in der Stadt.“
Eine Lüge, wie Kia deutlich spürte. Aber sie respektierte, dass ihre Großmutter nicht über das reden wollte, was sie beunruhigte. Wenn sie dazu bereit war, würde sie die Sache von sich aus ansprechen.
Sie blickte Kia an und schüttelte missbilligend den Kopf. „Du hast bestimmt wieder den ganzen Tag nichts gegessen. So dürr, wie du aussiehst, findest du nie einen Mann.“
Kia seufzte und verdrehte die Augen. „Großmutter, ich bin Tänzerin. Ich darf nicht dick sein. Und ja, ich habe brav gefrühstückt und ordentlich zu Mittag gegessen. Lediglich das Abendessen fehlt noch. Da ich wusste, dass du wie immer was für mich aufgehoben hast, habe ich darauf spekuliert, bei dir was Leckeres abstauben zu können.“ Sie drückte ihrer Großmutter einen Kuss auf die Wange.
Die nahm sie in die Arme und lachte. „Ach, Kind! Was mir gehört, gehört doch auch dir.“ Sie strich Kia über den Kopf. „Soll ich dir nachher die Haare flechten?“
„Danke, heute nicht.“ Heute war ihr danach, ihr Haar offen zu tragen, nachdem sie es den ganzen Tag für den Unterricht und ihr Training in einen strengen Knoten hatte binden müssen.
„Hallo, Alma.“
Kia zuckte beim Klang der Männerstimme hinter ihr zusammen. Als sie sich umdrehte, blickte sie in das dunkle Gesicht von Charlie Hannah, der heute seine Rastazöpfe am Hinterkopf mit einem Band aus Muschelperlen zusammengeknotet hatte, dessen lange Enden er sich als Stirnband um den Kopf gebunden hatte. Das verlieh ihm zu seiner durchtrainierten Figur das Aussehen eines schwarzen Kriegers aus alten Zeiten. Er grinste Kia an.
„Hi, Joy.“
Da Kia nach ihrer Flucht aus Haiti den neuen Nachnamen ihrer Großmutter angenommen hatte, war es ihr sicherer erschienen, ihren Vornamen ebenfalls nicht mehr zu benutzen. Deshalb hatte sie ihren zweiten Vornamen Joy als Rufnamen gewählt. Sollte man sie suchen – Louis suchte garantiert nach ihr – würde er nach allen möglichen Namenskombinationen suchen, die sie verwenden könnte, die aus einem ihrer Vornamen und dem Mädchennamen ihrer Mutter oder Großmutter bestand. Auf eine Joy Renard aus Savannah würde niemand kommen.
„Hi, Charlie.“
Er wandte sich an ihre Großmutter. „Ich möchte meine Bestellung abholen, Alma.“
„Komm rein.“
Er musterte Kia von oben bis unten. „Du siehst toll aus.“
„Danke.“
Ihre Großmutter schüttelte den Kopf. „Ich weiß gar nicht, was ihr jungen Leute an Magerkeit schön findet.“
Charlie lachte. „Ach, Alma!“ Er legte den Arm um ihre Hüften und drückte sie an sich. „Es kann doch nicht jeder so gesegnete Formen haben wie du.“ Er zwinkerte Kia zu.
Sie verbiss sich das Lachen. ‚Gesegnete Formen’ war die Untertreibung des Jahrhunderts. Wenn ihre Großmutter in der Tür stand, war diese vollständig blockiert, sodass nicht einmal ein Hund sich an ihr hätte vorbeizwängen können. Sie folgte ihr und Charlie in den Laden, wo Großmutter ihm ein Paket mit einer speziell für ihn zusammengestellten Teemischung reichte.
„Bleib doch zum Essen, Charlie. Joy hat auch noch nichts gegessen.“
„Gern.“ Er lächelte Kia zu.
Sie seufzte. Das hätte sie sich denken können. Großmutter hatte mit ihren Verkupplungsversuchen begonnen, kaum dass Kia einen Monat bei ihr wohnte. Unter dem Vorwand, dass sie noch vor Ladenschluss dringend irgendwelche Bestellungen abholen mussten, hatte sie ihr wohl sämtliche heiratsfähigen und heiratswilligen Männer des Viertels vorgeführt und alle Anstrengungen unternommen, Dates zu arrangieren. Sie konnte oder wollte einfach nicht begreifen, dass allein der Gedanke an eine Heirat für Kia der blanke Horror war. Sie war nicht ohne Grund aus Haiti geflüchtet. Zum Glück besaß sie die amerikanische Staatsbürgerschaft, sodass es mit ihrer Übersiedlung keine Probleme gegeben hatte. Selbst wenn sie keinen Grund gehabt hätte, sich zu verstecken und auf eine Familie zu verzichten, war eine feste Beziehung dennoch ausgeschlossen. Sie hätte vor ihrem Mann ständig etwas sehr Wichtiges verbergen müssen, das sie niemandem anvertrauen konnte. Nicht einmal einem geliebten Menschen. Doch eine Beziehung, in der ein Partner vor dem anderen ein so gravierendes Geheimnis verbarg, konnte auf die Dauer nicht gutgehen.
Deshalb hatte sie Großmutter und den Heiratskandidaten den Gefallen getan, einmal mit ihnen auszugehen, hatte aber auf subtile oder sehr direkte Weise keinen Zweifel daran gelassen, dass eine Beziehung für sie nicht infrage kam und alles andere erst recht nicht. Manche hatten sofort kapiert, einige erst später, aber inzwischen hatten alle aufgegeben. Bis auf Charlie. Er war der Überzeugung, dass steter Tropfen den Stein höhlte und Kia eines Tages nachgeben würde, wenn er ihr durch seine Hartnäckigkeit bewies, wie ernst es ihm war. Er hatte keine Chance. Selbst ohne die Last der Vergangenheit und des Geheimnisses, die sie zu tragen hatte, war er nicht ihr Typ, obwohl er wirklich nett war.
Er lächelte sie immer noch an. Sie schüttelte den Kopf und verzog sich in die Wohnung über dem Laden, um den Tisch zu decken. Charlie folgte ihr.
„Ich habe eure Ballettvorführung beim Spring Festival besucht, Joy. Du warst klasse.“
Sie schnitt eine Grimasse. „Dann war der Donnerhall, den ich gehört habe, also dein frenetisches Klatschen. Haben dir die Hände nicht wehgetan?“
Er lachte, legte einen Arm um sie und zog sie an sich. Kia versteifte sich und hob abwehrend die Hand. Er ließ sie los und blickte sie mit einer Mischung aus Besorgnis und Verletztheit an.
„Was ist denn los, Joy?“
Vielleicht lag es an dem kalten Hauch, den sie vorhin gefühlt hatte oder an dem seltsamen Verhalten ihrer Großmutter, aber sie brachte heute nicht die Geduld auf, höflich zu sein. „Gib es auf, Charlie. Ich mag dich, du bist ein netter Kerl, aber trotzdem wird aus uns niemals ein Paar werden. Nie. Also vergeude nicht deine Zeit mit weiteren fruchtlosen Versuchen.“ Sie ignorierte, dass er sie betroffen ansah und ging in die Küche. Auf dem Herd brutzelten Okraschoten und köchelte eine Chili-Sahne-Soße vor sich hin, während Fischfilets in der Bratröhre schmorten. Charlie kam ihr nach und blieb unschlüssig in der Tür stehen.
„Warum, Joy? Bist du“, er räusperte sich, „lesbisch?“
Das wäre eine perfekte Begründung gewesen. Sie hätte Ja sagen sollen und damit ein für alle Mal ihre Ruhe gehabt, weil Charlie das seinen Freunden erzählt hätte, die es in Windeseile im ganzen Viertel herumgetratscht hätten. Aber das wäre eine Lüge. „Nein.“ Sie tat einen tiefen Atemzug. „Ich will dir nicht wehtun, Charlie. Aber Fakt ist: Ich kann nicht, ich will nicht, ich werde nicht. Also lass es gut sein.“ Er wartete darauf, dass sie ihm eine nähere Erklärung lieferte, aber das hatte sie nicht vor. Charlie war jedoch nicht der Typ, der kampflos aufgab.
„Bitte nenn mir den Grund. Ich möchte es nur verstehen. Danach lass ich dich in Ruhe. Mein Wort drauf. Hast du – jemand anderen?“
Sie schloss für einen Moment die Augen. Wieso konnte er nicht einfach verschwinden? Sie sah ihn ernst an. „Okay, Charlie. Du willst einen Grund, hier ist er: Du bist einfach nicht mein Typ. Das ist alles. Und jetzt erwarte ich, dass du zu deinem Wort stehst und mich in Ruhe lässt.“
Er sah sie mehrere Sekunden an mit einem Gesichtsausdruck, den sie nicht deuten konnte. Schließlich nickte er. „Du hast recht, das tut weh. Aber damit kann ich leben. Danke.“ Er nickte ihr zu und ging.
Sie atmete auf. Sie hätte nicht gedacht, dass er so einfach loszuwerden wäre. Wenn sie das gewusst hätte, hätte sie ihm schon längst die ungeschminkte Wahrheit gesagt. Einerseits tat es ihr leid, dass sie ihn vor den Kopf gestoßen hatte. Andererseits war sie erleichtert, weil sie nun endlich Ruhe hatte. Zumindest hoffte sie das. Manche Männer verkrafteten kein Nein und wurden durch eine Abfuhr erst recht angespornt, sich noch mehr ins Zeug zu legen. Wenn sie Pech hatte, hatte sie Charlie gerade zum Stalken animiert. Das hätte ihr noch gefehlt.
Sie hörte die Stimme ihrer Großmutter durch das offene Fenster, die unten im Laden mit Charlie sprach, auch wenn sie kein Wort verstehen konnte. Ihr besorgter Tonfall sagte Kia, dass sie ihr Rede und Antwort stehen musste, sobald Charlie das Haus verlassen hatte.
Da kam sie schon. Blieb mitten in der Küche stehen, stemmte die Hände an die Hüften und blickte Kia vorwurfsvoll an. „Kianga, was ist nur los mit dir?“ Ihr gespielter Zorn hielt jedoch nur ein paar Sekunden an. „Kind, ich will doch nur, dass du endlich wieder glücklich wirst.“
Die Liebe und Fürsorge, die aus der Stimme ihrer Großmutter sprachen, waren zu viel für Kia. Sie brach in Tränen aus.
„Ach, Kind!“
Großmutter nahm sie in die Arme, drückte sie an sich und wiegte sie hin und her. Sie schob sie ins Wohnzimmer, setzte sich mit ihr auf die Couch und streichelte ihren Kopf und ihren Rücken, was Kia nur noch mehr zum Weinen brachte.
„Oh mein Sonnenschein, es wird alles wieder gut. Du musst es nur zulassen, meine kleine Kia.“
Kia klammerte sich an sie und ließ ihren Tränen freien Lauf. Großmutter meinte es gut, aber sie würde niemals glücklich sein. Und nichts würde jemals wieder gut werden. Ganz abgesehen davon, dass ihr ganzes Leben noch nie gut gewesen war. Dabei wünschte sie sich nichts sehnlicher als ein normales Leben, ohne ständige Angst, ohne immer auf der Hut zu sein; ohne sich überall wie eine Fremde zu fühlen. Und ja, sie wünschte sich auch einen Mann. Aber gerade dieser Wunsch würde für immer ein Traum bleiben.
Sie weinte eine Weile und genoss es, sich zur Abwechslung mal auf jemand anderen stützen zu können statt immer nur auf sich selbst. Aber letztendlich war auch das nur eine Illusion. Wenn es hart auf hart käme, musste sie das allein bewältigen. Andernfalls würde sie auch noch ihre Großmutter verlieren. Sie wischte sich die Tränen ab und richtete sich auf.
„Danke für den Trost. Aber wir wissen beide, dass das nicht sein kann, solange er noch lebt.“ Sie sah ihrer Großmutter in die Augen. „Was hast du vorhin gesehen, als ich gekommen bin? Was hat der Fluss dir gesagt?“
Großmutter seufzte. „Er hat sein Lied verändert. Singt von vielen neuen Leuten in der Stadt. Nicht alle sind gut.“ Sie schüttelte den Kopf. „Niemals sind alle gut. Aber das ist normal.“
Kia und ihre Großmutter entstammten einem alten Priestergeschlecht, das ursprünglich in der nördlichen Kongoregion beheimatet gewesen war, bis ihre Vorfahren als Sklaven nach Amerika verschleppt worden waren. Neben der Verehrung eines Schöpfergottes gehörte die Kommunikation mit den Naturgeistern, die in der Erde, in Bäumen oder Flüssen lebten, zu ihren Fähigkeiten und Pflichten. Trotz der Versuche der weißen Herren, ihren Vorfahren diesen Glauben und die damit verbundenen Praktiken auszutreiben und sogar zu vernichten, indem sie notfalls die Sklaven töteten, bei denen sie bemerkten, dass sie mit den Geistern sprachen, war ihnen das nicht vollständig gelungen. Obwohl sich ihr Blut im Laufe der fast dreihundert Jahre, die seit der Verschleppung ihrer Vorfahren vergangen waren, mit dem anderer Afrikaner und auch Weißer vermischt hatte und die religiösen Inhalte ihres Glaubens sich entsprechend verändert hatten, war diese Gabe immer wieder vererbt worden und trat in jeder zweiten Generation auf.
Großmutter besaß diese Fähigkeit der innigen Naturverbundenheit ebenso wie Kia. Aber sie benutzte sie nicht. In der heutigen Zeit mitten in einer Großstadt war es nicht nötig, zu erfahren, wann der nächste Regen fiel oder wo die Okras am besten gedeihen würden. Das übernahmen die Farmindustrie und die Meteorologen. Sie nützte also gar nichts. Stattdessen war sie die Ursache für ihr Unglück. Mehr oder weniger.
„Wenn es nur das wäre, hätte es dich nicht so beunruhigt, Großmutter. Komm schon, ich bin erwachsen. Du kannst es mir ruhig sagen.“
Großmutter seufzte. „Es geht etwas vor sich, das nicht gut ist. Noch ist es nur ein Hauch, aber der ist sehr, sehr kalt.“
Kia erschauderte, als sie an den kalten Hauch dachte, den sie vor der Ballettschule gefühlt hatte. Großmutter fasste sie bei den Schultern und sah ihr in die Augen.
„Du hast ihn auch gespürt.“
Kia nickte. „Vorhin, als ich die Ballettschule verlassen habe. Wie die Vorankündigung einer Eiszeit.“ Sie sah Großmutter forschend in die Augen. „Das ist noch nicht alles, nicht wahr?“
Sie wiegte den Kopf hin und her. „Vielleicht nicht. Das weiß ich noch nicht, Kind. Aber ich finde es heraus.“ Sie lächelte. „Jetzt lass uns erst einmal essen. Und ich verspreche dir, dass ich nie wieder versuchen werde, dich mit einem netten jungen Mann zusammenzubringen.“
„Das weiß ich sehr zu schätzen. Aber ganz ehrlich: Das glaube ich erst, wenn mindestens ein Monat vergangen ist, ohne dass du mich einem Mann vorstellst. Ich kenne dich doch.“
Großmutter blickte sie liebevoll an. Der Blick sagte Kia mehr als alle Worte.
Sie gingen in die Küche und widmeten sich dem Abendessen. Kia hing ihren Gedanken nach, und auch Großmutter sagte nicht viel. Nach dem Essen wusch Kia das Geschirr ab, während Großmutter sich in ihren Schaukelstuhl vor das Haus setzte und dem Fluss lauschte. Kia verabschiedete sich mit einem Kuss auf die Wange von ihr und fuhr nach Hause. Inzwischen war es zehn Uhr und schon dunkel.
Sie parkte ihren Wagen auf dem Stellplatz gegenüber dem Haus, ging über die Straße und schloss die Haustür auf. Hinter der Wohnungstür von Mrs. Ferris, der sechzigjährigen Hausmeisterin, hörte sie wie jeden Abend die Stimme deren Lieblingspredigers aus dem Fernseher, die verkündete, wie sehr Gott alle Menschen liebte. Mrs. Ferris antwortete auf jedes Halleluja aus dem Fernseher mit einem inbrünstigen Halleluja!
Kia lächelte und stieg leise die Treppe zum ersten Stock hinauf, in dem ihre Wohnung lag. Als sie davor ankam, blieb sie abrupt stehen. Sie stieß ein entsetztes Wimmern aus. Jemand hatte die Tür mit roter Farbe beschmiert. Der Totenschädel eines stilisierten Gerippes grinste sie an, auf dessen Kopf ein Zylinder thronte. In der Hand hielt es einen Pot-de-tête, auf dem drei Kreuze und ein paar senkrechte Striche gemalt waren.
Ihre Hand zuckte zu dem roten Beutel unter ihrer Bluse. Sie hatte ihn zu oft abgelegt, war zu oft ohne Schutz gewesen, obwohl Großmutter sie davor gewarnt hatte. Sie hatte sich zu sicher gefühlt, hatte geglaubt, hier im fernen Savannah außer Gefahr zu sein; weitgehend zumindest. Sie hatte sich geirrt.
Louis hatte sie gefunden.
*
Alma lauschte dem Flüstern der Flussgeister, nachdem Kianga sie verlassen hatte. Sie erzählten ihr nichts Neues. Sie hatte Kia vorhin nicht noch mehr beunruhigen wollen und ihr deshalb verschwiegen, dass die Loas ihr durch das Fa noch etwas offenbart hatten, das zu einer Bedrohung werden könnte. Die Frage war, für wen. Es mochte vielleicht nichts mit Kia zu tun haben – oder alles.
Alma versuchte sich einzureden, dass sie Kia gut genug geschützt hatte. Schließlich lebte sie seit zehn Jahren in Savannah. Wenn man sie hätte aufspüren können, wäre das schon lange geschehen. Seine Macht reichte weit. Selbst von Haiti aus hätte er nicht mal ein Jahr gebraucht, um sie zu finden, wenn es ihm möglich gewesen wäre. Außerdem wusste er nicht, dass Alma in Savannah wohnte. Die einzige Adresse, die er von ihr haben könnte, war die in New Orleans, und dort lebte sie schon lange nicht mehr. Alma hatte ihre Spur gut verwischt. Sie war unzählige Male umgezogen, hatte noch dreimal geheiratet und den Nachnamen ihres letzten Mannes, John Renard, beibehalten, von dem sie inzwischen ebenfalls geschieden war. Nur ihr Fleisch und Blut hätte sie finden können, denn sie hatte in New Orleans eine subtile Fährte hinterlassen, die niemand sehen oder verstehen konnte außer ihrer Tochter Saba und Kia.
Alma hatte gehofft, dass Saba sie finden und zu ihr zurückkehren würde. Im Gegensatz zu ihrer Tochter hatte sie schon vor deren Heirat gewusst, dass ihr Mann sie nur benutzen würde. Dass er Saba überhaupt nur heiraten wollte, weil sie der Blutlinie der alten Priester entstammte. Aber wenn es um die Liebe geht, hörten Kinder nahezu nie auf ihre Eltern. Saba hatte ihren Eigensinn bedauerlicherweise mit dem Leben bezahlt. Wenigstens hatte sie genug Verstand besessen, Kia beizeiten die geheimen Zeichen zu lehren, damit sie die Spur zu ihrer Großmutter finden konnte.
Für Alma war es schon ein schwarzer Tag gewesen, als Saba ihrem Mann mit ihrer neugeborenen Tochter nach Haiti gefolgt war, dessen Schwärze nur noch von dem Tag übertroffen wurde, an dem sie von Sabas Tod erfahren hatte. Derselbe Tag, an dem Kia sie gefunden hatte, die vor ihrem Vater geflüchtet war, der nicht nur der Mörder ihrer Mutter war. Er hatte Kia obendrein zwingen wollen, den Erben des Bizango-Kults zu heiraten, der die eine Hälfte Haitis beherrschte, um auf diese Weise durch Kia seine eigene Macht von der anderen Hälfte aus über das ganze Land zu etablieren. Da Alma und Saba Kia aber unmittelbar nach ihrer Geburt heimlich einer anderen Gottheit geweiht hatten, besaßen die Petro, die finsteren Götter, die ihr Vater und der ihr zugedachte Ehemann verehrten, keine Macht über sie.
Konnte es trotzdem sein, dass ihr Vater oder der Mann, den sie nach seinem Willen heiraten sollte, sie gefunden hatte? Besonders Letzterer würde sie nicht aufgeben, da sie ihm versprochen war und er sie deshalb als sein Eigentum betrachtete. Doch auch Kia lebte unter dem Namen Renard und benutzte den meisten Menschen gegenüber ihren zweiten Vornamen. Auch ihr Führerschein war auf Joy Renard ausgestellt. Somit gab es weder eine namentliche Verbindung zu ihrem Vater noch zu dem Mädchennamen ihrer Mutter. Dazu das Amulett, das Alma ihr angefertigt hatte … Eigentlich war es unmöglich. Doch je mehr sie darüber nachdachte, desto unsicherer wurde sie. Sie brauchte Gewissheit.
Sie stand auf, stellte den Schaukelstuhl in den Laden und ging in das Zimmer, in dem sie ihren Kunden Lebensberatung gab. Sie nahm die Knochen aus dem Beutel, in dem sie schliefen, hauchte ihren Atem darauf und schüttelte sie in der Hand, bis sie spürte, dass der rechte Moment gekommen war, sie fallen zu lassen. Sie verteilten sich auf dem roten Tuch, das sie als Unterlage benutzte. Alma erschrak. In der Hoffnung, dass das Orakel sich dieses eine Mal geirrt hätte, nahm sie die Knochen erneut in die Hand, schüttelte sie gut durch und warf sie. Und noch ein drittes Mal.
Das Ergebnis blieb dasselbe. Etwas war schiefgegangen, und Kia befand sich in großer Gefahr. Verdammt, sie hätte das Orakel früher befragen sollen. Es hätte sie gewarnt. Aber sie war so sicher gewesen, dass die Schatten von Kias Herkunft sie hier nicht einholen könnten, weil sie ihre Enkelin bestmöglich geschützt hatte. Sie hatte sich geirrt. Jetzt musste sie schnell handeln, um das Schlimmste zu verhüten. Falls es nicht schon zu spät war.