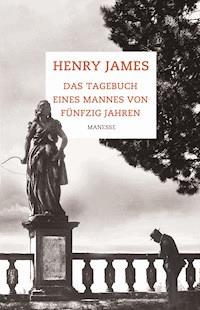9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich flirte ganz unheimlich schrecklich gerne!« Die junge Amerikanerin Daisy Miller weiß, was sie will, und sie nimmt es sich – ganz gleich, was die sogenannte gute Gesellschaft denkt. Während ihrer Europareise mit der Familie lernt Daisy am Genfer See den Studenten Winterbourne kennen und verdreht ihm sofort den Kopf. Doch er ist ihr zu steif, zu reserviert, zu »europäisch «. Ganz anders der lebensfrohe Signor Giovanelli in Rom. Mit ihrer offen zur Schau gestellten Liaison brüskieren die beiden die Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Henry James
Daisy Miller
Eine Erzählung
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt und mit Anmerkungen von Britta Mümmler
I
In der kleinen Stadt Vevey in der Schweiz gibt es ein besonders komfortables Hotel; aber es gibt dort natürlich viele Hotels, denn der Tourismus ist der Wirtschaftszweig des Ortes, der, wie viele Reisende sich erinnern werden, an einem bemerkenswert blauen See liegt – an einem See, den jeder Tourist einmal gesehen haben sollte. Am Ufer des Sees präsentiert sich eine endlose ansehnliche Reihe von Häusern solcher Art, in jeder Kategorie, vom »Grandhotel« neuesten Stils mit kreideweißer Fassade, unzähligen Balkonen und einem Dutzend flatternden Fahnen auf dem Dach bis hin zur kleinen Schweizer Pension älteren Datums mit rosa oder gelben Hauswänden, die ein Name in deutsch anmutender Schrift ziert, und einer in die Gartenecke gezwängten Sommerlaube. Eins der Hotels in Vevey jedoch ist berühmt, ja geradezu traditionsreich, und unterscheidet sich von vielen seiner benachbarten Emporkömmlinge durch eine Atmosphäre von Luxus und Gediegenheit. Den ganzen Monat Juni über gibt es in dieser Gegend außerordentlich viele amerikanische Reisende; man kann sogar sagen, dass Vevey in dieser Zeit fast schon den Charakter eines amerikanischen Kurortes annimmt. Dann beschwört so mancher Anblick oder Laut ein Bild oder Echo von Newport und Saratoga herauf. Dann herrscht ein Gewimmel hierhin und dorthin eilender »schicker« junger Mädchen, ein Geraschel von Musselinrüschen, ein Gedröhne von Tanzmusik schon am Vormittag und ein nie abreißendes Geplapper hoher Stimmen. Einen Eindruck von all dem bekommt man in dem ausgezeichneten Speiselokal des »Trois Couronnes«, ja man fühlt sich in Gedanken regelrecht wie ins »Ocean House« oder »Congress Hall« versetzt. Doch das »Trois Couronnes«, das muss hinzugefügt werden, hat noch anderes zu bieten, das sich von diesen Vorstellungen stark unterscheidet: gepflegte deutsche Kellner, die wie Legationssekretäre aussehen; russische Prinzessinnen, die im Garten sitzen; kleine polnische Jungen, die an der Hand ihrer Hauslehrer spazieren gehen; die Aussicht auf die schneebedeckten Gipfel der Dents du Midi und die malerischen Türme von Schloss Chillon.
Ich kann nicht beurteilen, ob es die Ähnlichkeiten oder eher die Unterschiede waren, die den jungen Amerikaner am meisten beschäftigten, der vor zwei oder drei Jahren im Garten des »Trois Couronnes« saß und ziemlich müßig einige der anmutigen Motive betrachtete, die ich soeben erwähnt habe. Es war ein schöner Sommermorgen, und wie auch immer der junge Amerikaner die Dinge betrachtet haben mag, sie müssen ihm bezaubernd erschienen sein. Er war tags zuvor mit dem kleinen Dampfschiff aus Genf gekommen, um seine Tante zu besuchen, die in dem Hotel abgestiegen war – Genf war schon seit Langem sein Wohnsitz. Aber seine Tante hatte Kopfschmerzen – seine Tante hatte fast immer Kopfschmerzen – und lag nun in ihrem abgedunkelten Zimmer da und atmete Kampferdämpfe ein, sodass er nach Belieben umherstreifen konnte. Er war etwa siebenundzwanzig Jahre alt; wenn seine Freunde von ihm sprachen, sagten sie gewöhnlich, dass er in Genf »studiere«. Wenn seine Feinde von ihm sprachen, sagten sie – aber Feinde hatte er im Grunde keine: er war äußerst liebenswürdig und allgemein beliebt. Ich sollte einfach nur erwähnen, dass gewisse Leute, wenn sie von ihm sprachen, betonten, dass er sich nur deshalb schon so lange in Genf aufhalte, weil er einer dort lebenden Dame überaus zugetan sei – einer ausländischen Dame, einer Person, die älter war als er. Nur sehr wenige Amerikaner – eigentlich keiner, glaube ich – hatten diese Dame, über die einige merkwürdige Geschichten kursierten, je gesehen. Doch Winterbourne empfand eine alte Zuneigung zu der kleinen Hauptstadt des Calvinismus; er war dort als Junge in die Schule gekommen und danach sogar, probeweise – das heißt, um die graue alte »Akademie« an dem steilen, steinigen Hang auszuprobieren –, aufs collège gegangen; all dies Umstände, die zu einer großen Anzahl Jugendfreundschaften geführt hatten. Er hatte viele davon aufrechterhalten, und sie waren ihm ein Quell großer Zufriedenheit.
Nachdem er an die Tür seiner Tante geklopft und erfahren hatte, dass sie unpässlich war, hatte er einen Spaziergang durch die Stadt gemacht und war danach zum Frühstück wieder hereingekommen. Diese Mahlzeit hatte er inzwischen beendet, aber er genoss noch eine kleine Tasse Kaffee, die ihm von einem der Kellner, die aussahen wie attachés, an einem kleinen Tisch im Garten serviert worden war. Schließlich war auch der Kaffee ausgetrunken, und er zündete sich eine Zigarette an. Bald darauf kam ein kleiner Junge den Weg entlang – ein Bengel von neun oder zehn, der auffallend klein war für sein Alter und einen altklugen Ausdruck in seinem blassen Gesicht mit den kleinen ausgeprägten Zügen hatte. Er trug Knickerbocker und rote Strümpfe, die seine armen spindeldünnen Waden erst so richtig betonten, und dazu ein leuchtend rotes Halstuch. In der Hand hielt er einen langen Bergstock, dessen scharfe Spitze er in alles hineinstieß, woran er vorbeikam – Blumenbeete, Gartenbänke, Schleppen von Damenkleidern. Direkt vor Winterbourne blieb er stehen und blickte ihn aus einem Paar strahlender, durchdringender kleiner Augen an.
»Geben Sie mir ein Stück Zucker?«, fragte er mit einer dünnen hohen, harten Stimme – einer Stimme, die unreif klang und dennoch irgendwie nicht mehr jung.
Winterbourne warf einen Blick auf den kleinen Tisch neben sich, auf dem sein Kaffeegeschirr stand, und sah, dass einige Stück Zucker übrig waren. »Ja, du darfst dir eins nehmen«, erwiderte er; »aber zu viel Zucker ist nicht gut für kleine Jungen, glaube ich.«
Dieser kleine Junge trat einen Schritt vor und suchte sich sorgfältig drei der begehrten Überbleibsel aus, von denen zwei in der Tasche seiner Knickerbocker verschwanden und das andere ebenso prompt an einer anderen Stelle. Er stieß seinen Bergstock, wie eine Lanze, in Winterbournes Bank hinein und versuchte, das Zuckerstück mit den Zähnen zu zerbeißen.
»Oh, zum Teufel, ist das harrrt!«, rief er, wobei er Vokale und Konsonanten treffsicher aller Geschmeidigkeit beraubte.
Winterbourne kam sogleich der Gedanke, dass er die Ehre haben könnte, hier einem Landsmann begegnet zu sein. »Pass nur auf, dass deine Zähne nicht kaputtgehen«, sagte er väterlich.
»Ich hab’ keine Zähne, die kaputtgehen können. Die sind alle ausgefallen. Ich hab’ nur noch sieben. Mutter hat sie gestern Abend gezählt, und gleich danach ist noch einer ausgefallen. Sie hat gesagt, sie ohrfeigt mich, wenn noch mehr ausfallen. Dabei kann ich gar nichts dafür. Es liegt alles an diesem alten Europa. Es liegt am Klima hier, dass sie ausfallen. In Amerika ist keiner ausgefallen. Es liegt an diesen Hotels.«
Winterbourne amüsierte sich köstlich. »Wenn du gleich drei Stück Zucker auf einmal isst, wird deine Mutter dich bestimmt ohrfeigen«, erlaubte er sich zu sagen.
»Dann muss sie mir eben Bonbons geben«, erwiderte sein junger Gesprächspartner. »Ich krieg’ hier nirgends Bonbons – amerikanische Bonbons, mein’ ich. Amerikanische Bonbons sind die besten Bonbons.«
»Und sind amerikanische kleine Jungen auch die besten kleinen Jungen?«, fragte Winterbourne.
»Weiß ich nicht. Ich bin ein amerikanischer Junge«, sagte das Kind.
»Ich sehe schon, du bist einer der besten!«, erwiderte der junge Mann lachend.
»Sind Sie ein amerikanischer Mann?«, fuhr der aufgeweckte Kleine fort. Und auf die bejahende Antwort seines Freundes hin verkündete er sodann voller Überzeugung: »Amerikanische Männer sind die besten.«
Sein Gegenüber dankte ihm für das Kompliment, und das Kind, den Bergstock mittlerweile rittlings zwischen den Beinen, stand einfach da und blickte sich um, während es ein weiteres Stück Zucker in Angriff nahm. Winterbourne fragte sich, ob er in seiner Kindheit genauso gewesen sei, denn er war in etwa demselben Alter nach Europa gebracht worden.
»Da kommt ja meine Schwester!«, rief sein junger Landsmann plötzlich. »Die ist ein amerikanisches Mädchen, jede Wette.«
Winterbourne blickte den Weg entlang und sah eine schöne junge Dame auf sich zukommen. »Amerikanische Mädchen sind die besten Mädchen«, sagte er daraufhin fröhlich zu seinem Gast.
»Meine Schwester nicht!«, erwiderte das Kind prompt. »Die schimpft mich immer nur aus.«
»Das ist vermutlich deine Schuld, und nicht ihre«, sagte Winterbourne. Die junge Dame war inzwischen näher gekommen. Sie war in weißen Musselin gekleidet, der mit unzähligen Rüschen, Falbeln und Schleifen aus pastellfarbenem Band verziert war. Weil sie keinen Hut trug, balancierte sie in der einen Hand einen großen Sonnenschirm mit einem breiten bestickten Rand; und sie war auffallend, ja erstaunlich hübsch. »Wie hübsch sie immer sind!«, dachte unser Freund und setzte sich auf seinem Platz auf, so als wollte er jeden Augenblick aufstehen.
Die junge Dame blieb vor seiner Bank stehen, nicht weit von der niedrigen Gartenmauer entfernt, von der man auf den See hinausblickte. Der kleine Junge hatte seinen Bergstock nun in einen Sprungstab verwandelt, mit dessen Hilfe er im Kies herumhüpfte und dabei nicht wenig davon aufspritzte. »Aber Randolph«, begann sie ganz unbefangen, »was machst du denn da?«
»Ich steig’ die Alpen rauf!«, rief Randolph. »Genau so macht man das!« Und dabei vollführte er noch einen weiteren übertriebenen Sprung, dass Winterbourne die Kiesel um die Ohren flogen.
»Genau so stürzt man ab«, sagte Winterbourne.
»Er ist ein amerikanischer Mann!«, rief Randolph mit seiner harschen dünnen Stimme aus.
Die junge Dame schenkte diesem Umstand keine Beachtung, sondern sah ihren Bruder direkt an. »Ich glaube, du bist jetzt besser mal still«, sagte sie einfach nur.
Winterbourne hatte den Eindruck, in gewisser Weise vorgestellt worden zu sein, stand auf und ging, seine Zigarette wegwerfend, langsam auf die reizende Erscheinung zu. »Dieser kleine Junge und ich haben Bekanntschaft miteinander geschlossen«, sagte er mit ausgesuchter Höflichkeit. In Genf nämlich durfte ein junger Mann, wie er sehr genau wusste, eine junge unverheiratete Dame nicht einfach von sich aus ansprechen, außer unter bestimmten, selten auftretenden Bedingungen; aber welche Bedingungen konnten hier in Vevey besser sein als diese? – wo so ein hübsches amerikanisches Mädchen des Weges kam und mit der größten Selbstverständlichkeit in einem Garten vor einem stehen blieb. Dieses hübsche amerikanische Mädchen warf Winterbourne auf seine Bemerkung hin, was immer das auch beweisen mochte, einfach nur einen Blick zu; dann wandte sie den Kopf wieder ab und sah über die Gartenmauer hinweg auf den See und die gegenüberliegenden Berge. Er fragte sich, ob er wohl zu weit gegangen sei, kam aber zu dem Schluss, dass er sich lieber weiter galant vorwagen als zurückziehen sollte. Und während er noch nachdachte, was er als Nächstes sagen könnte, wandte die junge Dame sich wieder dem kleinen Jungen zu, mit dem sie ganz so sprach, als wären sie beide allein miteinander. »Ich möchte mal wissen, woher du diesen Stock hast.«
»Den hab’ ich gekauft!«, rief Randolph.
»Das soll doch wohl nicht heißen, dass du ihn mit nach Italien nehmen willst!«
»Doch, den nehm’ ich mit nach Italien!«, posaunte das Kind heraus.
Sie blickte an ihrem Kleid hinunter und strich das ein oder andere Schleifenband glatt. Dann wandte sie ihre entzückenden Augen wieder dem Bittsteller zu. »Also ich finde, du solltest ihn lieber irgendwo liegen lassen«, sagte sie kurz darauf.
»Sie fahren nach Italien?«, entschloss Winterbourne sich nun sehr respektvoll zu fragen.
Sie warf ihm mit liebenswürdiger Zurückhaltung einen Blick zu. »Ja, Sir«, erwiderte sie dann. Und weiter sagte sie nichts.
»Und denken Sie dabei – äh – an den Simplon?«, fuhr er mit leicht eingebrochenem Selbstvertrauen fort.
»Ich weiß nicht«, sagte sie. »Vermutlich an irgendeinen dieser Berge. Randolph, an welchen Berg denken wir?«
»Denken wir?« – der Junge starrte sie an.
»Na, überqueren wir.«
»Überqueren wohin?«, fragte er.
»Na, direkt hinunter nach Italien« – Winterbourne empfand ein unbestimmtes Bedürfnis des Nacheiferns.
»Weiß ich nicht«, sagte Randolph. »Ich will nicht nach Italien. Ich will nach Amerika.«
»Oh, Italien ist ein schönes Land!«, sagte der junge Mann lachend.
»Kriegt man da denn Bonbons?«, fragte Randolph.
»Hoffentlich nicht«, sagte seine Schwester. »Du hast schon genug Bonbons gehabt, finde ich, und Mutter findet das auch.«
»Ich hab’ schon ewig lange keine mehr gekriegt – seit hundert Wochen nicht!«, rief der Junge, der immer noch herumhüpfte.
Die junge Dame prüfte den Sitz ihrer Falbeln und strich noch einmal ihre Schleifenbänder glatt; und Winterbourne wagte nun, eine Bemerkung über die Schönheit der Aussicht zu machen. Seine Zweifel begannen sich zu legen, denn er begriff allmählich, dass sie wirklich nicht im Geringsten verlegen war. Sie mochte kühl, sie mochte abweisend, ja sie mochte sogar zimperlich sein; denn das war es anscheinend – zu diesem verallgemeinernden Schluss war er schon gekommen –, was die meisten »zurückhaltenden« amerikanischen Mädchen machen: Sie kamen des Weges und bauten sich unmittelbar vor einem auf, nur um zu zeigen, wie entschieden unnahbar sie waren. Ihr frischer heller Teint jedoch hatte nicht den leisesten Anflug eines Errötens gezeigt; sie war also weder gekränkt noch aufgeregt. Sie bestand nur – auch so was war ihm zuvor bereits begegnet – aus reizenden kleinen Teilen, die nicht zueinanderpassten und kein ensemble bildeten; und wenn sie woanders hinsah, während er mit ihr sprach, und ihm gar nicht richtig zuzuhören schien, so war das einfach ihr übliches Benehmen, ihre Art des Umgangs, weil sie ganz und gar keine Vorstellung von »Form« hatte (wo auf der weiten Welt hätte sie die mit solch einer Plaudertasche wie Randolph als Anhängsel auch bekommen sollen?), die in solch einer Situation angebracht wäre. Während er noch ein wenig weiterplauderte und auf einige Sehenswürdigkeiten in der Umgebung hinwies, die ihr vollkommen unbekannt zu sein schienen, schenkte sie ihm allmählich jedoch immer mehr Aufmerksamkeit; und schließlich merkte er, dass sie nicht mehr den leisesten Anflug von Zurückhaltung zeigte. Doch sie gab sich nicht so, dass man es hätte »kokett« nennen können, denn ihr Gesichtsausdruck war so sittsam rein wie kristallklares Wasser. Ihre Augen waren die hübschesten, die man sich vorstellen konnte, und Winterbourne hatte wirklich schon lange nichts Hübscheres mehr gesehen als all die verschiedenen Merkmale seiner schönen Landsmännin – ihr Teint, ihre Nase, ihre Ohren, ihre Zähne. Er war allgemein sehr interessiert an dieser Materie der Wirkung von Reizen und ganz besessen davon, diese aufzufinden und, gleichsam, zu ergründen; und so stellte er auch im Hinblick auf das Gesicht dieser jungen Dame einige Betrachtungen an. Es war keineswegs geistlos, aber auch nicht betont – was denn, um Himmels willen, sollte sie jemals betonen? – ausdrucksvoll; und obwohl es solch eine Ansammlung feiner Makellosigkeiten darbot, warf er diesem Gesicht insgeheim – sehr nachsichtig – einen Mangel an letztem Schliff vor. Er hielt es für mehr als wahrscheinlich, dass seine Eigentümerin bereits eigene Erfahrungen mit der Wirkung ihrer Reize gemacht und gewiss ein daraus resultierendes Selbstvertrauen gewonnen hatte; doch selbst wenn sie sich hauptsächlich darauf verließ zu ihrem Zeitvertreib, verriet ihr munteres, oberflächliches, süßes kleines Gesicht doch weder Spott noch Ironie. Schon bald wurde deutlich, dass sie, wie immer diese Dinge sich nun auch verhalten mochten, der Konversation gegenüber sehr aufgeschlossen war. Sie erzählte Winterbourne, dass sie den Winter in Rom verbringen würden – sie und ihre Mutter und Randolph. Sie fragte ihn, ob er ein »richtiger Amerikaner« sei; sie hätte ihn nicht für einen gehalten; er wirke eher wie ein Deutscher – diese Blume wurde wie aus einem großen Feld der Vergleiche herausgepflückt überreicht –, vor allem wenn er spreche. Winterbourne erwiderte lachend, dass er zwar schon Deutschen begegnet sei, die wie Amerikaner sprachen, aber, soweit er sich erinnern könne, noch nie einem Amerikaner mit der von ihr erwähnten Eigenart. Dann fragte er sie, ob es für sie nicht bequemer sei, sich auf die Bank zu setzen, von der er soeben aufgestanden war. Sie erwiderte, dass sie gern ein wenig stehe, ließ sich kurz darauf aber dennoch schicksalsergeben auf der Bank nieder. Sie erzählte ihm, dass sie aus dem Staat New York sei – »wenn Sie wissen, wo das ist«; doch dieser Redefluss wurde erst so richtig beschleunigt, als unser Freund ihren quirligen kleinen Bruder einfing und festhielt, damit der ein paar Minuten neben ihm stehen blieb.
»Jetzt sag mir doch mal deinen vollen Namen, mein Junge.« So fuhr er geschickt fort.
Worauf das Kind tatsächlich zum Ausbund ungeschminkter Wahrheit wurde. »Randolph C. Miller. Und ihren sag’ ich Ihnen auch.« Wobei er mit seinem Bergstock auf seine Schwester zeigte.
»Du solltest lieber warten, bis man dich fragt!«, sagte diese junge Dame in aller Ruhe.
»Ich würde Ihren Namen aber natürlich gern wissen«, erlaubte Winterbourne sich zu sagen.
»Sie heißt Daisy Miller!«, rief der Bengel. »Aber das ist gar nicht ihr richtiger Name; das ist nicht der Name, der auf ihren Visitenkarten steht.«
»Wie schade, dass du keine meiner Visitenkarten dabei hast!«, bemerkte Miss Miller genauso gelassen.
»Ihr richtiger Name ist Annie P. Miller«, fuhr der Junge fort.
Das schien ihr, erstaunlicherweise, zu gefallen. »Und jetzt frage ihn nach seinem« – und sie zeigte auf ihren gemeinsamen Freund.
Doch dieser Punkt schien Randolph völlig gleichgültig zu sein; er gab stattdessen weiter Auskunft über seine eigene Familie. »Mein Vater heißt Ezra B. Miller. Mein Vater ist nicht in Europa – er ist an einem besseren Ort als Europa.« Einen Augenblick lang glaubte Winterbourne, dass man dem Kind beigebracht hatte, auf diese Weise anzudeuten, dass Mr Miller ins Reich der himmlischen Gerechtigkeit eingegangen war. Doch Randolph fügte sogleich hinzu: »Mein Vater ist in Schenectady. Da hat er eine riesige Firma. Mein Vater ist reich, jede Wette.«
»Also wirklich!«, stieß Miss Miller hervor, senkte ihren Sonnenschirm und betrachtete angelegentlich den bestickten Rand. Winterbourne ließ den Jungen sogleich los, und der lief, den Bergstock auf dem Weg hinter sich herschleifend, davon. »Europa gefällt ihm nicht«, sagte das junge Mädchen wie mit einem natürlichen Instinkt für die allgemeingültige Wahrheit begabt. »Er will zurück.«
»Nach Schenectady, meinen Sie?«
»Ja, er will unbedingt wieder nach Hause. Er hat hier keine Spielkameraden. Einen Jungen gibt es zwar, aber der geht immer nur mit einem Lehrer spazieren. Man lässt ihn nicht spielen.«
»Und Ihr Bruder hat keinen Lehrer?«, fragte Winterbourne.