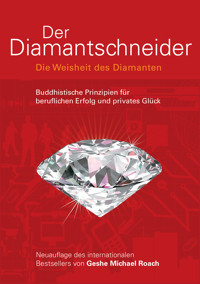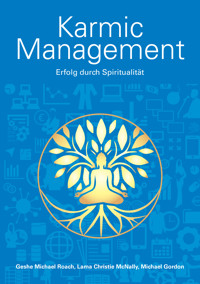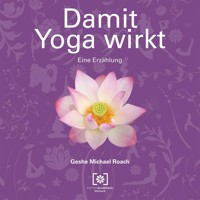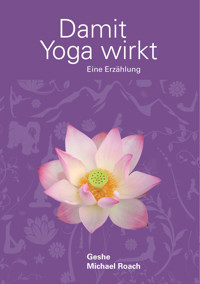
18,80 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EditionBlumenau
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Warum Yoga wirkt - dich selbst und andere mit den Yoga-Sutras heilen Entdecke das Geheimnis, warum Yoga bei manchen Menschen wahre Wunder wirkt – und wie auch du diese Kraft für sdich nutzen kannst! Dieses Buch nimmt dich mit auf eine inspirierende Reise: Du lernst Schritt für Schritt, wie Yoga wirklich funktioniert. Die Tipps und Methoden stammen direkt aus den uralten Yoga-Sutras – authentisch, klar und für heute übersetzt. Egal, ob du Anfänger:in oder erfahrene:r Yogi:ni sind, hier findest du wertvolle Informationen und Anleitungen, die du sofort in deine Praxis integrieren kannst. Das Buch begleitet dich auf deiner Yoga-Reise, gibt dir Hintergrundwissen und neue Impulse und hilft dir, Gesundheit, Freude und innere Stärke zu entfalten. Lass dich von jahrtausendealtem buddhistischen Wissen und moderner Erfahrung inspirieren – und erlebe, wie Yoga auch in deinem Leben wirkt! von Geshe Michael Roach, Autor des Yoga-Romans "Katrin" und des internationalen Bestsellers "Der Diamantschneider – Buddhistische Prinzipien für beruflichen Erfolg und privates Glück".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Geshe Michael Roach
Damit Yoga wirkt
Sich selbst und andere
mit den Yoga Sutras heilen
Aus dem Amerikanischen von
Elke Yashoda Selzle
Lektorat Ivonne Senn und
Annette Winkel
Impressum
Ungekürzte Ausgabe
August 2012
EditionBlumenau
Hamburg
www.editionblumenau.com
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
How Yoga Works, Diamond Cutter Press, USA
Copyright © 2004 Geshe Michael Roach
Copyright der deutschen Ausgabe: © 2012 EditionBlumenau, Hamburg
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen, bleiben vorbehalten.
Titelkonzept: Silvia Engelhardt, Hamburg
Titelgestaltung: Kati Krüger, Hamburg
Satz und ebook: Tanja Renz, Herrsching am Ammersee
ISBN: 9783981388862
Wir freuen uns auf Ihren Besuch: www.editionblumenau.com
Weitere Bücher von Geshe Michael Roach bei der EditionBlumenau:
Der Diamantschneider
Karmic Management
Der Garten des Buddha
Der östliche Pfad zum Himmel
Damit Yoga wirkt
Inhalt
Wo wir alle anfangen
Bleibendes Wohlbefinden
Ein Grund, nicht zu schwänzen
Ein Gleichgewicht der Gefühle
Es richtig machen
Das Kreuz mit den Vorlieben
Aufbau einer regelmäßigen Praxis
Lichtkanäle
Nordstern
Pferde und Reiter
Der Atem und ein Lächeln
Der Atem und das Herz
Stilles Sitzen
Lernen, wie man sitzt
Offenherzige Freundlichkeit
Wir missverstehen unsere Welt
Schon wieder der Stift
Da draußen, da drüben
Sogar für die, die verstehen
Faust und Blitz
Wahrhaftig, alles ist Leiden
Ein Gefäß
Hochmut vor dem Fall
Nahe an der Frömmigkeit
Zwei Einladungen
Fleisch oder Licht
Samen, keine Entscheidungen
Samen werden gepflanzt
Die erste Frage
Der Gartenbau beginnt
Den Kreislauf durchbrechen
Die Festung der kleinen Dinge
Schwierige Fragen und schwierige Antworten
Weltsicht
Passende Bilder
Erhabenere Samen pflanzen
Freude
Nehmen, nicht denken
Das Ende alter schlechter Samen einläuten
Alte Schulden annullieren
Der Atem des Geistes
Gedankliche Samen
Mit Leichtigkeit
Der Seher verweilt
Zeit und Raum reduziert auf eine Pfütze
Am Fluss stehen
Gnade
Ihre Hand
Nachwort
Vorwort
In den letzten Jahren sind überall in der westlichen Welt Yoga-Schulen eröffnet worden. Manche Menschen besuchen einige Wochen lang regelmäßig Kurse und beginnen dann bereits, schlanker, stärker und strahlender auszusehen. Andere versuchen es eine Zeit lang, teilweise sogar an derselben Schule, erzielen aber anscheinend nicht die Ergebnisse, die sie sich davon erhofft haben. Worin liegt der Unterschied?
Dieses Buch erklärt das Geheimnis, wie Yoga funktioniert, sodass es auch bei Ihnen wirkt. Heutzutage werden viele verschiedene Arten von Yoga gelehrt; egal, welche Art Sie lernen, dieses Buch wird Ihnen helfen, dabei erfolgreich zu sein.
Die Tipps, die Sie hier finden, um beim Yoga erfolgreich zu sein, stammen direkt aus dem ältesten Buch, das jemals darüber verfasst wurde: den Yoga-Sutras bzw. einem Werk mit dem Titel »Ein kurzes Buch über Yoga«. Es wurde vor ungefähr zweitausend Jahren in Indien geschrieben, ist aber heute noch genauso aktuell wie damals – und ebenso wirksam.
Wir haben unsere Übersetzung des Buches in die Geschichte einiger Menschen eingebettet, die Yoga lernen wollen und dabei auf dieselben Herausforderungen stoßen wie wir alle – und Erfolg haben, indem sie lernen, wie Yoga wirklich funktioniert. Tatsächlich reicht ihr Erfolg weit über gutes Aussehen und sich wohlzufühlen hinaus – und so wird es auch Ihnen ergehen.
Sicher interessiert es Sie, dass wir alle, die Autoren dieses Buches, viele Jahre unseres Lebens damit verbracht haben, direkt von den großen Lamas und Meistern der alten indischen und tibetischen Traditionen zu lernen, wie Yoga funktioniert. Außerdem haben wir uns vieler alter Bücher dieser Tradition bedient, die teilweise zuvor ins Englische übersetzt worden sind, um Ihnen eine Anleitung zu geben, die authentisch ist und funktioniert.
Sie werden sehen, dass das Buch in Wochen unterteilt ist: Wir schlagen vor, dass Sie das Buch einmal ganz von vorn bis hinten lesen. Danach empfiehlt es sich, es regelmäßig in der Ruhephase nach der eigenen Yogapraxis hervorzuholen und das mit der jeweiligen Woche korrespondierende Thema zu betrachten. Wenn Sie diesem Rat folgen, können wir sicher sein, dass Sie erfahren, warum Yoga wirkt. Und dass Sie dabei die Gesundheit und Freude finden, die wir gefunden haben.
Viel Glück von uns allen!
Ihre Diamond-Mountain-Lehrer
Wo wir alle anfangen
Dritte Februarwoche,
Jahr der Eisenschlange (1101 n. Chr.)
Es war eine dieser staubigen kleinen indischen Städte. Es gab kein Ortsschild und keine Möglichkeit, herauszufinden, wie das Städtchen heißt. Die Straße wird einfach nur breiter und man sieht mehr Menschen. Dann endet plötzlich das wilde Grün des Dschungels und man erkennt die ersten kleinen Häuser aus braunen Lehmziegeln. Ehe man sich versieht, befindet man sich inmitten eines kleinen Stroms aus Bauern, Frauen, die Wasserkrüge aus Ton auf ihren Köpfen tragen, Kühen, Schweinen und Hühnern, die alle zur Stadtmitte ziehen.
Wir kamen zu einem kräftigen Holzbalken, der ungefähr in Hüfthöhe über die Straße ragte. An einer Seite stand ein kleines Wachhäuschen mit einem gelangweilten Polizisten, der sich in der sonnigen Hitze aus einem kleinen Fenster auf die staubige Straße lehnte. Long-Life und ich hatten im Jahr zuvor schon Dutzende solcher kleinen Grenzübergänge gesehen – die Polizei sollte Menschen, die Holz oder wilde Tiere aus dem Dschungel stehlen wollten, fangen, denn der Dschungel war Eigentum eines kleinen örtlichen Tyrannen, der sich selbst König nannte.
Meistens jedoch nutzte die Polizei die Gelegenheit, um Bestechungsgelder von reisenden Kaufleuten zu erpressen.
Die Menschen und Tiere kamen bis zum Schlagbaum, duckten sich darunter durch und gingen weiter, so machten es auch Long-Life und ich. Für Long-Life war es einfacher. Er ist ein kleiner tibetischer Schnauzer und reicht mir bis zur Hälfte der Wade.
Als wir uns unter dem Schlagbaum hindurchduckten, trat der Polizist heraus. Er bückte sich träge, hob einen Stein auf und warf ihn nach Long-Life, der sich bereits an diese indische „Begrüßung“ gewöhnt hatte und dem Stein mit Leichtigkeit auswich. Ich war hingegen müde und mir war heiß und so bedachte ich den Mann mit einem strafenden Blick, während ich Long-Life auf den Arm nahm.
»Du«, rief er.
Ich ging ohne anzuhalten weiter, etwas, was mir meine Großmutter beigebracht hatte. Man konnte immer noch sagen, man hätte nichts gehört.
»Du da. Halt!« Und dann hörte ich einen Lathi auf den Boden klopfen. Ein Lathi ist ein starker, biegsamer, böser Holzstock. Er reicht einem ausgewachsenen Mann ungefähr bis zur Hüfte und alle Polizisten tragen einen. Er macht nicht viel her, aber in den richtigen Händen kann er die Haut in Minutenschnelle aufplatzen lassen. Einige dieser Männer, das wusste ich, suchten nur nach einer Entschuldigung, um ihn einzusetzen. Also hielt ich an.
»Komm zurück!«
Ich drehte mich um und schaute in sein Gesicht. Es war dunkel von vielen Stunden in der Sonne, seinem bösartigen Gemüt und noch etwas anderem.
Ich ging langsam zurück und versuchte, gelassen zu wirken.
»In das Wachhaus!«, befahl er mit seinem Stock deutend. Es war gerade groß genug für eine Person, auf keinen Fall für uns beide. Aber ich wollte lieber keine Diskussion anfangen; die Finger um den Stock waren angespannt.
Er drückte sich nach mir in die enge Hütte, kam mir viel zu nahe und dann wusste ich auf einmal, was mit ihm los war. Er hatte den süßlichen Gestank eines Mannes, der zu viel von dem hiesigen Zuckerrübenschnaps trank. Er starrte mich mit seinen blutunterlaufenen Augen an und ließ seinen Blick an meinem rosa-orangefarbenen Baumwollsari hinauf- und hinuntergleiten, den ich vor fast einem Jahr gegen meine warmen winterlichen Wollsachen eingetauscht hatte.
»Du bist nicht aus dieser Gegend«, sagte er in fast anklagendem Ton.
»Nein, Sir, bin ich nicht.«
»Woher bist du dann?«
»Aus Tibet«, sagte ich. Er sah mich ausdruckslos an. »Die Schneeberge«, fügte ich hinzu und deutete vage in den Norden.
Er nickte, aber sein Blick wanderte wieder zu meiner Brust, dann zu Long-Life und schließlich zu meiner roten Wolltasche.
»Was ist in der Tasche?«, fragte er in demselben Ton. Ich hatte das schon Hunderte Male gehört. Es war der typische Auftakt zu einem Bestechungsversuch.
Ich war nicht in der rechten Stimmung. »Nichts Wertvolles«, erwiderte ich und versuchte, ein paar Zentimeter von seinem Körper und seinem Gestank abzurücken.
»Öffne sie!«, befahl er und zeigte auf eine kleine Ablage am Fenster, in der Nähe unserer Ellbogen.
Ich warf ihm einen bösen Blick zu und legte meine Siebensachen schweigend auf der Ablage aus. All mein Hab und Gut: ein Schal von Katrin, ein kleiner Holznapf und das Buch, gut eingewickelt zum Schutz vor dem Wetter.
»Öffne es!«, befahl er auf das Buch zeigend. Ich wickelte es aus und er lehnte sich über die uralten Seiten, als wolle er sie lesen. Sie standen jedoch auf dem Kopf.
»Es ist alt«, erklärte er. Er richtete sich wieder auf und sah mir direkt in die Augen.
»Stimmt«, sagte ich einfach.
»Woher hast du es?«
»Mein Lehrer gab es mir«, erwiderte ich.
Er sah wieder in mein Gesicht. »Dein Lehrer«, sagte er ungläubig.
»Mein Lehrer«, wiederholte ich.
»Pack es wieder ein.« Er deutete auf das Buch und meine Sachen.
Ich sammelte sie langsam ein und versuchte, ihn nicht sehen zu lassen, dass meine Hände zitterten. Dann schaute ich an ihm vorbei zur Tür hinaus.
»Darf ich dann gehen, Sir?«
Er nahm die Tasche aus meinen Händen. »Du wirst mit mir kommen.« Mit diesen Worten drehte er sich um, trat auf die Straße und machte sich auf in Richtung der Stadt.
Ich folgte ihm mit hämmerndem Herzen und Long-Life fest an meine Brust gedrückt. Nach etwa einer halben Stunde bog der Mann von der Straße in einen kleinen staubigen Hof ab. Am hinteren Ende stand ein schmutziges, heruntergekommenes Gebäude aus denselben dumpfen braunen Lehmziegeln. Es hatte eine Veranda mit einem palmengedeckten Dach, das an einer Seite bereits heruntergefallen und mit einer dichten Schicht staubigen Schmutzes bedeckt war. Im Giebel des Gebäudes war das Gesicht eines Löwen in den Lehm gekratzt, worunter sich zwei gekreuzte Schwerter befanden. Das Zeichen des örtlichen Königs, dachte ich mir – die sehen alle ziemlich ähnlich aus. Zumindest hatte er kein Geld genommen. Vielleicht könnte ich mit einem Höhergestellten sprechen, jemandem, der nicht betrunken war.
Der dunkelhäutige Mann trat zur Seite und zeigte mit seinem Stock auf die Tür. »Rein!«, grunzte er.
Ich hob meinen Rock und schritt über den Unrat, der sich auf der Veranda angesammelt hatte, und dann durch eine kleine Tür.
»Setz dich«, sagte er und zeigte auf eine kleine Holzbank an der Wand. Er ging durch eine Türöffnung in der gegenüberliegenden Wand und ich hörte, wie er mit leiser Stimme zu jemandem dahinter sprach.
Ich sah mich in der kleinen Polizeiwache um und erkannte, dass es sich um das Gefängnis handelte. Der Raum, in dem ich saß, war ziemlich groß. Der hintere Teil war mit Lehmziegeln in drei grobe Zellen unterteilt worden. Die Vorderseiten dieser Zellen bestanden aus Bambusrohren, die vom Boden bis zur Decke reichten und in die eine kleine Tür eingelassen war. Zwei der Zellen waren leer, aber in der Zelle ganz rechts lag eine Gestalt mit dem Gesicht nach unten auf dem nackten Boden.
An der Wand vor mir stand ein Regal mit alten, verrosteten Schwertern und Speeren. Es war mit einem Riegel gesichert. Das waren echte Waffen – Waffen, um Schwierigkeiten zu beheben, die diese Stadt vermutlich noch nie gehabt hatte. Hinter mir gab es zwei weitere kleine Zimmer. Das war es. Ich senkte meinen Blick wieder auf den Boden und die dort versammelten Schmutzhäufchen.
Der Polizist kam wieder heraus. »Komm!«, befahl er und zeigte auf die Tür hinter mir. Ich trat mit ungutem Gefühl ein, Long-Life fest an meine Brust gedrückt.
»Setz dich«, sagte er und deutete diesmal auf eine Grasmatte am Boden. »Der Hauptmann will mit dir sprechen. Warte.« Er ging und schloss die Tür hinter sich.
Ich setzte mich und sah den Hauptmann an. Er saß auf einer dicken Matte mit Kissen am Kopfende des Raumes über einen niedrigen, mit Papieren bedeckten Tisch gebeugt und schien ganz damit beschäftigt zu sein, etwas mit einem Bambusstift aufzuschreiben. Inzwischen kannte ich diesen kleinen Trick. Er würde mich so lange warten lassen, bis er sicher sein konnte, dass mir unbehaglich war. Erst dann würde er sich dazu herablassen, meine Anwesenheit wahrzunehmen. Das war seine Art, zu zeigen, dass ich unter seiner Würde war.
Ich nutzte die Zeit, um den Raum und auch den Hauptmann genau zu betrachten. Der Mann war von Unordnung umgeben: Stapel von Kontenbüchern und Papieren, alles von einer dünnen, braunen Staubschicht bedeckt. Das einzige Licht kam von einem kleinen Fenster gegenüber der Tür, durch das die Nachmittagssonne auf ihn und seine Arbeit fiel.
Ich schätzte sein Alter auf ungefähr fünfunddreißig. Er war der typische Beamte mittleren Alters. Früher hatte er bestimmt einmal gut ausgesehen. Er hatte dickes, schwarzes, leicht gelocktes Haar, in dem sich die ersten grauen Strähnen zeigten. Viel zu früh, dachte ich. Als er zur Seite schaute, um etwas zu überprüfen, sah ich, dass er leicht zusammenzuckte. Deshalb und aufgrund seiner gebeugten Schultern vermutete ich, dass er sich durch jahrelanges Gekrümmt-am-Schreibtisch-Sitzen ein Rückenleiden zugezogen hatte. Sein Gesicht war einst stark, beinahe edel gewesen, vermutete ich, nun aber war es gezeichnet von Schmerzensfalten, die sich von seinen Augenbrauen bis zu seinen Mundwinkeln zogen. Seine Wangen waren etwas aufgedunsen und er hatte Tränensäcke unter den Augen. Vermutlich verursachten ihm seine Rückenschmerzen Schlafprobleme. Und nicht nur dies. Ich nahm noch einen anderen Schmerz wahr – in seinem Herzen. Um nicht zu forsch zu erscheinen, senkte ich meinen Blick und wartete, wie man es von einer Frau in diesen Zeiten erwartete.
Schließlich legte er den Stift beiseite, verschloss sein Tintenfass und sah mich mit dem festen Blick eines Mannes an, der sich seiner Autorität gewiss ist.
»Der Wachtmeister sagt, ich solle meine Zeit damit verschwenden, ein Mädchen mit einem Buch zu befragen«, seufzte er.
Ich blickte auf und schaute in seine Augen. Es war kein unfreundliches Gesicht, aber es war das Gesicht eines Menschen, der Schmerzen hatte, und so dachte ich, es wäre besser, zu schweigen. Es entstand eine kleine Pause und in diesem Moment spürte ich, dass er bereit war, mich wieder meines Weges zu schicken. Ich schaute zur Tür. Er schien zu zögern, aber als ich mich zu ihm umwandte, musterte er mein Gesicht, als würde er mich womöglich kennen. Dann schaute er kurz nach unten und legte eine Hand auf den niedrigen Schreibtisch.
»Komm näher. Zeig mir das Buch.«
Ich stand auf, nahm das Buch aus meiner Tasche und legte es auf den Tisch. Ich wollte es auswickeln, aber seine Hände waren schneller, starke, schöne Hände, und packten es mit flinken Fingern aus. Er schien Ahnung von Büchern zu haben.
»Der Wachtmeister hatte recht«, er nickte. »Es ist ein altes Buch – Seiten aus Palmblättern, in die auf die alte Art Buchstaben gekratzt wurden.«
Ich nickte schweren Herzens.
»Wie bist du in den Besitz dieses Buches gelangt?«, fragte er mich mit strengem Blick.
»Mein Lehrer gab es mir.«
»Lehrer? Was für ein Lehrer?«
»Der eine, Sir.« Ich wusste, jetzt könnte es Ärger geben, aber wie immer war mir klar, dass es besser war, ehrlich zu sein. »Derjenige, der ... der es mich gelehrt hat.«
»Es dich gelehrt hat?«
»Ja, Sir.«
»Dich, ein Mädchen? Wie alt bist du?«
»Siebzehn, Sir.«
»Und du ... du hast dieses Buch studiert?«
»Habe ich.« Stolz hob ich meinen Kopf, so wie Großmutter es getan hätte.
»Wo?«
»In meinem Land, in Tibet.«
»Und da lebt auch dein Lehrer?«
»Ja, Sir ... oder ...«
»Oder was?«
»Er lebte dort ...«
»Ist er tot?«
»Mein Lehrer ist ...« Wie sollte er es jemals verstehen? »Mein Lehrer ist ... ist fortgegangen.«
»Fortgegangen?« Er bemerkte mein Zögern und sah mich aufmerksam an.
»Ja, Sir.« Ich lehnte mich ein wenig zurück und begann langsam, mir Sorgen zu machen.
»Und warum bist du dann nach Indien gekommen?«
»Ich reise zum Ganges, nach Varanasi, um dort weiter zu studieren.«
»Studieren? Ein Mädchen? Studieren mit wem?«
»Mit einem Lehrer«, erwiderte ich matt.
»Was für ein Lehrer? Wie heißt er?«
»Ich weiß es nicht ...«
»Du weißt es nicht? Wie willst du ihn dann finden?«
Oder sie, dachte ich, behielt den Gedanken aber für mich und schüttelte nur den Kopf.
Er musterte mich eindringlich. »Wie lange bist du schon auf Reisen?«
Ich schaute zur Decke und zählte die Monate. »Ein Jahr, Sir. Fast genau ein Jahr.«
»Und was hält dein Ehemann davon?«
»Ich ... ich habe keinen Ehemann, Sir.«
»Dann dein Vater.«
»Mein Vater ... mein Vater weiß, dass ich nach Indien gegangen bin.«
»Er weiß es, heißt es aber nicht gut?«, hakte er nach. Ich senkte meinen Blick.
Der Hauptmann seufzte erneut und fuhr mit den Fingern über den Buchtitel. Ich sah, wie sich seine Lippen bewegten, versuchten, den Klang des Sanskrits, der Muttersprache, zu bilden. Er kann es also lesen, dachte ich, aber nur zögerlich – gerade einmal den Klang.
»Es sind die Yoga-Sutren«, sagte er sanft. »Die große Mutter aller Lehren des Yoga.«
Ich nickte.
»Und du kennst es? Kennst du es gut?«
Ich nickte wieder.
Plötzlich richtete er sich gerade auf und ich sah ihn wieder zucken. Er hatte sich inzwischen so sehr daran gewöhnt, dass er sich dessen gar nicht mehr bewusst war.
»Stell dir vor, wie das in meinen Ohren klingen muss«, sagte er. »Ein Mädchen, ein Mädchen in deinem Alter, behauptet, ein solches Buch zu kennen. Ein unbezahlbares Buch, gelehrt von einem verschollenen Lehrer. Ein Mädchen, das allein umherzieht in einem fremden Land, ohne Ehemann, ohne Erlaubnis des Vaters, auf der Suche nach einem namenlosen Lehrer. Und wenn man dem Wachtmeister glauben darf, noch dazu ohne eine Rupie in seinem Besitz.«
Ich nickte. So konnte man meine Situation zusammenfassen.
»Du schwörst also, dass das Buch dir gehört? Du hast es nicht gestohlen?«
»Es gehört mir.«
Er stieß einen schweren Seufzer aus und drehte dann das Buch zu mir herum. Er blätterte durch die Palmblatt-Seiten und tippte mit seinem Finger auf eine Stelle.
»Gut, dann lies das. Was steht hier geschrieben?«
Ich beugte mich über den Tisch. »Es ist aus dem zweiten Kapitel«, fing ich an. »Und da steht:
Dinge, die nicht andauern können,
Erscheinen uns, als ob sie es täten.
ii. 5a«
Der Hauptmann senkte einen Moment den Blick, und als er ihn wieder hob, glitzerte es verdächtig in seinen Augen, als ob er gleich zu weinen beginnen würde. In seiner Stimme lag Verärgerung, vielleicht auch Kummer.
»Was soll das bedeuten?«, fragte er gebieterisch.
»Es handelt von unserem Leben«, erwiderte ich ruhig. »Unseren Freunden, unserer Familie, unserer Arbeit, unserem Körper. Wenn sie da sind, vor unseren Augen – wenn wir sie sehen und berühren können –, dann scheint es, als wären sie für immer da. Doch eines Tages verlassen sie uns unweigerlich.«
Der Muskel in seinem Kiefer zuckte. »Das bedeutet es nicht.«
»Doch, genau das bedeutet es, Sir.«
»Du lügst. Du denkst dir irgendetwas aus und versuchst, zu verbergen, dass du dieses Buch gestohlen hast. Denn das ist es nicht, was diese Stelle des Buches besagt. Es ist ein Buch über Yoga, das größte Buch des Yoga – und Yoga ist ... Yoga sind, nun, du weißt schon, Übungen, etwas, was man tut, spezielle Bewegungen, um gesund zu werden, um Probleme zu beheben, körperliche Probleme.« Er beugte sich weit zu mir herüber und zuckte dabei erneut zusammen, ohne sich dessen bewusst zu sein.
»Aber genau das sagt es«, wiederholte ich.
Der Hauptmann funkelte mich an und schloss das Buch. Ich streckte meinen Arm aus, um es an mich zu nehmen, aber er ließ seine Hand schwer auf die Seiten fallen.
»Ich werde es behalten«, sagte er rundheraus.
»Aber ich brauche es.«
»Das mag sein, aber es macht nichts, denn du bleibst auch.«
Mir klappte die Kinnlade hinunter und Tränen der Wut sowie der Angst stiegen in mir auf.
Der Hauptmann erhob sich mit einiger Mühe und sah stehend auf mich hinab.
»Wir werden sehen, ob irgendjemand das Buch als gestohlen meldet. Es kann ... ein paar Tage dauern. Während dieser Zeit wirst du die Gelegenheit haben, zu beweisen, dass das Buch wirklich dir gehört.«
»Aber ... aber wie?«, rief ich.
»Ganz einfach.« Er lächelte, doch auf seinem Gesicht lag ein Schatten der Anspannung. »Ich habe ein Problem, verstehst du. Ich habe meinen Rücken verletzt; es tut seit ... seit langer Zeit weh. Und Yoga, das weiß ich, kann es heilen. Du wirst mir zeigen, wie ich meinen Rücken heilen kann. Wenn dir das gelingt, weiß ich, dass du Yoga kennst, und dann kann ich dir auch glauben, dass das Buch dir gehört. Verstanden?«, sagte er mit einer gewissen Endgültigkeit in der Stimme.
»Aber ...«, erwiderte ich.
»Wachtmeister«, rief er zur Tür. »Komm und sperr sie ein!«
Bleibendes Wohlbefinden
Vierte Februarwoche
Der Wachtmeister packte mich grob am Arm, führte mich zur mittleren Zelle, schubste mich hinein und verriegelte die Tür. Einen Moment später kam er mit einem kräftigen Seil zurück.
»Schling es um den Hals des Hundes.«
»Er bleibt bei mir.« Ich versuchte, Großmutters autoritären Ton nachzuahmen, was mir jedoch misslang.
»Keine Hunde im Gefängnis«, sagte er nur.
Ich stand bewegungslos da und funkelte ihn böse an. Dann begann ich einfach zu weinen.
Es funktionierte – zumindest ein bisschen.
»Ich binde ihn draußen an«, sagte der Wachtmeister unwirsch. »Dann kannst du ihn durchs Fenster sehen.« Er zeigte mit seinem Stock auf ein kleines vergittertes Fenster in der Rückwand.
»Und Futter? Und Wasser?«, fragte ich.
Er sah mich mit finsterer Belustigung an. »Das Gleiche wie du«, sagte er nur. Er klopfte ungeduldig mit seinem Stock auf den Boden und ich verstand, dass ich mich schon glücklich schätzen durfte, dass er Long-Life nicht gleich umbrachte. Ich bückte mich, band Long-Life das Seil um den Hals und befahl meinem kleinen Löwen, brav zu sein – jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um anderen Menschen ins Bein zu beißen. Er war ruhig und schien es zu verstehen; wir hatten schon viel gemeinsam erlebt und das hier war nur eine weitere Phase, die wir für unser größeres Ziel durchstehen mussten. Folgsam trottete er mit dem Wachmann mit.
Kurze Zeit später sah ich ihn durch mein Fenster, und als die Dämmerung hereinbrach, entdeckten wir ein kleines Loch am Fuße der Wand. Es war gerade so groß, dass ich meine Hand hindurchstecken und Long-Lifes Nase berühren konnte, wenn wir uns beide streckten, aber die Steine waren gänzlich mit Schmutz überzogen. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und schaute aus dem Fenster. Ich sah einen kleinen Graben außen an der Zellenwand, der in einer stehenden, stinkenden Lache hinter dem Gebäude endete. Es dauerte einen Moment, bis ich mir einen Reim darauf machen konnte, doch dann verstand ich, dass dieses kleine Loch meine Toilette sein sollte. Ich drehte mich um und sah zur Vorderseite meiner Zelle hinaus.
Der Wachtmeister war immer noch da, er saß auf der Bank, den Blick gnadenlos auf mich gerichtet. In seinen Augen blitzte eine Art Hunger – genauso würde er ein Glas Alkohol betrachten. Mir wurde klar, dass dies das Schlimmste am Gefängnis sein würde – zur Schau gestellt und angestarrt zu werden, Tag und Nacht, von jedem, der mich anstarren wollte, ob ich wach war oder schlief und sogar dann, wenn ich zur Toilette ginge.
Zuerst beschloss ich, dass niemand jemals irgendetwas sehen sollte. Doch dann setzte ich mich hin und überlegte, was meine Lehrerin, was Katrin getan hätte. Die Worte des Meisters, die Worte von Patanjali, der vor tausend Jahren das kleine Buch auf dem Tisch des Hauptmanns geschrieben hatte, kamen mir in den Sinn. Ich hörte die Stimme meiner Lehrerin, die sagte:
Und sie erkennen, dass der
Körper selbst ein Gefängnis ist
iii. 39b
Auf gewisse Weise, so dachte ich, sind wir alle in einem Gefängnis, einem Gefängnis, aus dem uns nur der Tod befreien kann. Und diese anderen Gefängnisse – sie hängen lediglich vom Auge des Betrachters ab. Mir bot sich hier eine wunderbare Gelegenheit, um stärker zu werden und vielleicht auch anderen zu helfen – den anderen Menschen hier, einschließlich des Wachtmeisters, jeder gefangen in seinem persönlichen Gefängnis. Und so legte ich mich auf den Strohhaufen in der Ecke und ruhte mich aus.
Ich erwachte zur üblichen Zeit, vor Anbruch der Dämmerung, und machte wie immer meine morgendlichen Übungen. Ich hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass das Aufrechterhalten dieser Praxis wichtiger war als die Probleme, die immer wieder auftauchten und versuchten, mein morgendliches Ritual zu verhindern. Zum Glück war es im Gefängnis dunkel und das einzige Geräusch war das sanfte Schnarchen des Mannes auf dem Boden in der Nebenzelle. Immerhin war er nicht tot.
Danach setzte ich mich hin und dachte eine Weile nach. Ich dachte an den Hauptmann und seinen schmerzenden Rücken. Ich konnte meine momentane Situation als etwas Schreckliches betrachten, etwas, das Long-Life und mich das Leben kosten könnte, oder ich konnte versuchen, zu sehen, ob nicht gerade etwas Bedeutenderes geschah.
Ich begann, darüber nachzudenken, wie ich dem Hauptmann am besten und am schnellsten helfen könnte, seinen Rücken zu heilen. Dabei fiel mir auf, dass mich die Ereignisse genau an den Ort gebracht hatten, zu dem ich immer gewollt hatte: Ich hatte hier die Gelegenheit, anderen zu helfen, sich mit dem Wissen des Yoga selbst zu heilen – mit dem Wissen aus dem kleinen Buch des Meisters. Ich ertappte mich dabei, wie meine Lehrerin zu denken. Zum ersten Mal vermochte ich einzuschätzen, wie es sich angefühlt haben musste, auf der anderen Seite zu stehen und einen Schüler wie mich anzuschauen. Mir schwante, dass die Aufgabe, mich, die ich so stolz und dickköpfig war, zu unterrichten, sicherlich schwieriger gewesen war, als den Rücken eines müden Büroarbeiters zu heilen. Und so begann ich, einen Plan aufzustellen.
Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als sich im Gefängnis endlich etwas regte. Zuerst kam ein großer, jüngerer Mann durch die Eingangstür. Er drehte sich noch auf der Schwelle um, lehnte sich gegen den Türrahmen und starrte auf die vorbeiziehenden Passanten. Ungefähr zehn Minuten später kam der Hauptmann des Weges und betrat die Veranda. Der jüngere Mann nahm Haltung an, salutierte und trat respektvoll zur Seite, um seinen Vorgesetzten eintreten zu lassen.
Der Hauptmann deutete auf meine Zelle: »Bring die Gefangene in mein Zimmer.«
Der jüngere Mann drehte sich um. Er hatte mich bisher gar nicht wahrgenommen und sah mich nun überrascht an. Langsam kam er zu meiner Zelle, brachte mich in aller Ruhe ins Büro des Hauptmanns und schloss beim Gehen die Tür hinter sich.
»Wir werden jetzt anfangen«, verkündete der Hauptmann.
Ich nickte. »Bitte stellen Sie sich hier hin.« Ich zeigte auf die Mitte des Raumes. Er tat wie geheißen und ich begutachtete ihn schweigend, so wie es meine Lehrerin am ersten Tag mit mir getan hatte. Mit einem Mal wusste ich, was Katrin gesehen hatte, denn die ganz spezielle Art, wie der Hauptmann stand, verriet mir alles über sein Leben.
Sein Bauch, sein Kinn und seine Haut waren schlaff und sahen aus wie von einer Person, die den ganzen Tag am Schreibtisch arbeitet. Seine Schultern waren gebeugt und sein Nacken sah aus wie erstarrt nach Jahren der Anspannung, in denen er versucht hatte, es seinen Vorgesetzten recht zu machen, wo auch immer sie sich befunden haben mochten. Der Schmerz in seinem Rücken und der Schmerz seines Lebens hatten seine einst sanften Züge hart werden lassen.
Ich konnte seine verschiedenen Schichten sehen: der Körper zusammengesackt und verklemmt; die Gelenke, die langsam anfingen, von innen heraus steif zu werden; die inneren Winde, die an den Gelenken zu ersticken drohten; die Gedanken, die die inneren Winde blockierten; die Probleme in seinem Leben, die die Gedanken störten; und in der Mitte von alldem der Ursprung aller Ereignisse seines Lebens – eines löste das andere aus und er konnte nichts davon aufhalten, weil er sich gar nicht dessen bewusst war, was in seinem Körper geschah.
Doch wo sollte ich mit ihm anfangen? Wo hätte meine Lehrerin mit ihm angefangen? Ich hörte wieder Katrins Stimme und ich sprach die Worte des Meisters laut zum Hauptmann, meinem allerersten Schüler:
»Die Stellungen bringen ein Gefühl des
Wohlbefindens, welches dir bleibt.
ii. 46«
»Die Stellungen – du meinst die Übungen?«, sagte er. »Ja, das klingt schon eher nach Yoga.«
Ich lächelte. »Zumindest werden wir erst einmal damit anfangen. Stellen Sie sich so gerade wie möglich hin ...« Ich verbrachte eine ganze Stunde damit, ihn so in seinen Körper zu stellen, wie er in seinem Körper stehen sollte; wie er früher in seinem Körper gestanden hatte, bevor seine Gewohnheiten ihn verbogen und verdreht hatten. Und damit er nicht dächte, das wäre alles, was ich könnte, führte ich ihn dann noch durch eine Übung, die wir den Sonnengruß nennen und die ihn bereits nach wenigen Minuten aus der Puste brachte.
Am Ende hatte er den zufriedenen Blick eines Menschen, der etwas geleistet hatte – denselben Blick musste ich wohl auch an meinem ersten Tag gehabt haben, erkannte ich, und ich wusste, er hatte ihn verdient. Es braucht so viel Mut, erst einmal anzufangen, dachte ich bei mir.
»Ich möchte, dass Sie genau das jeden Morgen machen, die ganze nächste Woche über«, sagte ich. »Es dauert nur fünf oder zehn Minuten. Und dann machen wir von da an weiter. Die Stellungen werden Ihren Rücken heilen – genauso wie es im Buch steht.« Ich schaute demonstrativ zu dem Buch. »Sie werden Ihren Rücken für immer heilen.«
Der Hauptmann nickte glücklich und schickte mich zurück in meine Zelle.
Gegen Mittag dieses ersten Tages erschien ein kleiner Junge im Vorraum zu den Zellen. Er war dünn und barfüßig und nur mit zerlumpten kurzen Hosen bekleidet. In seinen Händen hielt er ein Tablett, das mit einem Tuch bedeckt war. Er ging in eines der Zimmer an der Seite und kam mit dem jüngeren Polizisten heraus. Sie gingen zu der Zelle neben meiner. Ich hörte, wie die Tür geöffnet wurde, dann ging der Junge wieder. Der Geruch von frischem Reis und selbst gemachtem Brot drang zu mir herüber und mir wurde bewusst, dass Long-Life und ich seit beinahe zwei Tagen nichts gegessen hatten.
Durch das Leben auf der Straße waren wir daran gewöhnt, nur dann zu essen, wenn sich uns eine Gelegenheit dazu bot. Ein paar Früchte am Baum, ein Fremder, der bereit war, sein Essen mit uns zu teilen. Doch jetzt war der Geruch überwältigend. Ich wartete darauf, dass mein eigenes Essen käme. Nach einiger Zeit fürchtete ich, dass es für mich gar kein Essen geben würde. In dem Moment schob sich eine Hand aus der anderen Zelle durch die Gitterstäbe und schob mir eine Tasse mit Reis und Bohnen zu.
»Iss«, flüsterte eine Stimme von der anderen Seite der Wand. »Beeil dich und dann schieb die Tasse zurück. Lass dich um Himmels willen nicht vom Wachtmeister erwischen.«
Ich schlang das Essen hinunter und legte einen guten Teil für Long-Life beiseite, den ich ihm später geben wollte. Ich schob die Tasse gerade noch rechtzeitig zurück, bevor sich der Schatten des Wachmanns an der Eingangstür abzeichnete.
Ein Grund, nicht zu schwänzen
Erste Märzwoche
Es überrascht mich immer wieder, wie schnell wir uns an etwas gewöhnen. Die Tage vergingen und ich nutzte sie gut, indem ich mir eine regelmäßige Yogapraxis und einen stillen geistigen Rückblick auf die Lektionen, die Katrin mich gelehrt hatte, angewöhnte. Es war, als ob ich mich in Klausur begeben hätte, was ich vermutlich auch tat. Das Leben in dem kleinen schmutzigen Gefängnis war langweilig – ab und zu kam ein Bauer, um eine Kuh als gestohlen zu melden, ansonsten geschah nichts. Die Tassen von der anderen Seite der Wand kamen still jeden Tag, immer gleich nachdem einer der Jungen ein frisches Tablett nach nebenan geliefert hatte. Es war kaum genug für Long-Life und mich. Der junge Polizist gab mir jeden Morgen einen kleinen Krug voll Wasser, das ich mir eine Handvoll nach der anderen mit Long-Life teilte, der in der Hitze hechelnd an einen ausgedörrten Baum gebunden war. Ich hatte sein volles Fell schon vor einer ganzen Weile kurz geschnitten, damit er besser unter der indischen Sonne reisen konnte – dennoch litt er.
Die nächste Stunde mit dem Hauptmann folgte genau eine Woche später. Er ließ mich in sein Büro bringen und ich bat ihn, zu wiederholen, was er gelernt hatte. Nach einer oder zwei Minuten erkannte ich bereits, dass er seine Übungen drei oder vielleicht sogar vier Mal hatte ausfallen lassen. Ich unterbrach ihn.
»Sie haben Ihre Übungen ausfallen lassen«, sagte ich bestimmt. »Und in dem Buch dort drüben auf Ihrem Tisch sagt der Meister:
Du musst regelmäßig
und ohne Lücken üben.
i. 14b«
»Ich habe meine Übungen nicht ausfallen lassen.« Sein Tonfall verriet, dass er es nicht gewohnt war, herausgefordert zu werden. Aber ich wusste, ich musste jetzt standhaft bleiben, sonst würde er nie geheilt werden.
»Doch, das haben Sie«, widersprach ich. »Ich kann es deutlich sehen. Vielleicht so wie Sie in die Augen eines Verdächtigen schauen und erkennen können, ob er etwas verbrochen hat oder nicht.«
»Ich wollte sagen«, räusperte sich der Hauptmann, »dass ich sie nicht habe ausfallen lassen, sondern es für nötig hielt, einen Tag mit den Übungen auszusetzen.«
»Einen Tag?« Ich lächelte ironisch und verspürte einen kleinen Stich im Herzen, weil ich mich plötzlich daran erinnerte, wie Katrin dieselben Worte mit demselben Lächeln zu mir gesagt hatte.
»Vielleicht ... vielleicht war es mehr als ein Tag«, gestand er.
»Dann müssen Sie mir jetzt mein Buch zurückgeben und mich gehen lassen«, sagte ich ausdruckslos. »Ihr Rücken wird nie heilen, wenn Sie nicht regelmäßig jeden Tag ein bisschen üben. Der Meister selbst sagt:
Und das fünfte Hindernis
ist Faulheit.
i. 30e«
Das Gesicht des Hauptmanns verdunkelte sich. Er richtete sich auf und verzog dabei wie üblich das Gesicht.
»Es war keine Faulheit!«, gab er zurück. »Ich bin kein fauler Mensch! Es war ... Arbeit! Unaufschiebbare Arbeit! Ich habe Verpflichtungen, verstehst du?!«
»Immer?«, fragte ich kühl. »War immer Arbeit der Grund? Immer etwas Wichtiges, was von Ihnen erledigt werden musste?«
Er dachte einen Moment darüber nach, bevor er antwortete. »An einem Tag – ich glaube, es war nur an einem Tag – war ich einfach nicht in der Stimmung, verstehst du? Dehnen und Strecken und Ächzen und all das; ein Mann in meinem Alter, mit meiner Verantwortung ...«
»Genug.« Lächelnd hob ich meine Hand. »Das habe ich alles schon mal gehört.«
»Hast du?« Er sah mich gespannt an. »Hast du schon viele andere unterrichtet? Ich dachte ... ich dachte, ich wäre der Erste.«
»Oh nein, diese Ausreden habe ich nicht von anderen gehört.« Ich lachte. »Ich kenne sie, weil ich selbst versucht habe, sie meinem Lehrer zu erzählen. Ich weiß daher, was wirklich dahinter steckt. Schlicht und einfach Faulheit. Kein edler Grund, keine hehre Verpflichtung. Irgendetwas kommt des Weges, und da Yoga ein bisschen anstrengend ist, lässt man es einfach ausfallen. Sie wollen es nicht wirklich tun. Sie wollen Ihren Rücken nicht ernsthaft heilen. Deshalb sollten Sie mich einfach gehen lassen.«
»Aber ich will es ... Ich will meinen Rücken heilen. Er tut weh, weißt du.« Er legte seine Hand auf den Rücken und schaute mit einer gewissen Traurigkeit zu Boden. »Es tut alles weh. Ich habe wirklich gedacht, du könntest mir helfen.«
Eine ganze Weile schwiegen wir. Ich sah ihn an, wie er so dastand mit seiner Traurigkeit. Dann kam mir der Gedanke, dass er vielleicht bereit war für den nächsten größeren Schritt, einen Schritt, der ihn weit bringen würde, wenn er es wirklich versuchte.
»Hauptmann, Sir, ich glaube Ihnen. Ich glaube, dass Sie wirklich geheilt werden wollen.«
Er schaute auf und blickte mich mit Dankbarkeit in den Augen sanft an.
»Und deswegen werde ich Ihnen jetzt etwas sagen, etwas Besonderes. Es ist ein bisschen früh, um darüber zu reden, aber wenn Sie es befolgen – ernsthaft befolgen –, werden Sie in der Lage sein, regelmäßig zu üben. Sie werden Ihre Übungen nicht schwänzen. Und dann wird es funktionieren.«
Er nickte. »Sag es mir. Ich werde es versuchen.«
Ich nickte ebenfalls. »Im Buch sagt der Meister:
Und wenn du diese Hindernisse überwinden willst,
dann gibt es eine, und nur eine
entscheidende Übung, um es zu schaffen.
i. 32«
»Und welche ist das?«, fragte er.
»Der Meister fährt fort:
Du musst Mitgefühl einsetzen.
i. 33b«
Der Hauptmann drehte sich um und sah aus dem Fenster. »Mitgefühl? Was soll denn das bedeuten? Wie soll mich das davon abhalten, meine Übungen ausfallen zu lassen?«
»Es ist etwas, das Sie verstehen müssen«, sagte ich leise »Es ist etwas sehr Wichtiges. Sie können nicht nur Yoga machen, um Ihren eigenen Rücken zu heilen. Das ist zu einseitig gedacht. Wir sind zu einseitig. Wenn wir etwas nur tun, um uns selbst zu helfen, wird es nie Erfolg haben. Man kann nie echte Anstrengung in etwas hinein legen, wenn man es nur für sich selbst tut. Man muss es für ein hehres Ziel tun.«
»Ein hehres Ziel? Was soll das sein?«
»Schauen Sie sich an, wie Frauen für ihre Kinder arbeiten – welche Arbeit sie vollbringen können, vierundzwanzig Stunden am Tag, Tag für Tag, zwanzig Jahre lang. Im Vergleich dazu ist Ihr kleines bisschen Büroarbeit lächerlich. Doch die Frauen schaffen diese ganze Arbeit nur aus einem Grund – weil sie es nicht für sich tun, sondern für andere.«
Der Hauptmann lachte. »Ich soll mein Yoga folglich auch für andere machen? Willst du mir sagen, dass ich meinen Rücken nicht heilen kann, wenn ich auf dem Weg dorthin nicht noch ein paar andere Rücken heile?«
»So in etwa«, sagte ich. »Alles, was Sie tun müssen, ist, darüber nachzudenken, wie Sie mit dem, was Sie hier lernen, weiteren Menschen helfen können. Wenn ich Sie das ganze Yoga lehre und Ihr Rücken tatsächlich besser wird und Sie mit einem breiten Lächeln im Gesicht herumlaufen, würde das irgendetwas bewirken, sagen wir, für den Wachmann oder den jungen Polizisten?«
»Für den Unteroffizier?« Der Hauptmann lächelte. »Ich weiß nicht – es braucht schon einiges, um ihn zu irgendetwas zu bewegen. Er hat überhaupt keine Energie; er begeistert sich für nichts. Er isst einen Berg von seiner Mutter mit Butter bestrichener Fladenbrote – stopft sich seinen kleinen Schmerbauch voll – und schlendert zur Arbeit. Dann steht er dort an der Tür und starrt den ganzen Tag nach draußen ins Nichts.« Er machte eine Pause. »Aber könnte Yoga ihm irgendetwas bringen? Glaubst du, es könnte ihm ein wenig Energie schenken, ein wenig Interesse am Leben?«
»Yoga kann viel«, erwiderte ich. »Vieles, was Sie sich kaum vorstellen können. Ja, sicher, es würde sein Leben verändern.« Ich legte eine kleine Pause ein, damit er wirklich zuhörte, was ich als Nächstes zu sagen hatte. »Sehen Sie, jetzt, wo er weiß, dass Sie mit Yoga angefangen haben, wird er abwarten, ob es Ihnen hilft. Wenn es das wirklich tut, könnten wir ihn dazu bringen, auch ein bisschen mehr auf sich zu achten. Das bedeutet, Mitgefühl einzusetzen. Wenn Ihnen bewusst ist, dass Sie nicht nur Ihren Rücken heilen, sondern dabei auch dem jungen Polizisten helfen, wird der Tag kommen, an dem Sie Ihre Übungen ausfallen lassen wollen und es dann doch nicht tun. Weil Sie damit nicht nur sich, sondern auch ihm schaden würden. Verstehen Sie?«
Der Hauptmann dachte darüber nach, aber ich konnte sehen, dass die Vorstellung nicht einleuchtend genug war, um sich in seinem Herzen festzusetzen. In diesem Augenblick sprang die Tür zu seinem Büro auf und der Wachmann platzte ins Zimmer. Er schnappte keuchend nach Luft, sein Gesicht war ganz rot und verzerrt von dem Alkohol, den er gerade genossen hatte.
»Oh!«, rief er aus. »Entschuldigung, Sir. Ich wusste nicht, dass Sie beschäftigt sind!« Er stand dümmlich schwankend im Türrahmen und schielte uns beide an.
»Das auch?«, fragte mich der Hauptmann leise.
»Auch das«, erwiderte ich.
Er nickte. »Ich werde es nicht vergessen.« Dann sagte er: »Wachmann, bringen Sie die Gefangene zurück in ihre Zelle.«
Ein Gleichgewicht der Gefühle
Zweite Märzwoche
Weitere Tage vergingen. Long-Lifes Seil dehnte sich und er robbte etwas näher an das kleine Loch heran, sodass ich seinen Kopf ein bisschen kraulen konnte. Inzwischen kannte ich den Dienstplan meiner drei Wächter. Der Hauptmann befolgte die typischen Bürozeiten. Er kam vormittags hereingeschlendert, arbeitete ein bisschen, machte eine lange Mittagspause, unterhielt sich danach mit ein paar Freunden, die auf eine Tasse Tee vorbeikamen, arbeitete dann noch etwas und ging rechtzeitig zum Abendessen nach Hause. Der Wachtmeister und der Unteroffizier wechselten sich mit ihrem Dienst ab und einer von ihnen schlief jeweils nachts im Nebenzimmer.
Eines Nachts gab es etwas Aufregung. Jemand hämmerte an die Eingangstür und weckte dadurch den Wachtmeister. Er musste mit ihm gehen und verschloss auf dem Weg nach draußen die Tür. Ein paar Minuten später hörte ich ein Klopfen von der Zelle nebenan.
»Mädchen«, sagte der Mann. »Mädchen, bist du wach?«
Ich war etwas überrascht. Ich hatte inzwischen die Hoffnung aufgegeben, hier jemanden zu finden, mit dem ich reden könnte. »Ja, ja, bin ich.«
»Gut, gut. Wir sollten uns unterhalten. Aber gib gut Acht auf die Eingangstür. Es ist den Gefangenen strengstens verboten, miteinander zu sprechen, und der Wachtmeister wird dir mit seinem Stock die Haut vom Allerwertesten abziehen, wenn er dich dabei erwischt. Verstanden?«
»Oh ja«, sagte ich, plötzlich um Worte verlegen.
»Wie heißt du?«, flüsterte er.
Mir dämmerte, dass mich das bislang noch niemand hier gefragt hatte. »Ich heiße Freitag«, flüsterte ich zurück.
»Du bist an einem Freitag geboren, ja?«, flüsterte er.
»Ja. Ja, das ... und mehr.«
»Gut, ich bin Busuku.« Er zog die Silben in die Länge: Buuu-suuu-kuuu.
»Busuku?«, fragte ich. »Das klingt gut. Hat der Name eine Bedeutung?«
»Oh ja«, erwiderte er mit einem leisen Lachen. »Es bedeutet ‚Herr Wertlos‘. Ich schätze, viele Menschen denken, ich bin die wertloseste Person in dieser wertlosen kleinen Stadt.«
»Ich denke nicht so. Ich wüsste nicht, was wir ohne dich getan hätten.«
»Wir? Ach so – du gibst etwas von deinem Essen dem Hund.«
»Oh ja, aber – er ist nicht nur ein Hund, verstehst du ...?«
»Ich verstehe. Also werde ich dir zukünftig etwas mehr schicken. Aber wir müssen reden ...« Die Eingangstür sprang auf. Ich erkannte die Silhouette des Wachtmeisters und wir verstummten. Doch der Polizist murmelte nur etwas vor sich hin und stolperte in sein Zimmer. Dann war wieder alles ruhig.
Beim nächsten Mal, als mich der Hauptmann zu sich rief, blieb er an seinem kleinen Tisch sitzen und bedeutete mir, mich auf die Matte zu setzen, die vor ihm auf dem Boden lag.
»Irgendetwas stimmt nicht«, sagte er.
»Und was?«
»Ich habe getan, was du gesagt hast – was das Buch sagt oder was du behauptest, es stünde in dem Buch. Egal. Ich habe es geschafft, an jedem einzelnen Tag zu praktizieren, außer an meinem freien Tag ...« Er schaute mich an wie ein Schuljunge, der erwartete, Ärger zu bekommen.
»Ein freier Tag ist in Ordnung«, sagte ich. »Wenn du bewusst einen oder zwei Tage in der Woche auswählst, an denen du dich erholst, ist das kein Auslassen, sondern in Ordnung.«
»Oh. Gut. Das freut mich. Ich habe mir schon so etwas gedacht. Und du hattest recht, wenn ich an den Unteroffizier und den Wachtmeister denke ...« Er verstummte, wandte sich zum Fenster und sah einen Moment lang hinaus. Dann drehte er sich wieder zu mir um und sah mich an.
»Sie haben solche Schmerzen, weißt du – ganz normale Menschen, die versuchen, ihr Leben zu leben, aber jeder hat irgendetwas. Ich habe lange gebraucht, um das zu begreifen. Mir vorzustellen, ich könnte ihnen helfen, und sei es auch nur ein kleines bisschen, ist mir gelungen. Ich habe keinen einzigen Tag ausgelassen. Aber jetzt glaube ich, dass es auf Dauer nicht gelingen wird.«
»Warum nicht?«
»Als ich anfing, jeden Tag ein bisschen Yoga zu machen, bekam ich auf einmal überall Schmerzen. Und meine Knochen – meine Knie und meine Arme und manchmal auch mein Rücken – geben seltsame knackende Geräusche von sich, wenn ich die Übungen mache. Und deshalb glaube ich, dass ich vielleicht anders bin – vielleicht funktioniert das bei mir nicht.« Er sah mich etwas geknickt an.
»Knackende Geräusche?«, fragte ich. »Hört es sich so an, wie wenn man seine Finger knacken lässt?«
»Genau so!«, rief er aus.
Ich lächelte. »Das ist ganz normal, besonders für einen Mann in Ihrem Alter. Die Gelenke, die die Knochen verbinden – besonders in den Knien, dem Hals, dem Rücken und den Schultern –, sind über die Jahre immer steifer geworden. Das ist Ihnen bislang nur nicht aufgefallen. Und jetzt lockern wir sie, setzen kleine Stellen frei, an denen die inneren Winde blockiert waren, und das erzeugt dieses kleine knackende Geräusch. Aber falls irgendetwas anderes wirklich wehtut, sollten Sie mir sofort Bescheid sagen.«
Er nickte, war aber mit seinen Gedanken ganz woanders. »Innere Winde?«, fragte er.
»Später«, erwiderte ich. »Später. Im Moment sollten Sie sich erst einmal freuen, wenn Sie diese Geräusche hören. Wenn die Gelenke erst einmal gelockert sind und die Winde zu fließen beginnen, werden sie von allein verschwinden. Es wird Ihnen vermutlich nicht einmal auffallen.«
»Und was ist mit dem Rest?«, beharrte er. »Du sollst mich heilen! Aber ich stehe aus dem Bett auf und gehe zur Arbeit wie eine lahme Ente. Mir tut alles weh!«
Ich lachte wieder. Das sollte man sich einmal vorstellen, mit ebendiesem Gerede habe ich meine Lehrerin auch genervt, ich habe sogar fast dieselben Worte benutzt. »Sie haben Schmerzen«, sagte ich, »weil Sie Muskeln aufwecken, die lange Zeit geschlafen haben. Wenn Sie diese Muskeln nicht aufwecken, wird Ihr Rücken niemals besser. Denn sie sind es, die Ihren Rücken aufrecht halten. Sobald Sie diese Art von Schmerzen verspüren, möchte ich, dass Sie sich an etwas aus des Meisters kurzem Buch über Yoga erinnern:
Lerne, deine Gefühle im Gleichgewicht zu halten.
Egal, ob sich etwas gut anfühlt oder ob es wehtut.
i. 33d
Es wird immer Tage geben, an denen Sie sich etwas wund fühlen, und andere, an denen Sie plötzlich einen Durchbruch erzielen und sich bestens fühlen. So ist das einfach, so ist es mit allem. Sie müssen versuchen, sich nicht zu sehr entmutigen zu lassen und sich nicht zu sehr zu freuen, denn erst einmal wird es eine ganze Zeit lang stetig auf und ab gehen. Man darf sich davon nicht ablenken lassen. Sie haben ein Ziel – Sie müssen an die beiden Männer denken.«
Der Hauptmann streckte sich und stand auf. Ich sah, dass er Muskelkater hatte, aber er zuckte nicht mehr zusammen – was ihm selbst allerdings nicht bewusst war. Er kam in die Mitte des Raumes und ich führte ihn durch seine Übungen und fügte ein paar stehende Positionen wie das Dreieck hinzu, um in seinem Körper Kraft aufzubauen. Auf die eine oder andere Art würde das alles seinem Rücken helfen.
Als wir aufhörten, schwitzte er, sah aber belebt aus – sowohl in seinem Herzen als auch in seinem Gesicht. Er stand eine Minute da, bevor er mich in die Zelle zurückschickte.
»Du hast etwas gesagt«, fing er an.
»Ja?«
»Du sagtest, es würde eine Zeit lang ... eine Zeit lang weiter auf und ab gehen. Aber du sagtest auch ‚erst einmal‘. Was soll das heißen?«
»Es wird.« Ich lächelte. Das war etwas, was Katrin immer zu mir gesagt hatte.
Es richtig machen
Dritte Märzwoche
Menschen denken, Gefängnisse seien schlecht, weil man nicht hinausgehen kann, wann man will. Aber ich glaube, wenn man alle Gefangenen, die es jemals gegeben hat, befragen könnte, was am Hinter-Gittern-Sein das Schlimmste ist, lautete die Antwort wohl: Zecken, dicht gefolgt von Flöhen, und mit etwas Abstand kämen dann die selteneren Besucher wie Ratten und große Dschungelkakerlaken. Der Boden war zu kalt, um nicht auf dem Heu zu schlafen, aber im Heu lebten auch die Zecken.
Während ich schlief, ging es. Nur ein leichtes Jucken hier und da, das meine Träume auf seltsame Umwege schickte. Aber wenn die ersten Sonnenstrahlen durch mein Fenster fielen, sah ich jeden Morgen zwei oder drei Zecken an der Wand hängen – anscheinend ihr bevorzugter Platz zum Verdauen –, aufgebläht wie rote Säcke, von der Größe eines Fingernagels, vollgesaugt mit meinem Blut. Und dann bekam ich Ausschläge, auf die sich die Flöhe mit Begeisterung stürzten. Wir beide, Long-Life und ich, verbrachten einen guten Teil unserer Zeit damit, uns zu kratzen.
Der Hauptmann rief mich ein paar Tage später wieder zu sich, wie ich es erwartet hatte. Auch wenn er es selbst noch nicht wahrgenommen hatte, ging es ihm langsam besser und er begann, stolz darauf zu sein, dass er nun regelmäßig Yoga machte. Mit Befriedigung sah ich zu, wie er die Übungen ausführte – er schaffte immer noch nicht mehr als gute zehn Minuten, aber immerhin. Dann jedoch kam er zu einer Stellung, die Vorwärtsbeuge heißt und bei der man mit ausgestreckten Beinen auf dem Boden sitzt und versucht, seine Zehen zu halten.
»Hauptmann. Warten Sie. Halt.«
Er sah zu mir auf, seine Wange ruhte leicht an seinem Knie.
»Halt? Das ist eine meiner besten Stellungen!«
»Ja, genau deshalb, weil Sie sie falsch machen.«
»Ganz sicher nicht!«, widersprach er energisch und richtete sich wieder auf. »Ich kann doch schon mit meinem Kopf die Knie berühren.«
»Ja, Sie kommen mit der Stirn an die Knie, aber nur, weil Sie diese gebeugt haben! Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie sie ganz strecken sollen. Der Meister sagt ...«
»Der Meister sagt! Der Meister sagt! Sagt der Meister jemals, dass ich etwas richtig mache?«, jammerte er.
Ich erinnerte mich grinsend an meine Kämpfe mit Katrin und sagte: »Der Meister sagt:
Deine Übung muss korrekt ausgeführt werden,
nur dann wird eine stabile Grundlage gelegt.
i. 14c
Verstehen Sie, es geht nicht darum, wie die Stellung für jemanden aussieht, der Sie beobachtet – den Hauptmann, der mit seinem Kopf seine Knie berührt. Wichtig ist der Vorgang, während die Übung ausgeführt wird. Das, was sie in einem bewirkt. Wie sie beginnt, die Kanäle auszurichten und zu öffnen.«
»Kanäle?«, fragte er.
»Später!« Ich fühlte mich zunehmend wie die griesgrämige alte Katrin. »Wenn Sie die Stellung nicht richtig ausführen, wenn Sie mogeln und versuchen, die Übung auszutricksen, nur um dabei gut auszusehen, dann gelingt sie nicht so, wie sie gedacht ist. Versuchen Sie es jetzt noch einmal, ohne die Knie anzuwinkeln.«
Der Hauptmann stöhnte, aber er streckte seine Beine noch einmal aus. Dann führte er seine Hände vorsichtig in Richtung Schienbein und machte einen runden Rücken wie eine Schildkröte, um seinen Kopf auf den Knien ablegen zu können.
»Nein!«, rief ich und gab ihm einen kleinen Klaps auf den Rücken – etwas, das Katrin mit mir Dutzende Male am Tag getan hatte.
Blitzartig stand er auf. Mit hochrotem Gesicht funkelte er mich an. »Warum! Aber! Du! Was machst du ... du ... Mädchen?!«
»Ich mag zwar ein Mädchen sein, aber ich bin immer noch Ihre Lehrerin. Sie haben es wieder falsch gemacht, Sie haben es genauso gemacht wie vorher. Sie haben gemogelt. Aber dieses Mal hätten Sie sich dabei verletzen können. Ich habe Ihnen gesagt, der Rücken muss gerade sein. Und Sie beugen Ihre Wirbelsäule und knicken dann in den Hüften ein wie ein Scharnier. Man darf den unteren Rücken jedoch niemals rund machen, dadurch verletzt man ihn nur noch mehr. Sie müssen lernen, mir zuzuhören und es richtig zu machen, so wie der Meister es sagt.«
Einen Augenblick lang sah er mich noch böse an, dann stieß er seinen Atem mit einem tiefen Seufzer aus.
»In Ordnung, ich werde es jetzt genau so tun, wie du sagst.« Er setzte sich wieder hin. »Ich strecke meine Beine ganz gerade aus. Keine Mogelei, siehst du!«, erklärte er und hielt seine Arme hoch.
»So weit, so gut.«
»Und jetzt halte ich meinen Rücken ganz gerade!«, sagte er. »Und ich beuge mich an meinen Hüften, wie ein Scharnier, und dann ...« Er beugte sich nach vorn. Es sah großartig aus.
»Siehst du?«, sagte er aufgeregt. »Siehst du?«
»Sehe ich was?«, fragte ich.
Mit einem Finger berührte er erst seine Stirn und dann sein Knie, bevor er verzweifelt den Kopf schüttelte. »Mein Kopf! Er ist gute sechzig Zentimeter von meinen Knien entfernt!«
»Und das ist völlig in Ordnung«, sagte ich. »Genau so weit kommen Sie im Moment, wenn Sie es richtig machen. Das ist eine gute Grundlage, auf der Sie aufbauen können und die Ihren Rücken heilen wird. Wir sind hier, um Sie gesund zu machen, nicht, um zu erreichen, dass Sie mit dem Kopf Ihre Knie berühren können.«
Der Hauptmann zuckte die Achseln. Er war immer noch ein wenig verärgert, versuchte dann aber noch einmal, die Übung richtig auszuführen. So sehr er es auch versuchte, er konnte nicht verheimlichen, was für ein intelligenter und sensibler Mann er in Wahrheit war.
Ich ließ ihn weitere sitzende Stellungen ausführen, um seinen Rücken langsam zu dehnen. Danach folgten ein paar sehr sanfte Drehungen in der Taille. Ich warnte ihn, davon nur einige wenige zu machen und diese genauso auszuführen, wie ich es ihm gezeigt hatte. Am Ende hieß ich ihn, sich hinzulegen und eine Weile in der Stellung der vollkommenen Stille und Ruhe auszuharren – eine Stellung, so still, dass wir sie die Leichenstellung nennen. Als er sich wieder aufsetzte, hatte er eine Frage an mich.
»Weißt du«, sagte er. »Ich habe dich beobachtet, wie du einige der Stellungen gemacht hast. Und ich weiß, auch wenn ich mich bemühe, kann ich sie nicht wirklich richtig machen. Nicht so wie du.«
»Oh ja, das weiß ich. Es ist einer der Widersprüche des Yoga. Um eine Stellung wirklich richtig zu machen, muss man sie tausend Mal nicht ganz richtig machen.«
»Somit kann man sagen, eine Stellung falsch zu machen, hilft dabei, sie richtig zu machen«, schlussfolgerte er freudig.
»Nicht, wenn das, was du falsch machst, etwas ist, was dein Lehrer schon korrigiert hat«, entgegnete ich so scharf, wie Katrin es getan hätte.
Er schickte mich zurück in meine Zelle.
Das Kreuz mit den Vorlieben
Vierte Märzwoche
Nach über einem Monat in dem schmutzigen kleinen Gefängnis hatte sich eine gewisse Routine eingestellt, die Dinge zu erledigen, die man anderswo als normal betrachtet. Wie sich zu waschen.
Meine Kleidung klebte vor Staub und Schweiß und ich hatte einen Geruch entwickelt, den ich trotz des Gestanks aus dem Graben vor meinem Fenster riechen konnte. Der Wachtmeister hatte anscheinend nicht die Absicht, mir genug Wasser zukommen zu lassen, damit ich mich waschen konnte. Dafür starrte er mich immer noch auf furchterregende Weise an, besonders wenn er sehr betrunken war. Es schien, als würde er nur darauf warten, dass etwas passierte.
Mir gelang es jedoch, jeden Tag ein kleines bisschen von dem Wasser abzuzweigen, das ich zum Trinken bekam. Ich sammelte es in einer kleinen Senke im Boden im hinteren Bereich der Zelle, wo es kälter war, und deckte es mit Heu zu. Nach ein paar Tagen hatte ich dort eine große Tasse voll und in der Nacht, wenn alles dunkel und ruhig war, wusch ich damit einen Teil von mir oder meiner Kleidung.
Unter meinem Kleid trug ich immer einen besonderen weißen Lendenschurz, den die Heiligen des yogischen Weges tragen. Ich hatte ihn von meinem Onkel bekommen, einem der größten tibetischen Meister dieser Kunst. Somit hatte ich immer, wenn ich mein Kleid wusch, diesen Lendenschurz an und wickelte mir dazu meinen Schal um die Brust – nur für den Fall, dass der Wachtmeister herauskam. Long-Life verfilzte immer mehr. Die Flöhe und der Mangel an Bewegung plagten ihn sehr, doch er beschwerte sich nie. Ich verbrachte viel Zeit damit, verschiedene undurchführbare Pläne zu entwerfen, um ihm zu helfen.
Wenn man bedenkt, wie neu Yoga für den Hauptmann war, kam er in dieser Woche sehr gut mit. Voll Konzentration vollzog er die Abläufe, die ich ihn gelehrt hatte, und bemühte sich, alles richtig zu machen, auch wenn es dadurch etwas langsamer voranging oder er die Stellung nicht vollkommen richtig einnehmen konnte. Ich ließ ihn friedlich zum Ende kommen, weil ein Lernender das manchmal auch braucht. Nachdem er sich ausgeruht und abgekühlt hatte, setzte er sich auf und sah mich mit einem breiten Lächeln an.
»Ich werde schon viel besser, nicht wahr?«
»Oh ja, ja, das werden Sie. Das können wir beide sehen. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie so gut und so beständig arbeiten –jeden Tag ein bisschen. Ich weiß, dass sich Ihr Rücken aufrichtet, und ich weiß, dass es die beiden anderen auch sehen können.«
»Demnach gibt es heute nichts, worüber du dich beschweren kannst? Nichts, um dir ein Zitat deines Meisters einfallen zu lassen?«
»Ich denke mir die Zitate nicht aus und glaube, das wissen Sie inzwischen auch.«
Er starrte mich nachdenklich an. »Vielleicht ja, vielleicht nein. Im Laufe der Zeit wird es sich zeigen. Willst du damit etwa sagen, dass du das ganze Buch auswendig kannst?«
Ich nickte, dann schwiegen wir beide eine Zeit lang. Und nur um zu verhindern, dass seine Zufriedenheit in Dreistigkeit umschlug, fügte ich hinzu: »Es gab ... es gab da allerdings eine Kleinigkeit.«
Der Hauptmann runzelte die Stirn, ohne jedoch seine gute Laune zu verlieren. »Lass hören.«
»Alle Übungen, die Sie gemacht haben, haben Sie gut gemacht. Aber Sie haben etwas ausgelassen. Sie haben das Boot nicht gemacht.«
Er verzog das Gesicht. Tatsächlich ist das eine Stellung, bei deren Erwähnung jeder Schüler das Gesicht verzieht. Es ist nicht leicht, im Sitzen die ausgestreckten Beine in die Luft zu strecken, während der Lehrer ganz langsam zählt.
»Das tut wirklich weh«, sagte er. »Ich muss keuchen und mein Magen fühlt sich an, als würde jemand darauf herumlaufen – ich glaube, das liegt an mir, an der Art, wie mein Körper gebaut ist. Ich bin mir sicher, anderen hilft sie und sie können sie leichter ausführen. Aber diese Übung ist einfach nicht für mich gemacht. Deshalb habe ich beschlossen, sie auszulassen. Außerdem spare ich dadurch Zeit, denn ich habe schon genug damit zu tun, an den anderen Stellungen zu arbeiten.«
»Darum geht es nicht, Hauptmann. Die Stellungen, die ich Ihnen gebe, haben eine bestimmte Reihenfolge und in dieser Reihenfolge liegt eine bestimmte Absicht. Jede Stellung gleicht die vorherige Stellung aus und die Wirkung auf Sie und Ihren Rücken fließt in eine bestimmte Richtung und hat ein bestimmtes Ziel. Wenn Sie auch nur eine Stellung auslassen, stören Sie diesen Fluss und gefährden Ihr Ziel in einer Weise, die Sie sich nicht einmal vorstellen können.«
Er sah mich an. Das, was am wichtigsten war, wurde wirklich langsam besser: seine Einstellung. Dieses Mal gab es keine trotzigen Widersprüche und deshalb wusste ich, dass ich ihn etwas tiefer einführen konnte.
»Und der Meister sagt ...«
»Ah! Der Meister sagt! Ich wusste es!« Aber er sagte es mit einem Lächeln.
Ich erwiderte sein Lächeln. »Der Meister sagt in seinem kurzen Buch:
Und es wird eine Zeit kommen,
in der Unterschiede dich nicht länger beunruhigen.
ii. 48«
»Unterschiede?«, fragte er.
»Unterschiede«, wiederholte ich. »Aber Unterschiede im Sinne von Vorlieben. Je tiefer man in die Yogapraxis eintaucht, vor allem dann, wenn sich die Kanäle öffnen und die inneren Winde besser fließen können ...«
»Wieder Kanäle. Wieder innere Winde.«
»Später«, sagte ich. »Also, wenn man mit dem Yoga weitermacht und tief im Inneren die Energie immer besser fließt, dann beginnt alles, sich von den Unterschieden zu entfernen und in Richtung Einheit zu streben.«
»Alles? Was alles?«
»Genau das: einfach alles«, erwiderte ich. »Aber momentan sprechen wir von den Stellungen und davon, Ihren Rücken zu heilen. Dieses Ziel werden Sie schneller erreichen, wenn Sie etwas weniger auf Ihre Vorlieben achten und stattdessen versuchen, die Unterschiede bei den Stellungen näher zueinander zu bringen. Das hilft Ihren inneren Winden und Ihrem Rücken sehr und ich verspreche, dass ich Ihnen das alles sehr bald genauer erklären werde.
Momentan geht es darum, dass Sie jede einzelne Stellung der Abfolge mit derselben Begeisterung und der gleichen Freude über den Grund, warum Sie sie machen, angehen. Sie sind alle für ...«
»Für ein betrunkenes Wrack und einen starrköpfigen Faulpelz, ich weiß.« Er machte zwar einen Witz, zeigte mir aber damit, dass er die anderen wirklich noch im Kopf hatte. Mein Herz machte einen Freudensprung. Wenn er das aufrecht hielte, könnte das Ganze tatsächlich gelingen.
Ich nickte: »Richtig. Sie sehen somit; keine Stellung ist wichtiger als eine andere. Manche sind für Sie einfacher, andere schwerer; jeder ist eben anders. Aber Sie sollten jede mit Aufgeschlossenheit machen und wissen, dass jede Übung Sie Ihrem Ziel ein kleines Stück näher bringt, nämlich den beiden anderen, über die wir gesprochen haben, zu helfen. Denn, wie wir schon besprochen haben, Yoga kann Ihnen nur helfen, wenn Sie es für etwas tun, das bedeutender ist als Sie selbst.