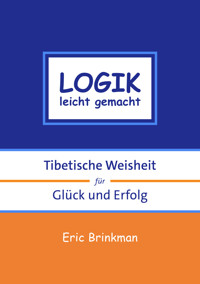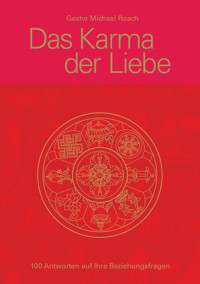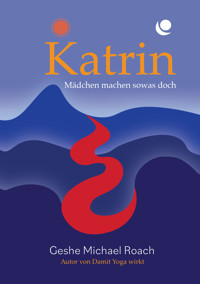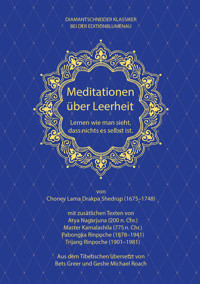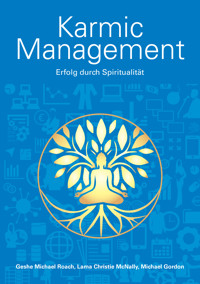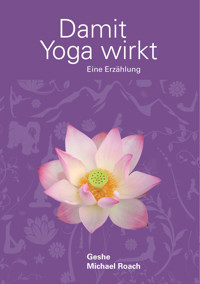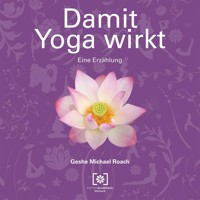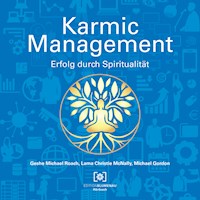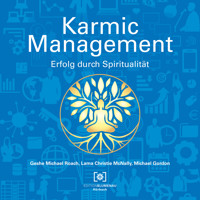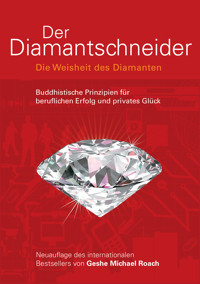
14,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EditionBlumenau
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Was, wenn der Weg zum geschäftlichen Erfolg nicht über Ellenbogen, sondern über Mitgefühl führt? Geshe Michael Roach, buddhistischer Mönch und Top-Manager, revolutioniert mit seiner Geschichte die Welt der Wirtschaft: Vom Laufburschen zum Vizepräsidenten einer 100-Millionen-Dollar-Diamantenfirma – und das konsequent nach den Prinzipien des Buddhismus. In diesem inspirierenden Buch enthüllt Roach erstmals die Geheimnisse der buddhistischen Ökonomie. Er zeigt, wie Achtsamkeit, Großzügigkeit und ethisches Handeln nicht nur den Alltag, sondern auch das Business verändern. Ein faszinierender Leitfaden für alle, die Erfolg neu denken und dabei Menschlichkeit ins Zentrum stellen wollen. »Ein exzellentes und bahnbrechendes Buch. Es liest sich wie ein spannender Roman.« – Buddhismus aktuell
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Geshe Michael Roach
Der Diamantschneider
Buddhistische Prinzipien
für beruflichen Erfolg
und privates Glück
Aus dem Amerikanischen von Michael Wallossek
Impressum
Ungekürzte Ausgabe
Mai 2011
EditionBlumenau
Hamburg
www.editionblumenau.com
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
The Diamond Cutter. The Buddha on Strategies for Managing your Business and your Life
Erschienen 2000 bei Doubleday, USA
Copyright © 2010 Geshe Michael Roach
Copyright der deutschen Ausgabe: © 2011 EditionBlumenau, Hamburg
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen, bleiben vorbehalten.
Titelkonzept: Silvia Engelhardt, Hamburg
Titelgestaltung: Kati Krüger, Hamburg
Satz und ebook: Tanja Renz, Herrsching am Ammersee
ISBN des Buches: 9783981388824
ISBN des ebooks: 9783981618884
Wir freuen uns auf Ihren Besuch: www.editionblumenau.com
Weitere Bücher von Geshe Michael Roach bei der EditionBlumenau:
Das Karma der Liebe
Karmic Management
Der Garten des Buddha
Der östliche Pfad zum Himmel
Damit Yoga wirkt
Inhalt
Vorwort
Der Buddha und die Berufswelt
Das erste Ziel:
Geld verdienen
Woher die Weisheit kommt
Was der Titel des »Sutra vom Diamantschneider« bedeutet
Wie das Sutra entstand
Das verborgene Potenzial in allen Dingen
Prinzipien zur Nutzung des Potenzials
Wie Sie das Potenzial nutzen können
Die wechselseitigen Entsprechungen – Probleme aus dem Berufsalltag und ihre wirklichen Lösungen
Der Akt der Wahrheit
Das zweite Ziel:
Sich des Geldes erfreuen − oder der Umgang mit Körper und Geist
Die Zeit der Stille – eine allmorgendliche Einstimmung auf den Tag
Klarheit und Gesundheit Jahr für Jahr
Die Klausur – auf lange Sicht hin arbeiten
Die Leerheit der Probleme
Das dritte Ziel:
Im Rückblick sagen können, dass es der Mühe wert gewesen ist
Shirley
Das ultimative Management-Werkzeug
Die wahre Quelle des Reichtums oder die Ökonomie der Grenzenlosigkeit
Zusatzinformation
Vorwort
Der Buddha und die Berufswelt
In den 17 Jahren von 1981 bis 1998 hatte ich die Ehre, gemeinsam mit Ofer und Aya Azrielant, den Inhabern der Andin International Diamond Corporation, und mit der Kernbelegschaft des Unternehmens eine der weltweit größten Diamanten- und Juwelenhandelsfirmen aufzubauen. Für unsere geschäftlichen Aktivitäten standen uns anfangs lediglich 50 000 Dollar Startkapital aus einem Kredit zur Verfügung, und es gab, mich selbst eingerechnet, drei bis vier Mitarbeiter. Als ich 1998 aus dem Unternehmen ausschied, um mich ganztägig dem Ausbildungsinstitut zu widmen, das ich in New York gegründet hatte, betrugen die Jahresumsätze mehr als 100 Millionen US-Dollar, und weltweit waren in den Niederlassungen der Andin International Diamond Corporation mehr als 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.
Während meiner Zeit im Diamantengeschäft habe ich eine Art Doppelleben geführt. Sieben Jahre vor meinem Einstieg in diese Branche hatte ich mein Studium an der Universität von Princeton mit Auszeichnung abgeschlossen. Zuvor waren mir im Weißen Haus die Forschungs- und Wissenschaftsmedaille des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika überreicht und in Princeton der McConnell-Forschungspreis der Woodrow Wilson School für Internationale Angelegenheiten verliehen worden.
Ein Stipendium der Woodrow Wilson School ermöglichte es mir, nach Asien zu reisen und am Exilwohnsitz Seiner Heiligkeit des Dalai Lama im indischen Dharamsala bei tibetischen Lamas zu studieren. So begann meine Ausbildung in dem von alters her überlieferten Weisheitswissen Tibets. Diese gipfelte 1995 darin, dass mir als erstem Amerikaner der Titel eines Geshe, eines Meisters der buddhistischen Lehre, zugesprochen wurde. Voraussetzung dafür waren 20 Jahre rigoroser Studien und Prüfungen. In den Jahren nach Abschluss meines Studiums in Princeton hatte ich in buddhistischen Klöstern gelebt – in den USA, aber auch in Asien – und 1983 die buddhistischen Mönchsgelübde abgelegt.
Nachdem durch den Schulungsweg eines buddhistischen Mönchs eine solide Grundlage geschaffen war, ermutigte mich mein wichtigster Lehrer Khen Rinpoche – sein Name bedeutet »Kostbarer Abt« –, in die Geschäftswelt einzusteigen. Ein Kloster sei zwar der ideale Ort, um mit dem bemerkenswerten Gedankengut buddhistischer Weisheit vertraut zu werden, so sagte er mir, doch die Betriebsamkeit eines amerikanischen Büros biete das perfekte »Versuchslabor«, um diese Ideale einer Realitätsprüfung unter Alltagsbedingungen zu unterziehen.
Eine Weile sträubte ich mich gegen diesen Vorschlag. Denn die Aussicht, die Beschaulichkeit unseres kleinen Klosters hinter mir zu lassen, erfüllte mich nicht gerade mit Begeisterung. Außerdem war ich durch meine eigenen Vorstellungen von einem amerikanischen Geschäftsmann – als einem habgierigen, rücksichtslosen und gleichgültigen Wesen – verunsichert. Nachdem ich jedoch eines Tages einem besonders inspirierenden Vortrag beigewohnt hatte, den mein Lehrer vor einigen Studenten hielt, erklärte ich ihm, dass ich seine Anweisungen in die Tat umsetzen und mir eine Arbeit in der Wirtschaft suchen werde.
Einige Jahre zuvor hatte ich während meiner täglichen Meditationssitzungen im Kloster eine Art Vision, und von da an wusste ich, in welchem Berufszweig ich arbeiten wollte: Zweifellos würde meine Tätigkeit mit Diamanten zu tun haben, obgleich ich eigentlich über diese Edelsteine wirklich nicht viel wusste und Juwelen mich im Grunde nie sonderlich fasziniert hatten. Ebenso wenig war je ein Mitglied meiner Familie in dieser Branche tätig gewesen. Ich ging also, arglos wie Voltaires Candide, von einem Diamantengeschäft zum nächsten und fragte, ob sich jemand bereit fände, mich als Praktikanten einzustellen.
Auf diesem Weg in das Diamantengeschäft einzusteigen ist ungefähr so, als würde man mittels eines Bewerbungsschreibens versuchen, einen Job bei der Mafia zu bekommen. Denn der Rohdiamantenhandel ist eine in sich geschlossene und überaus geheimnisvolle Gesellschaft, zu der normalerweise kein Mensch außerhalb des eigenen Familienkreises Zugang erhält. Den Handel mit größeren Diamanten – ein Carat oder mehr – hatten damals die Belgier unter Kontrolle. Die Israelis hingegen schliffen die meisten kleineren Steine, und die hassidischen Juden aus New Yorks Diamantenviertel auf der Siebenundvierzigsten Straße wickelten zum überwiegenden Teil den inneramerikanischen Großhandel ab.
Führen Sie sich zum besseren Verständnis bitte Folgendes vor Augen: Der gesamte Warenbestand selbst der größten Diamantenhäuser findet in ein paar kleinen Behältern Platz, die ganz ähnlich aussehen wie ein gewöhnlicher Schuhkarton. Und ein Diamantendiebstahl im Gegenwert von mehreren Millionen Dollar zum Beispiel lässt sich bis heute mit keinerlei technischen Vorkehrungen aufspüren: Man müsste sich lediglich ein oder zwei Hand voll Diamanten in die Tasche stecken und zur Tür hinausspazieren – etwas Ähnliches wie einen Metalldetektor, der die Steine erkennen beziehungsweise orten könnte, gibt es nicht. Vor diesem Hintergrund stellen die meisten Firmen lediglich Söhne, Neffen oder Cousins ein; niemals aber einen sonderbaren jungen Mann irischer Abstammung, der sich unbedingt mit Diamanten befassen möchte.
Soweit ich mich erinnere, war ich in zirka fünfzehn verschiedenen Läden, um zu fragen, ob man mich vielleicht für einen unqualifizierten Niedriglohn-Job anheuern wolle – und wurde überall prompt hinausgeworfen. Ein alter Uhrmacher aus einer nahe gelegenen Stadt gab mir schließlich den Rat, beim Gemmologischen Institut1 der USA (GIA) in New York ein paar Kurse über Diamantengraduierung2 zu besuchen. Denn mit einem Diplom in der Tasche würde ich die gewünschte Arbeitsstelle wohl eher bekommen, oder vielleicht würde ich unter den Kursteilnehmern auch jemanden kennen lernen, der mir weiterhelfen könnte.
Am Institut lernte ich Herrn Ofer Azrielant kennen. Genau wie ich nahm er an einem Kurs über die Graduierung – oder Klassifizierung – von qualitativ sehr hochwertigen Diamanten teil, so genannten »Investitions«- oder »Zertifikats«-Steinen. Um einen außerordentlich wertvollen Zertifikatsdiamanten von einer Fälschung oder einem entsprechend präparierten Diamanten zu unterscheiden, muss man beispielsweise winzig kleine Löcher oder andere Mängel von der Größe einer Nadelspitze erkennen können – während sich gleichzeitig Dutzende Staubpartikelchen auf der Oberfläche des Diamanten beziehungsweise auf dem Objektiv des Mikroskops ablagern und durch ihr verwirrendes Treiben leicht zu Fehleinschätzungen führen können. Beide wollten wir uns dort also die Kenntnisse aneignen, die man unbedingt haben muss, um in dieser Branche nicht sein letztes Hemd zu verlieren.
Ofers Rückfragen an den Kursleiter, seine Art, jedes Konzept dieses Mannes zu überprüfen und zu hinterfragen, haben mich sofort beeindruckt. Ich nahm mir vor, ihn zu bitten, mir bei meiner Stellensuche behilflich zu sein, und ihn auch zu fragen, ob vielleicht er einen Job für mich habe. Und so schlossen wir Bekanntschaft. Ein paar Wochen später – am Tag, an dem ich die Abschlussprüfungen über Diamantengraduierung in den New Yorker GIA-Laboratorien abgelegt hatte – machte ich mir Gedanken, unter welchem Vorwand ich ihn wohl in seinem Büro aufsuchen und nach einem Job fragen könnte.
In seiner Heimat Israel hatte er bereits eine kleine Firma gegründet. Und zu meinem großen Glück stand er gerade jetzt im Begriff, eine Niederlassung in den USA zu eröffnen.
Mit den passenden Worten verschaffe ich mir also Zugang zu seinem Büro und bitte ihn, mir die Grundlagen des Diamantengeschäfts beizubringen: »Ich bin bereit, alle anstehenden Arbeiten für Sie zu übernehmen. Machen Sie doch bitte einen Versuch mit mir. Ich werde das Büro aufräumen und saubermachen oder Fenster putzen. Was Sie mir auftragen, erledige ich für Sie.«
Seine Antwort: »Leider habe ich kein Geld, um Sie einzustellen. Aber wissen Sie was, ich werde mit dem Inhaber dieses Büros sprechen – sein Name ist Alex Rosenthal. Und wir werden mal sehen, ob er und ich Sie vielleicht gemeinsam bezahlen können. Dann könnten Sie Botengänge und sonstige Besorgungen für uns beide übernehmen.«
Ich fange also als Botenjunge an: sieben Dollar die Stunde, ein Princeton-Absolvent, der sich im feuchtheißen New Yorker Sommer genauso wie bei Winterschneestürmen und bei Eiseskälte zu Fuß seinen Weg ins Diamantenviertel bahnt und nicht näher gekennzeichnete Leinensäcke bei sich trägt – gefüllt mit Gold, das zu Ringen gegossen werden soll, und mit Diamanten, die darin eingefasst werden sollen.
Mit mir zusammen sitzen Ofer, seine Frau Aya und ein stiller, aber wirklich vorzüglicher jemenitischer Goldschmied namens Alex Gal rings um unseren einzigen – gemieteten – Schreibtisch, graduieren Diamanten, sortieren sie, skizzieren neue Entwürfe für Diamantringe und telefonieren herum, um Kunden zu akquirieren.
Gehaltsschecks gab es damals wenige, und wenn es sie gab, dann oft verspätet, während Ofer seine Londoner Freunde telefonisch zu überreden versuchte, ihm noch ein bisschen mehr Geld zu leihen. Ich hatte trotzdem bald genügend Geld zusammen, um mir meinen ersten dunklen Straßenanzug zu kaufen. Den habe ich dann monatelang getragen, Tag für Tag.
Häufig haben wir bis nach Mitternacht gearbeitet, und anschließend hatte ich noch eine lange Heimfahrt vor mir, bis ich schließlich wieder in dem Zimmerchen angelangt war, das ich in einem kleinen Kloster der Gemeinschaft asiatischer Buddhisten in Howell, New Jersey, bewohnte. Ein paar Stunden später würde ich schon wieder auf den Beinen sein und kurz darauf im Bus nach Manhattan sitzen.
Als unser Geschäft ein wenig besser lief, beschlossen wir umzuziehen, um dem eigentlichen Juwelenviertel näher zu sein, und gingen das Wagnis ein, uns einen Goldschmied eigens für die Schmuckherstellung zu leisten. Er saß allein in dem großen Raum, der uns als »Werkstatt« diente, und widmete sich der Fertigung unserer ersten Diamantringe.
Und ich genoss schon bald genügend Vertrauen, damit mein Wunsch in Erfüllung gehen konnte: Ich durfte mich an ein Päckchen loser Diamanten setzen, um sie der Graduierung entsprechend zu sortieren. Dann fragten mich Ofer und Aya, ob ich die Verantwortung für die neu gegründete Abteilung »Diamanteneinkauf« übernehmen wolle (die damals aus mir und einer weiteren Person bestand). Voller Begeisterung über eine derartige Gelegenheit stürzte ich mich geradezu auf dieses Projekt.
Für die Arbeit in einem normalen Firmenbüro hatte mein tibetischer Lama mir ein paar Leitsätze mit auf den Weg gegeben: Mein Bekenntnis zum Buddhismus für mich zu behalten, mir einen Haarschnitt in der üblichen Länge zuzulegen (anstelle des für einen Mönch typischen kahl geschorenen Kopfes) und mich ganz normal zu kleiden. Wann immer ich mich in meiner Arbeit nach buddhistischen Grundsätzen richte, habe dies stillschweigend zu geschehen. Ich solle keine Worte darüber verlieren – und es schon gar nicht an die große Glocke hängen. Innerlich müsse ich ein buddhistischer Weiser sein, von außen betrachtet jedoch ein gewöhnlicher amerikanischer Geschäftsmann.
Und so begann mein Versuch, die Abteilung nach buddhistischen Grundsätzen zu führen, ohne dies jemand anderen wissen zu lassen. Mit den Azrielants habe ich frühzeitig folgende Vereinbarung getroffen: Ich war in allen Belangen für die Diamantenabteilung verantwortlich und hatte dafür zu sorgen, dass die Steine einen guten Gewinn einbrachten. Auf der anderen Seite hatte ich uneingeschränkte Handlungsvollmachten, wenn es darum ging, Mitarbeiter einzustellen oder zu entlassen. Nur ich ganz allein hatte über ihre Bezahlung oder über Lohnerhöhungen zu entscheiden, über die Anzahl ihrer täglichen Arbeitsstunden und darüber, wer für welchen Bereich die Verantwortung übernahm. Ich musste lediglich zum vereinbarten Zeitpunkt das Produkt abliefern, und zwar mit ansehnlichem Profit.
Dieses Buch beschreibt, wie ich – gestützt auf überlieferte Prinzipien buddhistischer Weisheit – die Diamantenabteilung bei Andin International so aufgebaut habe, dass sie aus dem Nichts zu einem weltweit operierenden Unternehmen wurde, das jährlich viele Millionen Dollar Gewinn erzielte.
All dies habe ich natürlich nicht im Alleingang auf die Beine stellen können. Ebenso wenig hat sich bei uns alles nur nach meinen Auffassungen gerichtet. Ich darf aber sagen, dass während meiner Zeit als Vizepräsident bei Andin International die in diesem Buch dargelegten Prinzipien für die meisten Entscheidungen und Geschäftsstrategien maßgebend waren.
Worin bestehen, in aller Kürze zusammengefasst, diese Prinzipien? Im Wesentlichen geht es um drei Punkte:
Das Unternehmen soll erfolgreich sein, also Gewinn erwirtschaften. In den USA und in anderen westlichen Ländern herrscht die Meinung vor, wenn Menschen, die ein spirituelles Leben zu führen versuchen, Erfolg haben und Geld verdienen, dann sei irgendetwas nicht in Ordnung. Doch am Geld als solchem gibt es aus buddhistischer Sicht nichts auszusetzen. Denn wer über größere finanzielle Mittel verfügt, kann der Welt ja tatsächlich mehr Nutzen bringen als ein mittelloser Mensch. Vielmehr stellt sich die Frage, wie wir Geld verdienen; ob wir begreifen, woher es kommt; wie wir dafür sorgen können, dass es uns auch weiterhin zufließt; und ob wir eine gesunde Einstellung zum Geld wahren können.
Entscheidend ist also, dass wir unser Geld auf ehrliche und anständige Art und Weise verdienen; uns genau darüber im Klaren sind, woher es kommt, damit es nicht versiegt, und eine gesunde Einstellung zum Geld wahren, solange wir es haben. Halten wir uns daran, so lässt sich beides sehr wohl miteinander vereinbaren – gutes Geld zu verdienen und ein spirituelles Leben zu führen. Ja auf diese Weise wird der Gelderwerb zum Bestandteil einer spirituellen Lebensführung.
Geld sollte uns Freude bereiten. Mit anderen Worten, wir sollten geistig und körperlich gesund bleiben, während wir Geld verdienen. Die Aktivität, die uns materiellen Wohlstand bringt, sollte uns weder körperlich noch geistig derart auslaugen und erschöpfen, dass wir uns des Wohlstands nicht erfreuen können. Ein Geschäftsmann, der durch seine Tätigkeit die eigene Gesundheit ruiniert, macht den eigentlichen Sinn und Zweck seiner Arbeit zunichte.
Wenn Sie schließlich auf Ihr Berufsleben zurückblicken, sollten Sie aufrichtig sagen können, dass all die Jahre Ihrer beruflichen Aktivität einen Sinn hatten. Das Ende jeder geschäftlichen Unternehmung, die wir in Angriff nehmen, wie auch das Ende unseres Lebens rücken unausweichlich näher – für jeden von uns. Und am wichtigsten Punkt unserer Tätigkeit – wenn wir schließlich auf alles zurückblicken, was wir erreicht haben – sollten wir erkennen können, dass unser Verhalten und die Art und Weise, wie wir unsere Aufgaben erledigt haben, einen bleibenden Wert haben und eine positive Prägung in unserer Welt hinterlassen.
Fassen wir diese Gedanken noch einmal kurz zusammen: Unsere berufliche Tätigkeit dient ebenso wie die überlieferte Weisheit Tibets, wie einfach jegliches menschliche Streben, dem Ziel, äußeren Wohlstand und inneres Wohlergehen herbeizuführen. Daran können wir uns allerdings nur erfreuen, solange wir körperlich und geistig weitgehend gesund bleiben. Und im Laufe unseres Lebens müssen wir herausfinden, auf welche Weise wir diesem Wohlergehen eine tiefere und umfassendere Bedeutung geben können.
All das führt uns die Erfolgsgeschichte der Diamantenabteilung von Andin International vor Augen. Jeder kann diese Dinge lernen und sie in die Tat umsetzen, unabhängig davon, welchen persönlichen Hintergrund und welche Überzeugungen er oder sie hat.
1 Gemmologie: Edelsteinkunde
2 Graduierung: Einstufung von Diamanten in unterschiedliche Qualitätsgrade anhand von Merkmalen wie Reinheit, Farbe und Schliff; (Anm. d. Übers.)
Das erste Ziel:
Geld verdienen
Woher die Weisheit kommt
In der altindischen Sprache bezeichnet man diese Lehre als das Arya Vajra Chedaka Nama Prajnya Paramita Mahayana Sutra.
Auf Tibetisch heißt sie Pakpa Sherab Kyi Paröltu Djinpa Dordje Tschöpa Shedjawa Tekpa Tschenpoi Do.
Und auf Deutsch Das Sutra vom Diamantschneider, ein von alters her überliefertes Buch vom Weg des Mitgefühls, ein Buch, das die Vollendung der Weisheit lehrt.
Was unterscheidet dieses Buch von allen anderen Büchern, die Sie vielleicht irgendwann einmal zu Fragen des Berufs- beziehungsweise Geschäftslebens gelesen haben? Der Unterschied liegt in der Quelle jenes Wissens, das ich Ihnen hier zugänglich machen möchte: einem überlieferten buddhistischen Weisheitsbuch mit dem Titel das »Sutra vom Diamantschneider«. Und dieses Buch beginnt mit den oben angeführten Zeilen.
In diesem Quellentext liegt die uralte Weisheit verborgen, die uns geholfen hat, Andin International zu einem Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Dollar Jahresumsatz zu machen. Vorweg möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen geben, die Ihnen zeigen, welch bedeutende Rolle dieses Buch in der Geschichte Asiens gespielt hat.
Das »Sutra vom Diamantschneider« ist das älteste datierbare Buch der Welt, das nicht mit der Hand geschrieben, sondern gedruckt wurde. Eine Ausgabe aus dem Fundus des Britischen Museums lässt sich auf das Jahr 868 unserer Zeit datieren. Sie entstand demzufolge rund 600 Jahr früher als die Gutenberg-Bibel.
Bei dem Text handelt es sich um die Niederschrift einer Lehrrede, die der Buddha vor mehr als 2500 Jahren gehalten hat. Zunächst wurde sie mündlich überliefert, und später, in einem frühen Stadium der Schriftkultur, auf länglichen Palmblättern festgehalten: auf außerordentlich gut haltbaren Palmwedeln, auf die man die Worte dieses Textes anfangs mit einer Nadel eingeritzt hat. Nach diesem Verfahren hergestellte Bücher, die lange Zeit recht gut lesbar bleiben, kann man in Südostasien bis heute finden.
Auf zweierlei Art wurde dafür gesorgt, dass die Palmblätter eines Textes beieinander blieben. In manchen Fällen hat man mit einer Ahle ein Loch durch den Blätterstapel gebohrt, um anschließend ein Band durch das Loch zu ziehen. Andere Bücher wurden zur Aufbewahrung in Stoff eingeschlagen.
Das »Sutra vom Diamantschneider« wurde ursprünglich in Sanskrit aufgeschrieben, jener altindischen Sprache, von der wir heute annehmen, dass sie vor ungefähr 4000 Jahren entstanden ist. Als der Text vor etwa 1000 Jahren nach Tibet gelangte, wurde er ins Tibetische übersetzt. Im Laufe der Jahrhunderte haben die Tibeter ihn in Holzblöcke geschnitzt und dann auf lange Streifen handgeschöpften Papiers gedruckt, indem sie Tinte auf den Holzblock strichen und das Papier anschließend mit einer Walze gegen den Block pressten. Diese langen Papierstreifen schlägt man zur Aufbewahrung in helle safran- oder kastanienfarbene Stoffe ein, eine Reminiszenz an die Tage der Palmblätter.
Das »Sutra vom Diamantschneider« fand auch in anderen großen Ländern Asiens Verbreitung, etwa in China, Japan, Korea und der Mongolei. Während der letzten zwei Jahrtausende wurde der Text unzählige Male in der jeweiligen Landessprache nachgedruckt, und von den Lippen der Lehrer einer Generation vernahmen ihn in einer ununterbrochenen Überlieferungslinie die Schüler der jeweils nächsten Generation.
In der Mongolei beispielsweise genoss der Text so hohe Wertschätzung, dass jede Familie sorgsam eine Kopie auf ihrem Hausaltar aufbewahrte. Ein oder zweimal pro Jahr baten die Familien die im näheren Umkreis lebenden buddhistischen Mönche zu sich nach Hause, damit diese den Text laut vorlasen und den Familienmitgliedern so die Segnungen seiner Weisheit zuteil wurden.
Die Weisheit dieses Textes ist nicht leicht zugänglich. In der ursprünglichen Lehrrede bedient sich der Buddha, wie in vielen seiner Darlegungen, einer von mystischer Erfahrung geprägten Sprache. Nur ein lebender Lehrer kann uns ihren verborgenen Sinn enthüllen, indem er oder sie auf die vorzüglichen Erläuterungen zurückgreift, die im Laufe der Jahrhunderte niedergeschrieben wurden. In tibetischer Sprache sind uns drei dieser älteren Kommentare erhalten geblieben. Der älteste von ihnen entstand vor zirka 1600 Jahren, der jüngste immerhin vor rund 1100 Jahren.
Bemerkenswerterweise haben wir unlängst einen weiteren Kommentar zu diesem Werk ausfindig gemacht. Er ist weit jüngeren Datums und viel leichter verständlich. Während der vergangenen zwölf Jahre haben wir – eine Gruppe von Kollegen und ich – am Asian Classics Input Project gearbeitet, dessen Anliegen die Erhaltung der über die Jahrhunderte überlieferten tibetischen Weisheitsbücher ist. Mehr als 1000 Jahre wurden diese Bücher, durch den großen Schutzwall des Himalaya vor Krieg und Eindringlingen geschützt, in Tibets großen Klöstern und Bibliotheken aufbewahrt. Die Situation hat sich mit der Erfindung des Flugzeugs gewandelt, und im Jahr 1950 sind die Truppen des kommunistischen China in Tibet einmarschiert.
Während des Einmarsches und der anschließenden, bis heute andauernden Besatzung wurden mehr als 5000 Bibliotheken und Klosteruniversitäten, in deren Obhut sich diese bemerkenswerten Bücher befanden, zerstört. Flüchtlinge konnten auf ihrem gefährlichen Weg, der sie unweit des Mount Everest zu Fuß über den Himalaya führte, nur eine Handvoll Bücher mitnehmen. Um sich in etwa ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung zu machen, können Sie sich vorstellen, eine mächtige Armee habe die Vereinigten Staaten angegriffen und nahezu jede einzelne Hochschule und Universität einschließlich des gesamten Buchbestands der dazugehörigen Bibliotheken niedergebrannt. Stellen Sie sich vor, allein jene Bücher seien erhalten geblieben, die von Flüchtlingen auf ihrer mehrere Wochen oder Monate währenden Flucht zu Fuß nach Mexiko eigenhändig aus dem Land geschafft werden konnten.
Das Input Project hat tibetische Flüchtlinge, die in indischen Lagern leben, darin geschult, diese gefährdeten Bücher auf Computerdisketten abzutippen. Anschließend werden sie auf CD-ROM kopiert oder ins Internet gestellt und dadurch für Studenten und Gelehrte in aller Welt unentgeltlich verfügbar gemacht. Oftmals in entlegenen Winkeln der Welt haben wir Schriften aufgestöbert, die ansonsten nie aus Tibet hinausgelangt sind, und so konnten wir bislang rund 150 000 Seiten Holzblock-Manuskripte für die Nachwelt erhalten.
Inmitten einer verstaubten Handschriftensammlung haben wir auf diese Weise im russischen St. Petersburg die Ausgabe einer wundervollen Erläuterung zu dem »Sutra vom Diamantschneider« gefunden, die frühe Forschungsreisende von ihrem Aufenthalt in Tibet mitgebracht hatten. Dieser Kommentar trägt den Titel »Das Licht der Sonne auf dem Weg zur Freiheit« und wurde von einem bedeutenden Lama namens Tschönyi Drakpa Shedrup verfasst, der von 1675 bis 1748 gelebt hat. Wie es sich so trifft, stammt dieser Lama aus dem gleichen tibetischen Kloster, in dem ich meinen Studienabschluss erhalten habe: Sera Mey. Über die Jahrhunderte war sein Spitzname »Tschönyi Lama«, der Lama aus »Tschönyi« – einer Region in Osttibet.
In meinem Buch greife ich auf den im »Sutra vom Diamantschneider« wiedergegebenen Originalwortlaut zurück, ferner auf den Text von »Das Licht der Sonne auf dem Weg zur Freiheit«. Dieser wichtige Kommentar ist hier zum allerersten Mal ins Englische beziehungsweise ins Deutsche übersetzt worden. Neben den Auszügen aus diesen beiden großen Werken finden auch Erläuterungen Berücksichtigung, die im Laufe der letzten 2500 Jahre mündlich weitergegeben wurden – in der gleichen Weise, wie sie von meinen Lamas an mich weitergegeben wurden. Und zu guter Letzt komme ich auf tatsächliche Begebenheiten aus meinem Leben in der geheimnisumwitterten Welt des internationalen Diamantenhandels zu sprechen, damit anschaulich wird, wie dieses uralte Weisheitswissen Ihnen zuverlässig zu mehr Glück im Leben und zu mehr Erfolg im Beruf verhelfen kann.
Was der Titel des »Sutra vom Diamantschneider« bedeutet
Bereits der Titel des »Sutra vom Diamantschneider« enthält viel geheime Weisheit. Und bevor wir auf die Frage eingehen, wie Ihnen diese Weisheit zu mehr Glück und Erfolg verhelfen kann, tun wir sicher gut daran, über die Bedeutung des Titels zu sprechen. Lassen Sie uns zunächst einmal einen Blick auf Tschönyi Lamas Erläuterungen werfen:
Der Wurzeltext beginnt hier mit den Worten: »In der altindischen Sprache bezeichnet man diese Lehre als das Arya Vajra Chedaka Nama Prajnya Paramita Mahayana Sutra.« Die Sanskrit-Worte des Titels kann man folgendermaßen übersetzen: Arya heißt »erhaben«, und Vajra bedeutet »Diamant«. Chedaka entspricht »Schneider«, und Prajnya steht für »Weisheit«.
Param heißt »zur anderen Seite«, während ita »gegangen« bedeutet – und beides zusammen heißt »Vollendung«. Nama bedeutet »genannt«. Maha bedeutet »groß«, und yana steht für »Weg«.3Sutra wird mit »von alters her überliefertes Buch« übersetzt.
»Diamant« ist hier das entscheidende Wort für Sie, um zu begreifen, wie Sie im Leben und im Beruf erfolgreich sein können. In der tibetischen Überlieferung symbolisiert der Diamant ein verborgenes Potenzial, das allen Dingen innewohnt. Gewöhnlich spricht man in diesem Zusammenhang von »Leerheit«. Ist sich ein Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau über dieses Potenzial voll und ganz im Klaren, so weiß er oder sie, worin – finanziell wie in persönlichen Belangen – der Schlüssel zum Erfolg liegt. Im nächsten Kapitel werden wir uns eingehender mit diesem Potenzial befassen. Für den Moment genügt es zu wissen, dass das allen Dingen innewohnende Potenzial einem Diamanten gleicht, und dies in dreifacher Hinsicht.
Zunächst einmal kommt nichts einer absolut klaren materiellen Substanz so nahe wie ein reiner Diamant. Denken Sie an eine große Glasscheibe, zum Beispiel eine Scheibe von der Art, wie man sie für eine gläserne Schiebetür verwendet, die nach draußen auf eine Terrasse führt. Von vorne betrachtet, sieht das Glas ganz klar aus: so klar, dass man immer wieder von Fällen hört, in denen eine Scheibe zu Bruch geht, weil Nachbarn oder andere Besucher gegen die Scheibe laufen. Schaut man allerdings – anders als wir das normalerweise tun – entlang der Längsachse auf die Scheibe, dann weist solches Glas, genau wie die meisten anderen Glassorten, eine Grünfärbung auf. Diese Färbung rührt vom gehäuften Auftreten winziger, das gesamte Glas durchziehender Eisenverunreinigungen her, und je dicker die Glasschicht ist, durch beziehungsweise auf die man schaut, umso deutlicher zeigt sich die Grünfärbung.
Ganz anders ein reiner Diamant. Im Handel stufen wir den Wert der Diamanten vor allem anhand der fehlenden Färbung ein: Vollkommen farblose Diamanten sind besonders selten und wertvoll. Einen völlig farblosen Diamanten klassifizieren wir als »D« – was an sich schon auf eine Art historischen Fehler zurückgeht, denn als das moderne System zur Diamantengraduierung entwickelt wurde, gab es bereits zahlreiche miteinander konkurrierende Systeme. Der Buchstabe »A« wurde weithin zur Kennzeichnung eines sehr hochwertigen, weitestgehend farblosen Diamanten verwendet. Den Buchstaben des Alphabets folgend, wurde die zweitbeste Kategorie als »B« bezeichnet und so weiter.
Bezüglich der Einstufung in »A«, »B« und so fort hatte unglücklicherweise jedoch jedes Unternehmen andere Vorstellungen, was den Kunden verständlicherweise viele Probleme bereitete. So konnte beispielsweise das nahezu farblose »B« des einen Unternehmens dem mittelgelben »B« des nächsten Unternehmens entsprechen. Daher entschloss man sich, bei der Entwicklung des neuen Systems einfach weiter hinten im Alphabet zu beginnen, und bezeichnete den besten beziehungsweise farblosesten Stein als »D«.
Eine Fensterscheibe aus D-farbenem Diamant (einmal angenommen, es könnte tatsächlich einen Diamanten dieser Größenordnung geben) wäre vollkommen klar. Und würde man entlang der Längsachse durch solch eine Fensterscheibe aus D-farbenem Diamant schauen, dann wäre sie genauso klar. Dies ist die natürliche Beschaffenheit von etwas vollkommen Reinem oder Klarem. Stünde zwischen Ihnen und einer anderen Person eine ein oder zwei Meter dicke Mauer aus Diamant, an deren Oberfläche keinerlei Lichtreflexe aufträten, so könnten Sie den Diamanten gar nicht sehen.
Das verborgene Erfolgspotenzial, das Sie im »Sutra vom Diamantschneider« finden, entspricht genau dieser Scheibe aus Diamantglas. Es ist jederzeit vorhanden, allgegenwärtig. Jedem Objekt und jeder Person rings um uns wohnt dieses Potenzial inne. Und wenn wir uns dieses Potenzial zunutze machen, bringt es uns unweigerlich Erfolg, im persönlichen wie im beruflichen Bereich. In der Tatsache, dass uns dieses Potenzial verborgen bleibt, obwohl jeder Mensch und jedes Ding um uns herum von ihm durchdrungen ist, besteht die Ironie unseres Daseins: Wir erkennen es einfach nicht. Das »Sutra vom Diamantschneider« kann uns helfen, dieses Potenzial wahrzunehmen.
Noch etwas anderes zeichnet einen Diamanten aus: Er ist schlicht und einfach der härteste Gegenstand, den es gibt. Nichts, es sei denn, ein anderer Diamant, könnte einem Diamanten einen Kratzer zufügen. Gemäß der Knoop-Härteskala, einer der Bezugsgrößen zur Bestimmung von Materialhärten, ist ein Diamant mehr als dreimal so hart wie das nächsthärteste natürlich vorkommende Mineral, ein Rubin. Und selbst mit einem Diamanten kann man andere Diamanten nur unter der Voraussetzung anritzen, dass der anzuritzende Diamant eine »weiche Richtung«4 aufweist.
In der Tat werden Diamanten auf diese Art und Weise »zerschnitten«. Zwar kann nichts, außer einem anderen Diamanten, einen Diamant anritzen. Er kann jedoch entlang einer ebenen Schnittfläche »gespalten« werden, ähnlich wie man ein Stück Holz mit einer Axt spaltet. Um einen Diamanten zu schleifen, verwenden wir kleine Diamantstücke, die bei der Bearbeitung eines anderen Diamanten übrig geblieben sind – oder aber ein Stück von einem Rohdiamanten, das nicht die nötige Reinheit aufweist, um einen Edelstein daraus zu gewinnen. Dann spalten und zermahlen wir die Stücke, bis ein Pulver entsteht.
Dieses Diamantpulver wird mit Hilfe unterschiedlich feiner Siebe sorgfältig so lange durchgesiebt, bis ein ganz feines Pulver übrig bleibt, das in einem kleinen Glasfläschchen aufbewahrt wird. Anschließend versieht man eine große flache Scheibe aus gehärtetem Stahl mit Einkerbungen: Man kerbt so lange schmale Linien in die Oberfläche des Stahls, bis ein Netz aus feinen Rinnen entstanden ist. Dann wird die Scheibe hauchdünn mit Öl bestrichen. Meist handelt es sich dabei um Olivenöl. Für die richtige Mixtur hat allerdings jeder Diamantschleifer sein persönliches Geheimrezept.
Die stählerne Scheibe ist über eine Welle mit einem Motor verbunden, der an einem schweren, mit Stahlstreben verstärkten Tisch befestigt ist. So soll jegliche Vibration vermieden werden, wenn die Scheibe mit Hunderten Umdrehungen pro Minute zu rotieren beginnt. Dann wird Diamantpulver auf das Öl gestreut, bis sich eine graue Paste bildet.
Ein Rohdiamant wirkt oft nicht ansehnlicher als ein schmutziger Kieselstein, sieht so ähnlich aus wie ein kristallklares, von einer spülwasserbraun oder olivgrün gesprenkelten Außenschicht umschlossenes Stück Eis. Und an einem schlechten Tag kann es einem durchaus passieren, dass diese Schicht sich durch den gesamten Stein hindurchzieht. Das heißt, nachdem Sie ihn halb abgeschliffen haben, stellen Sie fest, dass der Rohdiamant, für den Sie so viel Geld bezahlt haben, völlig wertlos ist.
Dieser »Kiesel« wird dann in einer kleinen schalenförmigen Vertiefung fixiert, dem so genannten »Diamanthalter«; und der Diamanthalter wiederum sitzt an einer Haltevorrichtung, die dem Tonarm eines alten Plattenspielers ähnelt. Der Diamant wird mit einem speziellen Klebematerial, das auch unter der beim Schleifen des Diamanten entstehenden starken Hitzeeinwirkung nicht weich wird, im Diamanthalter befestigt.
Während meiner ersten Lehrzeit bei einem Meisterschleifer, Sam Shmuelof, wurde der Stein mittels einer aus Asbest und Wasser bestehenden Paste fixiert. Sobald der Stein heiß wurde, trocknete das Asbest und zog sich zusammen. So saß der Stein schön fest im Diamanthalter. Zur Herstellung der Paste haben wir auf dem Asbest herumgekaut. Damals wusste man noch nicht, dass schon ein winziges Stückchen Asbestfaser krebsauslösend wirken kann. Ich erinnere mich an einen Diamantschleifer, bei dem sich ein großer Tumor gleich neben dem Kehlkopf entwickelt hat.
Beim Einschalten des Motors muss die Scheibe ohne den leisesten Hauch einer Vibration in Schwung kommen und sich drehen: Die Justierung der Scheibe unter Zuhilfenahme einer älteren Schleifmaschine kostete uns Stunden. Der Diamantschleifer sitzt bei der Arbeit auf einer Sitzvorrichtung, die einem hohen Kinderstuhl ähnelt. Er beugt sich über die Scheibe, greift nach der Halterung, an der der Rohdiamant befestigt ist, und lässt den Diamanten ganz sanft die rotierende Scheibe touchieren.
Diamant ist unermesslich viel härter als Stahl. Würde der Schleifer die spitz zulaufende Kante eines Rohdiamanten zu stark auf die Scheibe drücken, könnte der Diamant diese daher leicht durchdringen. Deshalb schwenkt man den Stein behutsam zur Scheibe hin, um anschließend den Diamanthalter kurz auf Augenhöhe zu bringen. In der anderen Hand hält man ein Vergrößerungsglas.
Mit einer einzigen weichen Bewegung hebt ein erfahrener Schleifer viele Male pro Minute den Diamanten in Augenhöhe, um den Fortgang des Schleifprozesses zu begutachten, und bewegt den Stein gleich im nächsten Moment kurz wieder zur Scheibe hinunter. Dieser Bewegungsablauf ähnelt den wirbelnden Bewegungen, die ein Cheerleader mit dem Stab ausführt.
Bevor man den Stein kurz in Augenschein nimmt, wischt man ihn an einem über die Schulter geworfenen Handtuch ab, um Öl- und Diamantpulverspuren von seiner Oberfläche zu entfernen. Innerhalb von ein oder zwei Minuten lässt die Schleifscheibe auf der Oberfläche des Diamanten eine winzig kleine transparente Stelle entstehen – ein kleines Fenster, das einen Einblick ins Innere des Steines ermöglicht. Mit der Lupe späht man in das Fenster hinein, um festzustellen, ob der Diamant im Inneren etwa Flecke oder Risse aufweist. Diese wird man nämlich so zu positionieren versuchen, dass sie entweder durch den Schliff verschwinden oder wenigstens, während der Stein Gestalt annimmt, in eine Randposition rücken, in der sie den Gesamteindruck möglichst wenig stören. Denn ein schwarzer Fleck an der Spitze eines Diamanten beispielsweise würde sich in den Unterteilfacetten des Steines widerspiegeln und so den Eindruck vermitteln, eine ganze Familie von Flecken sei vorhanden, obwohl es sich tatsächlich nur um einen einzigen Flecken handelt. Dadurch würde der fertige Edelstein nahezu jeden Wert verlieren.
Dieser Prozess, bei dem man durch das Fenster schaut und sich die räumliche Anordnung des fertigen Edelsteins vorzustellen versucht, ähnelt der Planungsarbeit eines Bildhauers, der sich die von Natur aus vorhandene Materialstruktur und -färbung eines Marmorblocks auf bestmögliche Art und Weise für seine Skulptur zunutze machen möchte. Die Planungen für den Schliff eines großen Steins können sich über Wochen oder gar über Monate erstrecken. Zu dieser Arbeit gehört, dass man eine Reihe von Fenstern in die äußere Schicht schleift und geometrische Modellentwürfe anfertigt, um aus dem Rohdiamanten einen Edelstein von größtmöglichen Abmessungen zu gewinnen.
Eigentlich handelt es sich bei den kleinen schwarzen Flecken, die Sie mitunter im Inneren eines Diamanten finden, in vielen Fällen um weitere kleine Diamantkristalle, die ein größerer Kristall, während er heranwuchs, umschlossen hat. Diamanten sind gewöhnlicher Kohlenstoff, der durch die außerordentlich große Hitze in einem vulkanischen Schlot geschmolzen und dann tief im Erdinnern unter extremem Druck gehalten wurde. Dadurch verwandelt sich die atomare Struktur des reinen Kohlenstoffs in jene des Diamanten. Winzige Diamanten können unter ganz unterschiedlichen Bedingungen entstehen. Wenn zum Beispiel ein kohlenstoffhaltiger Meteorit auf die Erde stürzt, können sie sich genau an der Aufprallstelle bilden. Inmitten eines Kraters von beträchtlichen Ausmaßen befinden sich dann an dieser Stelle ein paar winzige Juwelen.
Die niedlich kleinen »Diamanten innerhalb eines Diamanten« können entweder in Form von schwarzen Flecken auftreten oder, entlang der entsprechenden Achse angeordnet, im Innern des Rohdiamanten einen unsichtbaren Einschluss bilden. Für den Schleifer stellen sie in beiden Fällen ein großes Problem dar. Durch sie entstehen im Stein winzige Spannungszonen. Wenn diese dann mit der Schleifscheibe in Berührung kommen und der Schleifer den anvisierten Facettenschliff durchführen will, scheint der Diamant sich geradezu gegen die Bearbeitung zu sperren. Trotz des Öls beginnt der Stein bei jedem Kontakt mit dem Stahl wie eine entfesselte Furie zu zetern und zu kreischen.
Bei den Diamantschleifereien im Diamantenviertel von New Yorks Siebenundvierzigster Straße handelt es sich meist um triste, spärlich beleuchtete offene Räumlichkeiten in den oberen Stockwerken der Gebäude. Hier landen auf ihrem Weg in die Vereinigten Staaten Diamanten im Wert von vielen Milliarden Dollar, ehe sie zu den Schmuckherstellern weiterwandern. Stellen Sie sich eine Reihe von Diamantschleifern neben der anderen vor: Über ihre Schleifscheibe gebeugt, drücken sie die flache Seite des Diamanten gegen den Stahl. Dabei geht von jedem Stein ein Quietschen aus wie von mangelhaft gewarteten Bremsen. Und inmitten dieses infernalischen Lärms sitzen, an solch ein Chaos gewöhnt, die Schleifer mit ruhigem Blick und voller Konzentration.
Die Reibung zwischen Stein und Scheibe lässt eine derartige Hitze entstehen, dass der Rohdiamant bald in einem tief purpurrot fluoreszierenden Farbton erglüht. In diesem Zustand kann er ebenso schlimme Verbrennungen verursachen wie glühende Kohlen. Sobald die Hitze auf die Spannungszone rings um einen inneren Einschluss übergegriffen hat, kann der ganze Stein regelrecht explodieren und mit enormer Geschwindigkeit derart von der Scheibe katapultiert werden, dass kleine Stückchen durch den gesamten Raum schießen. Falls es sich um einen großen Stein handelt, können Sie dabei zuschauen, wie einige Hunderttausend Dollar buchstäblich pulverisiert werden und sich in feinkörnigen Diamantstaub auflösen.
Welche Bedeutung kommt dem Umstand zu, dass Diamanten das härteste Material der Welt sind?
Gehen Sie doch einmal dem Gedanken nach, dass etwas in irgendeiner Weise ein Äußerstes, ein Höchstmaß verkörpert: das Größte, das Kürzeste, das Längste, das Breiteste. Unser Geist tut sich schwer mit dieser Vorstellung: Denn schließlich ist kein Phänomen so groß, dass sich seine Größe nicht noch um ein paar Zentimeter übertreffen ließe, beziehungsweise so klein, dass man nicht noch ein Stückchen abzwacken könnte.
Das verborgene Potenzial, von dem wir hier sprechen, ist etwas wahrhaft Absolutes – in einer Art und Weise, wie dies für nichts, was über ein physisches Dasein verfügt, jemals gelten könnte. Es ist die höchste Natur, die etwas Existierendem zu Eigen sein kann, die absolute Wahrheit jeder Person und jedes Gegenstandes. Die Härte des Diamanten kommt ihrer Natur nach dem Absoluten näher als jeder andere Gegenstand beziehungsweise jede andere Eigenschaft auf der ganzen Welt. Ein Diamant verfügt über die größte überhaupt existierende Härte. Daher kommt ihm noch eine zweite wichtige Bedeutung zu: Er dient als Metapher für das wahrhaft Absolute.
Kommen wir nun wieder zu jenen Diamantstückchen zurück, die sich über den Boden der Schleiferei verteilt haben, nachdem ein Stein beim Schleifen zerborsten ist, als sei er explodiert. Sie führen uns die dritte wichtige Eigenschaft von Diamanten vor Augen. Jeder Diamant ist auf der atomaren Ebene ganz einfach beschaffen: reiner, völlig unverfälschter Kohlenstoff. Tatsächlich handelt es sich bei dem Kohlenstoff in einer Bleistiftmine und dem Kohlenstoff in einem Diamanten um exakt die gleiche Substanz.
Die Kohlenstoffatome einer Bleistiftmine sind in Form von lose zusammengefügten Plättchen miteinander verbunden, ähnlich wie Schiefergesteinsschichten oder die Schichten von Blätterteig. Wenn Sie die Bleistiftspitze über ein Blatt Papier gleiten lassen, lösen sich diese Schichten ab, Plättchen für Plättchen, und verteilen sich über die Oberfläche des Papiers. Diesen Vorgang bezeichnet man im Allgemeinen als das Schreiben mit einem Bleistift.
In einem Diamanten sind die reinen Kohlenstoffatome eine völlig andere Verbindung miteinander eingegangen. Perfekte Symmetrie in jeder Richtung verhindert, dass auch nur ein einziges loses Plättchen des Ausgangsmaterials übrig bleibt. Dadurch übertrifft die Härte eines Diamanten alles, was wir kennen. Interessanterweise besteht jeder Diamant an jedem Punkt aus dem gleichen schlichten, durch dieselbe Atomstruktur verbundenen Kohlenstoff. Das bedeutet, dass auch der winzigste Diamantsplitter, bis hin zur molekularen Ebene, innerlich mit jedem anderen Stückchen Diamant exakt übereinstimmt.
Was hat das mit dem verborgenen Potenzial der Dinge zu tun? Wir sprachen bereits darüber, dass jedem einzelnen Objekt auf der Welt – unbelebten Dingen wie zum Beispiel Kieselsteinen und Planeten, aber auch Lebewesen wie Ameisen und Menschen – ein verborgenes Potenzial innewohnt, eine letztendliche Natur zukommt. Der springende Punkt dabei ist, dass hier in jedem einzelnen Fall genau das gleiche Potenzial vorliegt, es sich jedes Mal um dieselbe letztendliche Natur handelt. Auch in dieser Hinsicht entspricht das verborgene Potenzial der Dinge – jene den Dingen innewohnende Eigenschaft, die Ihnen inneren und äußeren Erfolg bringen kann – wieder einem Diamanten.
Daher also taucht das Wort »Diamant« im Titel dieses Buches auf. Diamanten sind vollkommen klar, so gut wie unsichtbar. Und das verborgene Potenzial von allem, was uns umgibt, ist genauso schwer zu erkennen. Diamanten sind nahezu etwas Absolutes – das Härteste, was überhaupt existiert. Und das verborgene Potenzial, das den Dingen innewohnt, ist ihre reine und absolute Wahrheit. Bei jedem Diamantsplitter, der irgendwo auf der Welt existiert, handelt es sich um exakt die gleiche Substanz wie bei jedem anderen – um hundertprozentig reinen Diamant. Und das Gleiche gilt für das verborgene Potenzial der Dinge. Denn stets beinhaltet dieses Potenzial eine ebenso reine, ebenso absolute Wirklichkeit wie in jedem anderen Fall.
Warum aber trägt das Buch den Titel »Sutra vom Diamantschneider«? Manch früherer Übersetzer dieses Werkes hat in der Tat den zweiten Teil des Begriffs fortgelassen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, welche unverzichtbare Rolle dieser für die Bedeutung des Buches spielt.
Wenigstens kurz sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Einsicht in das verborgene Potenzial der Dinge, ihre letztendliche Natur, zu gewinnen. Einerseits kann man Einsicht in diese Natur gewinnen, indem man entsprechende Erklärungen dazu liest – beispielsweise die in diesem Buch gebotenen Erklärungen – und sich anschließend hinsetzt, um über sie nachzusinnen, bis man das Potenzial begreift und es nutzen kann. Oder man begibt sich in einen tiefen Meditationszustand, in dem man – mit dem geistigen Auge – eine unmittelbare Einsicht in das Potenzial gewinnt. Das ist die andere Möglichkeit.
Zwar ist eine auf die zweite Art und Weise gewonnene Einsicht in dieses Potenzial weitaus wirkungsvoller; aber das Potenzial kann von allen genutzt werden, die zumindest sein Prinzip verstehen.
Hat man unmittelbare Einsicht in dieses Potenzial gewonnen, begreift man auch sogleich, dass es sich hier um die Einsicht in eine letztgültige Wirklichkeit handelt, und sucht im Geist nach etwas Vergleichbarem. Und nichts sonst in unserer gewöhnlichen Welt kommt diesem letztendlichen Potenzial so nahe, kein anderes gewöhnliches Ding entspricht der letztendlichen Wirklichkeit so sehr wie der Diamant – der härteste Gegenstand, den es gibt.
Aber obgleich der Diamant unter all den Dingen unserer Alltagswelt noch am ehesten dem Letztendlichen entspricht, lässt er sich doch nur in einem äußerst eingeschränkten Sinn mit dem verborgenen Potenzial vergleichen, auf das wir in den folgenden Kapiteln ausführlicher eingehen werden, da es sich bei diesem Potenzial um etwas wahrhaft Letztgültiges handelt. In diesem Sinn ist der Diamant also eine völlig unzulängliche Metapher, da dem wahrhaft Letztendlichen eine weit größere Kraft zu Eigen ist, es dem Diamanten Form oder Schliff verleihen kann. Daher trägt dieses von alters her überlieferte Weisheitsbuch den Titel »Sutra vom Diamantschneider«: Es vermittelt uns Kenntnisse von einem allerhöchsten Potenzial, das selbst einen Diamanten noch übertrifft – den härtesten Gegenstand, jenen Gegenstand, der unter sämtlichen Dingen der uns umgebenden gewöhnlichen Welt der letztendlichen Wirklichkeit noch am ehesten nahe kommt.
Sollte all dies für Sie ein wenig kompliziert klingen, so macht das überhaupt nichts. Das »Sutra vom Diamantschneider« wird Ihnen über solche Schwierigkeiten hinweghelfen. Genau dazu ist es ja da. Die verborgenen Abläufe hinter den Dingen wie auch das Geheimnis eines wirklich dauerhaften Erfolgs in unserem Lebensalltag und unseren beruflichen Ambitionen sind tiefgründig und liegen nicht so klar auf der Hand, dass wir sie leicht und ohne Bemühung erkennen könnten. Ganz sicher aber lohnt sich die Mühe.
3 Die wörtliche Übersetzung von yana wäre »Fahrzeug«. (A. d. Ü.)
4 Härte ist bei Diamanten eine vektorielle Eigenschaft, das heißt, sie variiert mit der Richtung im Kristall. Diamant kann Diamant schleifen, weil es Richtungen größerer und Richtungen geringerer Härte gibt. (A. d. Ü.)
Wie das Sutra entstand
Wir stehen am Ausgangspunkt einer außerordentlich interessanten Reise, in deren Verlauf wir vollkommenes Neuland betreten werden. Denn tatsächlich sind die hier entwickelten Vorstellungen, die uns in die Lage versetzen, Beruf und Privatleben zu meistern, niemals zuvor in einem zeitgenössischen Buch dieser Art dargelegt worden. Ein paar Informationen darüber, wo und wann dieses Weisheitswissen ursprünglich gelehrt wurde, könnten daher hilfreich sein.
Kommen wir zunächst einmal zum Quellentext, durch den uns dieses Wissen überliefert wurde: Es geschah vor mehr als 2500 Jahren im alten Indien. Damals konnte ein Mann aus reichem Hause, ein Prinz namens Siddhartha, die Herzen seiner Landsleute für sich gewinnen; ähnlich wie 500 Jahre später ein Mann namens Jesus. Der Prinz war, von Reichtum und Luxus umgeben, im väterlichen Palast aufgewachsen. Nachdem er aber gesehen hatte, wie die Menschen leiden – nachdem er gesehen hatte, dass wir im Laufe unseres Lebens unweigerlich all jene Dinge und Menschen verlieren müssen, die uns besonders am Herzen liegen –, entsagte er diesem luxuriösen Lebenswandel am Königshof. Auf sich alleine gestellt, versuchte er herauszufinden, wie es dazu kommt, dass wir leiden, und wie wir es möglich machen können, nicht mehr zu leiden.
Er gelangte zu einem letztgültigen Verständnis dieser Dinge und begann seinen Weg zur Befreiung vom Leid zu lehren. Viele verließen ihr Zuhause und schlossen sich ihm an, weil sie ein schlichtes Leben führen wollten wie er: das Leben eines besitzlosen Mönchs, der klar denken kann, weil sein Geist befreit ist von der Bürde, sich darüber Gedanken zu machen, was und wer ihm gehört.
Viele Jahre später schildert ein Schüler, wie das »Sutra vom Diamantschneider« zum ersten Mal in Worte gefasst wurde. Den Buddha, seinen Lehrer, nennt er den »Siegreichen«.
Einmal hörte ich, wie der Buddha die folgenden Worte sprach.
Der Siegreiche weilte in der Nähe von Shravasti im Park des Anata Pindada in den Gärten von Prinz Djetavan. Um ihn geschart hatte sich eine Versammlung von 1250 Mönchen, Schüler ersten Ranges; ferner eine immense Anzahl von Schülern auf dem Weg des Mitgefühls,5 die außergewöhnliche, heilige Wesen waren.
»Einmal hörte ich, wie der Buddha die folgenden Worte sprach«, ist für ein überliefertes buddhistisches Weisheitsbuch eine gängige Einleitung. Denn niedergeschrieben wurden diese Bücher vielfach erst lange, nachdem der Buddha bereits von dieser Welt gegangen war. Die Menschen jenes Zeitalters besaßen eine außerordentlich stark ausgeprägte Fähigkeit, sich die von einem großen Lehrer erhaltenen Lehren auf der Stelle zu merken.
Das Wort »einmal« ist hier von großer Bedeutung. Es bezieht sich einerseits auf die außerordentlich hohe Intelligenz, über die auch einfache Leute im alten Indien verfügten: auf den bereits angesprochenen Umstand, dass sie einen Wortlaut auswendig lernen und in seiner vollen Bedeutung verstehen konnten, sobald sie ihn vernahmen. Andererseits macht uns diese Formulierung darauf aufmerksam, dass das »Sutra vom Diamantschneider« lediglich ein einziges Mal dargelegt wurde, und bringt so zum Ausdruck, dass die hierin enthaltene Weisheit – das Wissen darüber, was die Dinge wirklich in Gang hält – eine seltene Kostbarkeit darstellt auf dieser Welt.
Indem Tschönyi Lama uns in seinen Erläuterungen zu dem »Sutra vom Diamantschneider« erklärt, wie und wo es zu dieser bemerkenswerten Lehrrede kam, liefert er uns weitere Hintergrundinformationen. Die Hervorhebung durch Fettdruck zeigt Ihnen, an welchen Stellen das »Sutra vom Diamantschneider« bei Tschönyi Lama wörtlich zitiert wird:
Diese Textpassage beschreibt den Ort der Belehrung. Hier spricht derjenige zu uns, der die Worte der Lehrrede schriftlich festgehalten hat.
Zunächst sagt er, dass er hörte, wie der Buddha die Lehrrede sprach. Einmal, was soviel bedeutet wie »zu einem bestimmten Zeitpunkt«, weilte der Siegreiche in der Nähe von Shravasti im Park des Anata Pindada in den Gärten von Prinz Djetavan. Um ihn geschart hatte sich, das heißt, bei ihm befand sich, eine Versammlung von 1250 Mönchen, Schüler ersten Ranges; ferner eine immense Anzahl von Schülern auf dem Weg des Mitgefühls, die außergewöhnliche, heilige Wesen waren.
Nun gab es damals in Indien sechs große Städte, darunter jene Stadt »Shravasti«. Sie lag im Reich von König Prasena Ajita, und zu ihrem Gebiet gehörte ein besonders schöner Landstrich: die zauberhaften Gärten eines Mannes namens Prinz Djetavan.
Mehrere Jahre, nachdem der Siegreiche zur Erleuchtung gelangt war, kam der Zeitpunkt, an dem ein Familienoberhaupt namens Anata Pindada den Entschluss fasste, einen großen Tempel von außergewöhnlicher Schönheit errichten zu lassen. Er wollte einen Platz schaffen, an dem der Buddha und seine Anhänger auf Dauer leben könnten. Zu diesem Zweck wandte er sich an Prinz Djetavan und kaufte von ihm Gärten zum Preis vieler Tausender von Goldmünzen. Deren Anzahl war so groß, dass man mit ihnen in der Tat die Gärten selbst vollständig hätte bedecken können.
Auch Djetavan bot dem Siegreichen ein Stück Land an, das zum Quartierbereich seiner Liegenschaftsverwalter gehört hatte. In diesen Gärten gestalteten unter Anata Pindadas Anleitung, der sich zu diesem Zweck Shariputras Fähigkeiten zunutze gemacht hatte, Kunsthandwerker aus den Ländern der Götter und der Menschen einen ganz außerordentlichen Park.
Nach dessen Fertigstellung benannte der Siegreiche den Haupttempel nach Djetavan. Denn er war gewahr worden, dass dieser es gerne so haben würde. Anata Pindada war übrigens ein besonderes Wesen. Er hatte absichtlich eine Wiedergeburt angenommen, die ihm es ermöglichte, als aktiver Förderer den großen Lehrer in finanziellen Dingen zu unterstützen: Er vermochte zu erkennen, an welchen Stellen in der Tiefe von Gewässern oder im Erdreich kostbare Edelsteine und edle Metalle verborgen lagen, und er konnte von diesen Reichtümern Gebrauch machen, wann immer er es wünschte.
Diese ersten Zeilen aus dem »Sutra vom Diamantschneider« machen uns auf etwas Entscheidendes aufmerksam. Der Buddha steht im Begriff, seine Lehre an eine Gruppe von Mönchen weiterzugeben, die sich ähnlich wie die Jünger Jesu entschlossen haben, nicht länger ihren gewöhnlichen Berufen nachzugehen, sondern ihr Leben damit zu verbringen, den von ihm gewiesenen Weg zu erlernen. Doch dass die Belehrung überhaupt zustande kommt, hat einen bestimmten Grund: Einflussreiche und sehr wohlhabende Leute sind auf den Plan getreten, um die Durchführung dieser Belehrung zu ermöglichen.
Im alten Indien waren die Angehörigen der Königshäuser die treibende Kraft im wirtschaftlichen und politischen Leben ihrer Länder – das genaue Gegenstück zur Geschäftswelt in der westlichen Gesellschaft der Neuzeit.
Wenn wir heutzutage über den Buddha und über buddhistisches Gedankengut sprechen, haben wir nur allzu schnell einen sonderbar aussehenden orientalischen Mann vor Augen, auf dessen Schädel sich eine Art Höcker erhebt und – falls wir mal eine jener chinesischen Statuen gesehen haben – der durch ein breites Lächeln und ein stattliches Bäuchlein gekennzeichnet ist. Doch sollten wir uns eher einen hoch gewachsenen, anmutigen Prinzen vorstellen, der auf ganz zwanglose Art und Weise durchs Land reist, dabei kenntnisreich, überzeugend und voller Mitgefühl Gedanken darlegt, die sich jeder Mann und jede Frau zunutze machen können, um ein erfolgreiches Leben zu führen und dieses Leben mit Sinn zu erfüllen.
Und stellen Sie sich unter seinen Anhängern bitte nicht einfach nur kahl geschorene Mönche vor, die mit überkreuzten Beinen vor einer Wand auf dem Boden sitzend Om rezitieren. Die vielleicht größten Meister des Buddhismus in den alten Zeiten waren Angehörige der Königshäuser, Menschen mit dem Elan und der Fähigkeit, ganze Länder und deren Ökonomie zu lenken.
Beispielsweise gibt es ein bemerkenswertes buddhistisches Lehrsystem namens »Kalachakra«, »das Rad der Zeit«. Während der vergangenen Jahrhunderte hat in Tibet der jeweilige Dalai Lama bei speziellen Versammlungen die Einweihung in die Kalachakra-Lehre erteilt. Ursprünglich jedoch hatte der Buddha die Könige des alten Indiens in dieser Lehre unterwiesen, Menschen von außergewöhnlicher Einsicht und Befähigung. Diese wiederum gaben die Kalachakra-Lehre über viele Generationen hinweg an ihre Nachfolger weiter.
Ich spreche diesen Punkt aus einem speziellen Grund an: um auf ein verbreitetes Missverständnis einzugehen, das den Buddhismus im Besonderen und ganz allgemein die innere spirituelle Einstellung jedes Einzelnen betrifft. Zwar hat der Buddhismus stets gelehrt, dass es eine Zeit und einen Ort gibt, das Leben eines zurückgezogenen Mönchs zu führen, um abseits des weltlichen Treibens zu lernen, wie man der Welt von Nutzen sein kann. Doch kommt es darauf an, der Welt tatsächlich von Nutzen zu sein; und damit wir ihr wirklich von Nutzen sein können, müssen wir in der Welt sein.
Beeindruckt hat mich während meiner Jahre im Diamantengeschäft die große Zahl von Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft, die mir ihr außerordentlich tief gehendes spirituelles Innenleben enthüllt haben. Eine Person habe ich dabei ganz besonders vor Augen, einen Diamantenhändler aus Bombay (neuerdings zutreffender in Mumbai umbenannt) namens Dhiru Shah. Wenn Sie Herrn Shah im New Yorker Kennedy Airport aus dem Flieger steigen sähen, wäre Ihr erster Eindruck der eines eher klein gewachsenen Mannes mit sattbrauner Haut und Brille, schütter werdendem Haar und vielleicht einem scheuen Lächeln. Er würde durch die Menge gehen, um seinen kleinen, abgewetzten Koffer vom Transportband herunterzunehmen und in ein Taxi zu steigen, das ihn zu einem bescheidenen Hotel in Manhattan bringt. Dort würde er dann am Abend ein paar Scheiben von dem Brot essen, das ihm seine Frau Ketki gebacken und mit rührender Sorgfalt in seinem Koffer verstaut hat.
In Wahrheit ist Herr Shah allerdings einer der bedeutendsten Diamantenkäufer der Welt, denn er kauft für Andin tagtäglich Tausende Steine. Und er ist einer der spirituellsten Menschen, den ich jemals kennen gelernt habe. Im Laufe der Jahre hat er mir nach und nach Einblick in den Reichtum seiner spirituellen Innenwelt gewährt.
Herr Shah ist Dschaina, Anhänger des Dschainismus (Jainismus), einer vor über 2500 Jahren – etwa zur gleichen Zeit wie der Buddhismus – von Mahavir begründeten religiösen Tradition. In der Abendstille haben wir gemeinsam auf dem kühlen Fußboden des Tempels in seinem Stadtviertel gesessen, einem schlichten, aber bezaubernden Gebäude aus Stein in einem stillen Winkel des ansonsten so chaotischen Bombay. Im Inneren des Heiligtums, wo es kühl und dunkel ist, bewegen sich vor dem Altar lautlos die Priester, ihre Gesichter vom weichen Widerschein der kleinen roten Öllampen erhellt, die sie zu Ehren ihres Gottes anzünden.
Frauen in weich fallenden Seidengewändern treten schweigend ein und führen als Zeichen der Ehrerbietung eine Niederwerfung aus, um anschließend wieder still dazusitzen und zu beten. Kinder flüstern, während sie von Statue zu Statue vorangehen und zu tausend heiligen Wesen aufschauen. Am Fuße der zum Tempel hinaufführenden Treppenstufen stellen Geschäftsleute ihre Aktentasche ab, ziehen die Schuhe aus und schreiten andächtig zum Eingangsportal empor, um den Tempel zu betreten und stille Zwiesprache mit Mahavir zu halten.
Dort im Tempel sitzend kann man in sich gehen und vollkommen die Zeit vergessen. Man kann vergessen, welcher Tag heute ist; vergessen, dass man aufstehen und nach Hause gehen muss. Man kann die tausend Tagesgeschäfte vergessen, und man kann das »Opernhaus« vergessen.
Das Opernhaus ist der Inbegriff des Diamantenhandels in Indien, wo unter Mitwirkung von rund einer halben Million Menschen – teils in Lehmziegelhütten und teils in viele Millionen Dollar teuren Bürohochhäusern – die meisten Diamanten der Welt geschliffen werden, um mit ihnen Kunden in Amerika, Europa, dem Mittleren Osten und Japan zu bedienen. Beim Opernhaus handelt es sich eigentlich bloß um zwei heruntergekommene alte Gebäude, das eine 16 Stockwerke und das andere 25 Stockwerke hoch, und seinen Namen hat es einfach deshalb erhalten, weil ganz in der Nähe, mitten in Bombay, ein heruntergekommenes altes Opernhaus steht.
Um in eins der beiden Gebäude zu gelangen, fährt man mit einem klapprigen Auto zu einem unglaublich vollgepfropften Parkplatz und bahnt sich dann seinen Weg zu einem betonierten Durchgang – zwischen einer großen Menge angehender Diamantenhändler hindurch, die einander Gebote und Gegengebote zuschreien und verrottete Pappschächtelchen mit ein paar winzig kleinen Steinchen hin- und herschwenken. Geschäftspartner stehen von den Käufern abgewandt so da, dass der eine durch eine unsichtbare Zeichensprache – mit seinen Fingern in der Handfläche des Geschäftspartners – dem anderen zu verstehen geben kann, wie hoch der Preis gehen sollte, ehe der Handel perfekt gemacht wird.
Nachdem man sich endlich zwischen den jungen Leuten hindurchgezwängt hat, drängelt man sich als Nächstes durch die Gruppe all derer, die in den einzigen altersschwachen Aufzug zu gelangen versuchen, der heute gerade in Betrieb ist. (Immer steht man vor der Wahl: den Aufzug nehmen und riskieren, irgendwo zwischen den Stockwerken stecken zu bleiben, wenn die Elektrizitätsversorgung wieder ausfällt; oder ungefähr 25 Stockwerke zu Fuß hinaufgehen und in Kauf nehmen, dass in der feuchtheißen Witterung von Bombay das neue Hemd, das man kurz zuvor frisch übergestreift hat, durch und durch verschwitzt ist, wenn man oben ankommt.) Anschließend muss man eine exotische Kombination von altertümlichen indischen Schlössern, digitalen Bewegungsmeldern und ausgeklügelten akustischen Sensoren passieren, um in den Bürotrakt zu gelangen, der ein wahres Refugium ist.
Denn hier sieht auf einmal alles ganz anders aus. In den größeren Büros findet man reichlich Marmor auf dem Fußboden, Marmor an den Wänden, Marmor auf der Toilette und schließlich auf Marmorsockeln stehende Skulpturen – antike Meisterwerke, die vom Büro der belgischen Niederlassung aus hierher verschifft worden sind. Die Sanitärinstallationen sind in vielen Fällen vergoldet, und bei der Toilette selbst handelt es sich um eine wundersame Kombination:
Ein Toilettenbecken westlichen Zuschnitts wird durch seitlich nach oben ragende Porzellanstützen ergänzt, damit die Toilettenbenutzer auf Wunsch auch hinaufsteigen und sich in traditioneller indischer Manier hinhocken können.
Hinter den verschlossenen Innentüren findet man ruhige, klimatisierte Räume, in denen in langen Reihen junge indische Frauen sitzen. Bekleidet mit wallenden Saris, wie indische Frauen sie bereits während der letzten paar Jahrtausende getragen haben, sitzen sie schweigend unter schwach fluoreszierenden Lampen, deren Licht eine spezifische Wellenlänge aufweist. Jede von ihnen hat einen hübschen Haufen Diamanten vor sich liegen, vielleicht im Gegenwert von rund 100 000 Dollar.
In der einen Hand, die sie immer wieder aus den Falten ihres Sari hervorstrecken, halten sie eine besondere spitz zulaufende Pinzette. Mit dieser holen sie jeweils einen Diamanten aus dem Haufen, führen diesen vor die mit der anderen Hand dicht vors Auge gehaltene Juwelierslupe und schnipsen den Stein dann in einem eleganten Bogen so über die Unterlage aus feinem weißem Papier, dass er auf einem von vielleicht fünf kleineren Diamanthaufen landet, die jeweils einen anderen Qualitätsgrad und Preis repräsentieren.
Das einzige Geräusch, das man in diesem Raum hört, rührt von der leicht über das Papier schabenden Pinzette und dem zarten Prasseln der auf dem richtigen Haufen landenden Steine her. Diese Szenerie wiederholt sich in den Sortierräumen auf der ganzen Welt: in New York, in Belgien, Russland, Afrika, Israel, Australien, Hongkong oder Brasilien.
Einmal sind wir aufs Land hinaus gefahren, um zu sehen, wie eigentlich die Steine geschliffen werden. Bei einem Großteil der Diamanten geschieht dies bei den betreffenden Leuten daheim unter Mithilfe der gesamten Familie. Über ein weit gespanntes Netzwerk von Boten, die per Zug, Bus, Fahrrad oder zu Fuß winzige Taschen mit sich führen, treten von Bombays großen Diamanthäusern aus Tag für Tag Rohdiamanten die Reise ins Umland an. Auf dem gleichen Weg kommen die Steine auch wieder in die Diamanthäuser zurück und landen erst einmal irgendwo in einem Sortierraum, ehe sie schließlich unter dem Geleitschutz eines Kuriers mit dem täglichen Nachtflug nach New York weiterreisen.