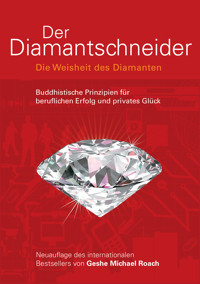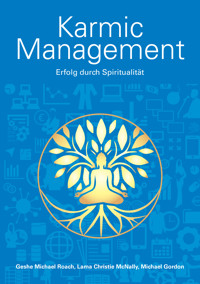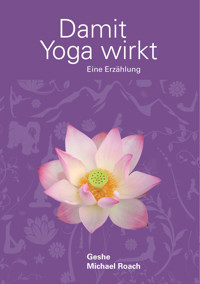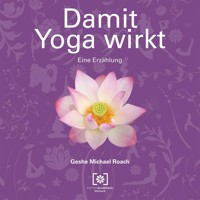18,80 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EditionBlumenau
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Freitag – Der Aufbruch einer jungen Heldin im alten Tibet Hoch oben auf den windumtosten Hochebenen des Himalaya wächst das Mädchen Freitag in einer Welt voller Traditionen und Geheimnisse auf. Während Yoga gerade erst seinen Weg von Indien nach Tibet findet, träumt Freitag von mehr als dem ihr zugestandenen Leben: Sie will lesen, schreiben und das uralte Wissen der Mönche ergründen – ein Privileg, das Frauen streng verwehrt ist. Doch Freitag lässt sich nicht aufhalten. Heimlich belauscht sie die abendlichen Debatten der Weisheitskrieger im Kloster, beobachtet ihren Bruder Tenzing bei der Ausbildung zum Geshe und schmiedet einen mutigen Plan. Sie will die erste Frau seit tausend Jahren werden, die Zugang zu den verborgenen Lehren erhält – koste es, was es wolle. Begleite Freitag auf ihrer abenteuerlichen Reise durch eine faszinierende, verbotene Welt voller Spiritualität, Mut und Rebellion. Geshe Michael Roach, renommierter Autor und erster westlicher Geshe, entführt dich mit dieser inspirierten Geschichte in die Ursprünge des Yoga und die Kraft weiblicher Selbstbestimmung. Ein Roman über Sehnsucht nach Wissen, den Mut zur Veränderung – und den Traum, Grenzen zu überwinden. Von Geshe Michael Roach, Autor des Romans "Damit Yoga wirkt" und des internationalen Bestsellers "Der Diamantschneider – Buddhistische Prinzipien für beruflichen Erfolg und privates Glück".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Katrin
Die geheimen Lehren der Selbstheilung
Und wie sie nach Tibet kamen
Übersetzung Ulrike Bienert-Loy
Lektorat und Korrektorat Eva Balzer
Geshe Michael Roach
Ungekürzte Ausgabe
1. Auflage Oktober 2022
EditionBlumenau
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
Katrin, Diamond Cutter Press, USA
Copyright © 2022 Geshe Michael Roach
Copyright der deutschen Ausgabe: EditionBlumenau
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.
ISBN: 978-3-9823962-2-4
Wir freuen uns auf Ihren Besuch: www.editionblumenau.com
Weitere Bücher von Geshe Michael Roach bei der Edition Blumenau:
Der Diamantschneider
Karmic Management
Der Garten des Buddha
Der östliche Pfad zum Himmel
Das Karma der Liebe
Damit Yoga wirkt
Ins Innere Königreich
Die Magie des leeren Lehrers
Das andere Sehen
Wellen des Lichts
Erster Teil
Mädchen tun sowas sehr wohl
Der alte Mann starrte noch eine Weile auf die Teeschale in seinen Händen. Dann richtete sich sein stählerner Blick auf mich und studierte aufmerksam mein Gesicht.
Schließlich sagte er: „Worum du da bittest, was du da lernen willst, das ist eine sehr ernste Angelegenheit.“ Erneut schwieg er, die Augen nach unten gerichtet, als suchte er Worte am Grund seiner Teetasse.
„Und selbst, wenn ich etwas über dieses ... Heilen wüsste ... ich könnte es dir niemals beibringen.“ Ein Schmerz durchzuckte meinen Körper, und er sah es.
„Ich meine, ich weiß nicht, wer du bist, und warum du es lernen willst. Und warum ausgerechnet du, so jung, und dann auch noch ein Mädchen?“
Noch einmal schwieg er, betrachtete die Teeschale, drehte sie zwischen seinen Fingern. Dann blickte er auf, und seine Augen blitzen.
„Aber wie du mich gefunden hast! Wie du diese Einsiedelei gefunden hast! Ich glaube kein Mensch hat jemals diesen Ort so erreicht wie du!“
Er beugte sich vor und war auf einmal ganz nah, ganz präsent – in meinen Augen, in meinem Leben. „Also gut, Kind, erzähl mir alles, von Anfang an, und lass nichts aus.“
Inhalt
1. Mein Zuhause 13
2. Meine Familie 16
3. Wie ich zu meinem Namen kam 22
4. Ich schlage einen anderen Weg ein 29
5. Erwachsenen den Weg weisen 35
6. Der Engel auf dem Thron 42
7. Feuer und Alarm 50
8. Die Krieger der Weisheit 61
9. Der Fremde in Weiß 71
10. Nadeln 83
11. Steh auf, Großmutter! 95
12. Wellen im Weiher 97
13. Die Quelle der Macht 102
14. Wie man ein Monster erlegt 106
15. Ein Krug Wasser erschließt mir die Welt 114
16. Pläne werden geschmiedet 119
17. Ich werde Milchmädchen 127
18. Jene, die zuhören 134
19. Die Klauenhand 140
20. Es wird nicht alles wieder gut 145
21. Ich treffe Langes Leben 151
22. Wie mir niemand und doch alle helfen 163
23. Die Frau mit dem Baby 167
24. Der Mann mit den Feuerhänden 172
25. Ein Geist aus Stein 180
26. Ich hören den Namen Katrin zum ersten Mal 186
27. Der Schmerz aller Heiler 194
28. Es darf nicht sein 201
29. Die Hälfte reicht auch 209
30. Ich treffe meinen Bruder 216
31. Mädchen tun sowas sehr wohl 225
32. Der Krieger trifft ein 233
33. Hilfe vom Himmel 237
34. Krieg wird geführt 241
35. Wenn eins drei ist 248
36. Wo die Sonne doch aufgeht 253
37. Unvollständiges Geständnis 259
38. Hüte und Teppiche 270
39. Der Ältestenweise 275
40. Die Ausladung 279
41. Angekommen 284
42. Engel auf Erden 290
43. Der letzte Beweis 295
44. Der Zauber ist vorbei 301
45. Nur zehn Minuten 307
46. Meine kleine Geshe 314
47. Engel der Befreiung 320
48. Schluss mit Schoßhund 325
49. Unterwegs 332
50. Das Antlitz des Todes 336
51. Der sprudelnde Bach 340
52. Böse Vorahnung 343
53. Wir verirren uns 344
54. Das Geschenk von Langes Leben 348
55. Keine Wahl 352
56. Sturz in die Dunkelheit 354
57. Die Höhle 356
58. Die Sonne geht auf 358
59. Unsere Geschichte beginnt 361
Mein Zuhause
Ich wurde im Wasserschwein-Jahr des ersten Zyklus‘ geboren, also im Jahr 1083 nach westlicher Zeitrechnung. Das erste, woran ich mich erinnere, ist wie ich die Augen öffnete und über mir einen kostbaren dunkelblauen Türkis baumeln sah, der fröhlich hin und her tanzte. Er war in zarte Silberringe gefasst wie in Mondlicht, und die Ringe hingen an einer Schnur schöner walnussfarbener Holzperlen.
Meine Augen folgten den Perlen zu kräftigen, wohlgeformten braunen Fingern, und ich erblickte meinen geliebten Bruder Tenzing, sein hübsches, ausdrucksstarkes Gesicht vor dem stählernen Blau des runden Dachfensters weit oben. Seine strahlend braunen Rehaugen lachten mich liebevoll an. Voller Freude rief er: „Amala! Meine hübsche kleine Schwester ist endlich aufgewacht!“
Amala – in unserer Sprache „liebe Mutter“ – kam und beugte sich über mich, und jetzt sah ich auch ihr liebes Gesicht vor dem Himmel. Sie umarmte meinen Bruder Tenzing, strich ihm liebevoll über den glattrasierten Kopf und sagte: „Oh ja, sie ist wirklich hübsch. Aber jetzt setz dich wieder an deine Bücher, mein kleiner Geshe, und lass die Kleine ausruhen.“
Er schenkte mir sein unwiderstehliches schneeweißes Lächeln und verabschiedete sich sanft mit einem glücklichem Ausdruck in seinen Augen. Die beiden Gesichter zogen sich aus dem Himmelblau zurück, der kostbare Türkis verschwand aus meinem Blickfeld, und ich blieb in meiner Wiege zurück, eingehüllt in weiche Wolle und warme Yakhaardecken, über mir das weite Blau des neuen Tages.
Ich weiß noch, wie ich stundenlang so lag, den Blick durch das Dachfenster unserer Zeltbehausung nach oben gerichtet. Langsam zog die leuchtende Sonne durch das Rund der Öffnung und tauchte mich in ihren goldenen Strahl, eine leuchtende Lichtsäule, in der die Rauchspiralen und -wirbel unseres Familienfeuers für mich tanzten. Der warme runde Lichtfleck wanderte träge durch den Raum und über meinen Körper, und so wärmte mich von oben die Sonne und im Rücken das Familienfeuer.
Ich lebte in diesem Fenster. Es war alles, was ich sehen konnte. Am Tag fühlte ich mich wie die Schwester der Sonne und in der Nacht wie die Schwester des Mondes, wenn dieser durch das nun sonnenverlassene, dunkle Rund wanderte. Dann flog mein Herz hoch hinaus, um mit den feuerfunkelnden Sternen am Himmel zu tanzen, um dieselbe mächtige, unsichtbare Achse. Ich war ein Kind des Himmels. An die Erde dachte ich kaum.
Das Dachfenster war der beste Teil unserer Zeltbehausung oder Jurte. Es war ein großes offenes Rund, gestützt von kräftigem Wacholderholz, ungefähr anderthalb Meter breit und tauchte das ganze Haus in sanftes, bernsteinfarbenes Licht, während der Rauch der Feuerstelle ungestört durch sie entweichen konnte. Acht gewölbte Speichen kreuzten das Rund, durchbrochen von einem kleineren, ca. 30 cm großen Holzring, in dem sich ein schönes Holzkreuz befand.
Das runde Fenster wurde getragen von ein paar Dutzend Dachstangen, rostrot gestrichen und verziert mit filigranen Zeichnungen von Drachen und Feuervögeln in Indigoblau, Karmesinrot und Smaragdgrün. Manchmal, wenn ich von meiner Wiege aus nach oben blickte, mich in der Sonnenlichtsäule und ihren Strahlen verlor, fühlte es sich an, als wäre es mein Körper, als wäre ich in diesem auf- und absteigenden Kern und würde dessen leuchtenden Strahlenkranz bestaunen. Dies also sind meine ersten Erinnerungen: eine große Achse und Linien aus Licht, durchwandert von Gestirnen und Planeten, in mir und um mich herum: mein neues Zuhause.
Unser Haus war warm und lebendig. Wie alle Familien schliefen wir zusammen, breiteten abends Wollteppiche, Decken und Steppdecken auf dem Boden aus, redeten, lachten und sangen noch ein Weilchen, wenn wir es uns gemütlich gemacht hatten. Auf einer Seite der Jurte hatte meine Großmutter Tara eine spezielle Strohmatratze und ein paar feine, gepolsterte Truhen, so dass sie etwas höher saß, friedlich und kraftvoll, und im Feuerschein blickte sie mit lachenden, funkelnden Augen auf uns hinab wie eine Königin. Und tatsächlich war sie auch einmal eine Königin oder Prinzessin ihres Volkes im hohen Norden gewesen, in der Nähe eines großen Sees namens Baikal.
„Erzähl mir die Geschichte noch einmal, Großmutter Tara“, bettelte ich, das kleine Mädchen auf ihrem Schoß. Gerne legte sie die Spindel beiseite, mit der sie Garn für die Teppiche meiner Mutter Amala sponn, denn im Herzen war sie immer noch eine Prinzessin, und Handarbeit machte ihr keine Freude. Dann, genau wie erhofft, griff sie in die Tasche an ihrem hellen Schärpengürtel und zog ein Stück Chura-Kampo für mich heraus. Das war damals die Süßigkeit für uns Kinder, denn Zuckerrohr wuchs hier oben nicht, und der „weiße Sand“ (wie wir den Zucker nannten) musste von Lasttieren aus Indien über die Berge getragen werden, war also selten und kostbar.
Aber Chura-Kampo war sowieso viel leckerer: kleine Käsewürfel, etwas größer als Spielwürfel, die auf eine Schnur gezogen und in der Sonne getrocknet werden. Unser Land lag so hoch, dass fast nie etwas verdarb, und die kleinen Würfel hielten sich jahrelang. Sie waren hart wie Stein. Man musste sie stundenlang lutschen – eine prima Methode, um Kinder für die Dauer einer Geschichte ruhigzustellen. (Onkel behauptete, die getrockneten Käsewürfel seien eine Erfindung böser Geister, weil alle in Tibet sie aßen und stundenlang nicht beten konnten, weil sie den Mund voll hatten.) Aber Großmutter Tara sagte nie Hallo oder Auf Wiedersehen zu mir, ohne ein Stück davon hervorzuzaubern und mir in den Mund zu stecken.
Meine Familie
„Damals war ich jung und schön“, begann Großmutter ihre Geschichte, und das glaubte man ihr sofort, denn selbst in ihrem hohen Alter sah sie großartig aus. Ihr hüftlanges Haar war zwar längst schneeweiß, aber immer noch voll und glänzend. Sie flocht es zu einem dicken Zopf, wie die meisten tibetischen Frauen, aber dann band sie sich den Zopf mit Bändern aus bengalischer Seide auf den Kopf, so dass es immer aussah, als würde sie eine Krone tragen.
Auch ihre Blusen waren aus Seide, mit langen Ärmeln, die ihr bis über die Finger reichten. Dies war eine alte Adelssitte, die anzeigte, dass ihr Träger nie niedere Arbeiten verrichtete, und die sich prima dazu eignete, an kalten Tagen die Hände warm einzupacken. Sie nähte ihre Blusen immer mit hohem chinesischem Kragen, passend zu ihrem langen Hals und aristokratischen Kinn. Diese königliche Haltung war ihr ohne jeglichen Anflug von Eitelkeit in Fleisch und Blut übergegangen. Von ihr hatte mein Bruder Tenzing seine gemeißelten Wangen und seine elegante Adlernase.
„Mein Vater war ein hoher Häuptling in unserem Land und ein bekannter Händler. Er führte große Karawanen nach Süden und Westen zur Seidenstraße, beladen mit Moschus, Pelzen und Edelmetallen aus unseren Wäldern. Lange hatte ich gebettelt, er möge mich doch bitte mitnehmen, nur ein einziges Mal, und endlich stimmte er zu. Ich glaube, er hatte gezögert, weil er Angst hatte, mich an die Räuberbanden der Ostmongolen zu verlieren, die schon damals immer stärker wurden.
In der Nähe der alten Stadt Khotan trafen wir auf der Seidenstraße auf eine andere Karawane, die mit Wollwaren und Schafherden nach China unterwegs war. Sie wurde von deinem lieben Großvater angeführt ...“, an dieser Stelle hielt sie stets inne, um sich eine Träne aus dem Auge zu wischen, denn mein Großvater war vor meiner Geburt gestorben, „... der, wie du weißt, einer der berühmtesten Händler war, die Tibet je gekannt hat. Damals war er noch nicht so reich, das wurde er erst, nachdem er mich getroffen hatte. Und natürlich weißt du, dass er es war, der deinem Vater alles beigebracht hat, was er heute weiß, damals, als er noch ein junger Bursche mit nur ein paar Säcken Salz und ein paar Yaks war.“ Sie lächelte nachsichtig. (Ich glaube, ich hatte dir bereits erzählt, dass sie zum mütterlichen Zweig der Familie gehörte.)
„Um es kurz zu machen: Dein Großvater verliebte sich auf den ersten Blick so sehr in mich, dass er die Karawane anhalten ließ und anschließend drei Wochen lang mehr oder minder auf Händen und Knien verbrachte, meinen Vater um meine Hand anflehend, während die Kamel- und Yak-Treiber beider Lager sich gegenseitig Chang-Bier und Arak-Wein ausschenkten, tranken und stritten, bis fast alle Waren verprasst waren. Am Ende ließ Großvater die Hälfte seines gesamten Reichtums – 300 Schafe – zurück und ritt mit mir davon“, erzählte sie stolz, und ich sah vor meinem inneren Auge ein Meer flauschiger Schafe nach Westen ziehen, während Großvater mit seiner Beute auf zwei Pferden nach Osten ritt. Später erkannte ich, dass mein Großvater so klug gewesen war, ein Bündnis mit den Mongolen zu schließen, die eines der größten Reiche Asiens errichten sollten, das es je gegeben hatte. Diese Ehe sollte meine Familie und ihre Karawanen viele Jahre lang schützen.
Aber für mich war Großmutter Tara einfach ein kleines Mädchen, und wir saßen stundenlang zusammen und kicherten, sehr zum Verdruss meiner Mutter Amala, die Garn für ihre Teppiche brauchte. Großmutter lehrte mich, den Tengeri, den Himmelsgöttern der Mongolen, das morgendliche Sang-Opfer zu bringen: getrocknetes Pulver aus Wacholderzweigen von den Höhen der heiligen Berge. Wenn sie über dem Rauch kniete, der von der Feuerstelle aufstieg, sah sie aus wie eine königliche Priesterin, und ich empfand Ehrfurcht vor ihrer Kraft und Anmut. In meiner Welt war sie das Firmament, unerschütterliche Autorität und Stärke.
Vater, ganz der echte Geschäftsmann, ließ sich diesen ganzen Hokuspokus gutmütig gefallen. Natürlich war er ein gläubiger Anhänger des Buddhas, aber er unternahm extra Reisen, damit seine Schwiegermutter immer ihr heiliges Wacholderpulver bekam, „denn man muss immer sichergehen, nicht wahr? Wer weiß, welche Religion sich am Ende als die richtige herausstellt!“
Diese Toleranz war die Grundlage seiner Lebensphilosophie, und obwohl er oft mit den Karawanen unterwegs war, liebte und respektierte ich ihn sehr. Er war ein brillanter Händler und so überzeugend, dass mein Bruder Tenzing und ich ihm morgens, wenn die täglichen Aufgaben verteilt wurden, lieber aus dem Weg gingen, weil er es innerhalb weniger Minuten schaffte, uns noch ein paar zusätzliche Aufgaben aufzuschwatzen und uns trotzdem das Gefühl zu vermitteln, wir hätten die Familie irgendwie im Stich gelassen. In geschäftlichen Angelegenheiten war er ebenso herausragend wie sein Bruder, Onkel Jampa, in spirituellen. Die Haltung meines Vaters in geschäftlichen Dingen bestand im Kern aus einer einzigen Regel, die er stets beherzigte: Von einem Geschäftsabschluss müssen immer beide Seiten profitieren. Damit lebte er uns einen wichtigen Kodex vor, der die Grundlage unserer Erziehung bildete: für andere ebenso gut zu sorgen wie für uns selbst.
Vater handelte hauptsächlich mit Salz und den feinen Wollteppichen, die Amala und die anderen Frauen in ihren Jurten woben. Er und die Männer der anderen Familien führten viele Yaks und andere Lasttiere in den Nordosten zu den großen Salzebenen und dann nach Süden zu den Pässen nach Nepal. Dann ritten sie hinab in das große Tal und tauschten in der geschäftigen Hauptstadt Kathmandu vor allem wertvolle Waren aus Indien ein, das noch weiter im Süden lag. Beladen mit Zucker und Reis, Safran, Sandelholz und tausend weiteren Gewürzen und Düften, mit kostbaren Seidenstoffen aus Varanasi vom Ufer des großen Ganges kehrte er dann wieder nach Hause zurück.
Vaters Familie hatte indisches Blut, sein fröhliches, pausbäckiges Gesicht zierten runde Augen und eine ausländische Nase, was ihm half, auch im Ausland Handel zu treiben. Früher waren er, sein Bruder und seine Schwester sogar gemeinsam mit meinem anderen Großvater bis nach Zentralindien gereist.
Vater war der jüngste der drei, Onkel Jampa, der bei uns wohnte, der mittlere. Die Schwester war viel älter, aber sie war verschwunden, und niemand sprach je über sie.
Meine Mutter, Amala, war eine schweigsame, schüchterne Frau. Ihr Gesicht musste nach Großvater kommen, denn es hatte nichts von Großmutter, sondern war schmal und spitz, mit weit offenen Eulenaugen und tiefschwarzem Haar. Ihr Leben war hart, weil mein Vater so oft unterwegs war, und sie die ganze Verantwortung trug. Abgesehen von einer Milchmagd namens Bukla und einigen Feldarbeitern bei der Aussaat und der Ernte lehnte Amala jede Hilfe ab, die ihr von den Familien der Karawanenpartner meines Vaters angeboten wurde, deren Frauen und Kinder östlich von uns lagerten, wenn die Männer unterwegs waren. Deswegen hatten wir nur selten Besuch.
Amala verbrachte den ganzen Tag an ihren Teppichen, die sie auf einem Webstuhl auf der anderen Seite der Feuerstelle gegenüber von Großmutters kleinem Thron wob. Der Webstuhl stand dicht an der Jurtenwand und bestand aus einem mannshohen Holzgitter, das bis hinauf an die Dachstangen reichte. Wenn Vater mit einem Teppichauftrag mit besonders großen Maßen für ein nepalesisches Adelshaus oder einen Tempel nach Hause kam, errichtete Amala einen breiteren Webstuhl mit einem Balken, der vom oberen Ende der Wand bis zu einem der beiden dicken Wacholderstämme reichte, die auf beiden Seiten der Feuergrube als Stützen für Dachfenster und Dach dienten.
Amalas Teppiche waren berühmt für ihre erlesenen Muster. Sie waren detailreicher als die aller anderen Knüpfer in unserem Landesteil. Sie beherrschte nicht nur tibetische Schneelöwen und Bergszenen, sondern auch die komplexen Symbole aus China, die Wachssiegelkunst der Mongolenfürsten und die Gestalten der furchterregenden Dschungeltiere Indiens. Während ich meine Großmutter stundenlang auf der einen Seite des Familienfeuers ablenkte, arbeitete Amala auf der anderen Seite ergeben am Webstuhl und verband diese verschiedenen Welten in der neuen Welt, die auf ihrem Holzrahmen entstand. Jeden neuen Schussfaden schlug sie mit der schweren Weblade fest, in einem Rhythmus, der sich in mir festsetzte, ebenso wie die Geheimnisse der Muster, denn ich war ein neugieriges Mädchen: Ich sah aufmerksam zu und lernte sie alle.
Das Einzige, was Amala aus ihrer tagelangen Trance am Webstuhl herausreißen konnte, war mein Bruder Tenzing, wenn er alle ein bis zwei Stunden kam, um frischen tibetischen Tee für Onkel zu holen, der in seiner Jurte auf der anderen Seite der Lichtung unterrichtete. Dieser Tee, ein Grundnahrungsmittel in unserem Land, war eigentlich eher eine Suppe. Wir tranken 15 bis 20 Tassen davon am Tag, um genügend Energie in der großen Höhe und Schutz gegen die Kälte zu haben. Jeden Morgen und Nachmittag kochte Amala eine neue Ladung, indem sie die riesige Teekanne mit kochendem Wasser, gepressten Japak-Teeblättern aus China, Milch, Butter, Salz und etwas Natron oder Muskatnuss füllte. Dann legte sie den Deckel auf die Kanne, ein langes, schlankes Fass, wie ein nach oben gerichtetes Kanonenrohr aus schönem, blank geriebenen Hartholz, gefasst von verzierten Messingringen. Und schon hörte man den vertrauten Schub des Stampfers, stetig auf und ab durch den Tee, bis er zu der dicken, goldenen Brühe wurde, die für uns Heimat war.
Tenzing brachte Onkels kleine Kanne und füllte sie, während Amala ein großes Getue um „meinen kleinen Geshe“ machte und ihn fragte, wie der Unterricht lief. In meiner Erinnerung war eines der ersten Dinge, die ich zu meiner Mutter sagte: „Amala, ich möchte auch hören, was Onkel unterrichtet.“
Sie schaute mich an mit leicht überraschtem Blick und sagte: „Aber Mädchen tun sowas nicht, Liebes.“
Und ich hörte plötzlich eine Stimme in meinem Kopf, die sehr laut rief: „Mädchen tun sowas sehr wohl!“ Aber wie ein braves Mädchen in einer asiatischen Familie des elften Jahrhunderts machte ich keinen Mucks, sondern schaute nur auf meine Füße.
Und so war die einzige Zeit, wo ich meinen Bruder Tenzing wirklich für mich allein hatte, ohne Onkel und Amala, nachts, wenn wir uns auf Amalas üppige Teppiche betteten, mit dem Kopf zum Familienfeuer, sicher eingekuschelt zwischen Großmutters Bett auf der einen Seite und meinem Vater und meiner Mutter auf einem höheren Teppichstapel auf der anderen. Wir zogen uns die Decken über den Kopf und warteten, bis wir die Schlafgeräusche der Erwachsenen hörten. Und dann fragte ich Tenzing, was Onkel an diesem Tag gelehrt hatte.
Und Tenzing unterwies mich dann voller Stolz, als wäre er bereits ein Geshe. Er beantwortete alle meine Fragen mit Liebe und Geduld. Dann, eines Abends, platzte er heraus: „Freitag, heute habe ich etwas ganz Besonderes herausgefunden!“
„Was denn?“, flüstere ich zurück.
„Onkel hat ein Geheimnis!“, verkündete er.
Wie ich zu meinem Namen kam
„Erzähl‘s mir!“, flüsterte ich lauter.
„Einer der anderen Jungs, du weißt schon, der Große, Drom, hat eine kleine Kröte in die Klasse geschmuggelt und hat sie zwischen sich und seinem Freund Hammer hin- und hergeschoben, und Hammer hat versucht, sie aufzuheben, ohne dass Onkel es sieht, und dann ...“, Tenzing fing an, wild zu kichern.
Jedes Mal, wenn er kicherte, musste ich auch kichern, aber es gelang mir ein eindringliches „Leise! Du weckst noch alle auf! Also, was ist dann passiert?“
„Die Kröte hat Hammer auf die Hand gepinkelt. Und er hat geschrien und die Kröte in Richtung von Onkels Altar geschleudert.“
„Und dann?“
„Onkel hat gerade ein Zitat nachgeschlagen, an das er sich nicht erinnern konnte. Er hat es nicht bemerkt. Mir war klar, dass wir alle Ärger bekommen, wenn wir die Kröte nicht zurückholen, bevor Onkel sie sieht, also habe ich so getan, als würde ich aufstehen, um Onkels Teetasse aufzufüllen.“
„Wie hast du die Kröte eingefangen?“
„Auf dem Weg ließ ich wie zufällig den Deckel der Kanne fallen und er rollte zur Rückseite des Altars. Ich habe mich gebückt und mich zwischen Jurtenwand und Altar gequetscht, um ganz hinten nach der Kröte zu greifen. Da habe ich gemerkt, dass einer der Steine hinten am Altar locker war. Ich habe genauer hingeschaut und gesehen, dass man ihn herausziehen kann. Es sah so aus, als wäre ein kleines Päckchen drin.“
„Hast du gesehen, was drin war?“
„Oh nein! In diesem Moment sagte Onkel: ‚Ah, da bist du ja!‘ Ich dachte, er meint mich. Ich nahm die Kröte in die eine Hand und den Holzdeckel in die andere, hielt den Deckel hoch und sagte: ‚Gefunden!‘ Da sah ich, dass Onkel immer noch den Kopf über seinem Buch hatte und der Klasse eine Zeile vorlas. Also ging ich nach vorn und füllte seine Tasse. Ich zitterte und hätte statt des Deckels fast die Kröte auf die Kanne gesetzt. Du kennst ja Drom: Er grinste mich frech an, also ging ich zurück zu meinem Platz. Auf dem Weg dorthin ließ ich die Kröte in seinen Schoß fallen. Es war klasse.“
„Was, glaubst du, ist in dem geheimen Paket?“, wollte ich unbedingt wissen.
„Keine Ahnung und ich wüsste auch nicht, wie wir es jemals herausfinden können. Onkel verlässt seine Jurte fast nie länger als ein paar Minuten – nur um die Kühe zu streicheln oder auf die Toilette zu gehen.“
Ich nickte, denn ich wusste, dass Onkel wirklich nur ein Ziel hatte. Er war Mönch durch und durch, bis spät in die Nacht hinein betete und studierte er. Er war eine Art Dauerleihgabe des örtlichen Klosters an unsere Familie für das, was wir Shapten nennen. Vater hatte von einem Tempel in Kathmandu eine vollständige Sammlung aller alten Lehren des Buddhas erworben, die bisher aus dem Sanskrit, der sehr alten heiligen Sprache Indiens, in unsere Sprache übersetzt worden war. Das war noch bevor Holzdruck in unserem Land populär wurde. Damals wurden die Bücher von Hand übertragen auf lange dünne Blätter aus Reispapier, die den alten Palmwedelblättern, dem ersten „Papier“ Indiens, nachempfunden waren. Die Schreiber hatten jede Seite mit leuchtenden Zeichnungen von Engeln und Gelehrten aus zermahlenen Edelsteinen geschmückt.
Diese Bücher waren nahezu unbezahlbar und der größte Schatz unserer Familie. Shapten war ein Brauch, bei dem ein Mönchsgelehrter aus dem örtlichen Kloster für eine Weile zu einer Familie geschickt wurde, wenn sie nur ein einziges wertvolles Buch besaß. Der Mönch sang das Buch laut und langsam vor, während die Familienmitglieder ein- und ausgingen und zuhörten, oft ohne etwas zu verstehen, aber in der Hoffnung, einen Samen zu pflanzen, um den Inhalt des Buches in einem späteren Leben richtig verstehen zu können.
Und so war es Onkels Aufgabe, unsere Texte laut zu singen. Ich kann mich an keinen einzigen Moment meiner frühen Kindheit erinnern, wo er sie nicht immer wiederholte, sie manchmal sogar nur den Kühen und Sternen vorsang, bis tief in die Nacht. Als er alt wurde, gewöhnten wir uns an, abends noch einmal durch seine kleine Holztür nach ihm zu schauen. Dann fanden wir ihn oft vornübergebeugt, mitten im Satz eingeschlafen, die Stirn an die Brust eines wunderschönen Engels auf der Textseite gedrückt.
Einem Mönch, der wie Onkel kam, um für eine Familie die heiligen Bücher zu singen, wurde ein separater Platz zugewiesen, da er aufgrund seines Gelübdes nicht mit Frauen unter demselben Dach schlafen durfte. Wenn die Beziehung zwischen dem Gastmönch und der Familie jedoch gut funktionierte, konnte er auch länger bleiben und zum Freund, Lehrer und Ratgeber der Familie werden. Jedes Familienmitglied konnte immer bei ihm vorbeischauen und sich Rat sowohl in spirituellen als auch geschäftlichen Fragen holen. Und laut Großmutter Tara war ich auch so zu meinem Namen gekommen.
Einige Tage nach meiner Geburt packten Vater und Amala mich ein und gingen zur Jurte von Onkel. In unserem Land war es Brauch, dass ein Lama dem Kind seinen Namen gab. Großmutter kam mit, um sich zu vergewissern, dass auch alles so gemacht wurde, wie es die Tradition verlangte.
Nach den Formalitäten – rituelle Begrüßungen und Verbeugungen, Darbringung von kleinen, mit Butter gefüllten Lederbeuteln und Blöcken feinen schwarzen Tees – ließen wir uns auf einem Teppich vor Onkel nieder, der, wie die meisten Mönche, sein kleines Holzbett als einzigen Stuhl in seinem kleinen Haus nutzte.
Mit nervösem Blick auf Großmutter begann Vater: „Verehrter Lama, ehrwürdiger Jampa Rabgay La, wir bitten dich, erweise uns die Ehre und gib unserer Tochter einen Namen.“
Onkel strahlte auf seine übliche Art, ein breites weißes Lächeln unter langen, struppigen weißen Schnurrbartsträhnen, die ihm über die Mundwinkel hingen. Aber seine Augen waren immer traurig. Solange ich ihn kannte, besaß er diese tiefe Traurigkeit. „Gewiss, gewiss doch! Mit Vergnügen!“, sagte er.
Onkel schaute jeden von uns warm an, hielt bei Großmutters strengem Blick kurz inne und sagte dann: „Aber das wird etwas dauern. Die Dinge müssen richtig gemacht werden, wisst ihr. Es gibt ein paar Schritte, die ich machen muss, um den richtigen Namen zu finden, also habt etwas Geduld mit mir. Besonders du, kleines Mädchen!“ Und er beugte sich nach unten und kitzelte mich unter dem Kinn. Ich verzog ein wenig das Gesicht – um eine Reaktion zu zeigen – ersparte ihm aber das Geheul, denn ich war wirklich sehr glücklich in der hellen Wärme seiner Jurte und seiner Gegenwart.
Er warf noch einen Blick auf Großmutter, die streng und aufrecht hinter Vater und Amala saß, und kramte in einigen abgedeckten Körben herum, die er neben seinem Bett aufbewahrte. Schließlich zog er eine kleine lackierte Schachtel heraus, in der zwei kleine weiße Knochen lagen. Es handelte sich um die Knöchel eines Schafs, fast quadratisch und mit verschiedenen Einkerbungen auf jeder Seite. Die Mongolen und die Nordstämme nutzten diese Knöchel gern als Würfel zum Spielen oder um die Zukunft vorauszusagen. Großmutter war mit ihnen aufgewachsen und nickte zustimmend.
Dann nahm Onkel ein kleines Buch mit losen Blättern aus Reis-papier, das in ein schmutziges, altes Seidentuch eingewickelt war und Spuren generationenlangen Gebrauchs aufwies. Es war ein Kartsi-Buch über die Positionen von Sternen und Planeten, voller seltsamer Zeichnungen und Symbole zur Bestimmung der besten Tage für wichtige Aufgaben und der zu meidenden Tage sowie Tipps für das Treffen von Entscheidungen. Später erzählte er mir, dass es eigentlich nur zwei Voraussetzungen braucht, um eine gute Entscheidung zu treffen: Freundlichkeit und das Verständnis dafür, wie die Dinge wirklich funktionieren. Doch dabei gelte es natürlich auch, die Traditionen zu berücksichtigen, die anderen wichtig sind.
Also blätterte er vorsichtig durch das Buch, summte von Zeit zu Zeit bedeutungsvoll vor sich hin, warf die Würfel auf den kleinen Tisch zwischen sich und meinen Eltern, rechnete entlang seiner Fingergelenke, wie wir Tibeter es tun, und kratzte gelegentlich mit einem Bambusgriffel Notizen auf ein kleines Stück Pergament in seiner schönen, bedächtigen Kalligrafie-Schrift.
Das alles dauerte ziemlich lange, und langsam wurden die Erwachsenen unruhig. Ich hingegen konnte glücklicherweise den Augenblick genießen und blieb ruhig. Onkel runzelte die Stirn und murmelte vor sich hin. Von Zeit zu Zeit warf er Großmutter einen nervösen Blick zu, bis sie anfing, sich Sorgen zu machen. Schließlich stieß er einen langen Seufzer aus, sammelte die Seiten des Buches wieder zusammen, faltete das Tuch darüber und legte die Würfel zurück in ihre Schachtel. Er tat dies alles sehr langsam, als wolle er einen schwierigen Moment hinauszögern. Jetzt wurden auch meine Eltern nervös, und Großmutter war kurz davor, aufzuspringen.
„Der Name des Mädchens“, sagte Onkel langsam und schaute von einem Gesicht zum anderen, „muss ... Pasang sein.“
Großmutter zuckte zusammen und warf Onkel einen finsteren Blick zu. „Besteht eine Gefahr?“, fragte sie. „Sollen wir das Mädchen in einen Kessel legen?“
Onkel schüttelte nervös den Kopf, denn Großmutter konnte schwierig sein, wenn nicht alles nach ihrem Kopf ging. Er war weit gereist und kannte den nordischen Brauch, ein neugeborenes Kind mehrere Tage lang in einen großen Kessel zu legen, wenn die Mutter zuvor Kinder bei der Geburt verloren hatte. Die Menschen glaubten, dass die Todesgeister nach dem neuen Kind suchen würden, also wurde das Baby versteckt und man sprach über es, als sei es bereits gestorben. Dies, so hieß es, würde die Geister täuschen, sodass sie verschwänden. Gestillt wurde das Baby von der Mutter in ruhigen Momenten im verdunkelten Zelt oder der Jurte, verborgen unter einem Tuch.
„Nein“, sagte Onkel nachdenklich, und er fügte seinen Lieblingssatz hinzu: „Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen.“ Er hielt kurz inne und fuhr dann fort: „Es gibt keinen Grund, die Geister zu täuschen, ganz im Gegenteil.“
„Warum hast du ihr dann einen Jungennamen gegeben, wenn nicht, um die Todesgeister zu täuschen, die nach ihr suchen?“, fragte Großmutter, denn sie spürte, dass meine Mutter die Wahrheit wissen musste, auch wenn sie hart war.
Und da sprach Amala, leise, voll Vertrauen zum Lama, ergeben in seine Entscheidungen. „Es ist ein guter Name“, sagte sie, „und ich kenne viele gute Menschen mit diesem Namen. Hast du ihn ihr gegeben, weil sie an einem Freitag geboren wurde?“ Denn auch das war in unserem Land üblich: Kinder werden nach dem Wochentag benannt, an dem sie geboren wurden. Und Pasang war unser Wort für Freitag.
„Nein“, antwortete Onkel sanft, „auch das nicht. Und bitte“, er hob sanft die Hand, „bitte, nicht ich habe ihren Namen ausgesucht.“ Er sah Großmutter an. „Es ist ihr Name, es muss ihr Name sein. Alles passt“, sagte er mit einem Nachdruck von Endgültigkeit, während er auf das alte Buch und die Schachtel mit den Würfeln wies.
„Aber was bedeutet es, mein Bruder?“, fragte Vater schließlich in der ruhigen, nachdenklichen Art, die er manchmal an den Tag legte, wenn seine Gedanken sich mit Höherem beschäftigten, jenseits des Räderwerks seiner geschäftlichen Unternehmungen.
Onkel wandte sein trauriges Antlitz zu meinem Vater und blickte ihm in die schönen Augen. Er sprach leise, fast ehrfürchtig. „Ihr Name ist Pasang, und so sollst du sie nennen. Sie wird Freitag heißen. Aber denk immer daran, dass die wahre Bedeutung des Wortes Pasang der Planet Venus ist, der Morgenstern. Der Stern steigt auf, viel heller als jeder andere Stern am Nachthimmel, um das Ende der Dunkelheit, das Kommen der Sonne anzukündigen. Pasang, Freitag, Venus, Morgenstern ...“, sagte er leise und berührte mit seinen warmen, weichen Händen meinen Kopf. „Sie kommt in der dunkelsten, kältesten Stunde der Nacht. Sie kennt die schlimmsten Zeiten. Und dann steigt der Glanz aus dem Osten auf und verschlingt sie in Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, die die Welt erfüllt.“ Dann war Stille und sie bekamen ein Gefühl dafür, was kommen würde. Und auch Großmutter Tara war zufrieden.
Ich schlage einen anderen Weg ein
Onkel Jampa wurde im Dorf Kishong und im nahegelegenen Kloster Gempil Ling zu Recht geschätzt, nicht wegen seiner hellseherischen Fähigkeiten, sondern wegen seiner Kenntnis der alten Schriften und der Weisheit, die über viele Generationen gütiger Lehrer weitergegeben worden war, zunächst in Indien und dann auch in unserem Land Tibet. Onkel war einzigartig, weil er die alten Schriften in Sanskrit lesen konnte, und er hatte zwölf Jahre lang bei einem der größten Gelehrten unserer Zeit in Indien studiert.
Sein Wissen, seine Bescheidenheit und sein großartiger Humor machten Onkel zu einem beliebten Lehrer. Den größten Teil des späten Vormittags und nachmittags unterrichtete er Gruppen junger Mönchsschüler, die jeden Tag den weiten Weg vom Kloster auf sich nahmen, um in seinem Wissen zu baden, ein paar Stunden außerhalb der Klostermauern Spaß zu haben und ohne Aufsicht durch die Gegend zu streifen.
Der Unterricht dauerte jeweils etwa eine Stunde, beginnend mit den jungen Schülern bis dann am Abend die erfahrenen Schüler an der Reihe waren. Zu unserer Zeit waren etwa 250 Mönche in Gempil Ling. Etwa zehn davon waren Lehrer wie Onkel und verantwortlich für die Unterweisung von 120 Mönchsschüler. Sie waren im zehnjährigen Kurs, der zum Geshe-Titel führt, in zehn Klassen eingeteilt. Ein Geshe ist ein Mönch, der die fünf großen alten Bücher gemeistert hat, deren Themenbereiche von Philosophie bis zu Gebet und Meditation reichen. Der Kurs ist sehr schwierig, und nur wenige Mönche jeder Klasse bestehen die Abschlussprüfung. Unser Kloster war eines der ersten in Tibet, das Mönche auf diese Weise ausbildete, und Onkel – mit seiner in Indien erworbenen Ausbildung – hatte bei der Erstellung der Studienpläne und Prüfungsmethoden mitgewirkt.
Im Laufe der Jahre sollten Ausbildung und Titel eines Geshe noch aufwändiger und strenger werden und sich über das ganzes Land verbreiten. Aber schon zu unserer Zeit wünschte sich jeder Mönch in Gempil Ling, diese Ehre zu erlangen. Und es war der Traum jeder Mutter mitzuerleben, wie ihr Sohn vor einer Versammlung von Dorfbewohnern und Mönchen seine mündliche Prüfung ablegte und die goldene Kopfbedeckung erhielt. Ganz sicher war es der Lebenstraum meiner Mutter für meinen Bruder Tenzing.
Tenzing war fast zehn Jahre älter als ich. Schon lange vor meiner Geburt hatten meine Eltern ihn für ein Leben als Mönch bestimmt. Bereits mit sieben Jahren durften Jungen ihre ersten Gelübde ablegen: Nach alter Tradition mussten sie nur groß genug sein, um eine wilde Krähe anschreien und von ihrem Sitzplatz verscheuchen zu können. In den ersten acht Lebensjahren lernten diese Novizen lesen und manchmal auch schreiben. Außerdem widmeten sie sich täglich mehrere Stunden lang dem Auswendiglernen von mindestens drei der alten Klassiker. Erst im Alter von fünfzehn Jahren – wenn man sie für alt genug hielt, eine Frage sorgfältig zu durchdenken – begann ihre formelle Ausbildung bei einem Lehrer, um die Bedeutung jener Bücher zu verstehen, die sie bereits auswendig kannten.
Danach folgten zehn harte Studienjahre – heute sind es sogar zwanzig – bis zur Geshe-Prüfung. Auf halbem Weg, im Alter von zwanzig Jahren, trifft der junge Mann die endgültige Entscheidung, Mönch zu bleiben oder nicht. Diesmal ist es seine Entscheidung, und sie gilt für sein ganzes Leben. Mädchen jedoch haben diese Wahl nicht, wie ich schmerzhaft erfahren musste.
Mein Vater und Onkel hatten den Abt des Klosters, einen alten Freund, der ebenfalls in Indien studiert hatte, überredet, dass Tenzing Onkels Diener werden durfte. All dies auf Initiative von Amala, die so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollte: Ihr geliebter Sohn sollte Geshe werden, aber er sollte auch in ihrer Nähe bleiben, während er aufwuchs. Die jungen Diener eines älteren Lamas haben eine Reihe von Aufgaben: Zum Beispiel holen sie ihm sein Essen aus der Küche, schleppen in zwei an einer Stange hängenden Eimern aus einem nahegelegenen Bach Wasser zum Trinken und Waschen für ihn heran. Sie kümmern sich auch um seinen Altar mit frischen Blumen und Duftwasserdarbringungen für die Engel. Die wichtigste Aufgabe eines Dieners jedoch besteht darin, die Teetasse des Lama stets mit heißem, starkem, salzigem tibetischem Tee gefüllt zu halten, denn der ist, wie jeder weiß, absolut unentbehrlich für klares Denken beim Lesen eines schwierigen Buches.
Eines Tages war Tenzing spät dran mit dem Tee. Amala war gerade dabei, ein schiefes Stück Teppich zu reparieren, und Großmutter hatte sich zu einem Nickerchen hingelegt. Ich war fünf Jahre alt, ich erinnere mich genau. Ich stand einfach mutig auf und tat, was ich schon immer tun wollte: Ich schnappte mir ein kleines Kännchen Tee und brachte es zu Onkel.
Als ich zur Tür hereinschlüpfte, war Onkel mitten im Satz und schaute von seinem Sitz auf dem Bett konzentriert auf eine Gruppe von acht jungen Anfängern hinunter, Tenzings Klasse.
„... und deshalb ist der wahre Schutz, die wahre Zuflucht, nicht die Bilder von heiligen Wesen oder sogar die Werke, die sie in unserer Welt gelehrt haben“, sagte er eindringlich und zeigte auf den Altar und den Stapel wertvoller Texte. „Es sind vielmehr die Konzepte, die dich beschützen: anderen Gutes tun und das Wissen, warum du dies tust, und was es dir bringen wird ...“ Plötzlich hielt er inne, blickte über die kleine Ansammlung kahlgeschorener Köpfe hinweg und starrte mich überrascht an.
Ich senkte schnell meinen Blick und bevor seine Augen mir etwas anderes sagen konnten, marschierte ich los nach vorne, entlang des schmalen Platzes vor dem Altar, den die Schüler für den Diener freigelassen hatten. Ich erreichte Onkels Tisch und stellte mich daneben. Schlagartig wurde mir die Stille bewusst, und ich spürte, wie die Blicke der Jungen auf mir lasteten. Meine Hände begannen zu zittern. Ich nahm den Deckel der kleinen Holzkanne ab und hob sie an, um Onkels Tasse zu füllen, aber ich war nicht groß genug. Einer der Jungen begann zu kichern.
Ich erinnere mich genau daran, in aller Klarheit, denn in diesem Moment entschied sich, dass ich einen anderen Weg einschlagen würde. Ich stellte die Kanne auf dem Boden ab und griff mit beiden Händen nach der Tasse. Jemand murmelte: „Ein Mädchen ... in der Klasse!“ Ich hob nicht den Kopf, um zu sehen, wer das gesagt hatte, und es war mir auch egal.
Meine Hände zitterten jetzt so stark, dass ich das Kännchen unter den Arm klemmen und die Tasse mit beiden Händen halten musste. Der Tee floss langsam heraus. Und dann sagte Onkel: „Freitag ... Freitag! Was machst du da?“
Ich erschrak und verschüttete etwas Tee auf dem Boden. Jetzt begannen mehrere Jungen zu kichern und zu gackern. Es war erst wenig Tee in der Tasse, aber ich konnte nicht weitermachen. Hilflos blickte ich zu Onkel hoch.
„Ich ... ich ... habe dir ... deinen Tee gebracht“, stammelte ich, die Kanne unter den Arm geklemmt. Ich war zu klein, um die Tasse wieder auf den Tisch zu stellen. Also hielt ich sie Onkel einfach hin. Er rettete mich, legte seine warmen Hände auf meine, nahm die Tasse und versenkte seinen weichen, traurigen Blick in meinen, suchend, aber auch tröstlich.
„Danke, Freitag“, sagte er freundlich, aber auch als klaren Auftrag, den Raum zu verlassen. Ich machte einen Schritt rückwärts, wie es Diener tun, aber eine laute, empörte kleine Stimme rief in meinem Kopf: „Bleib! Bleib da! Er wird ihnen gleich den Rest über Zuflucht erzählen. Das ist für alle Menschen wichtig, und du hast ein Recht darauf, es auch zu wissen!“
So wie damals hat mich diese Stimme mein ganzes Leben lang begleitet. Manchmal denke ich, es ist nur Stolz oder ein anderes negatives Gefühl. Aber oft befahl sie mir, etwas um der reinen Wahrheit willen zu tun. Und ganz gleich, was sie mir auftrug, es war immer etwas Schwieriges, etwas Richtiges, das aber normalerweise niemand tun würde, etwas, wofür ich mir Kritik einhandelte. Dennoch kam ich zu dem Schluss, der Stimme nicht zu trotzen. Also blieb ich in der Nähe des Altars stehen. Ich wartete, weil ich lernen wollte.
Doch noch immer herrschte Schweigen. Onkel hatte den Blick wieder auf das Buch gerichtet, das er unterrichtete, als wollte er seine Gedanken wieder sammeln. Unter den Jungen entstand nervöses Rascheln. Er sah auf und dann hinüber zu mir. Sein Blick und seine Stimme veränderten sich, wurden streng, als er einfach sagte: „Du kannst jetzt gehen, Freitag.“
Erneut richtete er den Blick auf das Buch, aber ich spürte seine Aufmerksamkeit. Ich wurde rot und blickte zu Boden. Kurz zögerte ich, trotzig und zunehmend wütend. Doch aus Respekt vor Onkel ging ich am Altar entlang zur Tür im hinteren Teil der Jurte.
Aber plötzlich lag vor mir auf dem Boden ein heiliges Buch, das Buch, das Onkel lehrte. Jeder junge Mönch hatte ein Exemplar, denn jeder hatte es als Übung vorab in kunstvoller Kalligrafie abschreiben müssen. Abrupt blieb ich stehen. Ich konnte nicht an dem Buch vorbeigehen. Und ich konnte nicht darüber treten, denn in unserem Land Tibet – wie im ganzen Osten – gelten Füße als sehr unrein, und wir dürfen nicht auf oder in die Nähe eines heiligen Gegenstandes auf dem Boden treten. Wir tragen nie Schuhe im Haus, und es gilt als Akt tiefer Demut, die Füße eines anderen Menschen zu berühren oder zu waschen, wie es einige große Heilige praktizieren. Ich konnte nicht weitergehen.
Ich schaute zur Seite und sah, wer sein Buch dort hingelegt hatte: es war der größte Junge der Klasse. Ich kannte seinen Namen, er hieß Drom, und ich hatte immer ein ungutes Gefühl bei ihm. Er blickte höhnisch auf, und einen Moment lang starrte ich in sein Gesicht, sah die leicht schiefe Nase, die scharfen, fiesen Zähne, wie die einer Ratte. Ich drehte mich um und blickte auf Onkel, die Kanne an meine kleine Brust gedrückt, kurz davor, in Tränen auszubrechen.
Er blickte erneut auf. „Freitag“, sagte er bestimmt, „geh jetzt. Du musst jetzt gehen.“ Mir brach fast das Herz. Onkel war so gut zu uns. Onkel verstand alles. Onkel würde mir nichts verweigern, nur weil ich ein Mädchen war. „Ich … ich ...“ Ich stotterte, kniff die Augen zusammen und eine Träne purzelte herunter. Ich senkte den Kopf, um sie zu verbergen.
Eine Hand tippte mir auf den Knöchel, ich öffnete die Augen und sah hinab. Es war Tenzing, der sich hinter dem großen Jungen hervorlehnte und das kostbare kleine Buch sanft aus meinem Weg schob.
Ich war frei, wie ein kleiner Vogel, dem man die Freiheit geschenkt hatte. Ich rannte zur Tür und wirbelte herum. Ich spürte die Augen aller Jungen auf mir und die von Onkel. Ich werde es lernen, flüsterte ich unhörbar und stellte mich aufrecht und stolz ins Sonnenlicht an der Tür. Und dann ging ich hinaus.
Erwachsenen den Weg weisen
Der Vorfall mit Onkels Tee war für mich ein Wendepunkt. Jetzt wollte ich unbedingt lernen, was Tenzing und die anderen Jungen lernten. Schon das Wenige, das ich von Onkel gehört hatte, hatte mich tagelang in Bann gezogen. Ich fragte mich, welche Art von Konzept dich schützen könnte, so wie ein großer Freund oder ein Schwert dich vor etwas sehr Gefährlichem schützen würden. Aber selbst in diesem jungen Alter spürte ich bereits, wie hoffnungslos meine Suche war. Schon jetzt konnte ich fühlen, wie mich die starken Strömungen des mächtigen, jahrhundertealten Flusses „So-ist-es-immer-schon-gewesen“ bedrängten und mich zwangen, als Frau aufzuwachsen, so wie Amala und Großmutter Tara: still und brav in einer verdunkelten Jurte, lebenslänglich an Teppichen und Mahlzeiten arbeitend, unbemerkt ausgeschlossen vom Tor zur Welt, durch das Tenzing und seine Freunde bereits gingen. Nein, beschloss ich, so werde ich nicht sein. Ich werde tun, was Mädchen nicht tun, ob es ihnen nun passt oder nicht.
Mein erster Schritt war klar. Tenzing verbrachte, wie alle Jungen des nahegelegenen Klosters, die Zeit nach dem Abendessen im Freien, indem er gemessenen Schritts die Familienjurte umkreiste und dabei die Schriften übte, die er auswendig lernen musste, wenn er jemals ein Geshe werden wollte. Diese Bücher waren viele Jahrhunderte zuvor in Sanskrit geschrieben und von den ersten Lotsawas, den Meisterübersetzern unseres Landes, ins Tibetische übersetzt worden. Die Schriften waren in Versform verfasst, damit man sie leichter auswendig lernen konnte. Zudem waren sie in einer Art Kurzschrift oder Code geschrieben, den der Lehrer erst erklären musste, bevor man ihn verstehen konnte. Und so schenkte niemand den jungen Männern viel Aufmerksamkeit, wenn sie über das Klostergelände schlenderten und alte, unverständliche Weisheiten rezitierten.
Die Gesänge waren wunderschön, eine unterschiedliche Melodie für jedes Mönchshaus, eine unterschiedliche Melodie für jeden Meisterlehrer. Es hieß, es gebe unsichtbare Geister, die in der Dämmerung traurig und gequält durch die Welt wandern. Wenn du dein Buch beim Gehen laut vorsingst, dann können sie es hören und sind getröstet.
Ich schmiedete meinen Plan, so wie ich es immer getan habe: eine Methode, zumindest in meiner Vorstellung, wie ich die Welt dazu bringen würde, mich etwas tun zu lassen, was sie normalerweise nicht zulässt, was aber der Welt helfen würde, wenn es getan würde. Ich hatte bereits beschlossen, dass die Welt ihren ersten weiblichen Geshe braucht. Schließlich sind wir ganz anders als Jungs. Ich sage bewusst nicht: schlauer, obwohl das durchaus der Fall sein kann. Und wenn männliche Geshes lehren und den Menschen mit dem, was sie gelernt haben, helfen können, dann können weibliche Geshes das auch, aber eben auf ihre besondere Art. Und so war mir klar: Ich musste mich in der Nähe der Stupa aufhalten.
Eine Stupa ist übrigens eine Art kleiner Tempel, wie du ihn fast überall findest, mitten in der Großstadt, oder auch einfach irgendwo am Straßenrand. Sie ist nicht dafür da, um hineinzugehen und zu beten. Man kann eine Stupa normalerweise nämlich gar nicht betreten. Im Inneren befindet sich nur eine kleine Kiste oder etwas anderes mit einem kleinen, besonderen Gegenstand darin. Das könnte zum Beispiel der alte Zahn eines besonders freundlichen Menschen sein, der vor langer Zeit gelebt hat, oder vielleicht ein Stück seiner Kleidung.
Die Stupa wird um diese Kiste gebaut, eine große zwiebelförmige Kuppel, oder, auf dem Land, einfach ein großer Steinhaufen. So war auch unsere Stupa: Sie befand sich hinter unserer Familienjurte, ein riesiger Steinhügel, der bei der Rodung der an das Haus angrenzenden Felder aufgeschüttet worden war. Onkel, Vater und einige Karawanenmänner hatten ihn mit viel Mühe aufgeschichtet, so dass er eine tiefe Nische an der Vorderseite hatte und wunderschön aussah.
Ganz hinten auf einem flachen weißen Stein stand eine wunderschöne Bronzestatue von Tara, dem Engel der Befreiung. Vater hatte sie aus Nepal mitgebracht. Wir stellten nachts oft ein paar Butterlampen auf den Stein. Die Nische schützte sie vor dem Wind, und aus dem Inneren des Steinbergs strömte fröhliches Licht.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches heilige Relikt in unserer Stupa versiegelt war. Onkel sagte, es sei etwas ganz Besonderes, das er vor langer Zeit aus dem heiligen Land, aus Indien, mitgebracht hatte. Aber er wollte nicht sagen, was es war. Gerade weil wir es nicht wussten, wurde die Stupa für Tenzing und mich noch interessanter, und wir spielten oft in ihrer Nähe.
Das Wichtigste für mich war aber, dass die Stupa ziemlich nah an der Ecke des Viehgeheges gebaut worden war, sodass man direkt daran vorbeigehen musste, wenn man um die Jurten herumgehen oder den Pfad erreichen wollte, der auf der Rückseite herausführte – die Abkürzung zum Kloster. Wir glauben nämlich, wenn wir einen heiligen Ort umrunden, sei es eine Stupa oder das Haus des Lehrers, und dabei die entsprechende Geisteshaltung beibehalten und voller Güte an andere Menschen denken, dann überträgt sich der Segen des Ortes ein wenig auf uns und hilft uns, ein besserer Mensch zu werden.
Es verstand sich von selbst, dass Tenzing, während er singend die Bücher rezitierte, deren Inhalte ich von ihm lernen wollte, stets um die Familienjurte und die Stupa herumging. Dann nahm er den Weg zu unserer Lichtung zurück, an der Innenseite des Viehgeheges entlang, zu Onkels Jurte. Onkel hatte aus irgendeinem Grund darauf bestanden, seinen Platz direkt am Rand des Geheges einzurichten. Ich verstand nicht, wie er schlafen konnte bei all dem Lärm, den die Tiere machten, wenn sie sich bis tief in die Nacht und dann wieder lange vor Tagesanbruch lautstark anblökten.
Jedenfalls konnte ich etwa die Hälfte von dem hören, was Tenzing sang, und es wiederholen, bevor er auf der nächsten Runde um unsere Jurte zurückkehrte. Es war keine ideale Art zu lernen, aber die einzige, die mir zur Verfügung stand. Und wenn man weiß, dass man ein Problem überwinden muss, lernt man manchmal besser als Menschen, die keine Probleme haben. Man könnte also sagen, ich hatte Glück.
„Großmutter Tara“, sagte ich sittsam und legte meine erste Falle aus: „Erzählst du mir noch einmal die Geschichte von deinem Namen, von Tara?“
„Natürlich, Kind“, antwortete sie, und das reichte schon für ein paar getrocknete Käsestückchen. Ich lutschte am ersten und Großmutter legte los. „Weißt du, wenn du lange genug betest und brav bist, dann verwandelst du dich in – na ja, eine Art Engel. Und dann kannst du zum Beispiel an drei Orten gleichzeitig sein ...“
„Drei?“, fragte ich ungläubig, um meine kleine Falle noch glaubwürdiger zu machen.
„Ja, drei!“, sagte sie. „Du könntest drüben im Dorf sein, in Kishong, und gleichzeitig auch im Kloster, in Gempil Ling, und immer noch hier in der Jurte sitzen und deiner Großmutter zuhören“, schloss sie mit wissendem Nicken.
„Wieso sollte man an drei Orten gleichzeitig sein wollen?“, fragte ich mit großen Augen.
„Weil du dann natürlich mehr Menschen helfen kannst“, antwortete sie. „Du könntest im Dorf mit einem einsamen Kind spielen, drüben im Kloster bei einem großen Ereignis wie morgen Abend helfen, die Butterlampen anzuzünden, und immer noch hier vor Ort sein und für Amala auf die Kühe aufpassen.“
Ich dachte einen Moment lang nach. „Aber wäre das nicht ein bisschen unheimlich? Würde das die Leute nicht durcheinanderbringen? Würden sie mich nicht seltsam finden?“
„Genau!“, antwortete sie und nickte. „Deshalb siehst du aus wie drei unterschiedliche Personen, wenn du das machst, je nachdem, womit sich die Leute besser fühlen. Für das Kind siehst du aus wie ein anderes Kind. Für die Mönche siehst du aus wie ein Mönch. Und hier siehst du vielleicht wie eine schöne erwachsene Frau aus.“
„Und das kann man lernen?“, fragte ich.
„Natürlich“, sagte Großmutter. „Jeder kann lernen, wie man immer mehr Menschen gleichzeitig hilft. Genau darum geht es ja in den Büchern, darum lehrt Onkel die Menschen, darum lernen die Jungs, Geshes zu werden. Und um alle daran zu erinnern, dass es manchmal hilfreicher ist, wenn ein Verwirklichter sich als Mädchen zeigt, kam Tara in die Welt – ein Buddha in Gestalt einer Frau.“
„Was bedeutet dein Name?“, fragte ich. „Was bedeutet Tara?“
„Es bedeutet Engel der Befreiung – der Engel, der den Menschen zeigt, wie sie frei sein können“, sagte sie stolz.
„Wer hat dir diesen Namen gegeben?“, wollte ich wissen.
„Oh“, sagte sie, „niemand hat ihn mir gegeben. Ich habe einfach beschlossen, dass er mir gefällt, und habe ihn angenommen, als ich deinen Großvater geheiratet habe.“ Sie hielt einen Moment lang traurig inne.
„Mir hat die Bedeutung gefallen und ich wollte mich seinem Volk anpassen, also nahm ich einen ihrer Namen an.“
„Wie lautet dann dein ursprünglicher Name?“
„Mein ursprünglicher Name ist Tengrar Yowh.“
„Hat das auch eine Bedeutung?“
„In unserer Sprache, in den Ländern des Nordens, bedeutet er Engel des Himmels. Es ist sogar derselbe Name, den deine Tante hatte, nur dass ihrer in Sanskrit war, und deshalb nannte man sie Dakini.“
„Dakini ...“ Ich sprach den Namen aus und spürte ein Ziehen in meinem Herz. „Dakini. Oh, Großmutter, wie war sie denn so? Hast du sie gekannt?“
„Oh nein, Kind. Das ist lange her, als dein Vater noch ein Junge war“, sagte sie mit ernstem Unterton.
„Was ist lange her?“, fragte ich neugierig. „Wo ist sie? Warum kann ich sie nicht sehen?“
„Keine Ahnung“, antwortete Großmutter, und ich wusste, dass es ein Geheimnis sein musste, wenn nicht einmal Großmutter es herausfinden konnte. „Keiner weiß es genau, und dein Onkel spricht nie darüber“, sagte sie leise.
Ich nickte und sah, dass es Zeit war, zur Stupa zu gehen. „Wenn ich also viel zu Tara bete, meinst du, dann kann ich lernen, so zu sein? Ich meine, an drei verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein, um den Menschen zu helfen?“
„Natürlich“, sagte Großmutter Tara, wohl erfreut über mein Interesse an ihrer Namensvetterin. „Es gibt sogar ein spezielles Gebet, das Mädchen lernen dürfen. Es könnte eine Weile dauern, aber ich glaube, du könntest es auswendig lernen. Es hat 21 verschiedene Strophen, die du ihr vorsingen kannst.“
„Wie wunderbar!“, rief ich. „Kannst du es mir beibringen? Dann könnte ich abends zur Stupa gehen und es ihr dort vorsingen!“
Großmutter schwieg kurz. Ich hatte den Eindruck, sie überlegte, wie lange sie brauchen würde, um Onkel das Gebet zu entlocken und es zu lernen. Dann strahlte sie: „Natürlich kann ich das tun. Und ich werde Amala und Vater von unserem kleinen Plan erzählen, und ich bin sicher, er wird ihnen gefallen. Wir fangen nächste Woche mit der ersten Strophe an. Dann können wir alle paar Wochen eine weitere Strophe lernen, wenn das nicht zu viel ist. Schaffst du das, kleines Mädchen?“, freute sie sich.
Ich lächelte voller Freude zurück, stellte mich aufs Bett und umschlang ihren Nacken. Dann fiel mir eine letzte Sache ein. „Was gibt es denn morgen im Kloster zu feiern, Großmutter?“
„Es ist die Amtseinführung des neuen Abtes – vielmehr des alten Abtes – aber es ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Schauspiel. Und dein Vater plant danach ein großes Feuer, um zu feiern“, sagte sie und schaute mich mit ihren Kleinmädchenaugen an. „Und ja, natürlich werden wir beide zusammen hingehen.“
Ich quietschte vor Freude, vor allem darüber, dass es mir gelungen war, diesen besonders störrischen Erwachsenen so erfolgreich in meine Falle zu locken. Es war, als hätte ich eine der freundlicheren Kühe an einem Seil auf die Weide geführt.
An diesem Abend richtete ich Taras Altar in der Stupa ein. Sie warf mir einen strengen Blick zu, aber ich hatte den Eindruck, dass sie im Grunde einverstanden war. Tenzing schlenderte vorbei und begann gerade, die erste Zeile seines ersten Buches zu singen:
Jene, die zuhören und die Frieden suchen ...
Ich hörte zu. Und damit begann es. Mit der Zeit konnte Großmutter Tara mir das ganze Lied über Tara beibringen, 21 Verse. Und als ich zehn Jahre alt war, hatten Tenzing und ich die drei wichtigsten Bücher des Geshe-Kurses auswendig gelernt: über tausend Strophen. Und niemand, außer meinem Herzen, hörte mich sie jemals singen.
Der Engel auf dem Thron
Großmutter Tara und ich näherten uns dem Haupttempel des Gempil Ling-Klosters. Wenn man noch nie an einem großen Festtag in einem solchen Tempel war, konnte man sich nur schwer vorstellen, wie das ist. Die Mönche aus unserem Kloster und dem gesamten Umland waren gekommen, gekleidet in ihre feinsten goldenen Roben. Die Flügel der lackierten Türen waren weit geöffnet und die Mönche saßen sich in langen Reihen auf ihren Kissen gegenüber, die sich bis auf die Stufen und den Vorplatz erstreckten. An einem Tag wie diesem durfte jeder seinen hohen spitzen Geshe-Hut tragen und diese Hüte bewegten sich wie die Wellen eines großen Meeres, wenn die Mönche einstimmig für eine gute Zukunft beteten und sich im Takt der großen Trommeln wiegten. Die Wände aller umliegenden Gebäude und der Boden bebten im Rhythmus der Trommeln.
Die Dorfbewohner drängten sich durch die Gänge die Stufen hinauf und in den Tempel, wo sie sich in einer langen, stillen Schlange hinter den singenden Mönchen an den Steinwänden entlang zu den Altären bewegten, um dort Gebete zu sprechen und Lichter darzubringen. Irgendwo dazwischen, eingequetscht zwischen den jüngeren Mönchen, saßen Tenzing und seine Klassenkameraden. Sogar Onkel hatte man zu diesem Anlass aus seiner Jurte locken können, und jetzt saß er ganz vorne bei den hohen Geshes.
Wir gingen auf den Eingang des Tempels zu. Der Gesang wurde zum mächtigen Crescendo, als Hunderte von Stimmen sich zu den höchsten Tönen hinaufschwangen. Ein starker, warmer Wind voll menschlicher Körperwärme, Weihrauchduft und dem Geruch der in tausend kleinen Lampen brennenden Butter wehte mir ins Gesicht. Eine Prozession von etwa zehn hohen Lamas mit besonderen Hüten und aufwendigen Roben bahnte sich feierlich ihren Weg mitten durch das Meer von Klängen und Menschen. Ich stand auf der Schwelle der massiven Tempeltore. Großmutter ging weiter und zog mich an der Hand. Aber ich war wie erstarrt.
Sie saß auf dem Thron. Ich konnte sie über die Masse der wogenden goldenen Hüte hinweg sehen. Und sie leuchtete golden. Aber noch mehr als das: sie war das goldene Licht. In dem Moment traf mich ihr Blick. Ihre Augen waren außergewöhnlich: voller Liebe, aber auch voller Macht.
Ich ließ Großmutters Hand los und rannte nach vorn. Sie rief mir hinterher, aber ich konnte sie nicht hören. Ich lief direkt auf den Engel auf dem Thron zu, mitten durch die Reihen der Mönche. Ich musste unbedingt zu ihr. Ich musste sie berühren. Vorbei an den fließenden Seidengewändern der hohen Lamas, über die vor dem Altar auf den Boden gemalten, filigranen Symbole von Güte und Freundlichkeit hinweg. Die harten Lehmstufen zum Thron hinauf, nur hin, hin zu ihr, mit ausgestreckten Händen, Arme und Herz offen für sie, wild entschlossen, die Holzstufen des Throns zu erklimmen.
Sie blickte auf mich herab, und jetzt konnte ich sie ganz deutlich sehen. Sie lächelte, als Zeichen, dass alles gut sei, dass die Zeit kommen werde … Und dann packten mich starke Hände und rissen mich zurück auf den Boden neben dem Thron.
„Hoppla, kleines Mädchen!“, sagte ein großer Mönch mit einem breiten Lächeln im Gesicht. „Der Platz ist heute schon besetzt, es sei denn, du bist zufällig der neue Abt von Gempil Ling!“
Ich sah aufgeregt zu ihm auf und deutete auf den Engel, der doch so offensichtlich bereits auf dem Thron saß, aber sie war weg. Ich runzelte verwirrt die Stirn und klammerte mich an die große warme Hand des freundlichen Mönchs.
„Was ist denn hier los, Geshe Lothar?“, hörte ich eine fröhliche Stimme hinter mir, die den Lärm übertönte. Ich drehte mich um und sah, dass die Prozession der Lamas Altar und Thron erreicht hatte. Der vorderste Mönch war ein kleiner, rundlicher, fröhlicher Mann mit breitem Lächeln und leicht schielenden Augen, der eine wunderbare Wärme ausstrahlte.
„Ich weiß es nicht“, antwortete der Mönch, der mich abgefangen hatte. „Aber es sieht so aus, als hättest du Konkurrenz für deinen neuen Posten“, lächelte er. Da nahm der Erhabene meine andere kleine Hand in seine und beugte sich mit fragendem Blick direkt zu meinem Gesicht hinunter. Er kniff mich fröhlich in die Wange, sagte „Hallo du“ und richtete sich wieder auf.
„Keine Chance, sie jetzt noch sicher aus diesem Gedränge herauszubringen“, sagte er und blickte über die Menge der singenden Mönche und Dorfbewohner hinweg. „Ich schlage vor, ihr setzt sie einfach hin und behaltet sie bis zum Ende der Zeremonie bei euch. Wer auch immer sie verloren hat, hat sie sicher schon gesehen und wird sie nachher wieder abholen.“ In dem Moment wurde mir bewusst, dass fast alle zu uns aufblickten und sich die Hälse verrenkten, um zu sehen, was da gerade passierte und warum ein kleines Mädchen die Amtseinführung des nächsten Abts von Gempil Ling störte.
Der Erhabene, der Abt, drehte sich um und stieg die Stufen zum Thron hinauf. Zu beiden Seiten dieses zentralen Throns, auf dem der Engel gesessen hatte, standen weitere, niedrigere Throne für frühere Äbte des Klosters und angereiste Würdenträger. Der Lama auf dem Thron zur Rechten sah anders aus als alle anderen, ein bisschen wie eine männliche Version von Großmutter, mit langem aristokratischen Hals und einer autoritären Ausstrahlung. Er warf mir einen kalten, missbilligenden Blick zu und mich überlief ein Schauer. Doch da hatte mich der fröhliche Mönch, Geshe Lothar, schon neben sich in eine Reihe freundlich aussehender älterer Mönche gezogen, direkt auf die Plattform vor den Altären, die aus großen Steinplatten bestanden und die sich über die gesamte Vorderseite des Tempels erstreckten.
„Was ist los, Kleine?“, flüsterte er mit einem Lächeln und lehnte seinen Kopf nahe an meinen, um mich trotz des Lärms hören zu können. Ich blicke zu ihm auf.
„Der Lama auf dem anderen Thron, er sieht so böse aus!“, flüsterte ich zurück.
Geshe Lothar schaute hinüber und dann zurück zu mir. „Ja, der“, sagt er langsam. „Das ist der Gründervater! Er hat dieses Kloster vor vielen Jahren ins Leben gerufen. Er ist der erste unserer Äbte und im Grunde immer noch der Chef hier, ganz gleich, wer der Abt ist. Und er ist nicht wirklich böse“, sagte Geshe Lothar und machte eine kurze Pause, „nur sehr streng. Man muss streng sein, wenn man einen neuen Ort wie diesen gründet, in einem Land, in dem es zuvor nie wirklich viele Klöster gegeben hat.“
„Oh“, sagte ich. Und dann traf mich der Blick des Abts, des Mönchs, den sie Erhabener nannten. Neben seinem Thron, der in unseren Tempeln im Grunde nur ein schickes Kissen auf einem sehr hohen, schmalen Podest ist, stand ein seltsamer kleiner Tisch mit dünnen, fast mannshohen Beinchen. Und gerade streckte sich ein Mönch mit einem großen Messingkrug so hoch wie nur möglich, um frischen tibetischen Tee in eine auf dem Tisch stehende zarte Tasse aus weißem chinesischem Porzellan zu gießen. Der Erhabene zwinkerte mir zu, zeigte auf den Tee und dann auf mich, als wollte er sagen: „Du wirst auch etwas davon bekommen!“
„Aber er sieht wirklich nett aus“, sagte ich zu Geshe Lothar und deutete mit dem Kopf auf den Abt.
„Ja, der Erhabene ...das ist er wirklich. Es braucht ein starkes Herz und viel Humor, um Abt dieses oder überhaupt eines großen Klosters zu sein. Mönche, musst du wissen, sind stur. Das müssen sie auch sein, wenn sie Mönch bleiben wollen. Und wenn du eine große Gruppe von ihnen führen willst, musst du ein sehr weiser, geduldiger Mensch sein. Und der Erhabene, Geshe Donyo, ist ein solcher. Obendrein ist er auch noch bescheiden und lustig, alle mögen ihn. Deshalb haben die Mönche ihn für weitere sechs Jahre zum Abt gewählt. Und das feiern wir alle heute.“
Er hielt inne und schaute mir lange in die Augen. „Wärst du auch gerne Abt, Kleine?“, fragte er lachend.