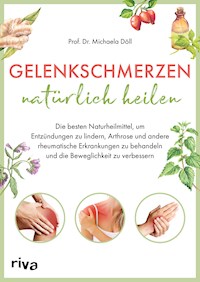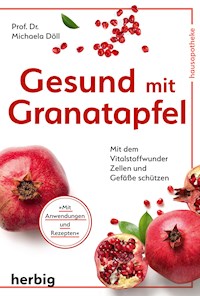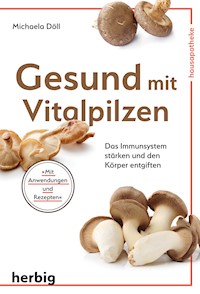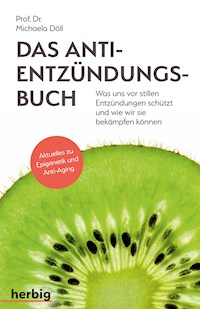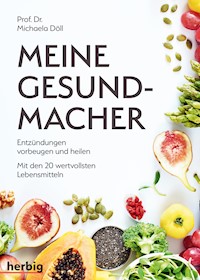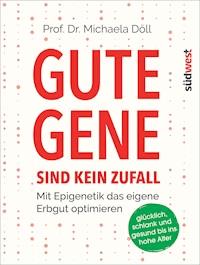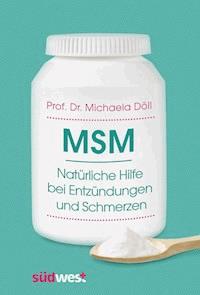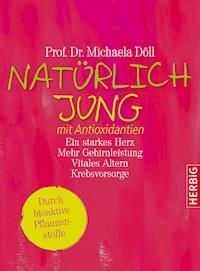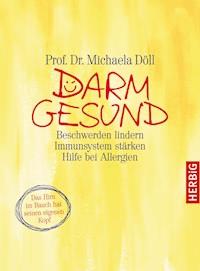
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herbig, F A
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wenn der Darm im Gleichgewicht ist, fühlen wir uns wohler und sind glücklicher. Doch Bauchschmerzen, Blähungen und Verstopfungen stören oftmals dieses Wohlbefindden. Reizungen sowie Entzündungen des Darms oder Nahrungsmittelallergien sind heute weit verbreitet. Doch wie bringen wir den Darm ins Gleichgewicht? Die einfache Lösung: Vielseitige gute Keime und Ballaststoffe mit großem Heilungspotenzial helfen der Darmflora wieder ins Lot zu kommen und das Immunsystem zu stärken. Pro- und Prebiotika stärken die körpereigene Abwehr und verbessern den Schutz vor Infektionen, Allergien, Entzündungen und Darmkrebs. Mit speziellen Check-ups zur Laktoseintoleranz, zum Reizdarm und zum Darmkrebsrisiko.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Wichtige Hinweise
Die Wissenschaft ist ständig im Fluss. Die vorliegenden Informationen beruhen auf gründlicher Recherche der Autorin. Ziel des Buches ist es, die modernen Erkenntnisse der medizinischen Forschung aufzuzeigen, wobei die Betreuung durch einen Therapeuten hiermit nicht ersetzt werden soll. Alle Angaben, Empfehlungen und Informationen (auch zu den genannten Medikamenten) sind ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie der Autorin.
Für die Angaben zu den aufgeführten Produkten kann weder seitens der Autorin noch seitens des Verlages eine Gewähr übernommen werden. Der Leser sollte in jedem Fall seinen Therapeuten um Rat fragen, verordnete Medikamente nicht eigenmächtig absetzen und die Anwendung der hier genannten Präparate auf seinen speziellen Bedarfsfall vom betreuenden Therapeuten prüfen lassen.
Prof. Dr. Michaela Döll im Internet:
www.prof.drmdoell.de
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.herbig-verlag.de
überarbeitete Neuausgabe
© für die Originalausgabe und das eBook: 2015 F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
© 2007 F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
eBook-Produktion: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
ISBN 978-3-7766-8226-7
Inhalt
Vorwort
Verdauung – eine Reise zwischen den Körperöffnungen
Wir verspeisen im Verlauf des Lebens zehn Elefanten
Den Mund haben wir nicht nur zum Reden
Ab durch den Tunnel
Das Gemenge im Säurebad
Der Magenpförtner ist ein strenger Kontrolleur
Der Darm – ein Tennisplatz im Bauch
Fleißige Helfer im Oberbauch: Bauchspeicheldrüse, Leber und Gallenblase
Endlich kann die Feinarbeit beginnen
Das »dicke« Ende der Verdauung
Der Darm ist nicht nur für die Verdauung da
Reine Nervensache und starke Abwehr – hier spricht der Bauch
Das Hirn im Bauch hat seinen eigenen Kopf
Der Darm ist unser wichtigstes Immunorgan
Bakterienpolizei im Darm: Da tummelt sich was
Intakte Darmflora – Voraussetzung für die Gesundheit
Früh übt sich, wer ein Meister werden will
Stillen sorgt für willkommene Mieter
Freunde und Feinde im Verdauungskanal
Das macht dem Darm und seinen Bewohnern zu schaffen
Antibiotika – Segen, aber auch Fluch
Antibiotika fegen den Bakterienrasen weg
Darmfeindliche Esssünden
Stress stresst auch die Darmflora
Born to be wild – freie Radikale machen Randale im Bauch
Darmfit oder nicht – was man einem Bauch so alles ansieht
Bauchgefühle – hart oder weich
Der gesunde Bauch lässt sich kein X für ein U vormachen
Trommel- oder Hängebauch – was die Bauchform verrät
Weniger ist einfach mehr
Darmreinigung – der erste Schritt in die richtige Richtung
Probiotika – Bakterien, die es gut mit uns meinen
Keime für ein langes Leben
Prebiotika – »Futter« für probiotische Keime
Kleine Helfer mit großer Wirkung
Probiotika machen die körpereigene Abwehr stark
Ständig krank und keiner weiß, warum
Probiotika verbessern die Schlagkraft des Immunsystems
Mit Probiotika leistungsstark und seltener krank
Starke Blase: Probiotika senken das Risiko für Harnwegsinfekte
Blasenstark: Cranberries in Kombination mit Vitamin C
Grapefruitkernextrakt – ein natürliches Antibiotikum
Probiotika – effiziente Unterstützung bei Allergien und Neurodermitis
Allergien – wenn das Immunsystem über das Ziel hinausschießt
Die »Allergiker-Karriere« beginnt früh
Nahrungsmittelallergien – wenn Essen krank macht
Die Allergie und der Darm – ein krankes Gespann
Probiotische Keime schlagen Allergien in die Flucht
Neurodermitis – wenn Kratzen zum Verhängnis wird
Milchsäurebakterien halbieren das Risiko für Neurodermitis
Probiotika am besten mit hautwirksamen Vitalstoffen kombinieren
Probiotika helfen bei Laktoseintoleranz
Hilfe – Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall
Luft im Bauch – woraus besteht ein »Pups«?
Genießen ohne Reue
Milchzucker ist nicht nur in Milch und Milchprodukten enthalten
Rettung durch probiotische Keime
Check-up: Leiden Sie unter Laktoseintoleranz?
Probiotische Keime lassen Darmpilzen keine Chance
Darmpilze – harmlos oder problematisch?
Darmpilze nutzen die Gunst der Stunde
Leberschäden ohne Bier und Schnaps
Probiotische Keime hemmen das Ansiedeln von Darmpilzen
Seien Sie ein schlechter Gastgeber für Darmpilze
Bitterstoffe machen Darmpilzen das Leben schwer
Probiotika unterstützen den Darm beim Reizdarm-Syndrom
Reizmagen – der Magen ist ein armer Schlucker
Multi-Target-Therapie: Gleich »mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen«
Reizdarm – Bauch in Aufruhr
Dem gereizten Darm auf der Spur
Alarm im Darm durch Infektionen und Medikamente
Frischpflanzensäfte für ein gutes Bauchgefühl
Eine gute Lebensführung und probiotische Keime harmonisieren den aufgeregten Bauch
Check-up: Sind Sie ein Reizdarmtyp?
Prebiotika bringen bei Verstopfung den Darm in Schwung
No way out – Verstopfung oder »wenn der Darm streikt«
Tabuthema Hämorrhoiden – die verheimlichte Pein
Dunkle Geschäfte – woraus besteht der Stuhl?
Wie kommt es zu einem »faulen« Darm?
Keine Fürsprache für Abführmittel
Ballaststoffe sind kein Ballast
Ballaststoff ist nicht gleich Ballaststoff
Erziehen Sie Ihren Darm – Dickdarmzeit ist morgens!
Prebiotika helfen dem Darm auf die Sprünge
Probiotika sind hilfreich bei Durchfallerkrankungen
Wasser marsch – Durchfallerkrankungen können lebensbedrohlich sein
Bakterielle und virale Infektionen sind die häufigsten Auslöser
Wenn einer eine Reise tut – dann kann er was erleben
Tödliche Rotavirusinfektionen – besonders für Kinder gefährlich
Probiotische Keime verkürzen die Krankheitsdauer
Vorbeugen ist besser als leiden
Probiotische Keime und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
Durchfall und Bauchschmerzen können auch auf Entzündungen hinweisen
Gelenke, Augen, Herz und Nieren können betroffen sein
Woher kommt eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung?
Erfolge bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen mit Probiotika
Myrrhe und Co. stärken die Darmbarriere und lindern Beschwerden
Achten Sie vor allem auf die ausreichende Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren
Aminosäuren – für die erkrankte Darmschleimhaut besonders wichtig
Pro- und Prebiotika reduzieren das Darmkrebsrisiko
Darmkrebs – bei uns häufig, bei Naturvölkern nahezu unbekannt
Am Anfang war der Polyp
Wie kommt es zu Darmkrebs?
Die Früherkennung bietet gute Chancen
Neu und hochspezifisch: Enzymtests liefern Hinweise auf Polypen und Darmkrebs
Risikofaktoren für Darmkrebs
Pro- und Prebiotika haben einen schützenden Einfluss
Studien mit Pro- und Prebiotika zeigen Schutzwirkung
Das können Sie zusätzlich tun, um Ihr Darmkrebsrisiko zu senken
Check-up: Testen Sie Ihr persönliches Darmkrebsrisiko
Literaturangaben (Auswahl)
Register
Lesetipps
Vorwort
Wir leben in einer Überflussgesellschaft – der überwiegende Teil der Bevölkerung isst oft und reichlich. Dabei möchten wir sehen, was auf dem Teller liegt – schließlich »isst das Auge mit«. Was vom Essen übrig bleibt, betrachten wir dagegen eher nicht so gern. Der Darm und die Verdauung führen ein Schattendasein, wobei vielen Menschen nicht bewusst ist, dass dieses fleißige Organ neben der Verdauung noch eine Reihe weiterer wichtiger Aufgaben übernimmt. Der Darm ist z. B. ein wichtiges Immunorgan – hier sitzen etwa zwei Drittel der Abwehrzellen. Chronische oder wiederkehrende Infekte, Abwehrschwächen, Entzündungen und Allergien nehmen häufig hier ihren Anfang. Auch Verdauungsbeschwerden wie Durchfälle, Bauchkrämpfe, Blähungen oder Verstopfungen sind weit verbreitet und zeigen, dass die Darmgesundheit vielfach zu wünschen übrig lässt. So leiden derzeit in Deutschland etwa 16 Millionen Menschen unter einer Verstopfung, 12 Millionen Menschen sind vom Reizdarm-Syndrom mit Durchfällen oder Verstopfung und Bauchschmerzen betroffen. Und schließlich ist der Darmkrebs die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen und Männern und kostet jährlich etwa 30 000 Menschen in Deutschland das Leben.
Für die Gesunderhaltung des Darmes sind die dort angesiedelten »guten« Bakterien von immens wichtiger Bedeutung. Medikamente, Genussmittel und Ernährungsfehler setzen dieser Darmflora, wie diese Wohngemeinschaft auch bezeichnet wird, extrem zu. Probiotika haben in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung. Darunter versteht man lebende, »gute« Bakterien, die den Darm in seinen Funktionen unterstützen, die körpereigene Abwehr stärken und eine Reihe weiterer gesundheitsfördernder Wirkungen entfalten können. Wie eine Vielzahl von Studien inzwischen belegt hat, ist die Anwendung von Probiotika (probiotischen Keimen) u. a. bei Allergien, Neurodermitis, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Durchfällen, Verstopfung, Milchzuckerunverträglichkeit und dem Reizdarm-Syndrom hilfreich. Dabei können die probiotischen Keime nicht nur zu einer Linderung der jeweiligen begleitenden Beschwerden beitragen, sondern gleichzeitig helfen, die Nebenwirkungen von Medikamenten zu reduzieren. Das sollte allerdings nur in Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt erfolgen.
Und nun darf ich Sie einladen, die Reise durch unsere Körpermitte mit mir anzutreten. Erfahren Sie mehr über den Darm und die Bedeutung, welche die »Wohngemeinschaft« in unserer Bauchhöhle für die Gesundheit des gesamten Körpers hat. Lesen Sie, wie Probiotika durch ihre vielfältigen positiven Wirkeffekte die Gesunderhaltung des Darmes fördern und zur Normalisierung eines gestörten Gleichgewichtes im Darm beitragen können.
Herzlichst
Ihre Prof. Dr. Michaela Döll
Verdauung – eine Reise zwischen den Körperöffnungen
Wir verspeisen im Verlauf des Lebens zehn Elefanten
Am Anfang war die Esslust oder der Hunger. Nun ist sie in der Bauchhöhle verschwunden: die Portion Spaghetti mit der Käse-Sahne-Soße, der gemischte Blattsalat und das Tiramisu (wussten Sie übrigens, dass die deutsche Übersetzung für dieses Dessert »Richte mich auf« heißt?). Leider musste es auch noch schnell gehen, da die Zeit mal wieder drängte. Was passiert nun mit einer solchen (oder anderen) Mahlzeit im Körper? Wird dieser tatsächlich »aufgerichtet«, wie die leckere Nachspeise verheißt, oder hat er damit erst einmal seine Last?
Ganz gleich, ob Sie auf italienische Küche, bayrische Schmankerln oder Rohkost stehen – die zerkleinerten Nahrungsbestandteile landen über kurz oder lang in der Bauchhöhle und verweilen dort auch für viele Stunden – und das bedeutet für das Verdauungssystem Schwerstarbeit. Im Verlauf eines 75-jährigen Lebens werden hier im Schnitt 40 bis 50 Tonnen Nahrung zersetzt – das entspricht dem Gewicht von etwa acht bis zehn Afrikanischen Elefantenbullen! Noch dazu ist der Reiseweg des Nahrungsbreis durch den Körper ziemlich lang, im Durchschnitt bis zu 72 Stunden – bei manchen länger, bei anderen etwas kürzer. Dann ist die Reise zu Ende: Die unverdauten Reste werden mit dem Stuhl ausgeschieden.
Den Mund haben wir nicht nur zum Reden
So schön es ist, gemeinsam am Tisch zu sitzen und sich zu unterhalten – für die Verdauung ist viel Reden während des Essens nicht unbedingt günstig, denn der anstrengende Prozess der Nahrungsaufschließung beginnt bereits im Mund. Und dafür ist es wichtig, ausreichend zu kauen (jeden Bissen optimalerweise bis zu 30 Mal) und schon gar nicht ständig mit vollem Mund zu sprechen und damit den Speisebrei auch noch mit Luft aufzublähen. Die Bissen werden im Mund zermalmt und mit Speichel vermengt. Dieser wird von den Ohrspeichel-, Unterkiefer- und Unterzungendrüsen hergestellt – so läuft uns beim Anblick einer leckeren Mahlzeit förmlich »das Wasser im Mund zusammen«. Der Speichel enthält Enzyme, die den groben Brei bereits »andauen«. Vor allem die Kohlenhydrate werden hier – durch das Enzym Amylase – bereits in kleinere Bruchstücke zerlegt. So können pro Tag bis zu zwei Liter von diesem wertvollen wässrigen Saft hergestellt werden. Je besser und öfter sich unsere Kauwerkzeuge hier einbringen, desto leichter wird es für die nachfolgenden Verdauungsorgane. Wird hastig gegessen, so kommen größere, weniger vorbereitete Brocken im Magen-Darm-Trakt an und dieser ist dann besonders gefordert, um die noch anstehende Verdauungsarbeit zu bewerkstelligen.
© Shutterstock/Svitlana-ua
Ab durch den Tunnel
Nach dem Schluckvorgang wird der Nahrungsbrei über die Speiseröhre in den Magen befördert. Dabei fallen die Bestandteile nicht von selbst nach unten, sondern müssen aktiv abwärtsbewegt werden. Dafür ist die etwa 25 Zentimeter lange Speiseröhre mit einem raffinierten Muskelsystem ausgestattet, welches die Fracht in einer Art »Wellenbewegung« (Peristaltik) nach unten schiebt.
Ist der Brocken, der verschluckt wurde, zu groß, so drückt er an die Tunnelwand und löst dort einen Nervenreiz aus. Dieser sorgt dafür, dass sich die ringförmigen Muskeln direkt oberhalb des Hindernisses zusammenziehen und das zu hastig verschluckte Teil zwangsweise doch im Magen landet. Ab dem Zeitpunkt des Schluckens haben wir also nichts mehr zu melden – die bewusste Kontrolle über den Nahrungsbrei, die wir im Mund beim Kauen noch besitzen, ist aufgehoben. Von nun an geht alles seinen Gang – ohne dass wir die Fracht noch aufhalten oder beeinflussen könnten –, die peristaltische Wellenbewegung übernimmt das Kommando.
Das gilt übrigens auch für die umgekehrte Richtung: Hat man unbekömmliches oder verdorbenes Essen zu sich genommen, kann der Mageninhalt via Speiseröhre explosionsartig nach außen befördert werden. Auch das können wir kaum beeinflussen: Der Körper versucht, durch Erbrechen die schlechte Mahlzeit wieder loszuwerden. Der Wille, diesen Vorgang zu unterdrücken, wird uns in den meisten Fällen wenig nutzen.
Das Gemenge im Säurebad
Nun ist der Speisebrei in die erste Verdauungsstation vorgedrungen: in den Magen. Ein dehnbarer Muskelsack, der mit mehreren Muskelschichten und einer grob gefalteten Schleimhaut im Inneren ausgestattet ist. Je nachdem, was wir ihm zumuten, kann er sich um das 20-Fache ausweiten. Hier wird die zu verdauende Fracht erneut durchgewalkt und mit »Verdauungssäften« versehen. Diese enthalten Enzyme wie das Pepsin, welches die Aufgabe hat, Eiweiße in kleinere Bruchstücke zu spalten. Diese Eiweißschere arbeitet aber nur dann gut, wenn die Umgebung so richtig sauer ist. Daher produziert der Magen große Mengen an Salzsäure, welche die Nahrung zersetzt, Bakterien abtötet und dem Eiweißenzym das richtige »Wohlgefühl« vermittelt. Bis zu drei Liter Magensaft, der aus Schleim, Wasser, Säuren und Enzymen zusammengesetzt ist, werden über die Drüsenzellen der Magenschleimhaut in das Mageninnere abgegeben. Um sich vor der aggressiven Salzsäure zu schützen, ist der Magen selbst mit einer Schleimschicht ausgekleidet, die ebenfalls von spezialisierten Zellen der Magenschleimhaut gebildet wird.
Je nach Nahrungszusammensetzung verweilt die vermengte und angedaute Fracht zwischen einer bis fünf Stunden im Magen, bevor sie dann portionsweise an den anschließenden Dünndarmabschnitt weitergegeben wird. Am schnellsten wandern die Kohlenhydrate aus dem Magen weiter. Am längsten zurück bleiben die Fette. So kann es passieren, dass uns fette Speisen im wahrsten Sinn des Wortes schwer »im Magen« liegen.
Was ich Ihnen rate
Stress, Hektik, Ärger und Genussmittel können den Magen »nervös« machen. Nicht immer muss hinter solchen Beschwerden eine Magenschleimhautentzündung stecken. Lassen Sie auftretende Magenprobleme von Ihrem Arzt abklären.
Der Magenpförtner ist ein strenger Kontrolleur
Über die rhythmischen Wellenbewegungen wird schließlich und endlich auch die fette Kost in Richtung Magenausgang geschoben. Dort sitzt der Magenpförtner – ein kräftiger Ringmuskel, der den Übertritt der Häppchen in den beginnenden Dünndarm kontrolliert. Pro Zeiteinheit verlässt immer die gleiche Menge an Kalorien (etwa 6 kJ bzw. 1,5 kcal pro Minute) den Magen – nur so ist gewährleistet, dass die weiteren Darmabschnitte die ankommenden Nahrungsbestandteile auch reibungslos aufspalten können.
© Shutterstock/Alena Hovorkova
Der Darmabschnitt, der den Mageninhalt portionsweise übernimmt, heißt Zwölffingerdarm. Seinen Namen hat dieser Dünndarmabschnitt seiner Länge (etwa 30 cm) zu verdanken, die etwa der Breite von 12 Fingern entspricht. Ist der Zwölffingerdarm noch nicht für die Portiönchen aus dem Magen bereit, macht der Magenpförtner erst einmal dicht und die Verdauungsfracht gelangt zurück in die oberen Abschnitte des Magens, wo sie erneut durchgewalkt und mit Verdauungssäften vermischt wird. Der Nahrungstransport gerät damit erst einmal ins Stocken.
Der Darm – ein Tennisplatz im Bauch
Unvorstellbar, aber tatsächlich wahr: Auseinandergefaltet und »gebügelt« hat unser gesamter Darm (Dünn- und Dickdarm) eine Oberfläche von 400 Quadratmetern und damit in etwa die Größe eines Tennisplatzes. So steht unserem Körper eine riesige Umschlagfläche für die Nährstoffbeschaffung zur Verfügung. Aus dem Speisebrei werden Fette, Zucker, Eiweiße, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente herausgeholt.
Damit das Ergebnis möglichst optimal ausfallen kann, hat die Natur den Darm mit zahlreichen Falten, Furchen und Vertiefungen versehen. Dieser Trick der gigantischen Oberflächenvergrößerung erleichtert dem Darm seine Aufgabe gewaltig. Dabei ist es diesem Organ zunächst einmal völlig gleich, ob diese Nährstoffe aus einer Schweinshaxe, der Pizza oder aus einem Gemüseeintopf stammen. Für die optimale Nährstoffausnützung gibt der Darm sein Bestes.
Fleißige Helfer im Oberbauch: Bauchspeicheldrüse, Leber und Gallenblase
Der Darm täte sich allerdings schwer mit der Verdauungsarbeit, wenn da nicht die fleißigen Helfer in der Nachbarschaft wären – die Bauchspeicheldrüse z. B., auch Pankreas genannt. Dieses bis zu 100 Gramm schwere, zungenförmige Gebilde liegt zwischen Magen und Wirbelsäule. Das fleißige Bauchorgan produziert täglich bis zu 1,5 Liter Sekret. Darin enthalten sind zucker-, eiweiß- und fettspaltende Enzyme (auch Hormone). Der breite Kopfteil der Bauchspeicheldrüse schmiegt sich direkt in eine Schlinge des Zwölffingerdarms, was sehr praktisch ist, denn in diesen Darmabschnitt wird jetzt das produzierte Enzymgemisch entlassen. Dies geschieht durch die speziellen Ausführgänge der Bauchspeicheldrüse, die direkt in den Zwölffingerdarm münden.
Zu den weiteren wichtigen Helfern der Verdauungsarbeit zählt auch die Leber. Diese ist unser größtes Drüsenorgan (Gewicht: 1500 bis 2000 Gramm) und sitzt gleich oberhalb der Bauchspeicheldrüse auf der rechten Körperseite. Neben vielen anderen Aufgaben, die sie hat, stellt die Leber die Gallenflüssigkeit her, die dann in der Gallenblase gespeichert wird. Von dort wird die Galle in den Zwölffingerdarm gepumpt. Jetzt erst geht es den Fetten so richtig an den Kragen: Die in der Gallenflüssigkeit vorhandenen Gallensäuren machen aus großen Fetttropfen kleine Tröpfchen (Emulsion), damit es die fettspaltenden Enzyme im folgenden Darmabschnitt, dem Dünndarm, leichter haben.
Endlich kann die Feinarbeit beginnen
Im insgesamt etwa drei Meter langen Dünndarm findet nun die eigentliche Verdauungsarbeit statt. Neben dem relativ fest sitzenden Zwölffingerdarm (Duodenum) gibt es noch zwei weitere Dünndarmabschnitte (Leerdarm und Krummdarm), die freier beweglich sind.
Die Bausteine der Nahrung werden in diesem Schlauch mithilfe der Enzyme so zerkleinert, dass sie die Schleimhaut passieren und ins Blut gelangen (resorbiert werden) können. Dafür ist dieser gesamte Darmabschnitt mit unzähligen Zotten und Falten versehen, welche die Oberfläche der Dünndarmschleimhaut enorm vergrößern.