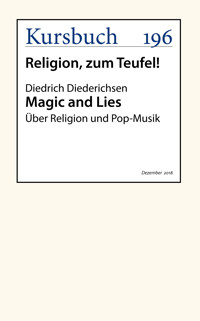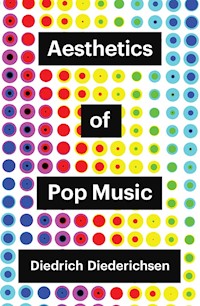39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kaum war das 21. Jahrhundert angebrochen, wartete es auch schon mit neuen Schrecken, Idiotien und gelegentlichen Glücksmomenten auf. Zu den wenigen, die es noch wagen, in diesem von den Medien verdickten und beschleunigten Wirrwarr Zusammenhänge herzustellen und dabei an einem anspruchsvollen Begriff von Kritik festzuhalten, gehört Diedrich Diederichsen. In dieser Wundertüte von einem Reader mit Aufsätzen und Kommentaren, wenn auch erst aus den ersten dreiundzwanzig Jahren des Jahrhunderts, zeigt er sein stupendes Wissen über sämtliche Trends in Kunst, Kino, Fernsehen, Literatur, Musik, Theater, Theorie und Politik, das bis in die feinsten Verästelungen der Gegenkultur reicht. Er ist in der Lage, aus Erkenntnistheorie ebenso Funken zu schlagen wie aus den »Simpsons«, den Inszenierungen von René Pollesch oder Serien wie »Underground Railroad«. Vor allem vermag er es wie kein anderer, das eine mit dem anderen zu verknüpfen und von Theodor W. Adorno zur Familie Duck oder von einer Hamburger Baustelle zu einer feministischen Kunstinstallation (und zurück) zu springen. Was Zeitgenossenschaft bedeuten kann, ist seit Walter Benjamin nicht mehr so eindrucksvoll unter Beweis gestellt worden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1818
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Diedrich Diederichsen
Das 21. Jahrhundert
Essays
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Diedrich Diederichsen
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Diedrich Diederichsen
Diedrich Diederichsen, geb. 1957 in Hamburg, ist Professor für Theorie, Praxis und Vermittlung von Gegenwartskunst an der Akademie der bildenden Künste in Wien. In den 80er Jahren war er Redakteur bei den Musikzeitschriften Sounds und SPEX, seit den 90ern arbeitet er als Hochschullehrer u. a. in Stuttgart, Frankfurt, Wien, Pasadena, St. Louis, Los Angeles. Bei KiWi erschienen seit 1985 neun Bücher (u. a. »Sexbeat«, »Politische Korrekturen«, »Über Popmusik«).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Kaum war das 21. Jahrhundert angebrochen, wartete es auch schon mit neuen Schrecken, Idiotien und gelegentlichen Glücksmomenten auf. Zu den wenigen, die es noch wagen, in diesem von den Medien verdickten und beschleunigten Wirrwarr Zusammenhänge herzustellen und dabei an einem anspruchsvollen Begriff von Kritik festzuhalten, gehört Diedrich Diederichsen.
In dieser Wundertüte von einem Reader mit Aufsätzen und Kommentaren, wenn auch erst aus den ersten dreiundzwanzig Jahren des Jahrhunderts, zeigt er sein stupendes Wissen über sämtliche Trends in Kunst, Kino, Fernsehen, Literatur, Musik, Theater, Theorie und Politik, das bis in die feinsten Verästelungen der Gegenkultur reicht. Er ist in der Lage, aus Erkenntnistheorie ebenso Funken zu schlagen wie aus den »Simpsons«, den Inszenierungen von René Pollesch oder Serien wie »Underground Railroad«. Vor allem vermag er es wie kein anderer, das eine mit dem anderen zu verknüpfen und von Theodor W. Adorno zur Familie Duck oder von einer Hamburger Baustelle zu einer feministischen Kunstinstallation (und zurück) zu springen. Was Zeitgenossenschaft bedeuten kann, ist seit Walter Benjamin nicht mehr so eindrucksvoll unter Beweis gestellt worden.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I. Volk auf der Bühne
Der Kaiser hat kein Tabu, das ihn bricht: Bataille, Camus, Caligula
Der Mainstream und seine Masken: Die Kultur der neuen Mitte
Definitionen
Intellektueller Mainstream
Die Umbau-Aufgabe
Restauration mit Strizz
Bürger als Rebell
Mainstream braucht Elite
Vorläufer: Popper
Michael Moore und der gesunde Menschenverstand
Avantgarde und Revolution
Ostdeutsche Nischen
Sinnlichkeit
Fakten, Fakten, Fakten
Zuständige Genies
Fußball ist unser Leben
Mainstream der Migranten
Vier Gentrifizierungsgewinnlerinnen
Lars von Triers doppelt verneinte Telenovela: The Boss of It All
Der Verbratene: Tina Feys 30 Rock
Regietheaterhass, Partiturunantastbarkeit und Bürgerlichkeitsdebatte
Autografie und Allografie
Rohstoff Wut
1. Wut
2. Die Wut der (Klein-)Bürger
3. Die Wut der Überforderten
4. Die Wut der Aufständischen
5. Die Wut der Theorie
6. Nach der Wut?
To Live Outside the Law You Must Be Honest: Menschen in 3D
There Is No Such Thing As Populärkultur, Except In Gegenwartstheater
Wenn die Oper vorbei ist, mach das Licht aus: John Cages Europeras
Das entgrenzte Können – fünf Akte
1. Können und Sein
2. Asger Jorn
3. Hank Beckmayer
4. Matrix des Könnens
5. Nicht-Können können
Umsonst und künstlich: Das Berliner Kulturprekariat im Kino
Welttheater for the People: Castorfs Faust
II. Spekulationen
Reality used to be a friend of mine
Ist der Marxismus ein Korrelationismus?
Posthumanismus: Die Liebe zum Anorganischen als Kritik des Lebendigkeitskonsums
Der Nullpunkt und der Ausstieg aus der linearen Zeit
Viereck: Konzeptkunst, Drones, Pop, Antirassismus
Komposition nach Performance
Wertlosigkeit – zwischen Armut und Utopie
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
Sound-Art und die Romantik des Posthumanen
Heilige Scheiße: Formlosigkeit und Unreinheit als Ursache von Verehrung
Krise, Form, Tendenz
Byron, die Birne – Tod, Technik und Transformation
III. Minima
Die Ordnung der Getränke
Being Homo Sapiens
Je kleiner der Mensch, desto größer die Welt
Evidenz-Choc: Das Bild vom toten Carlo Giuliani
Als wir tot waren …
Lügen wie gedruckt
Täglich Rilke
Öffentlichkeit und Erfahrung
Postskriptum zur Piratenpartei
Was die Gentlemen präferieren
Diskursethik und Respektlosigkeit
Tote schreiben besser
IV. Künstler_innen
Isa Genzken: Subjekte am Ende der Fahnenstange
Mary J. Blige: Dreifachkreisch
De Rijke/De Rooij: Unendliche Traurigkeit, endliche Bilder
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
Im Kino onanierend: Rückblick auf die Neuen Wilden
Eric Dolphy: Der Unvollendete
Albert Ayler: Der Heilige Geist
Unsere Musik: Jean-Luc Godard
Der Jahrhundertmann: Luis Buñuel
Melancholie-Facharbeiterin: Marianne Faithfull
Scott Walker: Der Stürzende
Michael Jackson: Lieber aufhören, bevor man genug davon hat
Etwas mehr als seiner Zeit voraus: Stephan T. Ohrt, Maler der 80er-Jahre
John Ford: Amerikanische Volkskunst
René Pollesch: Nachkörperliche Intensität
Captain Beefheart: Die Verschwörung von Lancaster
Claire Denis: Lieber die Gekaufte sein
Epic Theater: Christoph Schlingensief
James Blake: Nach dem Narzissmus
Matana Roberts: Familiengeschichte
Wiener Gruppen: Gegen die Wirklichkeit – der Sprung aus der Geschichte und seine Geschichte
Andy Warhols Filme, gesehen von Douglas Crimp: Zusammenkommen, um getrennt zu bleiben
James Benning: Romantik und Aufklärung
Feminismus, Antifaschismus, Psychedelia: Katharina Sieverding und ihr Stauffenberg Block
Der Chef konnte delegieren: Rainer Werner Fassbinder im Gropius-Bau
Mike Kelley: Das Opium beziehen wir von Brecht
Das letzte Album: David Bowie (1)
Trauer in Schöneberg: David Bowie (2)
Prince – Fünf Thesen
Individueller Orient: Michael Buthe
Lunge schlägt Strom: Yoko Ono
Sirius Is Serious: Sun Ra und Stockhausen
Treffende Verkennung
Komisch, weil plausibel?
Tony Conrad: Den Dingen auf den Grund gehen. Dann darüber lachen
Deutlich mehr als zwei Kontinente: Cecil Taylor
V. Kunst Ideologie Politik
Kunst? Besser als Utopien!
Die License zur Nullposition: sogenannte Pop-Literatur
Warum Amoklaufen?
Die Kraft der Negation
Deconstructing Martin
Outlaws für Amerika: Die Politik New Hollywoods
Kreative Arbeit
Familienkritik als Künstlerkritik: Paul McCarthy und seine Hummel-Figuren
1. Vorspiel zu einem Nachmittag Laokoons
2. Nachbarn: Kleine Kinder und das Erhabene
3. Jenseits des Erhabenen: einmal
4. Jenseits des Erhabenen: zweimal
5. Machtlosigkeit als Vorlust der patriarchalen Gewalt
Exkurs: Patriarchen, Genies, Familien
6. Kunst des Risikos. Die alpine Performance
7. Gesellschaft in Isolation. Familie. Narrenschiff
Street Art als Schwellenphänomen
1. Um 1980: Eintritt in die Ontologie der Kunst. Um 2010: Keine äußere Ähnlichkeit mit Kunst
2. Das Zeitalter der politischen Auto-Ethnografie der African American Community: Eine Neubestimmung von Kunst und Kommunikation zu Beginn der 70er-Jahre
3.1978: Der Deutsche Herbst – Helke Sander – Die visuell behinderte Gegenöffentlichkeit – Erstes Auftreten des Fotografen/Street-Artist-Couple
4. Samo© und Henry Flynt
5. Street Art und (Foto-)Kunst: Drei Beispiele einer produktiven Fernbeziehung – Wool, Hujar, Leonard
6. Kein Writing on the Wall: Street Art als lebendige Bildunterschrift für urbane Sensationen – Kulturpessimismus?! – Richard Serra
Postideologie: Querfronten
Zehn Thesen zu Subversion und Normativität
1. Subversion ist nicht notwendig etwas Gutes
2. Normativität ist nicht notwendig etwas Schlechtes
3. Subversion stellt nicht unbedingt einen Gegensatz zum Kapitalismus dar
4. Normativität ist ohne Aktualität, Subversion ist ohne Perspektive
5. Pop-Musik ist subversiv
6. Politik ist normativ
7. Subversion und Normativität kommen unter einer Bedingung zusammen: Geschichte
8. Subversion und Normativität haben einen fatalen Treffpunkt: in der Anrufung
9. Subversion gelingt (nur) in der Kleinteiligkeit, in der wir gegenwärtig zu leben gezwungen sind
10. Subversion braucht Institutionen
Das Eingemachte
1. Linkspopulismus und fromme Intersektionalität
2. Antiautoritäre Autoritäre/Haterism
3. Stand der Dinge
Vokabular bereitstellen: Saidiya Hartman
VI. Mann ohne Eigenschaften
Pose versus Exzess. Queere Performance in den US-Subkulturen der 60er
Schönheitschirurgie am gewachsenen Schnabel
Alles, nur nicht weiß: Barack Obama
Frau mit zwei Eigenschaften. Ein Film des über hundertjährigen Manoel de Oliveira
Brillenträger, der weinen kann: John Lennon als Nowhere Boy
Die ganze Männlichkeit – auf zwei Körper verteilt
Sich raushalten: Die Mentalität des Diagnostikers
Schamane oder Messias: Der Schallplattenverkäufer als höheres Wesen
Ohne Eigenschaft, ohne Titel
VII. Berlin, Berlin
Hip to be square: Du darfst auch Dünkel zu mir sagen
Armut, Unabhängigkeit, Hedonismus – Stagnation, Endlichkeit, Todesnähe
Homeland kommt nach Berlin
Eine Stadt versteht sich selbst – Die Ära Castorf
VIII. Demokratie
Moral, Ironie, Demokratie – Ironie I, II, III
Die Joschka-Fischer-Diskussion
Die Moleküle des iXlam
Klassenverräter einfangen
München 1972: Reformisten, Experten, Polizisten – ein Film von Sarah Morris
Ein Zucken in der Wange
Allein: Als Antikapitalist_in unter lauter Antikapitalist_innen
Von Tosca lernen
Unter der sengenden Sonne der digitalen Demokratie
Camp: Gesichterlektüren, Backstagewissen, Peinlichkeitsregime
Die Physiognomie der Abgekoppelten – gut 150 Jahre Gesichter der Bohème
Das Gemeinsame: Wie erledigt man einen erledigten Fall?
Das Volk der High School – Das Unbehagen in der Demokratie in einem populären Genre
IX. Die Deutschen und die Anderen
Der Reisebürosonderzug
Wie der Blues nach Deutschland kam
Weil Opi halt so rührend war
Der Chef brüllt schon wieder so
Deutschland. Das Normale wollen und das Monströse schaffen
Worum geht es bei der WM-Party?
Die Utopie der Kooperation
Rückblick auf 2009: Bornierte Eliten und antiautoritäre Kämpfer
Gedenken, Schande, Minimalismus
Krautrock
Die deutsche Hütte: Wir sind das Volk – ein Musical
Am Stammtisch der Sachlichkeit – Markiertes Sprechen in Deutschland
In der großen Pause
Die zwei Querfronten
Zwischen zwei Hinrichtungen: Die originale Intersektion
Das Patchwork ist kein Ponyhof
Zärtlichkeitsdividende und performative Wende
Markierung, Diskriminierung und struktureller Rassismus
Deutsche Übersetzungen
X. Darkness, Darkness
Jede_r kann der Zombie sein
Keine Stars mehr, nur noch Prominente
Allein im Norwegerpullover: Montag kommen die Fenster von Ulrich Köhler
Das begehbare Buch
Wer wohnt im Schwarzen Loch?
Israel, Libanon, 1982
Ohne Liebe: Durchdringung, Flucht, Erstarrung
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
Kontinuität des Hauptstadtkoksens
Verletzen, Wetten, Kontrollieren: Cady Noland, Bret Easton Ellis, Donald Trump
Massenmörder und Massenkulturen
Psychopathologie und Herrschaft
Das Spiel und die Identifikation
Material und Symbole
Modernes Verschwinden
XI. Ästhetische Theorie
Verfolge den Prozess! Die No-Neck Blues Band in autonomen Zentren
Dienst am Dirt: Iggy Pop
Bildung von Horden als gesellschaftliche Aufgabe von Musik
Kritik und Distinktion
Betroffene, Exemplifizierende und Human Interfaces – Rimini Protokoll zwischen Theater, Performance und Bildender Kunst
Erhabenheit und Monotonie: Bücher über Coltrane
Material – Reiz – Zeichen
Die genau gemessene Distanz zur Utopie: Jacques Demy
Lady Gaga: Lieber Dialektik als Spagat
Schrott zu Lametta: Oneohtrix Point Never
Kalte Sterne, faule Subjekte, wohlbegründete Negationen – Paul Bley, Annette Peacock und die Beckett-Linie bei ECM
Noch mehr Witze über das Private und die Autonomie: Louise Lawler
Kunst – Gebrauch – Nutzen
XII. Serien und Erzählungen
Long Strange Strip: Garry Trudeaus Doonesbury
Das Buch und die Fernsehserie
Constanze und Variable
Wann ist endlich Schluss?
Nicht atmen können: Devs / The Outsider
Gegen den Terror der Sonne: Underground Railroad
XIII. Drogen, Träume, Widerstände
Schleiern und Entschleiern
Polyphilo: Existenzielle Architektur und eine Kulturindustrie des Outdoor
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Beseelung, Entdinglichung und die neue Attraktivität des Unbelebten
1. Grinsen und Lächeln des Unbelebten
2. Verdinglichung und Entdinglichung
3. Ding und Kooperation: Psychedelia und Sexualität
Das Glück in der frühen Pop-Musik: 8 Meilen über der Schule schweben
1. Somebody to Love
2. Happy
3. So Beautiful: Schule schwänzen
4. Lazy: faul, schüchtern und überlegen mit den Kinks
5. High. 16 Meilen
6. Sünde
7. So glücklich
8. Theorie des Glücks: Felicity
Träumen als Produktion (von Passivität) oder: mediumspezifisch ohne Medium. Träume, Magie und Transformationsästhetik
1. The Dream as in »American« and as in »I Have a«
2. Dream Theory und Dreamtime
3. »Ein Träumer will immer noch mehr«
4. Wenn ich träume, träume ich von dir
5. Mir träumte
6. Eine Ästhetik des Traumes
7. Eine bürgerliche Wochenzeitschrift
8. In Dreams Begin Responsibilities
9. Keine Reproduktion, keine Aufbewahrung: Dream Music
10. Feminine Männer: Die neuen Mutanten
11. Forever, forever
12. Ein weiterer Sommer des Schamanismus versus Transformative Ästhetik
13. Die Medien-Spezifik des Außermedialen
XIV. Bioskop
Der Job eines guten Gesichts
Die glückliche Stunde
Die Sonne des Oktobers
Leben und sterben ohne Neustart-Option
Barry Lyndon: Bemerkungen zu einem Lieblingsfilm
Entstehung
Determinismus und Autorschaft
Kälte – Materialismus – Archäologie
Bilderbogen – Stummfilm
Wärme – Sentimentalität
Die Kamera zum Laufen bringen
Nebenzimmer, Nachbarhäuser
Perfekt programmierter, selbstreflexiver visueller Humor
Napalm Death
1978–1972–1969: Kontinuitäten
Uniformen der Empfindsamkeit
XV. Gender und Sex
Biopolitik mit Britney Spears
Konkret heißt auf Englisch Beton
Normalität von Millionen
Hinterbühnen des Penetrationstheaters
Was ist eine Orgie?
Die wichtigste Stimme des 21. Jahrhunderts
Warum eine Platte von ihm kaufen, wenn ich auch gleich mit ihm ins Bett gehen kann?
Das eigene Problem selbst lösen
Darauf einen Blubberlutsch!
Aus der Geschichte gefallen: Der Sexualsozialismus und seine Zeit
Der revolutionäre Traum von der Ehe gegen die kapitalistische Realität der Sexualität
Register
Vorwort
Die drohende Unbewohnbarkeit des Planeten, die drohende Verwaltung dieses unbewohnbaren Planeten durch eine global gewordene Bande neotraditionalistisch auftretender Faschist_innen oder auch nur die sogenannte Zeitenwende, in der Linke und emanzipativ Positionierte notgedrungen sich an die Seite von Wirtschaftsliberalen stellen und militärisches Denken und Bewaffnung befürworten (müssen), um wenigstens einen Teil des skizzierten Szenarios aufzuschieben, kommen in diesem Buch nicht vor; jedenfalls nicht ausdrücklich. Dafür wird der Weg dahin, über viele Stationen, die keineswegs nur solche des Niedergangs und der Regression sind, ausführlich beschrieben, dargelegt, verfolgt. Die Idee, schon gegen Ende des ersten Viertels eines Jahrhunderts dessen Geschichte vorzulegen, ist in ihrem Größenwahn von Carl Einstein inspiriert, der seine Kunst des 20. Jahrhunderts, den Band 16 zur Propyläen-Kunstgeschichte, schon 1926 veröffentlichte.
Eine Geschichtsschreibung, die so früh kommt, ist in all ihren Überlegungen darauf verwiesen, Material aus der bekannten Geschichte, also aus der Vergangenheit herbeizuschaffen, um vorstellbar zu machen, wie es weitergehen könnte: um einen Begriff von Abläufen, Unterbrechungen, Wiederholungen, von Beschleunigung und Verlangsamung zu gewinnen. Deswegen beginnt dieses 21. Jahrhundert bei mir 1968 in einer psychedelischen Hütte oder 1961 in einem New Yorker Loft oder sogar schon um 1900 in Wien. Prognostische Versuche werden dagegen kaum unternommen; es bleibt den Leser_innen überlassen zu erkennen, wie diese Texte zu Aufbrüchen, Nullpunkten, Neuanfängen sowie ihre Diagnosen von Verschärfung und Zuspitzung einem Möglichkeitssinn zuarbeiten, der politisches Handeln noch heute mit Hoffnungen und Perspektiven ausstattet, welche über das Verhindern des je noch Schlimmeren hinausgehen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur die oder eine Geschichte dieses Autors – das, was man einen »Roman« nennen könnte.
Eine der verschiedenen kulturell-politischen Dynamiken, die den Hintergrund dieser gesammelten Schriften ausmacht, ist der Druck des größeren Übels. Sie begann vor langer Zeit mit so etwas wie einer scharfen, aber nicht unsolidarischen Kritik an 1968. Die artikulierte sich Ende der 1970er-Jahre etwa in einem Song wie »California Über Alles« von den Dead Kennedys: der Vorwurf an die alte Gegenkultur, selbst ein ideologisches, esoterisch-neoliberales Regime mit Lächelpflicht errichtet zu haben oder errichten zu wollen, exemplifiziert an dem »grünen« kalifornischen Gouverneur jener Zeit (und dann auch wieder im 21. Jahrhundert), Jerry Brown. Kurz darauf kam Ronald Reagan an die Macht, und die Band musste den Song korrigieren – mit den Worten: »We’ve Got a Bigger Problem, Now!« Dies ist eine durchgängige Dynamik: Die fortgesetzte kontinuierliche Expansion eines deregulierten, jede Art von Sicherheit auflösenden Kapitalismus erpresst die Linke mit dem drohenden Faschismus, den die ständig zunehmende Verunsicherung der Leute – Bürger ehemaliger, teilweise sozialistisch oder sozialdemokratisch erkämpfter Wohlfahrts- und Versorgungsstaaten – immer wieder erzeugt. Wann immer Züge der kapitalistischen, neoliberalen Weltordnung massiv und erfolgreich kritisiert werden konnten (zum Beispiel 1999 in Genua und anderswo oder 2008 mit/durch Occupy und den darauf aufbauenden globalen Protesten) oder wenigstens als Gegenstand strategisch angemessen dargestellt wurden, spitzte sich eine para-faschistische Variante oder Komponente dieser Weltordnung (Islamismus, Erdoğanismus, Putinismus) zu, stand wieder einmal eine neue Kraft auf, sodass sich die Linke immer wieder gezwungen sah, mit Liberalen gemeinsame Sache zu machen: zur Verhinderung von Trump, Putin, Erdoğan, Orbán et cetera gäbe es keine Alternative. Es gibt sie tatsächlich nicht. Was aber tun mit der permanenten Erpressung?
Dieses Buch erzählt eine Geschichte, und die besteht selbst aus zu unterschiedlichen Zeiten entwickelten Vorstellungen von geschichtlichen Verläufen, in fast jedem Text ist das der Fall. Es erzählt also eine Geschichte der Entstehung unterschiedlicher Geschichten in einem Kopf, der ein schon bestehendes Bild von geschichtlichen Verläufen – in Kunst, Politik und anderen Systemen – mit immer wieder anderen Zwischenergebnissen abgleicht. Zugleich stellt das Buch die Frage nach dem Ausweg, nicht aus der Geschichte an sich, aber aus folgender fataler Logik: Die negativen Makro-Entwicklungen haben nichts an einer Reihe von Mikro-Fortschritten oder zumindest fortschrittlichen Perspektiven geändert. Diese Gleichzeitigkeit von Sensibilisierungen und Brutalisierungen könnte nun für das Fallenlassen von Kategorien wie »Fortschritt« und »Geschichte« sprechen, für einen Skeptizismus gegenüber jeder Form von perspektivischem und damit auch linkem Denken. Oder, genauso falsch, zu einer Geißelung jeder Art von in letzter Zeit entwickelter Empfindlichkeit und Empfindsamkeit, die nicht als Fortschritte, sondern als bloßes Gehabe von Kleinbürger_innen, Privilegierten, Kindern von Reichen, die nicht nur selbst reich sind, sondern nun auch noch moralisch überlegen sein wollen, hingestellt werden. So trompeten es zahllose Anti-Woke-Autor_innen gerade in eine deutschsprachige Öffentlichkeit, die sich auf allen Ebenen von Diskriminierungsbekämpfung und Aktivismus verabschieden will. Leider stoßen leninistische Traditionsmarxisten, darüber hinaus auch zu Welt und NZZ übergelaufene Alt-Antideutsche und andere verlorene Jungle World-Schäfchen gerne in dasselbe Horn, wenn sie gegen Judith Butler und Intersektionalität wettern oder transphobe Tiraden gegen Mittelklassekinder mit grünlackierten Fingernägeln absondern.
Natürlich, Identität ist ein Gewaltverhältnis. Ist man von diesem betroffen, benachteiligt, markiert, ausgeschlossen, ist es nicht nur legitim, sondern zuweilen auch geboten, sich auf dieses zu beziehen, »sich zu identifizieren«. Authentizitätsperformances beziehungsweise Authentizismus ist die Kulturalisierung dieser legitimen Operation; sie ist problematisch, wenn sie deren strategischen Charakter ignoriert und die Identität verabsolutiert. Individualismus ist die bürgerliche Version von Authentizismus, das Interface unmarkierter (weiß-männlicher) Identität. Mit ihr ist nicht viel anzufangen. Empathie, Empfindlichkeit, Fragilität und auch Radikalität sind sekundäre kleinbürgerliche Produktionen, mit denen unter (intersektionalen) Umständen eine Menge anzufangen ist, aber auch viel Kitsch und kleinbürgerliche Selbstverständigung geölt wird.
Im Sinne solcher grundsätzlichen Überlegungen, die im Hintergrund dieses Buches wirken, lohnt es sich, zweierlei festzuhalten: Dass zum einen Fortschritte auch ohne direkte Koppelung mit spezifischen materiellen Ursachen oder anderen Makroentwicklungen real sind. Es gibt eine relative Autonomie etwa der Kultur oder der Universität oder auch innerhalb des durch Kunst Denkbaren, die vielleicht nur eine Ungleichzeitigkeit sein mag, ein Vorpreschen oder ein Verzögern. Und zum anderen: Fortschritte sind immer Koproduktionen, Intersektionalismen – zustande gekommen durch echte oder imaginäre und höchst unvollkommene und oft asymmetrische Begegnungen von tatsächlich Privilegierten mit Personen, die gegen reale Benachteiligungen kämpfen. Das ist kein neues Phänomen – und es geht auch nicht um Credits für privilegierte Kinder, sondern es geht gegen das perfide Prinzip der Sahra-Wagenknecht-Linie, etwa den Schutz von Geflüchteten mit dem Argument zu bekämpfen, Antirassismus sei ein Hobby großstädtischer Eliten. Die Fortschritte sind so real wie die Menschen, die sie tragen. Das materielle Verhältnis, das deren Dynamik ermöglicht hat, mag im Absterben oder, im Gegenteil, noch gar nicht abgeschlossen und im Stadium der Tendenz sein; Wirkungen dauern länger, beginnen früher, als ihre Ursachen gesichert und sichtbar existieren.
Trotzdem bleibt aus einer weiteren Perspektive richtig, was Sylvia Wynter sagt, dass das westliche Konzept der Emanzipation (obwohl in seinem Einzugsgebiet zu begrüßen) oft verbunden ist/war, wenn nicht gar begrifflich gekoppelt ist mit (kolonialer) Unterwerfung, mit Extraktion und Ausbeutung. Eine aktuelle Verbindung ist eben auch die zwischen Bewusstseinserfolgen bei westlichen, privilegierten Jugendlichen und der gleichzeitigen parafaschistischen Kapitulation großer Teile der Bevölkerung desselben Westens vor einer in jeder Hinsicht unsicheren Zukunft. Wie eng diese Verbindung ist und wie viel Kausalität es in diesem Komplex gibt, bleibt ein Gegenstand von Spekulation. Die Gesamtschau, ohnehin nicht wirklich möglich, ignoriert nicht nur fortgeschrittene Zustände, Erreichtes als historische Objekte eigenen Wertes, den politischen Gebrauchswert der erwähnten (kleinbürgerlichen) Produktionen wie »Sensibilität«, »Empathie«, »Radikalität«; darüber hinaus zeigt sich gerade in den vorliegenden Texten, dass ein Wissen überwintern und dann wieder mobilisiert werden kann – dass man Fortschritt oder Entwicklung nicht einsinnig und linear denken muss. Ein queeres Minimalismus-Wissen prägt kulturelle Umgangsformen und ökologisches Denken unerwartet 50 Jahre nach seiner Entstehung zu Zeiten von Kuba-Krise und Kennedy-Ermordung. Der revolutionär-verzweifelte Sarkasmus eines Julius Eastman erreicht uns erst Jahrzehnte später.
Der Weg zu einer Entkoppelung von Emanzipation und Unterwerfung führt natürlich über das Aufgeben der Unterscheidung zwischen Berechtigten, Zuständigen und anderweitig klassifizierten Menschengruppen und geht in der praktischen aktivistischen Politik notgedrungen oft genug den Weg auch des Klandestinen, der Abschottung, um zu schützen und zu erhalten, was ein solches Erreichtes wäre. Abhilfe bei diesem Dilemma könnte das Studium der Neuanfänge oder der Wiederaufnahmen bieten; es ist ein durchgehendes Thema in diesem Buch, das an sehr unterschiedlichen Gegenständen ausprobiert wird: Drogen als verdrängte Rückseite der Politisierung, das Träumen und seine (technischen) Medien, radikale Vereinfachungen, extreme Komplexität, Nichts. Alles.
Das, was heute neu zu sein scheint – dass die Rechte nicht mehr konservativ und traditionalistisch, sondern revolutionär und neo-traditionalistisch auftritt –, ist nicht neu: Es ist exakt die Wiederkehr der Genese von Faschismus. Die Frage, die nicht nur mich in den Texten dieses Buches immer wieder beschäftigt: Woraus besteht das wirklich Neue? Ist »die Revolution« ein absoluter Neuanfang, wie es die zu einer bestimmten Phase von mir stark kritisierte Alain-Badiou-Schule sieht, oder besteht das Neue nicht vielmehr aus dem neu angeeigneten Alten, das sich nur verwandeln und transformieren muss? Wynter zitiert den Biologen und Philosophen Humberto Maturana, der sich an ’68 in Chile erinnert: Der politische Neuanfang hatte anfangs keine Sprache. Soziale Veränderungen sind neu in dem Maße, in dem sie von der bekannten Sprache noch nicht erfasst werden können. Erst wenn wir neue Worte, Wörter oder andere Zeichen – oder etwas anderes als Zeichen – gefunden haben, können sie beginnen. Diese Dimension der Erneuerung vergessen zu haben oder nur als Befreiungskitsch zu kennen, war sicher eine Schwäche der Linken. Autor_innen wie Wynter, die dem westlichen Epistem, dem Begriff des Menschen mit einem neuen, von Frantz Fanon und Michel Foucault inspirierten Gegenhumanismus begegnen wollen, bieten vielleicht eine Denkmöglichkeit, der Logik von Erpressung einerseits und halbierter Emanzipation andererseits zu entkommen. Es gibt eine Reihe von Texten hier, die Ähnliches, wenn auch weniger systematisch, ausprobieren.
Ein anderer, von mir indes häufiger beschrittener Weg würde hingegen zurückführen zu einem Geschichtsdenken, das eher altdialektisch die bestimmte Negation als einen Motor ansieht, der eben ohne permanenten Bezug auf das Ganze auskommt und trotzdem nicht in Relativismus und Identitätsfixierung versinken muss: Der Versuch, Geschichte als Geschichte von bestimmten Negationen zu erzählen, wird ebenfalls in zahlreichen Texten unternommen. Wenn etwa People of Color darauf bestehen, über ein bestimmtes Anliegen unter sich diskutieren zu wollen (etwa eine Ausstellung in Dortmund), ist das kein ideologischer Authentizismus, keine antiuniversalistische Segregation – im Sinne von: nur Betroffene verstehen das Problem – oder gar eine Retourkutsche gegen die Verursacher von Diskriminierungserfahrungen, sondern vielmehr eine Absage (konkrete Negation) an die Allzuständigkeit des scheinneutralen, unmarkierten weißen Mannes, der seine Perspektiven und Interessen hinter einer Normalität versteckt, die sich auch noch als Universalismus selbst verklärt. Wenn die weiß-westlich und so falsch realisierte historische Idee von Universalismus zur konkreten Negation von dessen Ritualen und Vorschriften durch Nichtweiße führt, wird die Idee eines Universalismus ernster genommen als irgendwo anders. Nicht seine Idee wird abgelehnt, sondern seine Realisierung, die an der oder an einer universalen Idee gemessen wird: Er wird geprüft und in seiner real existierenden Form verworfen, eben weil er keine universalistische Realität stiftet, noch auf einer universalistischen Tradition aufruht – sondern auf ausschließenden, unterwerfenden, rassistischen und kolonialistischen Vorstufen. Dies anzuerkennen, wäre die Voraussetzung dafür, tatsächlich Universalismus zu entwickeln. Nicht ernst genommen wird der Begriff des Universalismus hingegen im ökonomischen Liberalismus, der den Markt für universalistisch erklärt, im Ethnopluralismus, der die Menschen für essenziell verschieden hält, statt die gemachte Ungleichheit zu beklagen, und leider auch nicht von einem abstrakten Materialismus, der spezifische und konkrete Erfahrungen mit Benachteiligungen unterbewertet.
Dass Erfahrungen nicht mehr gemacht werden können in der Gesellschaft des Spektakels, ist einer der Ausgangspunkte vieler in diesem Buch beobachteten Entwicklungen und vor allem Gegenprogramme. Sowohl künstlerische wie politische Organisationsformen, Lebensstile, Moden, NGOs, Bands, Kommunen, Seminare, Kulte bemühen sich – oft auf klandestinen, also sich abschottenden Wegen –, die Erfahrung zurückzugewinnen, die in Krieg und Konsum verloren geht. In der digitalen Kultur ist der große Screen mit Bildern, den die Warenform vor der Wirklichkeit aufspannt, oft auch einer, der Bilder von einem selbst zeigt und so einen Narzissmus befördert, der sich noch leichter mit Selbstbestimmung, Souveränität und anderen Lieblingszuständen des Subjekts verwechseln lässt als die konsumistische Sedierung von früher. Auch andere digitale Sozialformate haben gegenkulturelle beerbt und ihren Sinn nicht selten ins Gegenteil gedreht, obwohl die vielbeklagte Blase als Generalschlüssel zu einer Theorie digitaler Öffentlichkeit die Effekte simplifiziert, die dabei entstanden sind, dass jede_r Benutzer_in heute sich in seiner/ihrer Chatgruppe wie in einer Grenzen überschreitenden Kommune fühlt – wahrscheinlich auch rassistische hessische Polizisten.
Diese an dieser Stelle nur andeutungsweise entwickelten Ideen bleiben aber, wie so manches in diesem Buch in sich widersprüchlich. Absolute Neuanfänge und konkrete Negation, Kairós und Ereignis bei Althusser/Badiou und Geschichtsdialektik bei Marx/Hegel, können nur mühsam koexistieren. Der Autor hat in diesen knapp 25 Jahren Phasen durchgemacht und ist nicht immer konsistent geblieben. Dieses Buch versucht, das nicht zu kaschieren. In seiner Nebenrolle als autofiktionales Konvolut gehört dies zu den Storys, die es erzählt: Seine Protagonist_innen sind Ideen unterschiedlicher Stärke und Haltbarkeit.
Diese Erinnerung versteht sich als Geflecht von Erzählungen, die oft genug davon handeln, wie andere erzählen, wie konventionell und hegemonial erzählt wird und dass sich das Erzählen ändern muss. Die Erzählung (etwa im Fernsehkrimi) rund um das Konzept des individuellen Täters und des Tatorts, der Ermittlung und der (psychologischen) Rekonstruktion haben sich gerade in den ehemaligen Nazi-Ländern als stabilisierende Struktur etabliert. Es geht dabei darum, ein großes Unverständnis von der Einrichtung der Welt und die eigene Verstrickung in sie mittels einer imaginären Institution (erst der Kommissar, später die ihrerseits selbst verstrickten Ermittler_innen und die individuelle Verantwortung) zu sedieren. Teil eines verstrickten und schuldigen Kollektivs zu sein, wird so immer noch verdrängt oder auf (deviante) individuelle Verantwortung projiziert – oft genug auch im Umgang mit ökologischer Verantwortung: So sehr die notwendige Mobilisierung über den Entschluss, das individuelle Leben zu ändern, ein Medium finden kann, so unangebracht ist die am Ende depolitisierende Umlenkung von Verantwortung von Unternehmen und Staaten auf Einzelne. Die Forderung nach dem Ende der Dauerausstrahlung des ewigen Krimis, der Beginn einer anderen Fiktion, mit anders verteilten Subjektivitäten wird in unterschiedlicher Form hier erhoben.
Die Regeln beim Zusammenstellen der Texte kann man zusammenfassen. Das Buch sollte komponiert werden aus 1. Texten, die nach dem letzten, einen Zeitraum charakterisierenden Buch (Der lange Weg nach Mitte, 1999) erschienen sind. 2. aus Texten, die nicht schon in einem anderen Buch des Autors vorgekommen sind oder als Vorarbeiten zu diesen gelten können. 3. Alle Texte bleiben auf dem Wissens- und Überzeugungsstand ihres Veröffentlichungszeitpunktes, spätere Entwicklungen sowohl der dargestellten Dinge wie des sie darstellenden Autors können nicht berücksichtigt werden – in ganz wenigen Fällen informieren Ergänzungen in Klammern und Endnoten. 4. Die Texte werden nicht redigiert, wohl aber gekürzt und orthografisch auf den heutigen Stand gebracht. 5. In den 15, das Material thematisch strukturierenden Kapiteln sind die Texte chronologisch sortiert, vom ältesten zum neusten. 6. Das Buch durfte circa 1.100 Seiten lang werden, das entspricht etwa 2,4 Millionen Zeichen. Das Material der Vorauswahl liegt aber zwischen acht und neun Millionen Zeichen. Unbedingte Redundanzvermeidung erwies sich aber als eine zu bürokratische Maxime beim Kürzen. Bestimmte Verteilerknoten – seien es historische Konstellationen wie das Apartment in der New Yorker Ludlow Street, in dem Jack Smith, Tony Conrad und John Cale zusammenlebten, seien es bestimmte Ideen zur Ökonomie der Zeit in Roman und Fernsehserie oder zur falschen Teilung der Gegenkultur in eine psychedelische und eine politische Hälfte – müssen wiederholt sichtbar werden, da von ihnen immer wieder andere Wege aus gegangen werden: queere Kulturpolitik, Street Art, Minimal Music, Antirassismus haben da verschiedene gemeinsame Urknallsituationen. An sie zu erinnern, ihre Verfügbarkeit und Aktualität zu proklamieren, ist eines der Anliegen dieser Sammlung. Auf der anderen Seite erwiesen sich viele Texte zu vor allem Bildender Kunst, aber auch zu (Pop-)Musik, Kino und die Berichterstattung von Festivals (Berlinale, Ruhr-Triennale, Venedig-Biennale) als zu speziell für den übergreifend gedachten Charakter dieses Buches. Ich will gerne kleinere und fachspezifische Sammlungen zum selben Zeitraum nachreichen.
Dass diese Texte alle von einer Person verursacht sind, von einem Schreib-Täter, glaubt eh kein Mensch. Bei diesem Seitenumfang ist die Zahl der Personen, die einen Dank verdient haben, noch höher als bei dem letzten umfangreichen Buch, dessen Danksagung mir den Spott eingetragen hat, den Rekord der längsten Liste dieser Art aufstellen zu wollen. Daher nenne ich diesmal nicht alle bei 173 Essays zu erwähnenden circa 500 Personen, entschuldige mich dafür, dass ich nur aus dieser Ferne summarisch für den Auftrag, die Ideen und Inspirationen danke, und nenne stattdessen die überschaubarere Anzahl von Freund_innen, Redakteur_innen, Kurator_innen, Veranstalter_innen, die immer wieder hier vorliegende Texte redigiert, korrigiert und überhaupt in Gang gebracht haben: Franz Wille, Katja Nicodemus, Markus Müller, Christoph Gurk, Cristina Nord, Alex Scrimgeour, Tom Holert, Antje Ehmann und Harun Farocki, Marc Siegel, Thomas Heckel, Nico Siepen, Christian Höller, Helmut Draxler, Georg Diez, Simon Rothöhler, Ekkehard Knörer, Anke Dyes, Katharina Hausladen, Jens Kastner, Julian Weber, Anselm Franke, Annett Busch und Juliane Rebentisch. Ohne Heiko Wichmanns genial gepflegte Web-Site hätte ich den Überblick über Veröffentlichungen und Vorträge längst verloren. Ohne Helge Malchow wäre nie dieses Konzept einer Sammlung entstanden und ohne Stefan Ripplinger und sein ultragenaues und kenntnisreiches Lektorat wäre es nie realisiert worden. Dafür, mir wiederholt den Rücken und andere Körperteile freigehalten zu haben, danke ich Angela Vogel und Manfred Winkler. Ganz besonders danke ich Raphaela Vogel sowie unserem Sohn Bo Diederichsen, der vielleicht dereinst das 21. Jahrhundert mit einer größeren Erfahrungsbasis einschätzen können wird.
Berlin, Oktober 2023
I.Volk auf der Bühne
In welchem das Volk, die Leute, beobachtet werden, als stünden sie auf der Bühne, auch weil sie wirklich auf der Bühne stehen. Das betrifft die Diskussionen um die Berliner Volksbühne, den eine Weile tobenden Kulturkampf gegen das Regietheater, maximalistisch-radikale Überbietungen, konservative Stillstellungen der Oper, das Begehren, das die Bildende Kunst nach ihr hat, Frage nach der Darstellbarkeit des Menschen in Skulptur und Theater, aber auch eine politische Kultur, die sich immer wieder gerne selbst aufführt: von wütenden Bürger_innen bis zu deren Kanzler_innen. Doch der Umbau der kulturtragenden Schichten der alten BRD einschließlich ihrer kritischen und Subkulturen in eine neo-preußische Neue Mitte mit onkelhaften Dandys und viel Selbstrepräsentation konnte schon deswegen nicht gelingen, weil die Mittelklasse in dieser Zeit ökonomisch den Bach runterging und sich währenddessen kulturell verbiesterte.
Der Kaiser hat kein Tabu, das ihn bricht: Bataille, Camus, Caligula
Drei Akte, zwei sind jeweils einer menschlichen Ausscheidung gewidmet, der dritte allem anderen; rund um ein langes Solo von Bernhard Schütz herum. Der erste Akt baut im Wesentlichen auf dem Text von Camus’ Caligula auf, mit einer Abschweifung zum mexikanischen Menschenopfer, natürlich von Georges Bataille, der es ja selbst mal versuchen wollte. Seine Freundin Laure war auch gleich dazu bereit, aber Alexandre Kojève soll abgeraten haben, ein Menschenopfer sei jetzt doch ein Missverständnis von Hegel. Der zweite Akt baut im Wesentlichen auf einem Kapitel von Batailles Erotikon Das obszöne Werk auf, der berühmten »Geschichte des Auges«, dem womöglich letzten literarischen Versuch von Rang, der Idee der sexuellen Ausschweifung einen streng heterosexuellen Sinn zu geben. Der dritte Akt erzählt schließlich, was man sonst noch so über Unmögliche und Antivernünftige erzählen könnte und wie es in der Kantine der Volksbühne zugeht oder zugehen könnte. Am Schluss erscheint eine Sex-Arbeiterin (Stripperin) und repräsentiert das wirkliche Leben.
Der erste Einfall ist gleich sehr gut. Der Camus-Text trägt einige Minuten Wort für Wort eine zweite Bedeutung. Dass man nichts Neues erfährt, nichts zu erfahren wäre – über Caligulas Aufenthaltsort nämlich –, erfüllt bei Camus die römischen Patrizier mit Sorge. »Immer noch nichts.« – »Morgens nichts, abends nichts.« – »Seit drei Tagen nichts.« Hier ist aber auch das Problem gemeint, dass nichts kommt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Caligulas Geliebte Caesonia (Astrid Meyerfeldt) sitzt nämlich seit drei Monaten auf dem Klo und es kommt einfach nichts. Die anderen Patrizier, das bleibt der running gag, können alle auch nicht scheißen, sie können nichts machen. Und kacken ist gleich produzieren, wie einem natürlich gut freudianisch nahegelegt wird. Vor allem können sie nichts gegen den Tyrannen machen, der im Gegensatz zu ihnen sich kopfüber in die Scheiße stürzt und damit nicht nur seine Produktivität, sondern auch seine Souveränität beweist.
Die Volksbühne hat sich vorgenommen, ohne Glauben zu leben (Spielzeitmotto). Wahrlich ein Unterfangen von Dostojewski’scher Unerschrockenheit. Nicht ganz neu vielleicht, aber egal. Jedenfalls peitscht der Chef sein multitalentiertes Ensemble nun schon eine Weile durch die großen Diskussionsgegenstände der 50er-Jahre: den Existenzialismus, die Geworfenheit, die Wahl, den Menschen, den Sartre und nun den Camus. Waren aber bisher die Versuche, diese Themen ausgerechnet als relevant für die Verhältnisse in Zeiten gottloser Globalisierung auszugeben, etwas gewaltsam ausgefallen, ist es diesmal schöner und komplizierter. Diese Aufführung legt nämlich nahe, nunmehr auch den Glauben an die Brisanz und die Schröcklichkeit eines Lebens ohne Glauben aufzugeben. Das Nichts – das kann auch die Abwesenheit von Scheiße meinen.
Auch wenn sich das Stück zunächst dem bewährten Castorf’schen Twostep fügt (Dialogfetzen – Gehampel – Dialogfetzen – Bodenturnen – Dialogfetzen – Gesang – Dialogfetzen – Mittelstreckenlauf – Dialogfetzen – Instrumentalmusik), so wird doch die Gegenwart, die man immer so prima in diesem Schema als Nummer unterbringen konnte, diesmal nicht in den Würgegriff genommen: Gegenwartsbezug ergibt sich ganz entspannt und fast von alleine. Der Camus wird durchgearbeitet. Seinem Tyrannen, dessen »Wahrheit darin besteht, die Götter zu leugnen«, so sein Autor, dessen »Irrtum darin, die Menschen zu leugnen«, wird zu Recht die Brisanz gestohlen – seine Gewalt ist eher die des Maulhelden, sein Terror der eines verzogenen Einzelkindes, das beim Sackhüpfen nicht verlieren kann, seine Befreiungen die der analen Phase –, und sie wird ihm damit auf unerwartete Weise zurückgegeben. Dieser Regressions-Cäsar ist ja viel eher eine vertraute Figur unserer Tage, als es so ein Tyrann des Existenzialismus wäre, der noch souverän zwischen zwei Möglichkeiten die falsche wählen kann. Folgerichtig wird gegen Ende der Camus-Phase eine der größten Autoritäten unserer Tage für zeitgenössischen Infantilismus zitiert, Astrid Meyerfeldt und Bernhard Schütz tragen die großen Pinocchio-Tomatenköpfe des kalifornischen Künstlers Paul McCarthy, dessen Diagnosen sich allerdings nicht auf den Anti-Teletubbies-Kulturpessimismus runterkürzen lassen, der zur Zeit Konjunktur hat.
Nach einer kleinen Laser-Show, die die für allerlei Mittelstreckenläufe weit in die Tiefe gezogene Bühne perspektivisch noch weiter zuspitzt, wird in den Bataille-Teil übergeleitet. Übrigens war der ganze Abend von gelungenen Überleitungen, netten Fade-ins und Fade-outs geprägt. Sir Henry, der nicht nur Mucius und dann den geilen Sir Edmund spielte, hat auch die Musik eingerichtet und manchen Glücksgriff getan, etwa die wunderschöne, antike, durch eine gigantische Fuzzbox verfremdete Orgel, die er aus »Facelift« von Soft Machines Third übernommen haben könnte und hier eine raue Zäsur in die ansonsten eher pointillistisch getupfte Bataille-Szenenfolge treibt.
Auch Batailles Geschichten von transgressiver, todesnaher Sexualität werden so vorgetragen und kommentiert, als wollte jemand fragen: »Und das findest du jetzt geil?« Das ganze Tischtuch voller Pipi. Wow! Statt Simone (Kathrin Angerer muss wieder jede Menge Wet-Dress-Contests gewinnen) beim Urinieren zu zeigen, kriegt ihr Freund (Matthias Matschke) einfach ein nasses Tischtuch zugeworfen. No big deal. Im Gegensatz zum Stuhlgang klappt das Wasserlassen ganz prima. Natur- und Kultursekt fließen daher noch reichlich. Aber die Enttäuschung darüber, dass auch Batailles Lieblingsthemen – vom Programmheft suggestiv auf den Titel geschrieben: »Verschwendung, Opfer, Erotik, Feier, Marter, Terror, Souveränität« – außer Souveränität keine nennenswerten Einwände von irgendeinem TV-Programmdirektor deiner Wahl zu befürchten hätten, legt sich in für Volksbühnen-Verhältnisse fast schon pastellenen Tönen über die berühmten, stets nur angedeuteten Szenen mit Priestern, Toreros, Augen, Stierhoden und anderen Eiern nach dem Motto der Performance-Künstlerin Johanna Went: »Don’t put anything in your mouth, that you wouldn’t put into your vagina.« Die verschwitzt-religiöse Heiligsprechung gerade durch seine deutschen Anhänger, die jede produktive Auseinandersetzung mit Bataille hierzulande so schwierig macht, wird ihrerseits als falscher Glaube kenntlich, auch wenn sich die nachvollziehbare Begeisterung der ganzen Inszenierung für richtig schlechte Karnevals-Witze à la »Sevilla / Se will ja« – die Scheiße muss halt raus – sich nie billig oder ironisch gegen den Text richtet. Eher verpufft seine heute nur noch als Prätention lesbare Grandiosität unter den durchaus ernst gemeinten Bemühungen, ihn erneut zu mobilisieren. Was bleibt, nachdem diese Luft raus ist, ist aber vielleicht wirklich diskutabel.
Natürlich ist die Kombination Camus-Bataille auch interessant, weil man hier wirklich in ein zeitgemäß ausgestattetes geistesgeschichtliches Museum geführt wird. Wenn man hört, wie emphatisch und verspannt der Mensch bei Camus beschworen wird, kann man noch mal so richtig gut verstehen, dass die nächste Generation diesen Gesellen gerne verschwinden ließ, »wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand«. Wenn man sich die ganze entfesselte Agitation gegen eine Herrschaft der Vernunft und Nützlichkeit bei Bataille noch mal ansieht, dann bemerkt man, wie politisch gegenstandslos diese Tiraden, die sich zu Blütezeiten sozialdemokratischer Regimes immer wieder gut gemacht haben, heute sind. Gänzlich unvernünftig bestimmt verschwenderisches Transgressionskapital die Weltläufte. Kein Spießer steht dem Ausschweifenden im Weg, stattdessen sieht sich doch eher der ganzkörpergepiercte Event-Manager – wenn auch nicht so total, wie das eine andere kulturdiagnostische Mode will – von dem Imperativ »Überschreite!« umstellt.
Und damit nicht genug. Auch dass man nicht einfach zu seinem Vergnügen transgrediert, ist konsensfähig. »Die Lust wäre verächtlich, wenn sie nicht jene furchtbare Überschreitung wäre, die nicht der sexuellen Ekstase vorbehalten ist.« Also aufpassen: keine Lust ohne furchtbare Überschreitung, sonst lieber auf Sex verzichten und sich die furchtbare Überschreitung beim Amok- oder Marathonlaufen abholen. Ich kenne keinen Außenminister, der dieses Bataille-Zitat nicht unterschreiben würde. Genau darüber amüsiert sich aber die Darstellung des Caligula, wenn der nach jedem Sackhüpfen seine mitgestoppte Zeit ansieht. Elitäre Ekstase und mönchische Disziplin gehen so Hand in Hand, wie sie hoch im Kurs sind.
Das Programmheft hat diese Dimension der Inszenierung nicht. Es legt eher eine vernunftkritikfromme Lektüre nahe. Hier verbeugt man sich nicht nur vor Bataille und seinem »Thanatographen« Bernd Mattheus, man stellt sogar Verbindungen zu zeitgenössischen Meisterspinnern wie Jean Baudrillard und Michel Houellebecq her. Man muss es wohl immer wieder sagen: Baudrillards Sätze stimmen einfach hinten und vorne nicht. »Die Wahrheit will sich nackt zeigen. Verzweifelt bemüht sie sich um Nacktheit wie Madonna in dem Film, der sie berühmt gemacht hat.« Welche Madonna? Etwa Ciccone? Die ist durch keinen Film berühmt geworden. Oder meint er Desperately Seeking Susan, da ist sie aber nicht nackt und die Hauptdarstellerin heißt Susan Sarandon. Ist auch egal, irgendsone Frau halt. Eine, die da nackt war. Cicciolina vielleicht? Wahrheit und Nacktheit machen sich jedenfalls immer gut zusammen: »Dieser Striptease ohne jede Hoffnung gleicht dem der Realität, die sich im wörtlichen Sinn ›aus-zieht‹ und den Augen der leichtgläubigen Voyeure den Schein ihrer Nacktheit darbietet.« Umgekehrter Kaiser sozusagen, Caligula in reverse. Und all das, damit Baudrillard sich schließlich darüber beklagen kann, dass das Bild das »Reale« nicht mehr »erträumen könne, denn es ist seine virtuelle Realität«. War das schon mal irgendwann nicht so? Aber auch der überschätzte Houellebecq, der irgendwie ganz frechdachsig schreiben kann, sagt in diesem Programmheft nur Sachen, die nicht stimmen: Raves sind ihm ein Beleg, dass der doofe dekadente Mitteleuropäer im Gegensatz zum »Primitiven« nicht richtig feiern kann, wo die Raves doch eher dafür stehen, dass deutlich mehr Mitteleuropäer deutlich mehr Zeit mit Feiern verbracht haben als je zuvor. Daran ändert nichts, dass Houellebecq die Musik zu laut ist. Der Link von seinem Text zu Bataille-Interpret Mattheus ist dann die Gewissheit, dass die anderen »Arschlöcher« (Houellebecq) beziehungsweise »assholes« (Mattheus) sind. Willkommen in der Pubertät.
Das lange Schütz-Solo kommt, macht alles kaputt und alles wieder heile. »Gleich ziehe ich mich aus«, eröffnet er eine Sequenz von Einlagen, bei denen nun abwechselnd der Schauspieler (»Ich komme ja auch vom Tanz«) und dann wieder der Kaiser und kurz auch der Stier und Don Aminado, die er im Bataille-Akt verkörperte, zu Worte kommen. Jetzt wird er »tuntig«, nun berlinert er, nackt ist er schon, jetzt Schwyzerdütsch – kurz: alles, was jemand zu vorgerückter Stunde vorführt, von dem seine Freunde meinen, er hätte schauspielerisches Talent. Diesen Satz hat man gerade zu Ende gedacht, da wird auch schon in die Selbstreflexion, in die Metaetage gejumpt: »Das ist Schauspielkunst!« Voilà. Der Kaiser will Castorf hinrichten lassen, Angerer muss schon wieder unter die Dusche. Der Stoff entgleitet dem vielfach nass gewordenen Ensemble fulminant auf dem rutschigen Bühnenboden. Man muss auch loslassen können. Brigitte Cuvelier hat wenigstens einen französischen Akzent, der noch ein bisschen die Geistesgeschichte unseres Nachbarlandes aufbewahrt. Und noch ein Kantinenwitz.
All das war aber durchaus lustiger und treffender, als es vielleicht klingt. Schütz ist ja irgendwie die ganze Zeit auch noch Kanzler Schröder aus der »Berliner Republik«, ein echter Avatar, der seine Verkörperungen wechseln und alte mit sich herumschleppen kann. Idioten-Transgression und Casino-Humor schaukeln sich konsequent hoch, ein bisschen Geschlechterkampf rutscht etwas ungeschickt dazwischen und kulminiert im Auftritt einer »echten« Stripperin. Derlei ausstellende Vorführung von Sex-Arbeiterinnen nervt natürlich immer ein bisschen, wenigstens diente es der Sache. Der Souverän schreit nach »nackten Weibern«, der, der das Schauspiel und die Republik kommandiert, hat kein Tabu zum Überschreiten mehr. Vielleicht sollte er sich endlich in einem Leben ohne Glauben einrichten, wo man aber auch aus dessen Anerkenntnis keine heroische Pose herausgemolken kriegt, sondern Ruhe geben und was »Vernünftiges«, was Post-Souveränes machen muss.
Die deutsche Bataille-Rezeption ist anders als etwa die US-amerikanische, wo »Abjection«, der »verfemte Teil« eher zu einem begrifflichen Baustein für Theorien sexueller Minderheiten und deren Politik wurde, hauptsächlich eine rechte gewesen. Der Matthes&Seitz-Verlag, der schon mal Texte von Günter Maschke, Hans-Dietrich Sander und anderen Rechtsradikalen druckt,[1] bringt sein Werk seit Jahren in wunderschön gemachten Ausgaben regelmäßig auf den Markt. Ihr Herausgeber, der notorische Antisemit Gerd Bergfleth, lässt es sich meistens nicht nehmen, diese mit voluminösen, weltanschaulich triefenden Nachwörtern zu versehen. In den frühen 90ern hatte es anlässlich eines bei M&S erschienenen Syberberg-Manifests mit antisemitischen Passagen eine öffentliche Auseinandersetzung gegeben, doch noch im Verlagsprospekt vom Frühjahr 1999 – wo Mattheus Sade noch haargenau so kommentiert wie in dem 15 Jahre alten Text, den das Volksbühnenprogramm nachdruckt, Bataille: »hedonisten kommen bei sade nicht auf ihre kosten. der todesekstatiker verachtet die leicht erreichbare befriedigung« – findet man unfassbare Sätze wie diesen, von einem Guido Ceronetti: »Der düstere Balkan (…) erleidet grausame Qualen, weil man ihn an der totalen Vernichtung hindert, die er sich so sehnlich wünscht, um ein für alle Mal seinen ererbten Hunger nach Grausamkeit zu stillen.«
Die Volksbühne hat in letzter Zeit ja öfter gezeigt, auch mit solchen Kontexten (Schlingensiefs »Kameradschaftsabend« mit Horst Mahler and the likes) keine Berührungsängste zu kennen, zuweilen sogar zu ihrem Vorteil, aber eher zu ihrem Nachteil. Natürlich kann es sich ein Theater wie die Volksbühne nicht leisten, die Drastik-Angebote seiner Zeit auszuschlagen, und sei es Gothic, Heavy Metal, Jonathan Meese. Noch besser aber ist, wenn es gelingt, diese Drastik und ihr latentes Begehren, von der Antivernunft in normative Vernunft umzuschlagen, mit ihren eigenen Mitteln zu karikieren. Dann entspräche der Fall jener Thüringer Metal-Fans der superlustigen norwegischen Band Burzum, mit allerdings verurteilten Mördern in ihren Reihen, die Songs mit Titeln wie »Rundgang um die transzendentale Säule der Singularität« schreiben, ihrerseits zu Mördern wurden, der Idee eines Bataille, tatsächlich zum mexikanischen Priester werden zu wollen. Kojève soll sich kaputtgelacht haben, als Bataille ihm von seiner Idee eines Menschenopfers erzählt hat. Schütz-Caligula schafft es, den opferwilligen Bataille und den lachenden Kojève in einer Person verschmelzen zu lassen. Die kugelförmigen Absoluta aus dem Hodensack der Metaphysik, um die es die ganze Zeit geht, Sonne, Mond, Auge, Ei, sind am Ende alle präsent, dazu kriecht ein Penis/Paprika/Zunge-Objekt aus dem Bühnenboden. Da sind sie, die unmöglichen Absoluta, ebenso lächerliche wie lustige und eindrucksvolle Requisiten.
Vielleicht ist das den ganzen Abend angedeutete Thema, dass die Einheit aus ernstzunehmend-wahnsinniger Witzfigur und deren Kritiker genau das Schicksal des Schauspielers oder des Theatermachers sei, etwas hybrid oder alt und langweilig. Kaiser gleich Castorf, das liegt zu nahe. Dann wiederum finde ich diese Verschmelzung zwischen Vertretung einer drastischen, wichtigen und bescheuerten Position und ihrer Kritik ein gutes Vorhaben, wenn denn die neuen Irrationalismen und ihre Kritik auf dem begrifflichen Niveau der Gegenwart miteingearbeitet sind. Wenn man sich also gegen diese Vernunftkritik eingedenk der historischen Phase wendet, in der sie womöglich – bis zu einem gewissen Grade – auch einmal im Recht war. Und wenn man die neuen Antirationalen sowohl vor ihrer spezifischen Erfahrung wie vor der geschichtlichen ihrer Vorläufer fasst (und da ist für die Gegenwart Metal oft ein besserer Gesprächspartner als die Houellebecqs dieser Welt).
Das obszöne Werk: Caligula (Bataille, Camus), Regie: Frank Castorf, Volksbühne Berlin, 5.1.2000, Theater heute, 2, 2000
Der Mainstream und seine Masken: Die Kultur der neuen Mitte
Man merkt, dass etwas unmittelbar davorsteht, Mainstream zu werden, wenn der Ton, in dem der entsprechende Gedanke vorgetragen wird, nicht mehr nach männlichem Protest, sondern genervt und von sich selbst gelangweilt klingt. Es dürfte ja nun langsam eh klar sein, dass … Wenn in einem Nebensatz eines FAZ-Artikels, in dem es eigentlich um etwas ganz anderes geht, zu lesen ist, dass natürlich jeder von uns (»wer nicht!«) den »Familienvater Zinédine Zidane« lieber zum Nachbarn hätte als den »von seiner Gattin geschaffenen Amüsierbuben Beckham«, wird sozusagen eine letzte Warnung abgegeben: Wer jetzt noch nicht begriffen hat, dass Herren ihre Gattinnen schaffen und nicht umgekehrt, und zwar, um Familien zu gründen, und nicht, um sich oder andere zu amüsieren, wird sehr lange nicht mehr an einem eigentlich doch längst akzeptierten Minimalkonsens teilhaben. So wird man informiert, dass es höchste Zeit ist, sich von seiner metrosexuellen Frisur zu trennen (»dich hat wohl deine Frau zum Friseur geschickt«). Oder wenn in einem Nachruf der Süddeutschen auf Werner Tübke, nicht einmal mehr kulturkämpferisch, sondern nebenher dekretiert wird, dass es gut sei, wenn ein Künstler auf den »festen Fundamenten von Handwerk und Tradition« arbeite: Solche Sätze probieren ihre Installation als Mainstream, als Konsens-Mitte, indem sie sich schon mal so aufführen, als wären die ihnen zugrunde liegenden konservativen Überzeugungen längst durchgesetzt.
Definitionen
Ursprünglich hieß Mainstream eine Subgattung des Jazz. In den Fünfzigerjahren, als sich die Stile des Jazz so differenzierten, dass man die Anhänger des New-Orleans-Revivals, des Hard Bop, des Cool, des Third Stream, des West Coast Jazz und des Rhythm & Blues nun wirklich unter keine Baskenmütze mehr bekam, erfand man den Mainstream als Negativ all dieser pointierten Strömungen und Stile. Alles, was jetzt noch irgendwie ganz allgemein Jazz war und vielleicht von jedem ein bisschen, das war Mainstream. Wir sehen: ein Epiphänomen der Differenzierung. In die deutsche Alltagssprache brachten ihn dann wieder die Jugend- und Subkulturen. Die hatten von jeher das stärkste Bedürfnis, durch kulturelle Unterschiede gesellschaftliche zu behaupten – im Gegensatz zum erwachsenen Bürgertum entsprachen ihren feinen Unterschieden ja kaum real wirkmächtige Grenzen. Wann immer eine neue Entwicklung, künstlerischer oder sozial-kommunitärer Art, vom Mainstream adaptiert und auf seinen Märkten verramscht wurde, sprach man nun von einer Mainstream-Version derselben Sache, für die man eine Underground-Version als sauber erhalten wollte: Seitdem gibt es Punk und Mainstream-Punk, Techno und Mainstream-Techno, Alternativ-Kultur und Mainstream-Alternativ-Kultur et cetera.
Mainstream ist eine hässliche Vorstellung. Beleidigend für einzigartige Individuen, für verfügende Subjekte, für auratische Kunstwerke. Ein Strom, der langsam, aber sicher alles mit sich reißt, unausweichlich und schlammig wie Kapitalismus oder Klimakatastrophe. Seine generelle Struktur – die Inszenierung von Konsens, die Stillstellung von Unruhen und eitlen wie berechtigten Abgrenzungsbestrebungen sowie von Kritik in nicht diskutierbarem Geschmack – verhindert die Auseinandersetzung mit seinen konkreten, wechselnden Inhalten. Man kann Mainstream auch so definieren: Ein kultureller Konsens, der aus verschiedenen Gründen nicht zugeben und diskutieren will, auf welchen ethischen und ästhetischen Maximen seine Vorlieben und Wertschätzungen gegründet sind.
Zugleich gibt es aber auch den Mainstream als Ziel. Fernsehanstalten, Schallplattenfirmen, Kunstmessenbetreiber, ja selbst Stadttheater agieren heute in dem Bewusstsein und unter dem Druck, immer größere gesellschaftliche Konsense und Geschmackseinigkeiten bedienen zu müssen. Auch die Führer der strukturell immer schwächer werdenden und unter Globalisierung (Entmachtung von oben) und Individualisierung (Entmachtung von unten) ächzenden Volksparteien entwerfen gesellschaftliche Projekte, die den Mainstream suchen, den die anderen fliehen. DennMainstream kann auch so beschrieben werden: als Erfolg. Mit diesem Erfolg ist aber – und davor haben all die, die ums Verrecken nicht Mainstream sein wollen, vielleicht noch mehr Angst als vor der Nivellierung ihres Individualitäts- und Exklusivitätsvorsprungs – eine gewisse Formlosigkeit verbunden, der Verlust der Erkennbarkeit. Da greift ein grausamer Mechanismus.
Intellektueller Mainstream
Mainstream ist nämlich nicht nur eine Sache der Doofen und diskursiv Minderbemittelten. Die leben zwar den Mainstream, seine künstlerischen und seine Sinnangebote. Aber auf den Mainstream und seine Funktion, das Selbstverständliche und damit das Langweilige zu sichern und zu verwalten, bauen gerade die avancierten Intellektuellen. Er sorgt dafür, dass das längst Geklärte, was immer das jeweils sein mag, in verlässlichen Händen ist. Gerade die, die sich vehement vom Mainstream abgrenzen, aus inhaltlichen oder ästhetischen Gründen, sind doch umso dringender auf ihn angewiesen. Ist dieser nämlich nicht auf einem einigermaßen stabilen Niveau der Bildung und Einsicht installiert, muss der avancierte, elitäre oder hippe Intellektuelle immer wieder bei Adam und Eva anfangen. Wer hofft nicht, dass Grundsätzliches zu Feminismus und Antirassismus gesellschaftlich gegessen ist. Mögen die, die sich darum kümmern, auch langweilige Gutmenschen sein. Jedoch: Immer wieder überraschen einen gut gekleidete, geschmackvolle und kulturell informierte, junge Studierende kreativer Disziplinen mit Reden vom »natürlichen Kinderwunsch der Frau«, von »parasitären Arbeitslosen« und dem »angeborenen Rhythmusgefühl der Schwarzen«. Auch diese Ideen werden auf Nachfrage mit dem ungeduldigen Gestus des Das-weiß-doch-jeder-Konsens vorgetragen, der Zeichen dafür ist, dass etwas nicht nur Einlass in den Mainstream begehrt, sondern unmittelbar davorsteht, ihn zu erhalten. Mainstream bleibt eine gesellschaftlich konstante Struktur. Aber sie erhält gerade jetzt einen neuen Inhalt. Das macht ihn auch für Außenstehende interessant.
Die Umbau-Aufgabe
Einigkeit scheint darüber zu herrschen, dass die Gesellschaft umgebaut werden soll. Scheinbar jenseits der alten binären Konstruktionen wie Bürgertum und Arbeiterklasse, Linke und Rechte, Elite und Masse werden seit den frühen Neunzigern, als der Triumph des Kapitalismus und des Westens als neue Realität langsam anerkannt war, neue Modelle gesucht, denen die Suchenden gerne schöne Namen aus der religiösen Mystik geben, zum Beispiel »Visionen«. Modelle, die allerdings nie so genau wissen wollen, ob sie von denen sprechen, die den Umbau vornehmen oder denen, die das Resultat des Umbaus sein sollen. Ob zum Beispiel die »Neue Mitte« oder die viel beschworenen »Eliten« den Umbau herbeiführen sollen oder ob das Ergebnis dieses Umbaus eine Gesellschaft sein soll, die wieder von Eliten geführt werden oder auf eine andere Weise eine Mitte finden soll, wird selten expliziert. Meistens wird das Mittel zur Begründung des Zweckes. Was aber nur notdürftig darüber hinwegtäuschen kann, dass die rein wirtschaftlichen Gründe alleine auch den schärfsten Verfechtern ihrer Unausweichlichkeit nicht als Legitimation für ihre Umbau- und (Sozial-)Abbau-Wünsche ausreichen. Auch prosaische Pragmatiker und gewissenlose Globalisierungsgewinnler wollen, dass sie etwas Sinnvolles tun oder man es wenigstens dafür hält. Der Umbau sucht händeringend nach einem Überbau. Zu Recht: Denn es gibt absolut keinen Grund, selbst dann, wenn ich die von Wirtschaft und Konservativen geforderten Sozialabbaue für unausweichlich halten würde, stolz auf meine Zwangsverpflichtung zum Pizzabotenjob in einer süddeutschen Mittelstadt zu sein. Deswegen suchen auch Konservative im Kulturbereich öfters mal den Kontakt mit der Restlinken, weil ihnen mulmig dämmert, dass mit der reinen Marktorientierung niemand zu mobilisieren ist.
Restauration mit Strizz
Eine klassische Lösung ist die in der Tat meistpropagierte. Der Umbau muss ein Rückbau sein. Die Rekonstruktion des Status quo ante. Meistens wird der nur charakterisiert durch das Datum, vor das man zurückwill: in der Regel ist das 1968. Minimalkonsens: die alte Familie und neue Eliten, gerne darüber hinaus aber auch Deluxe-Erweiterungen wie Nation, Religion, Preußen, Kanon (»Unsere Besten!«). Selten sind die Vertreter der Rekonstruktion von Familie und Elite so ungeschickt wie der Chef des Hauses Adlon, der der Pop-Literatin Rebecca Casati von der Süddeutschen beim besorgten Nachfragen nach den Vorbildern in den Block diktiert, seit 45 sei es in Deutschland mit Eliten nicht mehr weit her. Tristesse reeducational. Den meisten ist aber klar, dass die Rekonstruktion nicht ohne Berücksichtigung veränderter Verhältnisse möglich ist.
Ein Comic in der FAZ stellt vielleicht die perfekte Synthese aus einst und jetzt da. Volker Reiches Strizz ist einerseits die Aktualisierung des Cartoons Vater und Sohn, aus der Feder des in Weimarer Republik und Nazi-Zeit beliebten E.O. Plauen, andererseits sind die Väter und Söhne, die hier vorkommen, keine biologischen. Die glückliche Kleinfamilie – zwei andere Ex-Pop-Literaten, die ex-hedonistische Alexa Hennig von Lange und der ex-triste Joachim Bessing beklagten dies unlängst bei ihrem Kreuzzug für die Rettung der Familie in ehemaligen Partytypen-Kreisen – sei nur auf den Trümmern alter zerbrochener Beziehungen zu haben. Die Schäden seien bleibend. Gleichwohl geht es in Strizzens Kleinfamilie ohne biologische Eltern und ohne Trauschein noch viel idyllischer und behüteter zu, als es sich die konvertierten Party-Eltern träumen ließen. Dazu passt, dass der Chef des jungen Strizz, nämlich die E.O. Plauens Vater zeichnerisch nachempfundene Figur, nur einen verzogenen Kater, aber keine leiblichen Kinder zu versorgen hat. Dafür hat er ein anderes Patriarchen-Attribut geerbt: Er hat immer recht. Dies behält er in den Diskussionen mit dem für jeden kulturellen Mainstream-Trend anfälligen Strizz, weil er den Draht zum Faktischen hat: zur Wirtschaft. So sehr der Comic oft versöhnungsbereit Kompromisse zwischen den kulturellen Fraktionen anbietet, so klar wird immer wieder, dass die Kultur – inhaltlich – nicht wirklich wichtig, eher Kinderkram und Flausen darstellt. Derart entlastet darf sie ganz heiter sein. Ja, sie muss es.
Für diese Heiterkeit gibt es aber neben ihrer Harmlosigkeit noch einen zweiten Grund. Man will nicht Mainstream sein: Kultur, die sich politisch und intellektuell wichtig nimmt, ist aber Mainstream, wie neulich anhand der Verhältnisse rund ums Theater demonstriert. Gelegentlich spielt der naseweise kleine Rafael seinem Onkel-Vater etwas auf einer Kasperlebühne vor. Diesmal waren es Klassiker des Avantgardistischen, zusammengefasst auf Klischees von beschmutzten Zuschauern und dem lärmenden Ensemble. Nun hat der in der Firma stets gelackmeierte und zurechtgewiesene Strizz zu Hause mehr zu sagen. So erklärt er seinem Neffen-Filius, dass jede aggressive und die Theaterkonvention infrage stellende Geste selbst längst klassisch sei, ja mehrheitsfähig und sogar provinziell. Daraufhin deklamiert der Kleine aus Faust II und der Angestellte lehnt sich zufrieden zurück und denkt »schön«.
Bürger als Rebell
Dass die Avantgarde – ob das Konzept oder konkrete Avantgardisten – alt geworden sei, kann logischerweise nur ein Argument gegen deren Argument sein, das Neue zu repräsentieren und einen Fortschritt in der Kunst zu postulieren. Man kann sich dann ebenso gut mit dem noch Älteren beschäftigen. Oder, und das scheint mir das Entscheidende an der gegenwärtigen Lage zu sein, einen Distinktionsgewinn daraus ziehen, wieder bürgerlich zu werden. Die jugendkulturelle Rezeption von Differenz und Dissidenz in kulturellen, künstlerischen und politischen Lebensmodellen der Nachkriegszeit bildete schon immer ein Amalgam aus schnöden und erzbürgerlichen Abgrenzungsstrategien (Kennerschaft, Hipster, Elite) und ödipalem Distinktionsbemühen (Rebell, unbestechlich) mit einer aber auch nicht wegdiskutierbaren Auseinandersetzung oder Identifikation mit den jeweiligen Inhalten des Modells (Antifaschismus, Antikapitalismus, Antirassismus, Umweltschutz, Sozialismus, Bürgerrechte, Hedonismus, Kritik). In dem Maße jedoch, in dem die Bezugspunkte dieser Modelle in der realen Welt an Macht und Einfluss verloren, verkümmerten auch viele dieser jugend- und gegenkulturellen Formen zu leeren Distinktionsabzeichen, bis sie schließlich, dieser Stimmung verhilft Strizz zum Ausdruck, auch als solche nicht mehr taugen.
So kommt es zu dem auch nicht neuen Kurzschluss mit dem Urmodell bürgerlicher Individualität, das nach der Regel funktioniert: Ich bin ein ganz normaler Bürger und daher (oder trotzdem) ein ganz besonderer Mensch (und umgekehrt). In diesem Kurzschluss besteht die Besonderheit nun darin, in Abgrenzung von der Abgrenzung bei der Norm zu landen – als Abgrenzung versteht sich. Man ist jetzt etwas ganz Verbotenes: ein Bürger, härter als jede Avantgarde. Und doch eigentlich sehr bequem. Man kann sich also, indem man den Avantgarden vorhält, Mainstream zu sein, zu einem noch viel globaleren Hauptstrom bekennen, einer wie auch immer zu füllenden Bürgerlichkeit und einer umfassenden Restauration – und sich dennoch als Rebell und Dissident fühlen.
Mainstream braucht Elite
Dieses Phänomen ist nicht neu. Als sich ein neuer kultureller Konservatismus zu Beginn der Neunziger noch als kämpferische Neue Rechte (»Rückruf in die Geschichte«, »Anschwellender Bocksgesang« et cetera) und nicht über feinsinnige Prinzen wie Asfa-Wossen Asserate (Manieren) oder seine rechtskatholischen Freunde wie Martin Mosebach präsentierte, war die Rede vom Tabubruch, von der Umwälzung und andere revolutionäre Rhetorik schon ein treuer Begleiter des rechten Dranges in die Mitte. Neu ist heute aber nicht nur, dass nahezu alle – in Nuancen ja durchaus unterschiedlichen – aktuellen Rückbau-Projekte (Familie, Bürgerlichkeit, Katholizismus, Höflichkeit et cetera) ihren Horror vor Mainstream mindestens artikulieren, oft aber sogar – wie Strizz – als Grund für die Rückkehr zur Bürgerlichkeit bemühen. Auffällig ist vor allem, dass auf keinen Fall Mainstream sein zu wollen, eine viel dauerhaftere, eben habituelle Ausstattung der Neo-Bürgerlichen geworden ist, als es die wahrscheinlich immer schon eher mit soldatischen Tugenden als mit bürgerlichen verknüpfte, rechte Liebe zum links eingeführten Tabubruch war. Darum taucht als Kompensationsthema zum Mainstream-Horror zurzeit überall als Geschwisterkategorie neben den jeweiligen Rückbauwünschen die Elite auf.
Denn Elite ist strukturell notwendig, wenn man ein Modell will, das einerseits bürgerliche Traditionen rekonstruiert, andererseits mit dem tiefsitzenden Anti-Mainstream-Affekt rechnen muss, dem oft zur Arroganz abgesackten habituell gewordenen Hipstertum der real existierenden Jung-Bürger. Es geht darum, eine bürgerliche Mitte um Werte mit universellem Gültigkeitsanspruch zu bauen und sich zugleich von der Masse, dem hässlichen Haufen, der von Rechts wegen in den Genuss dieses Universalismus kommen müsste, abzugrenzen. Dass deren Mainstream verachtenswert sei, ist dabei wahrscheinlich der größte Konsens, der sich in der deutschen Gegenwartskultur finden lässt.
Vorläufer: Popper
Wer in den letzten Monaten Asserate klug oder zauberhaft fand, hatte meist auch eines der Tagebücher von Harry Graf Kessler auf dem Nachttisch liegen. Die neuen Bürgerlichen suchen nach Vorläufern und Fundamenten für das, was sie am besten können: Dress-Codes und Habitus entwickeln und beurteilen, den in ihrer Generation noch aus Pop- und Szenekultur übernommenen, semiotischen Reichtum von Unterscheidungsorgien auf ältere deutsche oder europäische Traditionen zurückführen. Schon eine Weile hat im Jargon des Feuilletons der Dandy den Hipster abgelöst, aber seit einiger Zeit sind alle Dämme offen, und Elite-Formulierungen aller Art haben Konjunktur. Da ist es kein Wunder, dass verschiedene Zeitungen (SZ, WamS) unlängst den fünfundzwanzigsten Geburtstag des »Poppers« feierten. Unter diesem Namen verstand man damals junge Männer, die mit gepflegtem Seitenscheitel und einer etwas überspannten, liegenden Tolle, V-Ausschnitt-Pullovern und einem Parteibuch der Jungen Union gelegentlich den Mut zeigten, in den Diskotheken des damals noch überwiegend langhaarigen Undergrounds aufzutauchen. Wenigstens wenn diese in der Nähe des Mittelwegs in Hamburg-Pöseldorf lagen. München hatte genügend Natur-Popper, die sich für ein solches Konzept gar nicht erst entscheiden mussten. Da hat eines der Rückbau-Projekte, nämlich dieser zeitgenössisch neokonservative Szenetypus, auf den sich wohl nicht nur Strizz mit Bessing und Florian Illies mit Harald Schmidt einigen könnten – der Bürger nicht aus Tradition, sondern aus Überzeugung, der Bürger als »gegenkulturelles« Projekt –, endlich seinen Vorläufer gefunden und wird angemessen geehrt. Popper kombinierten die Abgrenzungsstile, den Avantgardismus und den Wunsch, weit vorne zu sein, die Hipster-Arroganz und den Kult um Cliquen-interne Geheimrituale, die nur nach innen verständlich, nach außen aber sichtbar waren, mit neokonservativen Werten. Nur hatten sie es auch tatsächlich noch mit dem linken Mainstream der 70er als Gegenüber zu tun. Die Erinnerung an die heroischen Kämpfe gegen diesen ist ihnen als legitimierende Legende deshalb so wichtig, weil etwas Vergleichbares heute nicht in Sicht ist.
Michael Moore und der gesunde Menschenverstand
Im Gegenteil: Die letzten Jahre waren auch kulturell von einer Rekonstruktion konservativer Themen und Befindlichkeiten geprägt, die allerdings von einem Thema unterbrochen und infrage gestellt worden sind: der US-Politik im Irak und beim sogenannten Krieg gegen den Terror mit all ihren Nebenthemen. Das hat dann ein linkes Mainstream-Produkt hervorgebracht, das, obwohl weltweit, besonders in Deutschland erfolgreich geworden ist, den Filmemacher und Populisten Michael Moore. Doch ist dies tatsächlich ein Fall linken Mainstreams? In vielen europäischen Staaten gibt es zurzeit massive antiamerikanische Mehrheiten, auch bei der Rechten. Zu diesen Mehrheiten addieren sich, neben der vollkommen berechtigten Kritik an der US