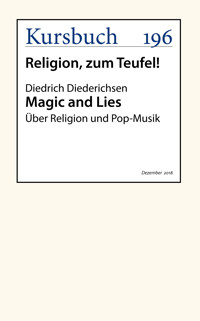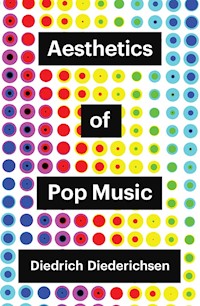19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Erst seit den 1960er Jahren widmen sich die Künste gezielt der technischen Klang- und Bildaufzeichnung. Wo vorher nur Slapstick und Surrealismus war, schießen nun Genres in großer Zahl aus dem Boden. Als behäbig erweist sich dabei eine Kulturkritik, die immer noch versucht, die Filme der Nouvelle Vague, das Cinéma Vérité, Punk, HipHop, Heavy Metal und Minimalismus, Fluxus, Performance Art, Pop Art, Nouveau Réalisme, Arte Povera, Soul-Musik und Concept Art entlang der Unterscheidung von E und U zu sortieren – als entweder hohe oder populäre Künste. In seinen Adorno-Vorlesungen zeigt Diedrich Diederichsen, dass ihr Gemeinsames viel entscheidender ist: das Bemühen, den verstörenden Effekt der Aufzeichnung und Wiedergabe von Körpern, Stimmen und anderen Realweltsplittern einzuarbeiten, zu verstärken, umzuleiten, der Kunst anzupassen oder die Kunst um den – sei es aggressiven oder zärtlichen – Effekt herum zu entwickeln. Im Lichte dieser Effekte von Phonographie und Photographie müssen alte Unterscheidungen über Bord geworfen und auch die Folgen von Kunst neu gedacht werden – egal, ob man Kinder schützen oder Erwachsene politisieren will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Diedrich DiederichsenKörpertreffer
Zur Ästhetikder nachpopulären Künste
Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2015
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2017.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2017
© Diedrich Diederichsen
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Inhalt
I. Indexikalität und Folgenreichtum
Ästhetik der Verursachung
Kritik der Wirkung, Kritik der Folgenlosigkeit
Aktivierung, Kulturindustrie, Effekt
Hat die Kulturindustrie eine Geschichte? Haben die Medien eine?
Der Index als konstruktiver Bruch
II. Case Study New York um 1960: Sex und Gewalt statt Lust und Unlust
Vor fünfundfünfzig Jahren
Traumhäuser
Hinter dem Spiegel: Queer Theatre, Screen Tests, Free Persons
»I could sleep for a thousand years« – Duration und kollektive Passivitätsakte
Gewalt wird zum Thema, Sex zum Bild
Sex und Gewalt statt Lust und Unlust: Verallgemeinerungen des Übergriffs
Trash-Filme und Free Jazz – noch eine Fallstudie
Entertainment through Pain und Repolitisierung
III. The Healing Festival: Konsequenz, Selbstorganisation, Kunst
Art Always Has Consequences
Gegenwartskulturen der Aggression und Verführung: HipHop, Metal, Pornographie
Vibration und Perforation oder ein lateraler Index: Kollektive und gemeinschaftliche Produktionen
Rezeptionsgemeinschaften und ihre Produktionen
Kunstcharakter und Erfahrung
Eine kleine Zusammenfassung
Der Fall Brasilien: Eine Populärkultur und eine Designtheorie
Danksagung
Über den Autor
I.Indexikalität und Folgenreichtum
»Ja, Gott sei Dank liebäugelt er mit Wirkungen! Ich will, daß der Autor mit Wirkungen liebäugelt! Ich möchte das, ich habe das, ich will, ich will mich nicht langweilen, bei ihm langweile ich mich nicht!«[1]
Marcel Reich-Ranicki
Ästhetik der Verursachung
Dieses Buch entwickelt und verbindet zwei Thesen, deren Verbindung bislang selten wahrgenommen oder diskutiert wurde. Die erste dieser beiden Thesen lautet, dass die Parallelität und Vehemenz, mit der in den Künsten um 1960 neue, von den technischen Aufzeichnungsmöglichkeiten Phonographie und Photographie geprägte Formate und Formen auftauchen, einen Epochenschnitt markiert, dessen ästhetische Konsequenzen bislang – jenseits ihrer vielberufenen medienkulturellen und medienkommunikativen Aspekte – nicht genug gesehen und gewürdigt worden sind. Offenbar war hierfür nicht schon die bloße Möglichkeit des Photographierens oder Tonaufzeichnens (die 1960 schon seit mehr als hundert bzw. fünfzig Jahren bestand) an sich entscheidend, sondern vielmehr deren Einbettung in allgemein zugängliche, ja alltägliche Praktiken der Produktion und Rezeption sowie die damit verbundene Entstehung einschlägiger Geschäftsmodelle. So wurden etwa die ökonomischen Konsequenzen der Klangaufzeichnung erst mehr als ein halbes Jahrhundert nach deren Erfindung gezogen, als die Musikindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg schließlich im großen Stil von Partituren und Kompositionsrechten auf Aufnahmen bzw. Tonträger als Hauptprodukt umstellte. Analoges gilt, so meine These, auch für die ästhetische Sphäre, die hier sowohl die künstlerische Produktion wie deren theoretische Reflexion umfassen soll.
Meine zweite These lautet, dass mit der zunehmenden Selbstverständlichkeit von Klang- und Bildaufzeichnungseffekten und dem dabei gewonnenen Niveau ihrer künstlerischen Reflexion[2] auch die vormals scharfe Scheidung in ›hohe‹ und ›niedere‹ Kunst gefallen ist. Als Gerücht oder (kulturpolitische) Forderung war vom Ende dieser Trennung zwar immer wieder mal die Rede, medienästhetisch aber wurde sie zur Realität. Und weil der Umgang mit diesen Effekten nach und nach alle Genres und Disziplinen gleichermaßen erreicht hat, lässt sich der damit verbundene Paradigmenwechsel weder soziologisch (bürgerliche versus Populärkultur) noch ökonomisch-ideologiekritisch (Kunst versus Kulturindustrie) vollständig beschreiben, sondern bedarf der ästhetischen Ebene des künstlerischen Umgangs mit Medieneffekten sowie den daraus resultierenden ebenfalls ästhetischen Konsequenzen. Zwar war die Notwendigkeit, diesen Umgang zu erlernen, sicher oft auch ökonomisch angezeigt, doch da das klassen- und bildungsspezifische Wissen der Künste dabei wenig hilfreich ist, beginnen sämtliche Akteure hier zunächst fast auf demselben Stand, gleich aus welcher Tradition sie kommen.
Was von ihnen – wie in den Künsten insgesamt seit circa fünfzig Jahren – ästhetisch gefordert wird, ist ein Umgehenkönnen mit den Medien des Index, sprich: Film, Photographie, Phonographie. Da diese aber weder in der hohen noch in der niederen Kunsttradition direkte Vorläufer haben, entwickeln beide Sphären in der ersten Hälfte des Jahrhunderts zunächst diverse Reaktionen der Abwehr und der Entschärfung (sofern man von einigen Momenten im Surrealismus oder Slapstick absieht, wo solche Effekte schon früh in reiner Form auftreten). Schließlich aber müssen sie sich allesamt demselben Problem und damit der entscheidenden Herausforderung der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts stellen, nämlich der ästhetischen Bewältigung des Index, also der Verursachung der Aufzeichnung durch ein Stück Wirklichkeit – ein Effekt, der jenseits sowohl von intentionaler, planender Beeinflussung als auch vom technischen Rahmen (etwa der Kamerabewegung und des Studioaufbaus bzw. der elektrischen Erzeugung, Verstärkung und Verzerrung von Tönen) liegt, sondern vielmehr durch die Aufzeichnung und Übertragung von Realien selbst entsteht, insbesondere von physisch präsenten Personen.
Die damit verbundene Herausforderung liegt in der fehlenden oder doch sehr begrenzten Verfügungsgewalt über diese Realien, wie sie die sonst so planvoll verwendeten Medien und Apparate quasi planlos im künstlerisch-medialen Werk erzeugen. Geht es hier doch kaum mehr um die Leistungen prä-technisch-medialer, prä-indexikaler Künste, wie sie traditionell durch Übung, Skills oder Talent zu haben wären, als vielmehr um ›angeborene‹, ›natürliche‹, also mehr oder weniger kontingente und entsprechend unverfügbare Attribute der aufgezeichneten Personen oder Außenwelten, um Sensationen spezifischer Körperlichkeit, Landschaft und Lebendigkeit. Hierin vor allem besteht die Attraktion solch ›unwillkürlicher‹, gleichsam ›rein medial‹ verursachter Spuren lebendiger Menschen im Medium. Wenn im Folgenden von Verursachung die Rede ist, so sei der Begriff deshalb in diesem aller subjektiven künstlerischen Gestaltung dezidiert entgegengesetzten Sinne zu verstehen, als ein Machen unterhalb oder neben aller Intention, bisweilen auch dagegen – als Stolpern, Kleckern, Absorbiert- oder auch Süßsein.[3] Die Aufwertung des solcherart Verursachenden bzw. Verursachten beleidigt und irritiert nicht nur das souverän waltende Künstlersubjekt, sondern auch den kulturindustriellen Plan und ermutigt all jene, die beides ohnehin entmachten oder unterbrechen wollen, sei es aus künstlerischen oder politischen Gründen, oder sei es, weil sie in der Attraktivität des Indexes realer Personen das bessere Business-Modell erkennen und so gewissermaßen eine kulturindustrielle Biopolitik begründen.[4]
Wie erwähnt, brauchte es noch recht viel Zeit, bis sich der neue, die nachpopulären Index-Künste konstituierende Medieneinsatz über die Produktion von Prototypen (wie sie von 1900 bis 1950 vorherrschte) hinausentwickeln konnte, und dann noch einmal viel Zeit, bis die kommerziellen und staatlichen Institutionen sich den neuen Gegebenheiten anzupassen lernten. So sind die meisten künstlerischen Neuentwicklungen auf diesem Feld in konventionell wie institutionell gesehen zugleich hoch- und populärkulturellen Kontexten erarbeitet worden – und zwar meist als Kritik an der jeweiligen Gestalt von Kulturindustrie, die man wahlweise (von links) kritisieren oder von innen her verfeinern respektive optimieren wollte.
Das Einstürzen der traditionellen E- und U-Differenz ist hier deshalb keine Frage des Niveaus. Das wäre von den alten Hochkulturen her gedacht. Auch markiert es keinen Perspektivenwechsel von ›werkbezogen‹ zu ›rezeptionsbezogen‹, von ›formalistisch‹ zu ›kritisch‹ oder Ähnliches. Stattdessen gibt es, seit die Künste über eine (elektro-)technisch-mediale Seite verfügen, einfach andere ästhetische Valeurs – ohne dass die alten aber deshalb gleich verschwinden würden. Bloß dreht sich nun nicht länger alles entweder um leichte Unterhaltung, Mitsingen, Tanzen, Schmunzeln und Rührung oder um Reflexivität, Katharsis, Durcharbeiten und Erschütterung, sondern stets und vor allem – nämlich an jener zentralen Systemstelle, wo einst Formulierung, Artikulation und Expression wirkten – um den Index, also gleichsam um die Direktübertragung einer anderen Menschenseele vermittels der technischen Aufzeichnung ihres Körpers, zumal in dessen unwillkürlichen Momenten.
Das Ereignis ist jetzt die Person per se und nicht mehr deren Können, Wollen oder Meinen – und damit womöglich etwas ganz und gar Außerkünstlerisches. Allerdings funktioniert das Körperereignis in der Kunst nie völlig rein, sosehr verschiedene Leute (allen voran Andy Warhol mit seinen Screen Tests) sich bemüht haben, es pur herauszudestillieren. Immer bleiben die indexikalen Anteile letztlich auf einen non-indexikalen Kontext angewiesen. Kann ihr spezifischer Realitätseffekt – zum Beispiel der eines Photodetails – doch überhaupt nur dann hervortreten, wenn er in einer (egal wie offen) intendierten Umgebung – etwa auf einem ikonisch komponierten Bild – situiert ist. Auch können andere Zeichen ihn verstärken.
Auf dieser Basis möchte ich im Folgenden zeigen, wie die populären und die nichtpopulären Künste seit ca. 1950 in unerwarteten außerinstitutionellen Begegnungen gemeinsam etwas entwickelt haben, was man eine – erst bloß praktische, allmählich aber auch diskursiv erschlossene – Ästhetik des Umgangs mit (elektro- und chemo-)technischen Aufzeichnungsmedien nennen könnte.
Als Ausgangspunkt mag dabei der nicht erst seit gestern diskutierte gewaltsame Aspekt der technischen Medien dienen. Schon Walter Benjamin beschreibt deren Spezifik in Metaphern des Zerschneidens und Penetrierens des menschlichen Körpers;[5] Roland Barthes schildert deren Zugriffsweise – an seinem Paradigma der Photographie – als punktierende Durchbohrung;[6] und für Sergej Eisenstein ergehen via Medientechnik synchrone Befehle ans Publikum.[7] Diese Kombination von Schnelligkeit, Direktheit und Gewalt, die sich für neuere Medienskeptiker und Kulturpessimisten wie Bernard Stiegler am regredierenden Umbau der Nervensysteme und Gehirne junger User schuldig macht,[8] bildet aus meiner Sicht heute den allgemeinen Maßstab für Wirkung – allgemein deshalb, weil er unausgesprochen auch jene Diskurse bestimmt, die sich offiziell nur für politische und aufklärerische Wirkungen von Kunst interessieren. Außerdem hat inzwischen wirklich jede_r diese Wirkungen selber erlebt und verhält sich dazu, gleich wie implizit oder bewusst: Wer die damit verbundenen Effekte als Aufgabe, ja Bestandteil von Kunst ablehnt, lehnt die medientechnischen Künste meist auch im Ganzen ab. Wer dagegen die besondere Versessenheit auf Wirkung teilt, ist meist – selbst wo er/sie deren Aufklärungspotential unverdrossen auf (mittlerweile wohlfeile) Vokabeln wie Provokation und Schock verengt – schon von den medienbasierten Künsten sozialisiert. Und auch als ökonomischer Maßstab ist Wirkung der Nachfolger der einstigen Stückverkaufszahlen. Der kybernetische Kapitalismus der Aufmerksamkeitsverwertung lebt davon, Wirkungsereignisse zu erfassen und zu mathematisieren.
Es wäre also an der Zeit, den Einfluss technischer Medien auf die Künste und deren Praktiken einmal anders zu lesen als immer bloß im Hinblick auf die damit verbundenen Verheißungen und Sorgen. Auf der Reproduktionsseite wären dies klassischerweise: erhöhte Zugänglichkeit, Standardisierung, Nivellierung, Verlust der Aura; auf Produktionsseite hingegen: Erweiterung des Sinnenerlebnisses, Betäubung und Sedierung, Illusionismus und das Verbergen der Gemacht- und Konstruiertheit medial generierter Universen; und von Seiten der kommunikativen Wirkung aus schließlich: Vernetzung, Integration, Partizipation. All diese Chancen und Gefahren sind vielfach diskutiert worden, und angesichts des Umbruchs zu einer digitalen Medienkultur hält die Diskussion darüber notwendig an. Selten wird dabei jedoch bedacht, dass das Allgemeine des Mediums im Falle der Aufzeichnungsmedien Photographie und Phonographie eben nicht das ›Allgemeine‹ – sprich hier: Allgemeinverständliche und allseits Anschlussfähige – hervorbringt, sondern im Gegenteil gerade das Einmalige, nämlich die Fähigkeit, sich »als Medium aufzuheben, nicht mehr Zeichen, sondern die Sache selbst zu sein«.[9] Demnach wäre die Tatsache, dass Photos und Tonaufnahmen unmittelbar von der physischen Anwesenheit von lebendigen Personen verursacht sind, also im Sinne von Charles Sanders Peirce ›indexikal‹ zu nennen wären, nicht die einzige Ursache des Realitäts- und Authentizitätseffekts, von dem hier die Rede sein soll. Entscheidend für den besonderen Folgenreichtum dieser Form von künstlerischer Arbeit ist vielmehr auch das der Singularität und Kontingenz von Person und Situation gerade entgegengesetzte (Massen-)Medium, dessen standardisierter und standardisierender, vervielfältigter und vervielfältigender Rahmen die indexikal hervorgebrachte Einmaligkeit wirkungsvoll hervorhebt und verstärkt. Erst das Massenmedium schafft den einmaligen Star – dessen massenmediale Feier freilich schon eine Domestizierung dieses Effekts vom Indexikalen zum Ikonischen markiert, eine Vergesellschaftung vom Schock des Singulären zu einer Syntax und Systematik von Maske und Typus.
Wo von Verursachung die Rede ist, stellt sich freilich auch die alte Frage nach der Wirkung neu: Wenn ich nicht mehr den Plan eines Künstlers entschlüsseln oder mich an Schönheitsmodellen reflexiv erfreuen soll, sondern man mir stattdessen direkt nahetritt – was folgt daraus gesellschaftlich? Zunächst sollte man sich von den ungut mechanistischen Metaphern lösen, die solche Kunsteffekte immer nur als werkzeughaft von außen (aber woher genau?) Bewirktes verstehen können: als Verrohung, Aufklärung, Erbauung, Mobilisierung oder Sedierung. Auf der anderen Seite sind bestimmte Teile dieser Metaphorik durchaus nützlich, vor allem gegen jene soziologistischen Theorien, die jedwede künstlerische Praxis bloß als irgendein gesellschaftliches Wirkungs- und Bewirkungsfeld neben anderen wie Handel oder Politik sehen wollen. Denn sosehr die Kunst das sicher auch ist, so wenig erfährt man über sie, wenn man ihre Spezifik nicht beachtet.
Die allgemeine Formel für die (übrigens deutlich voneinander zu trennenden) Quellen und Wirkungen solcher nachpopulären, d. h. auf direkter Übertragung von Körperlichkeit durch Bild- und Tonaufzeichnung beruhenden Künste lautet landläufig: Sex und Gewalt. In ihr kristallisiert sich der Umstand, dass Körper nunmehr unumwunden, also unter Umgehung der mimetischen künstlerischen Disziplinen den Kunstbezirk betreten und dementsprechend auch als Adressaten mit neuer Vehemenz und Fulminanz erreicht werden können. Sex und Gewalt werden so fast notwendig auch zur trivialen bzw. opportunistischen Schlussfolgerung auf Seiten kapitalistischer Kunstproduktion sowie mancher Diskussion darüber. Seit diese Wirkungstypen aber flächendeckend sowohl in der Praxis als auch im Selbstverständnis nahezu jedes Kunstbereiches dominieren, befinden wir uns in jener Lage, um die es in diesem Buch geht – einer Kunstepoche, in welcher in Kritik wie Selbstbeschreibung affirmativ von Provokation, Aufrütteln, Kick Ass, Rocken, Verstören, von der Improvisation als »Geschlechtsakt mit dem Publikum« (Robert Wyatt), von Verführung, Hingabe, Ekstase, schließlich aber auch von Weltverlust und Ich-Aufgabe die Rede ist. Dies alles sind Bilder von Wirkung, die nach und nach auch ins allgemeine Verständnis von gesellschaftlichem Handeln eingehen und denen die Kunst Material und Muster liefert.
Der Grund sowohl für die Besessenheit wie auch die Unsicherheit, welche die Wirkungsdimension der phonographischen und photographischen Künste hervorruft, ist die schon erwähnte Logik der unmittelbaren Verursachung, ob als Unwillkürliches einer Aufzeichnung oder als inszeniert Unwillkürliches vom Slapstick über Lo-Fi bis zu den weinenden Kandidat_innen in Castingshows. Dieses erkennbar Verursachte setzt sich vor das von Subjekten Geplante, von künstlerischen Absichten Intendierte. Und sowenig es für sich allein stehen kann, so sehr bildet es doch das Neue dieser Aufzeichnungskünste. Denn alle haben sie mit indexikalen Medien zu tun oder imitieren deren Effekte, die dort unter metaphorischen Bezeichnungen wie Überwältigung, Gewalt, Ansteckung, Durchbohren, Kick, Vibration etc. verhandelt werden. Dahinter steckt nicht zuletzt auch der Traum von einer nicht-entfremdeten Arbeit, die quasi ›beim Produzenten bleibt‹ (obwohl der sie vollendet) – und damit das Ideal vom Künstler als dem vollen, handlungsfähigen Subjekt. Freilich wird das Subjekt gerade durch das Mediale der verursachenden Index-Beziehung auch wieder entmachtet, denn nur um den Preis medialer Zeugenschaft kann ich authentisch sein. Die Dialektik der Verursachungskünste liegt somit darin, dass eine gewisse ›unentfremdete‹ Vollständigkeit, das ›Bei-mir-Bleiben‹ meiner Arbeit, nur dadurch zu erreichen ist, dass sie in einem objektiven Medium auftaucht. Umso mehr sind Künstler oder Performer, die unter dieser Dialektik leiden oder sie doch kontrollieren wollen, oft bemüht, auch in gewissermaßen amedialen bzw. Live-Situationen (meist durch Übertreibung) vergleichbare Effekte herzustellen oder zu rekonstruieren. Das wird uns noch beschäftigen.
Um den Umbruch zunächst auf eine notgedrungen vereinfachende, aber prägnante Formel zu bringen, könnte man sagen: In den bürgerlichen Künsten geht es seit der Aufklärung primär um die Einmaligkeit des mentalen Lebens ihrer Charaktere, die sich in Sequenz, Narration, Geschichtlichkeit sowie im Vertrauen auf die Übertragbarkeit dieser Prinzipien auf die im Rezeptionsakt reflexiv realisierte Individualität der (ebenfalls bürgerlichen) Adressaten entfaltet. In den traditionellen populären Künsten dominiert dagegen die körperliche Präsenz und Co-Präsenz von Personen in einer öffentlichen oder halböffentlichen, festlichen bis ekstatischen Live-Situation, in deren Fokus eine trickreich-verblüffende oder erotisch-verführerische Körperlichkeit steht. In den nachpopulären, auf der Verfügbarkeit von Aufzeichnungstechnologien basierenden Künsten schließlich wird das Leben des Geistes, die Individualität der bürgerlichen Seele, durch die Übertragung oder das Auslesen einer aufgezeichneten körperlichen Präsenz beschworen. Dabei wird die Seele jedoch weniger geschichtlich oder sequenziell entfaltet, sondern erscheint vielmehr so dicht, verblüffend und präsent wie der Körper, aus dem die Übertragung, das Recording sie herausholt. (Vielleicht wäre daher noch vor dem Slapstick der um die Jahrhundertwende so verbreitete Spiritismus als erste kulturelle Bewegung zu nennen, die auf diese Verhältnisse reagiert.)
Unweigerlich geht damit die schon erwähnte Demütigung des traditionellen, ausgebildeten, virtuosen, produktionstechnisch kenntnisreichen Künstlers einher, der über das mimetische Vermögen zu verfügen wusste und sich als hochentwickelten Vertreter der anthropologischen Idee von nicht-entfremdeter Arbeit und somit als Repräsentant gelingender Menschlichkeit sehen konnte. Seine Herabstufung bedeutet gleichwohl keinesfalls die ersatzlose Streichung all seiner Errungenschaften. Sicher werden seine ausdifferenzierte Subjektivität und seine über lange Zeiträume und komplexe Strategien vermittelte Intentionalität von zwei Seiten her bedrängt und teils ersetzt – nämlich zum einen durch Magier, Performer und Verführer, die mit einer (ihnen vielfach selbst unklaren) Technologie des Herbeizauberns von Attraktionen arbeiten und oft weitgehend den technokratischen und kapitalistischen Besitzern der technischen Produktionsmittel ausgeliefert sind; sowie zum anderen durch kluge Konzeptualist_innen und irre Intellektuelle, die vielleicht dereinst so etwas wie die Rettung oder Re-Installation von Künstler_innenfiguren erwirken könnten, indem sie das Ganze der neuen Lage auf einen dieser adäquaten Begriff von künstlerischer Praxis und Wirkung bringen (womöglich durch die allerneuesten Reden, Ideen oder auch Moden von Netzwerken und Verknüpfungen, Assemblagen und Kollektivitäten). Doch unabhängig von alldem gelingt das Index-basierte Werk, oder besser: Zulassen bzw. Präparieren der indexikalen Wirkung eben nicht einfach durch Streichung aller Subjektivität. Vielmehr evolviert es gerade aus der Spannung zwischen Objektwerden und Subjektbleiben, zwischen passivem Geschehen-Lassen des Photographiert- bzw. Aufgezeichnet-Werdens auf der einen Seite sowie der aktiven Herstellung von Rahmenbedingungen, unter denen dies besonders gut gelingt, auf der anderen. Hing die Unterscheidung von populären und nichtpopulären hohen Künsten einst an der fürstlichen Subjektivität des Herrschers über das mimetische Vermögen, seiner Virtuosität und Genialität, so sind die Menschen in den Künsten der Aufzeichnung auf ganz andere Weise, nämlich oft und an entscheidender Stelle zufällig und unwillkürlich Ursachen von Wirkungen. Doch verdanken genau diese Zufälle sich zum allergrößten Teil aktiv rahmenden Tätigkeiten, die man, je nachdem, als Regie, Ritual, Produktion, Supervision oder Installation bezeichnen mag.
Dies gesetzt, lässt sich auch der kulturpessimistischen, bis zu den aktuellen Lamenti etwa eines Hans Ulrich Gumbrecht nicht abebbenden Konjunktur der Beschwerde über die Erklärungsbedürftigkeit von Gegenwartskunst und den damit verbundenen Terror der unsinnlichen Diskurse[10] grundsätzlich widersprechen, zumindest sofern man sich die prinzipielle Einbettungsnotwendigkeit indexikaler, aufgezeichneter (Human- und Real-)Daten einmal klargemacht hat – eine Notwendigkeit, die übrigens nicht nur für Kunst, sondern auch für nichtkünstlerische Zwecke gilt. Je »wirklicher« das Photo, desto mehr bedarf es einer Erklärung im weiteren Sinne: von der simplen Info über seine Entstehungsbedingungen in kommunikativen Kontexten bis zur symbolischen oder künstlerischen Rahmung und Bearbeitung. Das ist die Dialektik des Index: Er brüllt aus der Wirklichkeit, sagt aber erstmal nichts. Diese Beschriftungs- und Kontextualisierungsnotwendigkeit des nackten indexikalen Datums der Aufzeichnung macht eine andere Front auf, an der die notwendige Mehrteiligkeit und damit Heterogenität zeitgenössischer Kunst jenseits jenes Unterschiedes zwischen ›Pressetext‹ und ›Sinnlichkeit‹ erscheint, unter dem die Spießer bei jeder neuen documenta leiden. Grundsätzlich sind Werke nicht mehr aus einem Guss, wenn sie zugleich aus indexikalen Direktübertragungen und weiteren – je nachdem – reflexiven, spekulativen, manipulativen oder kommentierenden Komponenten bestehen. Diese tiefe, nicht stilistische, sondern medienbasierte Heterogenität jenseits der vom Künstler noch zentral beherrschten Collage ist Grundlage aller Index-basierter Künste und kann ganz unterschiedlich bewältigt werden. Sie stellt die Fortsetzung jener notwendigen Unversöhntheit von Form und Inhalte dar, von der die Kritische Theorie (aber eben ohne Medientheorie) spricht. Und selbst da, wo Minimalisten oder bestimmte Konzeptualisten eine neue Einheitlichkeit auf der Ebene indexikaler Effekte herstellen wollten, konnte sie nie wieder so homogen sein wie ein Gemälde oder ein Roman. Das ästhetische Ziel und die magisch medialen Mittel bleiben notwendig unverschmolzen, die Leere zwischen Konzept und Zauber, zwischen Kick-Ass und Politambition muss bewältigt, bespielt, ausgehalten werden.
Kritik der Wirkung, Kritik der Folgenlosigkeit
Zum selben Problemkreis gelangt man übrigens auch, wenn man von der gegenwärtig am heftigsten geführten Kunstdiskussion ausgeht, nämlich der um deren gesellschaftliche und politische Folgen. War die politische Konsequenz künstlerischen Handelns einst ein Motiv des Aufbruchs, des aufbegehrenden ästhetischen Vermögens, sich aus der institutionellen Einhegung von Fiktion, Illusion und Repräsentation zu befreien, um direkte Effekte des Erkennens und der Mobilisierung beim Publikum zu erzielen, so ist sie zwischenzeitlich längst zu einer normativen Komponente akademischer Kunsterziehung geworden. Dabei verengt sie frühere Konzepte des schon bei Horaz geforderten Nutzanteils (prodesse) auf eine ganz bestimmte Spielart solchen Nutzens, nämlich politische Aufklärung und Mobilisierung – in letzter Zeit zunehmend auch direkte Eingriffe. Die Schwäche dieser Perspektive ist im Vergleich zu anderen Kunstpotentialen weniger ihre Enge, sondern ihr unmaterialistisch-moralistischer Hang zum Legitimationsdiskurs, der den Künsten die gewünschten politischen Konsequenzen nicht nur (gar als creatio ex nihilo) zutraut, sondern sie auch gleich darauf verpflichten möchte – meist um dann schlechtgelaunt entdecken zu müssen, dass sich die Hoffnung nicht erfüllt hat, ja gar nicht erfüllen konnte. Denn mit der Enttäuschung stellt sich meist auch die Überzeugung ein, dass die Künste so letztlich nur die Prägungen und Dispositive jener falschen Gesellschaft reproduzieren, die sie hervorgebracht hat. Der naiv-optimistische Glaube an eine rein durch guten Willen quasi hebelartig zu erreichende Wirkung schlägt dann in der Regel undialektisch in sein pessimistisches Gegenteil um und führt, wo nicht zu bloßem Zynismus, zu einer quasi-deterministischen Soziologie der Kunst, wie sie am brillantesten von Pierre Bourdieu vertreten wurde. Hinzu kommt, dass allzu unmittelbar erhoffte politische Effekte sich in der Regel sogar schon vor der unvermeidlichen Entzauberung gezwungen sehen, den Konventionen und Bedürfnissen der jeweils geforderten Antragsprosa und ihrer Verwalter zu genügen (da die Förderanträge ja meist von Leuten entschieden werden, die sich über gesellschaftliche Nützlichkeit Gedanken machen müssen) oder aber den Wünschen eines entfesselten Kunstmarkts, dessen Kunden die Sinnware immer öfter als »politische Kunst« einkaufen möchten.
Meines Erachtens lassen sich die Folgen künstlerischer Praxis in unserer Zeit aus einer anderen Perspektive ertragreicher betrachten, nämlich von unseren individuellen Beeindruckungserfahrungen und deren medientechnischen, ihrerseits durchaus politischen künstlerischen Ursachen her. Natürlich können persönliche Erlebnisse das Verfahren nicht allein bestimmen – ein undialektisch subjektiver Fanstandpunkt wäre die Folge. Doch eignen solche Transformationserfahrungen sich gut als Ausgangspunkt, eben weil so gut wie alle sie auf die eine oder andere Art gemacht haben. Es drängt sich sogar der Verdacht auf, dass die jüngste heteronome Festschreibung der Künste auf ihre Nützlichkeit gerade auch von den Erfahrungen mit solchen Attraktionswirkungen herrührt, und zwar in dem Maße, wie die Verursachung durch den aufgezeichneten Körper dabei mit der Verursachung durch Kunst verwechselt oder überblendet wird – nicht zuletzt in der Absicht, den stets befürchteten üblen Wirkungen durch karitativ vorauseilendes Kunsthandeln zu wehren. Ein Missverständnis mit sehr differenten Folgen.