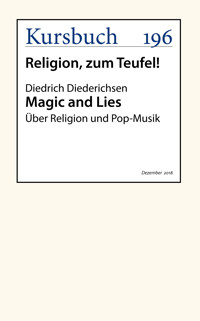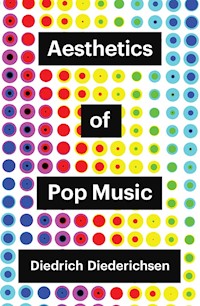35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Diedrich Diederichsen über Pop-Musik: das Opus magnum Ganze Generationskohorten von Pop-Fans hat er angeregt und aufgestört: Diedrich Diederichsen. Nun erscheint mit Über Pop-Musik das Ergebnis seines lebenslangen Nachdenkens über Pop.Über Pop-Musik ist ein kluges, ein kontroverses Buch, dessen Thesen ganze Gebäude eilig zusammengezimmerter Übereinkünfte zum Einsturz bringen werden. Pop-Musik, sagt Diederichsen, ist gar keine Musik. Musik ist bloß der Hintergrund für die viel tiefer liegenden, viel weiter ausstrahlenden Signale des Pop. Pop ist ein Hybrid aus Vorstellungen, Wünschen, Versprechungen. Er ist ein Feld für Posen und Pakte, für Totems und Tabubrüche. Der Autor bezieht seine Argumente aus Semiotik und Soziologie ebenso wie aus der Geschichte und Gegenwart der Pop-Kultur und aus den angrenzenden Gebieten Jazz, Kino, Oper. Es dürfte das erste Buch sein, das der ganzen Vielgestaltigkeit des Phänomens Rechnung trägt, und das einzige, in dem gleichzeitig Theodor W. Adorno und Congo Ashanti Roy auftreten. Und es ist ein sehr persönliches Buch. Diederichsen greift immer wieder auf die eigenen Erfahrungen zurück, sein Initiationserlebnis war ausgerechnet ein Konzert des bleichen Bluesrockers Johnny Winter. Was er über dessen Auftritt schreibt, gilt für viele, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sind: Pop hat »eingelöst, was wir alle immer schon geahnt hatten, aber als Kinder nie ganz genau wussten: dass es etwas gibt. Nicht, wovon Winter heulte, war wichtig, sondern dass in komischen Geräuschen ein Weg zur Welt war.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 940
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
TitelVORSPANNEinführungERSTER TEIL: HUMANE FAKTOREN / HUMANE RESSOURCENGeschichten aus der RezeptionDie unmögliche ProduktionZWEITER TEIL: SPRACHE – VOKABULAR – PERFORMANCEMusik und SpracheVokabular: Totem-Sound, Melodietypus, SounddesignPerformance und Pose: Das Theater der Pop-MusikDRITTER TEIL: GESCHICHTE UND VORGESCHICHTE DER POP-MUSIK – JAZZ, MODERNE, FORTSCHRITTJazzFortschritt, Geschichte – Pop-Musik als Musik nach JazzVIERTER TEIL: ZWISCHEN POP-MUSIQUE CONCRÈTE UND ABSOLUTER POP-MUSIK – STIMMEN, MASCHINEN, SOZIAL-OBJEKTEMedium und FormStimme und TextMaschinen und ihr Atem: RhythmusAbsolute Pop-Musik: Pop-Musik als zeitgenössische KunstFÜNFTER TEIL: DIE GESELLSCHAFT DER POP-MUSIKTrennen und Vereinen: Die heroischen Jahre der Pop-MusikDie weniger heroischen Jahre der Pop-Musik: Gegenkulturalismus ohne GegenkulturAusblickeDANKSAGUNGENBuchAutorImpressumVORSPANN
Einführung
Was?
Dieses Buch befasst sich mit Pop-Musik. Sein Autor hält Pop-Musik für einen eigenen Gegenstand. Pop-Musik ist für ihn kein Spezialfall aus dem größeren Gegenstandsbereich Musik. Und Pop-Musik ist nicht nur sehr viel mehr als Musik. Pop-Musik ist eine andere Sorte Gegenstand.
Im Folgenden werde ich das Wort ausschließlich in diesem Sinne verwenden: Pop-Musik ist der Zusammenhang aus Bildern, Performances, (meist populärer) Musik, Texten und an reale Personen geknüpften Erzählungen. Es ist ein Zusammenhang, den man ungefähr seit der Mitte des letzten Jahrhunderts beobachten kann. Seine Elemente verbindet kein einheitliches Medium, wenn es auch von entscheidender Bedeutung ist, dass sich unter den Medien, die Pop-Musik benutzt, die technische (Ton-) Aufzeichnung befindet. Den notwendigen Zusammenhang aber zwischen z.B. Fernsehausstrahlung, Schallplatte, Radioprogramm, Live-Konzert, textiler Kleidermode, Körperhaltung, Make-up und urbanem Treffpunkt, zwischen öffentlichem, gemeinschaftlichem Hören und der Intimität von Schlaf- und Kinderzimmer stellt kein Medium her – die Hörer, die Fans, die Kunden von Pop-Musik selbst sorgen für diesen Zusammenhang.
Im ersten Teil geht es daher zunächst um die Arbeit, die Projektionen, das Begehren dieser Rezipienten. Sie sind die Nutzer, aber eben in einem sehr hohen Maße auch die Macher von Pop-Musik; an einen Klassiker des Schrifttums der Arbeitswelt anschließend heißt daher der erste Abschnitt des ersten Teils: »Geschichten aus der Rezeption«. Erst danach geht es um die Hersteller: die Musiker, die Produzenten, die Kulturindustrien.
Ebenso wenig wäre aber eine Pop-Musik ohne Musik denkbar. Musik ist der ideale Speicher für die Fülle von heterogenen Dingen (Bildern, Ideen, Erinnerungen, Geräuschen, Körpergefühlen), die zwischen den verschiedenen Sende- und Empfangsstationen des Pop-Musik-Zusammenhangs zirkulieren, eben weil Menschen Musik auch ohne technische Medien speichern und reproduzieren können. Musik können sie auswendig. Der Gegenstand Pop-Musik lässt sich also nur unter Berücksichtigung von Musik diskutieren, aber er geht nicht in ihr auf. Pop-Musik ist mehr, aber nicht im Sinne eines Schwamms, der alles in sich einsaugt, sondern in dem Sinne, dass alle Teile für sich genommen unvollständig sind, jedenfalls auf Dauer gesehen.
Pop-Musik wird nach und nach aufgenommen. Wer sie wahrnimmt und verarbeitet, stellt immer wieder neue und andere Zusammenhänge zwischen den Teilprodukten (Sounds, Texten, Videos, Covern, Frisuren, Emblemen usw.) her, die inhaltlich und stilistisch miteinander verbunden sind und die sich vor allem auf dieselbe Person oder Personengruppe (einen Star, eine Szene) beziehen. Dafür können die Rezipienten von Pop-Musik immer auch eine Zeitlang mit einem Teilprodukt allein sein, wenn es auf einen Zusammenhang wartet. Doch hat selbst die Musik keinen Sinn, wenn man sie dauerhaft von den anderen Komponenten trennt. (Wer das versucht, muss sie enorm fetischistisch aufladen – wie der Vinylsammler; er schließt dann über die magische Integration in den Fetisch unterschwellig auch wieder andere Produkte mit ein.)
Es gibt daher auch keinen Pop, den man von der Pop-Musik trennen und mit anderen Eigenschaften, wie etwa dem Populären, klassifizieren könnte. Populäre Musik (oder neuerdings auch gerne: Popularmusik) umfasst Schlager, Folklore, eine Reihe von nicht-westlichen Musikformaten; von Pop-Musik ist sie nur ein Bestandteil, allerdings in relevanter Weise. Vom Populären ist historisch schon sehr viel länger die Rede als von Pop-Musik. Dieser traditionsreiche, aber auch behäbige und beladene Diskurs trifft weder die sozialen noch die medialen Realitäten, unter denen Pop-Musik entstanden ist. Ich unterscheide daher zwischen Pop-Musik, deren Geschichte 1955 plus/minus fünf Jahre beginnt, und dem Populären und der Populärkultur, die es schon vor der Pop-Musik gab und die auch weiterhin existiert. Schließlich kann man außerdem von einer neueren Pop-Kultur sprechen, die das Ergebnis des Einflusses der Pop-Musik als kulturelles, künstlerisches und kulturindustrielles Modell auf andere Künste und kulturindustrielle Formate darstellt. Der Ausdruck ist allerdings so irreführend, weil auf so verschiedenen diskursiven Baustellen im Einsatz, dass ich weitgehend auf ihn verzichten möchte. Wie aber verhält sich Pop-Musik zu dem Begriff des Populären? Das ist eine nicht unwichtige Frage, die jedoch im Verlauf des Buches keine große Rolle mehr spielen wird. Ich setze dann ihre Klärung voraus, die ich hier gebe.
Pop-Musik und das Populäre
Das, was alle angeht, nimmt kulturell die Gestalt des Populären an. Das wäre eine erste inhaltliche Bestimmung. Pop-Musik ist die Aufkündigung einer solchen Gemeinschaft aller mit den Mitteln, mit denen sich Gemeinschaften sonst symbolisch herstellen: Klänge, Abzeichen, Auftrittsformen, Verhaltensregeln. Im Gegensatz zu einer Elite und ihrer sich abgrenzenden Hochkultur, trennt sich die Pop-Musik von der populären Kultur auf deren Terrain und mit deren Mitteln. Ihre Sezession teilt sie den anderen mit, die sie nun wahlweise als zu alt, als faschistisch, zu deutsch, aber auch als zu schwach, zu weich und als inkonsequent adressiert.
Pop-Musik führt die Möglichkeit der Nonkonformität in eine Kultur ein, deren Grundlage und deren Darstellungsmittel auf Konformität und Zustimmung angelegt sind. Sie tut dies inmitten einer Epoche, die Konformismus lehrt, predigt und zu erzwingen versucht. Pop-Musik widersetzt sich nicht nur dem Befehl, dass ein Hemd weiß sein sollte und eine bestimmte Zigarette geraucht werden müsste, keine andere, sondern nach und nach auch allen anderen konformistisch vertretenen Werten. Erfolg hat sie damit aber nicht zuletzt, weil sich auch auf anderen Ebenen des Kapitalismus das Individuelle als Wert, Methode und Produkt gegen die Ökonomie der hohen Stückzahlen und der angepassten Untertanen durchsetzt.
Pop-Musik inszeniert allerdings Individualismen und Kollektivismen (zunächst) in Sprachen und mit Bildern, die der Artikulation von Zustimmung gedient haben. Verständliche, rhythmisch markante Lieder. Das wird sie trotz aller Verselbstständigung, die sie seitdem durchgemacht hat, nie ganz los: Sie ist affirmativ, sie sagt Ja. Und will doch Nein sagen. I can’t get no. It ain’t me. Dieses Nein, das für sein Publikum als Ja rüberkommt, ist eine große Stärke der Pop-Musik. Wenn es denn rüberkommt. Eine freudige und daher ermutigende, freundliche Verneinung des Bestehenden zugunsten der Umstehenden. Die beiden ewig konkurrierenden Beschreibungen der Pop-Musik, insbesondere ihrer heroischen Momente in Gegenkultur, Punk und Rave – großes glückliches Ja und große sarkastische Verweigerung – bilden eine Einheit: ein Nein im Modus des Ja und umgekehrt. Eine Weigerung, die nicht mit einer Party zutiefst verbunden wäre, ein riesiger eskapistischer Exzess jenseits von Raum und Zeit, der nicht vor einer bestimmten und konkreten Hässlichkeit Reißaus nähme, wären nicht satisfaktionsfähig. Dieser dialektische Kern ist aber auch eine Schwäche: Das Verhältnis kann sich z.B. leicht und unbemerkt umdrehen, die jeweilige Funktion von Ja und Nein ist schon im Genre angelegt, wird nicht von den einzelnen zu beurteilenden Gegenständen her entwickelt.
Historisch trennt Pop-Musik als ein Einspruch diejenigen, die ihn hören und ernst nehmen wollen, von denen, die das nicht wollen. Sie agiert ja mitten im Einzugsgebiet des großen Konsensus der westlichen Nachkriegsgesellschaften und des fordistischen Kompromisses zwischen den Klassen. Sie wird so zum Re-Entry der großen Klassendifferenz und der Unterscheidung populär/elitär in einem größer gewordenen Feld des Populären. Ein britischer Mod von 1965 ist der Arbeiteraristokrat, den Marx sich noch nicht vorstellen konnte. Es gibt nun einen Unterschied wie den zwischen High & Low noch einmal innerhalb der Low-Art und der Massenkultur und es gibt ihn, man denke an Pop-Art, auch auf der anderen Seite der Unterscheidung, in der High-Art – jeweils mit dem Argument und dem Gestus größerer Zeitangemessenheit, Modernität, gewissermaßen: als Reform. So wie dieses Re-Entry spaltet und an Klassenunterschiede erinnert, tendiert es aber auch zu deren Runterstufung zur Lifestyle-Orientierung: Als ob man es sich frei aussuchen könnte. Der Mod in »Substitute« von The Who beklagt dies exemplarisch.
Man kann das Populäre aber auch anders auf Pop-Musik beziehen, man kann nämlich (etwa im Sinne der britischen Cultural Studies) sagen, es gehe diejenigen an, die nicht herrschen. Wenn es eine Klasse der Herrschenden gibt, deren homogene Kultur sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie nicht erzwungen, nicht unmittelbar ableitbar, mithin relativ autonom funktioniert, dann wäre das Populäre das nicht-autonome, von Notwendigkeit (Reproduktion der Arbeitskraft etc.) gekennzeichnete Gegenteil dieser autonomen Kultur der Herrschenden. Und die Pop-Musik wäre eine Art autonome Kultur der Nichtherrschenden. Genau wie die High-Art der Herrschenden bestimmt sie utopische Punkte, Momente, Einstiege in eine Welt des Nichterzwungenen, das aber nun ein ganz anderes als das der Herrschenden wäre. Das geht historisch mit der Kulturalisierung von abhängiger Arbeit einher – Arbeit gerät zur Performance. Pop-Musik wird deshalb irgendwann nicht nur von der Abschöpfung der so kulturalisierten unteren Klassen ergriffen und verwandelt, sondern auch von der Restrukturierung der Bourgeoisie und der Mittelschichten. Denn die haben einst ihr Selbstbewusstsein aus Bildungswissen und den dazugehörigen Institutionen bezogen. Nun treten an ihre Stelle global agierende, kulturell hybride Oberschichten, die ihre kulturelle Zugehörigkeit nicht mehr im Modus der Tradition und der Herkunft, sondern in dem der Identifikation und des Begehrens regeln.
Eine dritte und besonders weit verbreitete Auslegung erkennt im Populären das, was die Neuen (im Sinne neuer oder neuartiger oder neu zugelassener Menschen) oder das Neue (ihre relevante Eigenschaft) angeht. Grenzt man das Populäre gegen das Traditionelle ab, dann wäre das Populäre immer auch das mit der Tendenz und der Entwicklung Verbündete, denn das Traditionelle ist ja das herabsinkende, ehemalige Populäre. Pop-Musik tritt als Populärkultur der Jugendlichkeit und der Minderheiten zunächst als Vertretung des Neuen auf, verstetigt aber ihre Formen zu einer dauerhaften Zuständigkeit, wie eine Nachrichtensendung, die jeden Tag pünktlich ausgestrahlt wird. In Pop-Musik sind bestimmte historische Formen des gesellschaftlich Neuen (neue Lebensformen oder neu zugelassene Akteure: Migranten, Jugendliche, sexuelle Minderheiten, Frauen) zu Traditionen geronnen. Es sind Traditionen, die zwar ihre ursprüngliche Legitimation verloren, aber (nicht nur) den westlichen gesellschaftlichen Mainstream gewonnen haben. In der Pop-Musik ist das Neue zum Wert geworden, der sich im Laufe der Zeit von den Interessen konkreter »neuer Personen« abgekoppelt hat, aber als Werteorientierung fortbesteht bzw. sich verselbstständigt hat. Dennoch gibt es nach wie vor neue Personen mit neuen Erfahrungen in der Pop-Musik, seien es Migranten, seien es Digital Natives. Noch hört man den Klang der Tendenz.
Man kann in diesem Zusammenhang auch eine vierte Beschreibung des Populären einführen, zu der sich Pop-Musik wiederum in besonderer Weise verhält: Das Populäre betrifft gemeinsame soziokulturelle Schicksale. Es überformt gemeinsame Erfahrungen kulturell, die aber im Hinblick auf die Umgebung, in der die leben, die diese Erfahrungen machen, besondere Erfahrungen sind. In dem Moment, in dem sie sich an die Mehrheitsgesellschaft wenden, ist ihre nach innen populäre Musik nicht mehr populär, sondern gewissermaßen individuell. Pop-Musik ist aber oft das Ergebnis einer nicht aufgelösten Spannung von Vereinigung und Trennung, Gemeinsamkeit und Besonderheit. Wenn also gemeinsame Erfahrungen von – sagen wir – afrikanischstämmigen Frauen in Deutschland oder uigurischen Wanderarbeitern unter der Hegemonie von Han-Chinesen gemeinsam gemacht werden, könnte man diejenige Kultur »populär« nennen, die von den gemeinsamen Erfahrungen handelt. Sie erhält einen anderen Charakter, in dem Maße, in dem die interne Intensität dazu beiträgt, dass sie sich von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzt.
Eine letzte Beschreibung des Populären wäre die gerade in Deutschland sehr traditionsreiche kritische Position, die in den industriell produzierten Massenkulturen einen manipulativen Betrug sieht: Was als Genuss, ja Befreiung erscheint, versklavt in Wahrheit. Die heute in gebildeten Kreisen gepflegte Internetskepsis belebt viele dieser Motive in ihrem Feldzug gegen Technoconsumerism. Das Populäre ist im Zeitalter standardisierter industrieller Formate nur noch als Lüge denkbar. Pop-Musik wäre im Verhältnis zu den ruinierten Zeichen und Komponenten dieser heruntergekommenen populären Kultur ein Neuanfang, der aus Trümmern und Ruinen einer entleerten Musik und Sprache etwas Neues beginnt: Indem er die einfachen Akkorde und Schemata mit Körperlichkeit auflädt, von der direkten Übertragung von Stimmen einen Schauer ausgehen lässt, das Entleerte wieder füllt gegen den Sinn der manipulativen Kulturindustrie. Im Zeitalter der planmäßigen Abschöpfung von Metadaten haben wir auf den ersten Blick ein anderes Problem: Nicht mehr die Zeichen sind ruiniert, sondern die sozialen Formate der Partizipation, des Zusammenkommens, der Versammlung von Verschiedenartigkeit. Sie dienen nur noch als Grundstock von Konsumentendaten und -präferenzen, um die es heute allein zu gehen scheint. Aber auch hier wäre das Modell eines anders aufgeladenen Neuanfangs denkbar.
Politik und Pop-Musik: Die Epoche der bemannten Raumfahrt
Allen Konstellationen, in denen ich hier das Verhältnis von Pop-Musik zum Populären beschreibe, ist gemeinsam, dass dem Populären das Statische zugewiesen ist, der Pop-Musik das Dynamische, historisch je Spätere. Pop-Musik beginnt in den mittleren 1950er Jahren. Aber wenn sie neue Zusammenhänge herstellt, müsste man nicht nur danach fragen, was ihr als Musik vorausging, woraus sie sich als Musik entwickelt hat und welche überaus diversen Stile, von Funk bis Punk, von Barber-Shop bis Narzissten-Folk, von Disco bis Grindcore, von Girl-Group-Soul bis zu Improv, sich aus ihr entwickelt haben, sondern auch, welcher andere Zusammenhang ihr vorausging. Das Moment der Erneuerung und der Umwälzung lässt sich nicht nur auf diesen historischen, konkreten Umbruch von Radio-Musik zu Teenager-Plattenspieler-Musik, von Radio-Musik zu Fernseh- und Bild-unterstützter Musik beschränken. Hier spielen noch andere Umbrüche hinein, in denen ganz ähnlich wie in der Pop-Musik enge, an Medien gebundene Formate in sehr komplexe kulturelle Formen übergingen. Dies wird im dritten Teil des Buches vertieft, das den Jazz und die kulturelle Lage der Afroamerikaner als Ausgangspunkt einer anderen Moderne bestimmt.
Analog zu einer aus der Sklaverei heraustretenden kulturellen Praxis (mit der sie freilich nicht verwechselt werden darf), wäre auch die Pop-Musik eine Praxis, die mit fremden Zeichen arbeitet. Wo allerdings die musikalischen Zeichen, die sich der Jazz aneignete, in erster Linie fremd waren, waren die, auf die sich die Pop-Musik in den 50ern bezog, nicht so sehr fremd, sondern vor allem ruiniert und heruntergekommen. Wie die meisten populären Formen waren sie von der kulturindustriellen Zurichtung entstellt.
Den Gegenstand zeitlich so einzugrenzen, dass er mit der von mir am leichtesten zu überblickenden historischen Periode – von meiner Geburt bis zum Redaktionsschluss dieses Buches – zusammenfällt, könnte man mir als Hybris oder Bequemlichkeit auslegen. Aber vielleicht ist diese Periode ja tatsächlich historisch in sich geschlossen. Man könnte sie die Periode der bemannten Raumfahrt der USA, die Zeit der NASA-Astronauten nennen, mit der Pop-Musik in etwa die Lebensdaten teilt. Jedenfalls ist die bemannte Raumfahrt von der Pop-Musik immer sehr interessiert begleitet worden. Doch lässt sich der alte Streit, ob man Pop-Musik nur aus der Erlebensperspektive oder gerade nur aus einer gesellschaftskritisch distanzierten, funktionstheoretischen gerecht wird, nicht so leicht entscheiden. Da in der Pop-Musik-Begeisterung als individuelle Wahrheit erscheint, was zugleich einen objektiven Schritt zur gesellschaftlichen Integration (oder Desintegration oder, sehr viel seltener, Integration in etwas gezielt Anderes, eine »andere Gesellschaft«) darstellt, wird man ihr erst gerecht, wenn man ihren Transformationscharakter von beiden Seiten beleuchtet: die Bilder des subjektiven Dazugehörenwollens wie des Nichtmitmachenwollens und die Antworten von Markt, Staat und Institutionen, vor allem aber den öffentlich ausgestellten Weg zwischen diesen beiden Polen – wie wir noch sehen werden. Wäre Pop-Musik eine Kunst im klassisch-westlichen Sinne des Begriffs, müsste der Dialog zwischen soziologischer und ästhetischer Perspektive nicht eingeklagt werden; die Ästhetik eines kulturellen Formats wie das der Pop-Musik muss erst noch entwickelt werden – soziologische Versuche sind dagegen zahlreich.
Während für die Krise des Populären heute das Problem des Populismus steht, hat die Pop-Musik eine Krise mit der Kritik, namentlich der Gesellschaftskritik, gemein. Dass Kritik einst legitimiert war, indem sie entweder parteilich aus einer bestimmten Perspektive sprach oder im Namen eines universalistischen Ideals, wird ihr heute als blinder Fleck vorgehalten. Denn weder erscheinen parteiliche Perspektiven noch legitim, seitdem bestimmten historischen Subjekten nicht mehr eine universelle Vorreiterrolle zugetraut oder zugestanden wird (wie noch im Marxismus oder auch komplexer in den intersektionalistischen Theorien der Race- / Class- / Gender-Perspektive), noch darf die universalistische Argumentation sich auf mit Kritik notwendig verbundene Standpunkte weiterhin beziehen. So jedenfalls wollen es die hegemonialen politischen und sozialen Philosophien wie etwa die Systemtheorie. Aus dieser Sicht stellt Pop-Musik noch eine Steigerung dessen dar, wofür die Kritik Prügel bezieht. Denn Pop-Musik agiert quasi fundamentalistisch von Partikularstandpunkten aus, die in der Regel nicht einmal im Namen von etwas auftreten, aber dafür oder gerade deshalb mit aller Vehemenz. Hier wird die partikulare Perspektive und die mit ihr verbundene uneingeschränkte Subjektivität an sich schon zur Legitimitätsressource: Ich-Sagen und Allein-Sein reichen schon, um den Schnabel ganz weit aufzureißen und sich zum Außen der Gesellschaft, des Systems, zu erklären.Hinweis
Wer Partikularismus und universalistische Anmaßung (Liebe, Frieden, Party) für prekär hält, dem muss auch die Pop-Musik prekär sein; jedenfalls solange sie sich nicht bloß als ästhetische oder künstlerische Position anbietet. Während die Kritik die Gründe für ihre Parteinahme diskutierbar zu machen versucht, bedeutet eine solche Diskutierbarkeit für die Pop-Musik-Perspektive oft gerade das Ende ihrer Legitimität – zumindest in all den Fällen, etwa HipHop, Punk und früher Rock’n’Roll, in denen diese Perspektive mit Emphase oder Verzweiflung vertreten wird oder wurde.Hinweis Auch wenn dies in der heutigen Pop-Musik, zumal in den immer kunstähnlicher werdenden Mittelschichtsmodellen, seltener geworden ist, so hat Pop-Musik doch lange Zeit das Verschwinden der zurückgedrängten emphatischen Gesellschaftskritik kompensieren dürfen. Seit den 90er Jahren sucht die verbliebene Linke immer wieder nach Ressourcen in der Welt der Pop-Musik. Analog dazu könnte man sagen, dass der Populismus in ähnlicher Weise sich an eine obsolete Idee des Populären klammert, wie das natürlich sympathischere Unternehmen der Kritik in die Pop-Musik investiert.
Pop-Musik war vor etwas mehr als 50 Jahren ein neuer Gegenstand wie Kino vor etwas mehr als 100 Jahren
Aber die Kompensation des Kritischen oder seine verzweifelte Beschwörung in Szenarien der Dissidenz und des Heroismus der Abweichung ist nur eine Bestimmung der Pop-Musik – allerdings eine viel diskutierte. Der Versuch, Pop-Musik überhaupt als Ganzes zu fassen, führt eher zu anderen Vergleichen. Ansätze, die sich entweder nur auf den sozialen Gebrauch der Musik konzentrieren oder sie tatsächlich mit musikimmanenten Kategorien zu treffen meinen, verfehlen das historisch spezifische Auftreten der Pop-Musik und ihre Bedeutung. Selbst wenn sie beides, sozialen Gebrauch und Musik, aufeinander beziehen, tendieren solche Ansätze dazu, sich in Traditionen und gesellschaftlichen Funktionen einzutragen (das Populäre, die populäre Musik). Musik, Gesellschaft, Ritual sind zwar mächtige Motive der Vereinheitlichung, die aber das konstitutiv Zusammengesetzte der Pop-Musik doch nicht erfassen können.
Die Filmwissenschaft dagegen kommt ohne Pseudosoziologie aus und hat keine Schwierigkeit, Experimentalfilme und Soap-Operas zu ihrem Bereich zu zählen, weil sich ihr Gegenstand in letzter Instanz von seiner medialen Materialität herleitet. Der Film war, im Gegensatz zur Pop-Musik, schon da, wenn man nur auf das materiell vorhandene mediale Resultat schaute. Aus seiner arbeitsteiligen Produktion, seiner hybriden Verbindung verschiedener künstlerischer Disziplinen (Theater, Musik, Tanz, Architektur, Bühnenbild etc.) und arbeitsteilig-industrieller Produktionsweise ergab sich ein Gegenstand, schon bevor man ihn von seinen Wirkungen her betrachtete. Die Parameter der Pop-Musik (Star-Körperlichkeit, Sound, spezifische Öffentlichkeit, Intimitätsfunktion) setzen sich nicht an einem Ort zu einem Medium zusammen, weder an einem Ort der Produktion noch an einem Ort der Rezeption.
Der Witz des kulturindustriellen und künstlerischen Formats Pop-Musik ist, dass sie von allen Beteiligten immer wieder aktiv zusammengesetzt werden muss. Das verlorene Ganze, das im Kino von einem medial-technischen Dispositiv zusammengehalten wird, wird in der Pop-Musik von einem einst neuen Rezipiententypus zusammengefügt: dem Fan. Das Format entsteht nicht in der Produktion, nicht in der Abspielstelle, sondern in der Rezeption.
Doch es gibt auch einen medienhistorischen Punkt: Pop-Musik ist die Praxis, die aus der phonographischen Aufzeichnung ein Format ableitet, in dessen Mittelpunkt empirische, konkrete Personen stehen – zunächst repräsentiert durch die einmaligen Geräusche, die ihr Körper hervorbringt.
Denn die medienpositivistischen und produktionsästhetischen Sicherheiten, die der Film zu bieten hatte, lenken den Blick von etwas Wichtigem ab: Zwischen öffentlichen und privaten Rezeptionsformen gibt es Übergänge und Stationen. Dieses Dazwischensein hat Pop immer schon ausgemacht, nun bestimmt es, und zwar ganz massiv, die Bewegt-Bild-Kultur. Der Aufstieg von Download und DVD und der ökonomische Niedergang des Kinos sind die gegenwärtig letzten Akte eines Dramas, das während der ganzen Epoche technischer Reproduzierbarkeit mit wechselnden Akteuren gegeben wird und das auf einen tatsächlich neuen Umstand verweist, der meiner Ansicht nach im Zentrum dessen steht, was wir – im Unterschied zum Populären – Pop nennen: die Möglichkeit, allein zu sein, mutterseelenallein mit der Gesellschaft. Das Bild von der tragbaren Intimität der öffentlichen Walkman-Nutzung hat auch die Nutzer von Bewegtbild-Formaten erreicht. Dabei erreichen mich in meiner abgekoppelten Intimität Gehalte, die von einer öffentlichen und großen Welt erzählen, der ich wiederum meine auf mich gestellte Abgekoppeltheit bei der Rezeption vorführe wie einen schönen Rücken. Um aber Pop-Musik im Unterschied zum Populären jenseits der sich vervielfältigenden Relationen von Öffentlich zu Privat auch auf dem Boden stabiler Praktiken näher zu beschreiben, werde ich versuchen, den hybriden Zeichengebrauch in der Pop-Musik zum Ausgangspunkt einer weiteren Unterscheidung zu machen. Dies geschieht vor allem im zweiten Teil des Buches, der den Zeichenformen der Pop-Musik nachgeht und sich mit den Performance-Formaten beschäftigt, die von diesem Zeichengebrauch hervorgebracht worden sind.
Musik ist das Geräusch, das ein Subjekt macht, Pop-Musik besteht aber auch aus den Geräuschen, die entstehen, wenn jemand gerade nicht Subjekt ist
Pop-Musik ist zum Gutteil eine indexikalische KunstHinweis. In gewisser Weise ist dieser Begriff schon ein Paradox, geht doch klassische Ästhetik davon aus, dass die Künste Sprachen (Symbole) und Bilder (Ikone) bearbeiten, während die indexikalische Komponente den Medienstandards und ihrer Technik überlassen bleibt. So unterliegt die Pop-Musik den wesentlichen Regeln aller indexikalischen Künste oder kulturellen Praktiken, wie sie Roland Barthes für die Fotografie formuliert hat.Hinweis Das Foto ist ein von den Fotografierten durch seine physische Präsenz in einem spezifischen Licht an einem spezifischen Ort verursachtes, also indexikalisches Objekt, dessen Besonderheit sich nie in einem spezifischen Gegenstand, den dokumentarischen oder künstlerischen Zielen des Fotografen realisiert, sondern in einem unwillkürlichen Besonderen, »Punctum« genannt. Es ist ein Detail, das die Kontingenz und Unwiederbringlichkeit des fotografischen Momentes freilegt. Das Punctum ist aber ein Rezeptionsphänomen, es gibt kein objektives Punctum, sondern nur mögliche Puncta. Seine Voraussetzung ist es, dass für den Betrachter gerade da, wo die Spur des Moments eingefroren erscheint, etwas Rührendes, Vergängliches, Lebendiges aufblitzt. Die Kontingenz des Punctums wird sich von ihrer Definition her nie einer Intention fügen, weder einer künstlerisch-formalen noch einer aufklärerisch-dokumentarischen Absicht, das Punctum ist eine quasi metaphysische Zone der reinen Medialität der Fotografie und auch der Phonographie.
Die Konzentration auf unwillkürliche Effekte (der Stimme, des Sound etc.) ist zentral für die Ästhetik der Pop-Musik. So wie sie das soziologisch Unmögliche für sich beansprucht – eine Verbindung eines Außen der Gesellschaft mit einem Innen –, so versucht sie etwas, das nach Barthes eigentlich unmöglich ist, nämlich eine Beherrschung des Punctums.
Damit ist die Pop-Musik ein Kind der phonographischen Epoche. Ihre Produkte sind in erster Linie Studio-Produkte, nicht einem planenden Komponisten oder Textautor zu verdanken (klassische Musik) noch der eine Echtzeitsituation kollektiv bewältigenden Combo (Jazz). Ihr Referenzpunkt ist weder die Komposition (also eine hingeschriebene Absicht) noch das reine recording date, also das Dokument einer Session im Studio oder auf der Bühne, sondern die im Studio gemeinsam mit einem Produzenten fertig gestellte Aufnahme samt der sie untrennbar begleitenden visuellen Verpackungselemente (Cover, Inner Sleeves, Booklet etc. – je spezifische Grafik, Typografie, Fotos etc.).
Die Rezeption von Pop-Musik ist erst vollständig, wenn sie mit diesen verschiedenen, aber aufeinander bezogenen Produkten (oder Produktteilen) verbunden ist, insbesondere mit den Unterschieden, die zwischen den verschiedenen Kommunikationsformen bestehen, etwa zwischen phonographischer Punctum-Rezeption und dem StudiumHinweis der grafik-designerischen Cover-Gestaltung oder den Entscheidungen der Maskenbildner. All diese Dinge bilden also nicht etwa die Umwelt oder den Dekor der Pop-Musik, sondern sind ihr Teil. Es müsste daher gelingen, diese Einheit aus ständig aufeinander verweisenden Elementen – gedruckten Bildern, Gestaltungselementen und Stücken aufgezeichneten Klanges – als eine Einheit, ein Objekt, zu beschreiben. Diese Einheit, dieses Objekt, wird in der Pop-Kommunikation hergestellt, zwar nicht fix, aber doch benennbar. Die Einheit der Pop-Musik ist diese Verbindung aus heterogenen und auf unterschiedliche Weise lokalisierten und lokalisierbaren Medien, Archiven und Distributionskanälen. Diese Einheit ist im Gegensatz zu der Einheit aus Darkroom, frontaler Projektion und belichtetem Zelluloid, die die Rezeptionsstation Kino ergibt, nicht als Institution adressierbar, wird aber in der Lebenswelt so gehandhabt, als wäre sie eine.
Magie und Kulturindustrie: komponierte und/oder massenproduzierte schöne Zufälle
Die frühe Phonographie wurde, stärker noch als die frühe Fotografie, genutzt, um übersinnliche Phänomene zu beweisen und ethnografische Dokumente herzustellen. Diese Funktion wurde von den künstlerischen oder kulturindustriellen Gebrauchsweisen der Phonographie überdeckt oder eingehegt. In der Pop-Musik – gemeint ist ihr begrifflicher Kern, nicht ihre sich mit Kunst oder Kulturindustrie verfransenden Ränder – geht es wieder darum, bezeugende Ton-Dokumente höherer Wesen zu empfangen oder sich und andere als ethnografisch dokumentiert zu erleben.
Die Pop-Musik ist zwar medienhistorisch ein Kind der Phonographie, kulturhistorisch aber in einer Epoche entstanden, die ich die zweite Kulturindustrie nenne, in der der Verbund von Radio und Kino, der die erste, von Adorno und Horkheimer beschriebene Kulturindustrie ausmachte, durch einen zweiten Verbund – den von Pop-Musik und Fernsehen – zwar nicht ersetzt, aber doch an die Seite gedrängt wird. In diesem Verbund übernimmt die Phonographie die Rolle, die Seele, das Kontingente, das Heilige im kulturindustriellen Produkt zu bezeugen: die Zufälligkeiten, die Kiekser, das Korn der Stimme, die Körperlichkeit und die Spur der Produktion auch in den Unfällen und Unschärfen im Umgang mit den (elektrischen) Geräten und Maschinen – aber auch deren ins Signalhafte übergehende Präzision, vor allem in den späteren Epochen. Die Nähetechnologien (Mikrofone, Mehrspurverfahren etc.), die in den 1950ern in Rundfunk- und Recording-Studios einziehen, präferieren den Menschlichkeit, Lebendigkeit, Aktualität bezeugenden kleinen Unfall gegenüber der ausgeleuchteten Schönheit, die Film und Fotografie der Dreißiger zum Ideal erklärt hatten. Es ist das kleine Geräusch, die durch Verstärkung und Mikrofone gerade in menschlichen Stimmen verfügbar gewordene kleine Abweichung vom Ideal, die Überraschung, die ihren Grund in der Individualität der aufgezeichneten Person oder in der Konstellation des Kollektivs haben. Die Rolle der Universalität und Objektivität des Allgemeinen und Neutralen übernehmen hingegen die neuen Standardisierungen und leidenschaftslosen Formate des Fernsehens.
Matrix der Kulturindustrien
1*
2*
Erste Kulturindustrie: Befehl und Traum
Radio: TON, Standard/Alltag, eingehegte Emphase
Kino: BILD, Ausnahme, betonte Emphase, Ideal
Zweite Kulturindustrie: Standardisierung und Identifikation
Fernsehen: BILD +, Standard/Alltag, eingehegte Emphase
Pop-Musik: TON +, Ausnahme, betonte Emphase, Körper
Dritte Kulturindustrie: Kontrolle und Integration durch Spiele
Internet: BILD +, TON +, Standard/Alltag, eingehegte Emphase, betonte Emphase
Outdoor: GPS, Krawall, Parkour, Gathering, Event, Ausnahme, Körper
* In jeder Kulturindustrie baut (1) Stationen des gesellschaftlichen Außen im Innenraum von Familie und Privatheit, während (2) ein (selbstbestimmtes oder privates oder intimes) Innen in das Außen baut.
Bei BILD + ist das Bild zwar noch die zentrale Attraktion, hat aber Funktionen der Tonstation in sich aufgenommen (Nachrichten im Fernsehen), analog funktioniert es bei TON +.
Wenn man das Punctum nie da findet, wo es einer haben wollte, sondern immer irgendwo andersHinweis, kann es auch nicht absichtlich hergestellt werden. Es bleibt ein Rezeptionsphänomen. Daher ist die Fotografie bei Barthes keine richtige Kunst, weder im Sinne bürgerlicher Ästhetik von sich ausdrückenden Einzelnen noch im Sinne eines künstlerischen Handwerks, in dem Meister und Könner eine Technik beherrschen. Sie unterliegt nicht den Intentionen von gezielt kommunizierenden Künstler-Subjekten, sondern bleibt auf Zufälle und einen empathischen, überraschten Betrachter angewiesen, bereit, sich in den Moment zu verlieben, in dem das Leben sich als sterblich zeigt. »Zufall ist keine ästhetische Kategorie«, bemerkte Pierre Boulez zu John Cages Chance Operations: »Man kann nicht Zufall komponieren.«Hinweis An dieser Stelle muss man zwei weitere Umstände in der Entstehungskonstellation von Pop-Musik einführen: die Idee des Readymade und den Entwicklungsstand der Massenkultur während der zweiten Stufe der Kulturindustrie.
In den 50er Jahren ist die Punctum-Frage und die Ästhetik des Indexikalischen ein Thema der avantgardistischen Kunstproduktion, wenn auch nicht unter diesem Namen. John Cages »kleine Geräusche« oder die Kritzelspuren bei WOLS und Jean Fautrier, die Idee informeller Kunst und das Aufkommen künstlerischer Programme wie der Aleatorik sind nur ein paar Beispiele für eine Reihe von Projekten, die das Zufällige und seine Spur gegen die letzten Zuckungen der großen Konstruktivismen und die aufziehende kybernetische Kontrolle in Stellung brachten. Sie alle versuchten, die ästhetische Herausforderung der indexikalischen Aufzeichnungstechnologien – den Punctum-Effekt – in der Ordnung klassischer High-Art-Produktion zu bewältigen. Überall dort, wo das gelang, musste auch die permanente Gefährdung alles Lebendigen, Indexikalisch-Kontingenten betont werden. WOLS und Pollock starben früh und spektakulär wie Buddy Holly oder The Big Bopper. Schon mit dem Readymade (also den Objekten, die Marcel Duchamp im White Cube platzierte; Pissoir, Schaufel usw.) wurde jedoch deutlich, dass in der Kunst Realitätseffekte nicht erzwungen werden können. Ein unter welchen Versuchsanordnungen auch immer in der Ordnung der High-Art gezielt produzierter oder provozierter Punctum-Effekt würde immer nur auf etwas verweisen, was diese Ordnung sehen kann, und das ist in der Regel die Künstler-Subjektivität.
Dieses Problem versuchte die Pop-Musik zu lösen, indem sie die neuen, phonographisch möglich gewordenen isolierbaren Punctum-Effekte nicht gezielt ausstellte (wie Cage und die High-Art der Epoche), sondern einstweilen in eine ganz traditionelle Liedhaftigkeit einbettete, die amerikanischen Traditionslinien Country & Western und Rhythm & Blues. Die drastischeren Geräusche und Nebengeräusche und anderen Kontingenzen, die gezielt Punctum-Effekte erzeugen sollten, blieben verdeckt und bewegten doch. Das lag daran, dass indexikalische Signale von anderer Leute Körperlichkeit, von allen möglichen Zuständen zwischen Erschöpfung bis Aggression, verhaltener Reizbarkeit bis tiefer Verletzung, in einer Genauigkeit und Auflösung übermittelt wurden, wie man das noch nie vorher erlebt hatte. Und zwar zu mir nach Hause. Das Zusammentreffen dieser hohen Auflösung von fremden, Gänsehaut verursachenden Individualitätsspuren und der Empfindsamkeit begünstigenden Rezeptionssituation einer intimen, privaten oder mit meinen Peers geteilten subkulturellen Situation war explosiv. Die neue Technologie war individualisierend und dezentralisierend: Transistorradios, tragbare Plattenspieler und andere Ausrüstungen für die Rezeption durch Jugendliche, ob allein oder mit Freunden.
Who do you love?
Es hatte sich also eine Konstellation aus standardisierter, traditioneller oder kulturindustriell geprägter konventioneller Musik mit durch neue Technologien in hoher Auflösung übertragenen Indizes von fremder und individueller, nicht-standardisierter Körperlichkeit ergeben. Zu dieser Konstellation gehörte notwendig auch ein Publikum, das zunehmend in eigenen und abgetrennten Orten von Jugendzimmer, Peer-Group etc. rezipieren konnte. Das schwierigste Problem innerhalb der neuen Konstellation war der Bezugspunkt dieser faszinierenden Geräusche. In wen oder was bist du verliebt? Der Referent war eben nicht Sexualität oder Vitalität oder Sentimentalität an sich (wie etwa bei herkömmlicher populärer Musik), sondern die Sentimentalität und Sexualität einer bestimmten Person, einer meist schreienden, auftrumpfenden, säuselnden, cool tuenden oder weinenden konkreten Person (oder einer kleinen Gruppe von Personen). Dass es sich um eine konkrete Person handeln muss, die sowohl bestimmt und individuell und ansteuerbar ist als auch zugleich fremd, ist die Voraussetzung dafür, nicht nur allein mit einer Projektion zu sein, sondern allein mit anderen in Potenz. Sie sind konkret wie meine Freunde, aber in dem unendlichen, offenen Raum der Fremdheit sind sie Vertreter der Vielen, die die Gesellschaft ausmachen. Ich kriege also einen Vertreter dieser Gesellschaft, einen solchen Fremden als Vertrauten, frei Haus geliefert über unabstreitbare, fetischisierbare Spuren seiner Körperlichkeit und seiner Gefühle. Dadurch, dass ich ihn mir aus den Informationen zweier ganz unterschiedlicher Zeichentypen – indexikalische, reale Körperlichkeit bezeugende Klänge und Geräusche versus idealisierte, ikonische Visuals – bilde, wird dieser Vertreter in einer besonderen Weise real. Er besetzt nicht nur reale und imaginäre Welt (wie schon der Tonfilmstar), sondern ich habe diese Ebenen zusammengesetzt und ihn konstruiert: Er gehört zu meiner Realität. Die symbolische Ebene, die umgeht mit diesen beiden Ebenen, ist mein Alltag.
Daher sind also die Akteure der Pop-Musik weder reine Darsteller noch reine Sprech-Akteure, die in eigener Sache als reale Personen sprechen. Es ist konstitutiv für alle Pop-Musik, dass in keinem performativen Moment klar sein darf, ob eine Rolle oder eine reale Person spricht. Dies ist eine entscheidende Spielregel. An der Ideologie des Authentizismus – der das Nicht-Darstellen, Nicht-Lügen zum maßgeblichen Kriterium für gute Pop-Musik erhebt – wie an seinem zutiefst verwandten Gegenteil, Rock-Theater, scheitert Pop-Musik nicht nur regelmäßig, wird sie schlecht, nein, über sie gerät sie an eine bald langweilige, absolute Grenze, mit der zu spielen allerdings anfänglich attraktiv ist. Denn der Authentizismus ist zunächst ganz begreiflich: Der Index übermittelt ja tatsächlich authentische Spuren. Unmittelbarkeit ist das Versprechen der Pop-Musik, aber (diese) Unmittelbarkeit ist Ergebnis eines Mittels, ein Medieneffekt. Der Pop-Rezipient wird von einer unstillbaren Neugier nach der Identität seines doch namentlich und mythologisch bekannten Gegenübers angetrieben. Was ist das für ein Typ, für eine Person, wie ist der oder die drauf, welche Haltung vertritt sie, welche Pose hat sie generiert? Wer allerdings glaubt, Pop-Musik sei dann gut, wenn die Frage befriedigend beantwortet werden kann, ist ein Authentizist und hat nichts verstanden; Pop-Musik ist immer so gut wie die Fragen, die zu stellen sie ermöglicht.
Dies ist, wie alle Bedingungen der Pop-Musik, die ich hier zusammenstelle, kein Programm, auch kein Erfolg, kein künstlerisches Ziel einzelner Interpreten, sondern eine unausgesprochene Spielregel, ohne die das, was wir Pop-Musik nennen, nicht funktioniert. Ihre Spielregel unterscheidet sie einerseits von anderen kulturellen Formaten, wird andererseits von diesen, während der letzten 20 Jahre deutlich zunehmend, mit gewissen Modifikationen ebenfalls eingeführt. Das wäre dann die viel beschworene Pop-Kultur – ohne Musik, aber auf der Basis von die Pop-Musik bestimmenden Spielregeln. Je länger es sie gibt, desto mehr differenziert sie sich entlang ihrer Möglichkeiten; Authentizismus und Rock-Theater sind schon lange keine Optionen mehr.
Wie du nur wieder aussiehst!
Auf ein Element wäre dabei noch näher einzugehen, das die Konstellation erst vollständig und lebensfähig macht: das Bild. Die Expansion der Pop-Musik ist ko-extensiv mit den mobilen, billigeren visuellen Techniken. Sie kommt uns nah mit Hilfe des Fernsehens, das den Musikern und den Performern dichter zu Leibe rücken kann, ohne großen Inszenierungsaufwand und bei sich mitunter wöchentlich wiederholenden Auftritten. Aber ebenso wichtig sind die auf Schallplattenhüllen und in den Zeitschriften der Fans verbreiteten Bilder von Musikern in immer wieder anderen, oft auch Rollen und gesellschaftliche Funktionen darstellenden Posen. Darüber hinaus sind die Bildwelten nicht auf Abbildungen der Musiker, fotografierte und andere, beschränkt. Zur visuellen Komponente gehören abstrakte grafische Konzepte (etwa im Techno), die zu bestimmten Labels oder Stilen gehören, Stadt- oder Fantasy-Landschaften, die als Projektionsflächen dienen. Kurz: eine schier unendliche Vielfalt von Bildern, die aber alle auf drei Weisen gebraucht werden: 1. So will ich sein. 2. Den / die will ich haben. 3. Da will ich hin.
Diese Bilder fügen sich nicht einfach dem Begriff des Ikonischen. Sie sind zum Teil nicht nur Bilder, die einer bestimmten Person ähnlich sind, die wir imaginieren oder aus Einzeldaten akkumulieren. Sie funktionieren – man denke an Fotos von Konzerten – teilweise als Dokumente, die das Roh-Material liefern für den entscheidenden Akt nicht nur der Bilder-Rezeption innerhalb der Pop-Musik-Rezeption: das Wiedererkennen. Wiedererkennen ist in Mikro- wie in Makrokonstellationen ein Element jedes Musikhörens. In der Pop-Musik mit ihrer phonographisch-indexikalischen Grundausrichtung wird dieses Wiedererkennen einmal im Sprung zwischen den Zeichengattungen vollzogen und auch innerhalb der Zeichengattungen: ein inszeniertes, ausgeleuchtetes Bild wird auf ein kontingenzreiches Live-Doku-Bild so bezogen wie ein Starschnitt auf einen Sound.
Zwischen zwei Medien entfaltet sich also die Kommunikation der Pop-Musik mit ihren einzelnen oder in kleinen Gruppen rezipierenden Fans: phonographisch aufgezeichnete Stimmen oder Stimmen-äquivalente indexikalische Sounds als Spuren individueller Körper einerseits, Bilder von den Personen oder den von ihnen vertretenen Welten andererseits. Diesem Oszillieren zwischen der intimen und ganz subjektiven Berührung durch die Stimme und dem objektiveren Kontakt mit dem Bild, auf das man zeigen und über das man sich unterhalten kann, entspricht die konstitutive Unklarheit, ob der Pop-Musiker Rolle oder Person ist. Er selbst schwankt zwischen der Rolle, wie sie eher das Bild vertritt, und der Person, wie sie eher die phonographische Aufzeichnung vertritt.
Führerschein auf Probe
Die Unentschiedenheit zwischen den beiden, kaum als Absoluta in Aussicht gestellten Möglichkeiten, Pop-Musik-Produkte zu lesen, wird als Kontaktaufnahme mit einer Gesellschaft gelesen, der man (noch) nicht angehört. Sie eröffnet den Raum für eine probeweise Identifikation, die wieder zurückgezogen werden kann. Ihre Ultima Ratio ist der gleichzeitige Kommunikationsabbruch im Großen bei gleichzeitiger Kommunikationsintensivierung mit Star oder Gruppe im Kleinen: die Urszene von Subkulturalisierung. Politisiert sich diese Subkulturalisierung, kann sie sich selbst als Dissidenz beschreiben, es stehen aber auch viele andere Selbstbeschreibungen zur Verfügung.
Der so entstandene Space von Selbstverständigung und Probehandeln ist traditionell der Zeitraum von Pubertät und Adoleszenz. Gesellschaften des Westens wiesen diesem Space nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue und erweiterte Rolle zu, weil ein traditionelles Hineinwachsen in die Aufgaben und die Ideologie der Erwachsenenwelt nicht mehr reibungslos verlief – die ganze Welt der disziplinierten Erwachsenen hatte sich als problematisch erwiesen, insbesondere in Deutschland. Im Verlaufe der Geschichte der Pop-Musik verselbstständigte sich aber dieser Space der Jugendkultur im gleichen Maße, in dem immer größere Teile der Gesellschaft weniger auf Disziplin und erlernbare Berufskompetenz, sondern stattdessen auf affektive und individuelle Eigenschaften, immaterielle Arbeit ausgerichtet wurden. Immer mehr in sich unterschiedlich strukturierte Subkulturen beerbten die zunächst relativ einheitlichen Jugendkulturen. Dabei blieben aber oppositionelle Modelle für das Verhältnis der Subkulturen zum Ganzen der Gesellschaft als Selbstbeschreibung dominant, auch wenn sich mittlerweile das entwickelt hatte, was Tom Holert und Mark Terkessidis 1996 den »Mainstream der Minderheiten« nannten.
Gemeinde und Elite
Unterschieden werden sollen Positionen in diesem Space: Personen oder subkulturelle soziale Spaces selbst. Diese Unterscheidung kann man auf zwei Weisen treffen. Auf der einen Seite säße der, wenn man seine Distinktionsakte gutheißt, HipsterHinweis, und, wenn man sie nicht gutheißt, auf der andern Seite der Nerd. Entsprechend heißt eine Gemeinschaft, wenn man ihre Integrationseffekte gutheißt, soulful, wenn man sie verachtet, Mainstream. Wenn das Ganze attraktiv gefunden wird, ist es nach dem Modell der spirituell verbundenen, aktiven Rezeptionsgemeinschaft des afro-baptistischen Gottesdiensts, das bis in die Rave-Kultur nachwirkt, soulful, wenn es sich dagegen etwa als kapitalistisch kalkulierte Konsumkultur und deren Konformitätseffekte herausstellt und deshalb abgelehnt wird, ist es Mainstream. Da es in der Pop-Musik darum geht, Nicht-Anschluss oder Sonderkommunikationen zu organisieren, ohne auf Traditionen wie Kirche, Rituale, Kunstvorbehalt etc. auszuweichen, muss immer entschieden werden, ob die jeweilige (vorläufige) Vermittlung zwischen dem Ganzen und dem Alleinsein zu groß oder zu klein ist, und Argumente danach ausrichten, dass das je zu korrigierende Kleine oder Große einen schlechten Namen bekommt, das Nächstgrößere oder Nächstkleinere einen guten.
Tatsächlich lassen sich Subkulturen nicht inhaltlich einfach mit Widerstand oder Dissidenz identifizieren. Gerade die formale, systemtheoretisch inspirierte Beschreibung einer Gesellschaft, die zusehends aus immer mehr sonderkommunikativen Zusammenhängen besteht, welche nicht den klassischen Systemen oder Subsystemen zuzurechnen sind, muss aber darauf hinauslaufen, dass Gesellschaft nur zum Objekt von (radikaler) Kritik werden kann, wenn die Kritiker sich in einem Modus der Vorläufigkeit befinden. Der jugendtypische Aufschub, den Pierre Bourdieu als ein Charakteristikum des Selbstverständnisses (oder der Lebenslüge) vieler auch erwachsener Kulturarbeiter schon in den 1960er Jahren beschrieben hat, wird von der Pop-Musik-Welt mehr oder weniger auf Dauer gestelltHinweis. Dass diese Perspektive unter anderem auch politische Kritik begünstigt, und zwar auch dann noch, wenn diese im Mainstream derselben Gesellschaft konsequent entwertet wird, lässt dann doch die Pop-Musik-Subkulturen als diejenigen Akteure der Demokratie erscheinen, die, anders als die unmittelbar verwickelten Interessenvertreter, einen Blick auf das Ganze nehmen können. Das Missverständnis, dass sie diesen einer revolutionären Tugend oder Unbestechlichkeit als Eigenschaft der eigenen Person verdanken, nicht einer Konstruktion dieser Gesellschaft, auf die sie schauen, ist dabei ihr blinder Fleck.
Primzahl Pose
Das dabei entstandene Vokabular, aus dem Pop-Musik-Kommunikation und auch ihre Meta-Kommunikation besteht, hat als kleinste Einheit weder den Song noch die kulturindustriellen und zuweilen auch künstlerisch geprägten und intendierten Produkt-Einheiten (Album, CD, Live-Show), sondern die immaterielle und mobile, vor allem performativ zu verstehende Einheit Pose. Das, was Pop-Musik-Rezeption und -Kommunikation ausmacht, ist das aktive Transportieren ihrer verschiedenen Rezeptionsszenen in andere Rezeptionsarenen: Intimes in Öffentliches, Peer-Group-Spezifisches in Gesamtgesellschaftliches, Spielerisches in Subkulturelles und vice versa. Dieses aktive, öffentliche und zur Beobachtung einladende Rezeptionstheater konnte, nicht zuletzt, weil es viele Vermarktungsmöglichkeiten bietet und sich auf ein freiwillig stark gebundenes Publikum verlassen kann, schließlich auch das Vorbild und oft das Modell für die aus Pop-Musik hervorgegangene Pop-Kultur werden. Die Konstante, der stabile Referent, den solche Transportaktivitäten brauchen, sind Posen – also eine durch Bilder und klanglich übermittelte Körperlichkeiten dokumentierte und so bezeugte Haltung. Diese Haltung stellt so etwas dar wie eine Handlungsmöglichkeit, die verdorben wäre, wenn sie unmittelbar in Handlung übersetzt würde – oder wenn sie zur Passivität verkäme.
Heutige Pop-Kultur (ohne oder nach Pop-Musik) ist die Imitation sowohl der medialen wie der performativen Besonderheiten der Pop-Musik für vor allem billige Formate der Unterhaltungsindustrie. Auch in Reality-Shows, Versteckte-Kamera-Witzen, aber auch bestimmten Kunstperformances, neo-dokumentarischen (Vanessa Beecroft, Phil Collins, Artur Żmijewski etc.) und interventionistischen (Thomas Hirschhorn, Santiago Sierra etc.) Formaten wird gezielt mit der Ungeklärtheit der Performer-Funktion gearbeitet und eine Attraktionslogik gefördert, bei der Zufälle, Fehler und körperlich verursachte Besonderheiten (allerdings nun kaum noch von Klängen übertragen, sondern ebenfalls von Bildern, oft billigen und digitalen) mit idealisierten Bildern zusammengeführt werden (nun aber bereits von der Produktion, nicht von aktiven Rezipienten).
Die Aktivierung der Rezipienten als Konsumenten ist darüber hinaus entscheidendes Kriterium digitalen Konsums zwischen ewiger Bewertung, digitalem Community-Building und Kommentierungsexzessen. Der schwebende Zustand der Halb-Integriertheit ist nicht mehr in erster Linie eine notwendige Fiktion, um einen Außen-Blick oder eine Vorzimmer-der-Gesellschaft-Illusion zu konstruieren (der die Realität entsprach, dass sich Lebensläufe länger offen halten ließen), sondern ist zum Normalzustand postfordistischer, halb-desintegrierter Verhältnisse geworden.
Eine zukünftige Pop-Musik, die sich von dem, was ich hier Pop-Kultur genannt habe, befreit hätte, kann entweder nur Kunst werden – oder die ursprünglichen Bedingungen verschärfen. Wenn sie Kunst würde, was oft passiert, hat sie wiederum zwei Möglichkeiten: Sie kann einzelne Bestandteile aus der Pop-Musik herauslösen, z.B. eine bestimmte Musik, und diese kunstmäßig, reflektiert und intentional weitertreiben (SunnO)))). Oder, interessanter, sie könnte genau den ganzen Komplex, der Pop-Musik ausmacht und zum Vorbild für Pop-Kultur wurde, als Thema adressieren, als eine Art institutionskritische Meta-Pop-Musik (Terre Thaemlitz). Am Ende des vierten Teils wird dies an einigen Beispielen durchgespielt.
Wenn sie keine Kunst werden will, kann sie tun, was die Techno-Kultur begonnen hat und viele, gelegentlich unter Begriffen wie »Ghetto-Tech« zusammengefasste Gattungen heute jenseits der alten westlich dominierten Pop-Musik weiterzutreiben versuchen: Sie könnte die Elemente von indexikalischer Nähe, des Wiedererkennens und der öffentlichen Orte, Bilder etc. neu justieren: Elemente streichen (den Star), andere erweitern (nicht mehr Körperlichkeit einer Person, sondern, symbolisch neu intepretiert, kollektive Körperlichkeit: Beats). Hier ließe sich noch einiges mehr eintragen, das im Laufe des Buches sich entfalten wird.
Matrix der Integrationen
a) Bürgerliche Kultur: subjektive Erfahrung eines objektiven (Kunst-) Gegenstandes→ durch bürgerliches Kunstgespräch / Kunstöffentlichkeit / Feuilleton wird das Individuelle zur seelischen Voraussetzung des Grundgedankens der bürgerlichen Gesellschaft, einer Gesellschaft der gerade wegen ihrer Verschiedenartigkeit Gleichen.
b) Pop-Musik: subjektives Erleben / Erfahren von objektivierten (öffentlichen) anderen Personen→1. selbst gewählte Sub- oder Proto-Gesellschaft, 2. Semi-Integration (Vorzimmer der Gesellschaft), 3. Dissidenz / Abhauen.
c) Pop-Kultur: Vermischung der drei Formen von Pop-Musik-Integration → Integration in eine allgemeine Mobilisierungskultur von schnell wechselnder Produktion und Rezeption medial vermittelter, hochaufgelöster Lebendigkeit. Mitspielen statt Identifizieren.
***
Obwohl die bis hierhin eingeführten Begriffe und Konstellationen so etwas wie das argumentative Gerüst dieses Buches bilden, werden in den einzelnen Teilen nicht so sehr Teilgebiete diskutiert als vielmehr Teilperspektiven eingenommen, von denen aus auf den Pop-Musik-Komplex geschaut wird. Bestimmte Begriffskonstellationen müssen daher mehrfach passiert werden. Im ersten Teil werden die aufeinander verwiesenen Perspektiven von Rezeption und Produktion aufgerufen, die die Traditionen der Ästhetik so oft gespalten haben. Im zweiten Teil wird Pop-Musik unter dem Aspekt betrachtet, ob man sie als ein Zeichensystem verstehen kann oder als einen bestimmten performativen Umgang mit einem solchen. Im dritten Teil wird geprüft, ob sich Pop-Musik in ein historisches Narrativ eintragen lässt: eine postkoloniale, eine fortschrittsgläubige, pessimistische oder optimistische, europäische oder afrikanische oder globale Geschichte? Im vierten Teil soll Pop-Musik als Kunst oder Nicht-Kunst, Mehr-als-Kunst, Weniger-als-Kunst diskutiert werden: Was ist ihr Material, welche Widerstände überwinden ihre Produzenten, welche Zukunft haben welche Praktiken? Im fünften und letzten Teil geht es schließlich um Pop-Musik und Gesellschaft, die traditionell häufig aufgerufene Legitimationsressource für die Diskussion von Pop-Musik: unsere Jugend, die Zukunft, die Revolution, die Demokratie – wen rettet, wen befördert sie?
ERSTER TEIL:HUMANE FAKTOREN / HUMANE RESSOURCEN
Geschichten aus der Rezeption
Das erste Mal
»Wie war’s beim ersten Mal?«, fragte mich neulich mein freundlicher Internet-Provider. Für sein kleines Boulevard-Feuilleton wurde das Publikum gebeten, das »ganz persönliche Erlebnis« zu schildern, wie’s denn für jeden Einzelnen war beim allerersten und wahrscheinlich alleraufregendsten Erlebnis. Die besten Beiträge werden prämiert.
Von was für einem Erlebnis könnte die Rede sein? In dieser Formulierung? Es müsste eines sein, das jeder und jede gehabt haben und das dennoch etwas ganz Besonderes war und bleibt, wenigstens in der Erinnerung. Absolut unvergleichlich. Diese Charakterisierung widerspricht der vielfach festgestellten Ökonomisierung unseres Lebens, in der nur, was knapp ist, wertvoll sein kann. Etwas, das alle erleben können, kann dies nicht. Nur ganz besondere ideologische Konstruktionen können noch solche Inseln einer nicht-ökonomischen Bewertung aufrechterhalten. Dafür müssen sie entweder das Erlebnis, um das es geht, durch die Hintertür dennoch ökonomisieren – mein Erlebnis war etwas Besonderes, weil es eine Komponente hatte, die nur ich als ganz besonderes (fittes, reiches, mutiges, fleißiges) Individuum »bezahlen« konnte – oder die großen Signifikanten extraökonomischer Welten auffahren: Kunst, Liebe und Gott.
Für diese drei gibt es allerdings jeweils geregelte und regelnde Institutionen, die sie einerseits bewahren und andererseits ihr Verhältnis zur anderweitig aufgebauten Welt der ökonomischen Vernunft verwalten: Museum/Kunstinstitution, Ehe/»Beziehung« und Kirche/Sekte. Was im Einzugsbereich dieser Institutionen passiert, mag hinreichen, einen Sinn des Lebens zu produzieren und Individuen zu stabilisieren, es hat aber nichts mit den Erlebnissen, Grenzüberschreitungen und Initiationsriten zu tun, die das »erste Mal« suggeriert. Das erste Mal führt möglicherweise – als so eine Initiation – in die von den Institutionen geregelte Welt ein, aber um das tun zu können, muss es anders sein als das, was dann diese später uns erleben lassen. Und anders muss es außerdem sein, weil es sonst nicht das Paradox lösen könnte, für alle zugänglich und zugleich ganz besonders zu sein.
Die Kernformel bürgerlich-abendländischer Individualität, dass jeder von uns ganz besonders ist und daher diese Besonderheit berücksichtigende und würdigende, aber gerade darum gleiche Menschenrechte verdient, ist ja auch deswegen von neuen Technologien und alten Reaktionären immer wieder unter Beschuss geraten, weil sie so selten ausgesprochen und expliziert wird. Individualität und Einzigartigkeit haben sich als Werte abgesetzt von ihrer Verknüpfung mit der universellen Idee des Bürger- und Menschenrechts und sind gerade so der Käuflichkeit anheimgefallen. Meine Einzigartigkeit leite ich als Konsumbürger nicht mehr von meiner speziellen Position zur Welt, meinem potenziellen Beitrag zu einer Demokratie ab, sondern von meiner Kaufkraft und deren Überbau oder Software, meinem Geschmack. Gleichheit ist dagegen unter die alt-antikommunistische und dennoch immer noch sehr lebendige ideologische Schimäre der »Gleichmacherei« subsumiert worden. Die verbliebenen Rituale, die Einzigartigkeit und Gleichheit und Gleichheit durch Einzigartigkeit artikulieren, werden nicht mehr so und als solche erlebt. Die Idee, dass sich in dem nur mir zugänglichen, absolut einzigartigen und jede Planbarkeit und Vorhersehbarkeit sprengenden (sexuellen oder künstlerischen) Erlebnis mein allgemeines Menschsein – gerade in dieser unhintergehbaren Unzugänglichkeit für andere – realisiert, ist zugunsten einer undialektischen Betonung nur des ersten Teils des Erlebnisses geschwächt worden. Tatsächlich haben als Letzte wohl manche Hippies LSD und Sex in diesem Sinne verstanden: als Begründung eines Kommunismus auf Basis von Einzigartigkeit.
Übrig geblieben ist, dass Sex nach wie vor als die radikale Grenze der kontrollierten und individuellen Persönlichkeit der Einzelnen gehandelt wird. Wie der Doppelcharakter der Kunst, zugleich käuflich und unbezahlbar zu sein, für besonders begehrenswerte Waren bürgt, so auch der Doppelcharakter des Sex, zugleich völlig allgemein und ganz besonders zu sein. Sex ist in einer Kultur käuflicher Erlebnisse einerseits und der zunehmenden Modellierung des Käuflichen nach der Struktur des prozessualen Events (statt der der fix-gegenständlichen Ware) andererseits das große Vorbild für ultimative Produkte: für Erlebnisprodukte. Dies sind die entscheidenden Produkte, nämlich die, die die Region des Unverkäuflichen erobern und somit sowohl für künftige Expansion wie aktuelle Grenzen eines totalen Kapitalismus stehen. Am Ende sind es diese Produkte, die jene Kernformel bürgerlicher Individualität selbst zur Produktformel werden lassen wollen und – noch wichtiger – aus der politischen Sphäre abziehen.
War ich also in so etwas hineingeraten, als ich an diesem Morgen die kleinen Quatsch-Links dieses Netz-Boulevards zerstreut überflog? Sollte einmal mehr das individuelle Erlebnis des ersten Mals zelebriert werden und übergehen in kleine Anekdoten, die die Größe der menschlichen Gleichheit in Differenz beleidigen und zu einer billigen, verwalteten Gleichheit des Begehrens herabwürdigen? Sollten mit Sex und Kunst schon wieder die Erfahrungen verkauft werden, die mit der transzendenten Erkenntnis des Individuellen als etwas Allgemeinem verbunden sind? Und warum eigentlich sich immer noch dagegen sträuben? Warum immer gleich beleidigt sein, wenn man käuflich wird – ist nicht vielleicht gerade das typisch fürs bürgerliche Bewusstsein, der horror commoditatis? Sollte man nicht stattdessen mit Warhol und Brecht sich einfach hinlegen und nicht mehr kalt und herzlos sein? Das Angebot annehmen, die eigene Subjektivität als Ware zu betrachten, und den mit Verdinglichung womöglich auch verbundenen Demystifikationsgewinn einstreichen?
Mitmachen also? Here we go: Es war eine Nacht im Dezember des Jahres 1972. Dichte Schneeflocken fielen schon früh im Winter auf die nördlichen Hamburger Vorstädte. Ich hörte Earthspan von der Incredible String Band und »Ride the Wind« von den Youngbloods – zwei äußerst sentimentale Werke, die mich in die richtige Stimmung für die große wattige Tumbheit brachten, die sich an die Stunden nach großen sexuellen Erlebnissen oft anschließt. Incredible String Band sangen in »The Actor« von einem einsamen Schauspieler, den ich mir groß, rotgesichtig und fleischig, aber mit kräftigem dunklem Haar vorstellte. Er verlasse, so hieß es, die Bühne mit einer Rose in der Hand. Dieses Kitschbild prägte sich mir vor allem deswegen als rätselhaft und attraktiv ein, weil es mit zwei anderen Informationen verschmolz: An seinen einsamen Abenden las er Algernon Swinburne (dessen ausgewählte Werke ich mir daraufhin in einer DDR-Ausgabe aus der Leihbibliothek Fuhlsbüttel besorgen musste) und aß »mightily with some false lust« – und, ohne den Ausdruck zu kennen, verband sich beides für mich zu einer kräftigen, vorbegrifflichen Idee von Kompensation, gefangen in einer Szene aus dem britischen 19. Jahrhundert. Wein oder Punsch, Euer Gnaden? Dicke Kartoffeln plumpsten in mehlige Soßen und es war nichts als ein Kuss, »a kiss that he found on damp but solid ground«.
»Ride the Wind« wiederum war ein wunderschönes, nichtsnutziges Trio-Jazz-Gedudel über laue kalifornische Nächte, die in irgendwelche unforcierte Zärtlichkeiten übergingen. Ich liebte an dieser Platte ihre Unwichtigkeit. Sie hatte null Prätention, sie war nichts außer süßem, kitschigem Gewinsel zu E-Piano-Jazz. Aber kein slicker Kitsch, sondern amateurhaft. Ich wollte genau das werden, ein E-Pianist, der mit zwei Freunden Kitschjazz daddelnd durch Kalifornien zieht. Besser: eine ganze Welt wie Kalifornien. Alle Lieder handelten von einem ungezwungenen endlosen Zusammensein in wohlriechenden Nächten. Halt: Den kalifornischen Geruch habe ich erst später kennen gelernt und den Erinnerungen an die Projektionen rund um wattig-zärtliches Wohlfühlen hinzugefügt. Es war also …
Doch – Moment. Das Internet-Feuilleton fragte gar nicht nach Sex. Nicht nach frühen Verwirrungen in Schnee und Schnellbus. Es fragte nach dem ersten Rockkonzert im Leben seiner Abonnenten. Denn ein Rockkonzert und für spätere Generationen ein Rave (oder so was) sind, das weiß das Portal instinktiv, genau jenes kulturelle Material, aus dem sich heutzutage die begehrten Formeln ableiten lassen, die das Besondere für alle fassen können. Sie sind wie erster Sex. Die Bücher, die Pop-Musik nun auch von und für Erwachsene nicht mehr wie einen kritisierbaren kulturellen Gegenstand behandeln, nicht mehr wie Kunst, sondern wie ein Fact-of-life, um den herum sich eine Biografie ansiedelt, wie bei anderen um gutes Essen, schöne Knaben oder edle Stoffe, bilden längst ihr eigenes Genre. Pop-Musik sei nicht Kunst, sondern Leben – wie Frauen und Fußball.
In deutscher Sprache haben im letzten Jahrzehnt etwa Konrad HeidkampHinweis, Thorsten KrämerHinweis, Thomas SteinfeldHinweis solche Bücher geschrieben, im englischsprachigen Raum sind sie nicht mehr aufzählbar, oben auf der Liste steht aber natürlich Nick HornbyHinweis. Auch da, wo sie in handfeste Theorie übergehen, macht es ihr Verhältnis zum Gegenstand oft aus, dass dieser nicht restlos theoretisierbar sei, weil er aus biografischem Stoff besteht. In Greil Marcus’ Lipstick Traces hängt, zugespitzt, die ganze Weltgeschichte an einem unaussprechlichen, nur wenige Sekunden andauernden Lärmausstoß, den er in San Francisco, beim letzten Konzert der Sex Pistols, gehört hat. Dieser nicht hintergehbare, letztbegründende Lärm bzw. die weiche Stelle, auf die dieses elektrische Wunder in Greils Seele traf, bleibt der Fluchtpunkt aller Poptheorie – im entscheidenden Moment taucht sie ins Leben ab und niemand kann sie da rausholen. Immer wenn sie’s schon fast nach Academia geschafft hat, erwischt die Theoretiker der biografische Impuls, wollen sie vom ersten Mal erzählen oder von ungewöhnlichem Wetter. Stormy weather, since the day that we’ve been together.
Die Initiation durch z.B. das erste Konzert gehört zu der Sorte Material, an dem das pubertäre wie das bürgerliche Grundproblem sich begegnen – Individualität und Gruppe miteinander zu vermitteln –, und erscheint daher zunächst als eine rein soziale Angelegenheit, oder eben, wie gesehen, als eine rein individuelle: als ein Stück aus dem Fotoalbum nämlich. In beiden Fällen kann es ohne Kunst und Kunstbegriff auskommen. Die daran angeschlossenen Erinnerungen und Erzählungen berichten nicht oder nur selten davon, wie man durch das erste Pop-Konzert zur Musik gekommen ist, sondern wie man dadurch der oder die geworden ist, die wir heute sind. Pop-Musik erscheint hier auf der der Kunst antagonistischen Seite der Welt, dafür in der unmittelbaren Nachbarschaft von Sex. Ein Erlebnis, das woanders hinführt als zu seiner Wiederholung. Zu einer anderen Praxis – Initiation führt immer zu einer anderen Praxis als der, die man bei der Initiation erlebt hat. Sex führt zu Liebe, Erwachsenwerden, Individuation oder zu Bordellen, Bars, Swinger-Clubs – jedenfalls nicht zu weiterem reinen Sex (das wäre noch immer pervers: Sexualität ist ja nur freigegeben, weil sie so wunderbar sozialisiert, also vom »reinen« Sex wegführt). Rock-Musik führt – in dieser Lesart – nicht zu einer weiteren permanenten Beschäftigung mit Rock-Musik, sondern dazu, sich selbst kennen zu lernen, sei es nun, um Soldat, Steuerberater, Kultursenator oder BDI-Chef zu werden – oder Plattensammler, was dem Swinger-Club entspräche. Kunst und Liebe sind von Dauer, Pop, Sex und das Leben dagegen kurz.
Es war vor 43 Jahren. Die Vorgruppe hieß Matthews Southern Comfort. Es war die Band von Ian Matthews, der, wenn ich mich nicht irre, durch eine andere Band bekannt geworden ist: War er nicht einmal bei Fairport Convention? Auf jeden Fall hatten die damals einen Hit mit »Woodstock«, der so genannten Generationshymne von Joni Mitchell, gespielt als Country-Rock mit Pedal Steel Guitar. Auf der Bühne stand auch eine Pedal Steel Guitar, die mich sehr faszinierte, aber sonst kann ich mich an nicht viel erinnern. Ich hatte aber schon mal auf einem Schulfest eine Band live spielen sehen (sie hießen The Selection, Motto: »Pop in Action – The Selection«), der bloße Anblick von Menschen auf einer Bühne konnte es also nicht sein, obschon es sich immerhin um die Bühne der Musikhalle handelte.
Ganz anders erlebte ich den Auftritt der Hauptband, sie hieß Johnny Winter And. Es war ein Auf-Tritt. Winter sprang auf die Bühne wie ein wildes Pferd und rannte unruhig hin und her. Dabei stöpselte er seine Gitarre ein und stieß einen seiner Schreie aus. Diese Schreie waren keine expressiven Kitschschreie authentischer Individualität, sondern pure Soundeffekte, ein Erkennungszeichen. Dieses Erkennungszeichen, offensichtlich live und vor meinen Augen produziert, vereinigte sich mit diesem ebenfalls offensichtlich persönlich anwesenden Körper zu einem sehr kurzen, aber unglaublichen Moment von Präsenz, der mich – wie man so sagt, aber wirklich – erschauern ließ. Dieser bislang nur als medialer Effekt gekannte Winter-Sound, der nur von Fotos bekannte hagere Körper dieses strähnig langhaarigen Albinos erstanden plötzlich als miteinander verbundene Attribute eines sehr wirklichen Körpers vor unserer aller überraschter Augen. Ein Geist war herabgestiegen und benahm sich komisch. Mir stockte der Atem. Wenn ich so sagen darf.
Zu dieser Geschichte gehört normalerweise keine Verteidigungsrede auf die Musik. Initiationen greifen kraft des Rituals, nicht weil der Schamane heute einen guten Tag hatte. Niemand ist verantwortlich für die ganz zufälligen Umstände seiner Initiation. Das ist ungerecht. Meine konnte nur funktionieren, weil es ein gutes Konzert war, im Gegensatz zu Matthews Southern Comfort. Weil es unter anderem nämlich auch gute Kunst war. Johnny Winters Band hieß Johnny Winter And, weil sie einen zweiten Lead-Gitarristen hatte, Rick Derringer. Er war das »Und«, das »Plus«, keine zweite vollständige Person, aber ein ständig präsenter Spiegel oder Doppelgänger. Ein heute vergessener Detroit-Rocker, der in den 60er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, bei den McCoys gespielt hat. Die McCoys kennt die Welt, weil sie einen Hit mit »Hang On Sloopy« hatten, ein Lied, das irgendwann in den globalen Oldie-Automaten eingespeist wurde und daher jederzeit zwischen Tokio und Tübingen aus Supermärkten oder Verkehrsradiosendern erklingen kann. Freilich war es nicht die beste Version von »Hang On Sloopy«. Die dauerte über zehn Minuten und war eine opulente Soul-Oper des großen und noch weiter gehend vergessenen David Porter. Der amerikanische Klassenkonflikt – »Sloopy was from a very bad part of town« – wurde bei Porter unter Aufbietung aller von seinem Kollegen und Freund Isaac Hayes berühmt gemachten Tricks (Flüster-Rezitativ, großes Lautstärke-Spektrum) zu welttheatralischer Größe überhöht, während die weißen McCoys Sloopy zur proletarischen Coolness einer typischen Greaser-Rock-Band runtergekocht hatten, wie Mike Kelley die 60er-Jahre-US-Bands zu nennen pflegte, die gegen die britische Invasion des Beats eine geradlinig stumpfe, amerikanisch-proletarische Rock-Identität verteidigten. Der Sänger der McCoys war, wenn ich mich nicht irre, Mitch Ryder. Ein späterer Liebling des deutschen authentizistischen Rockismus und seiner zentralen Institution, der Fernsehsendung »Rockpalast«.
Man kann Rick Derringer auch über seine Frau kennen, die im Laufe der Jahre sehr viel bekannter wurde, als er es je war. Liz Derringer fand sich nicht mit der Rolle der »Plus One« auf der Gästeliste ab und begann zunächst, Texte und dann Bücher über Rockmusik zu schreiben, schließlich auch über Rockmusikerfrauen und ihren prekären Status, wie er in dem Liebes(sic!)lied der Grateful Dead »Sugar Magnolia« unfreiwillig gruslig auf den Punkt gebracht ist: »She waits backstage, while I sing here for you«. Liz ist im Gegensatz zu Rick noch heute im Geschäft. Damals aber wurden Rick und Johnny Winter zum ersten Gitarrero-Duo der Welt. Der heute viel geschmähte und allein für den Sexismus und Machismus der Rockmusik symbolisch zur Verantwortung gezogene Typus des Gitarrenhelden war gerade erst ein paar Jahre vorher durch seine glänzendsten (Jimi Hendrix) und seine trübsten Vertreter (Eric Clapton) eingeführt und in Serie gegangen. Jeff Beck, John Cipollina, Jerry Garcia, Jorma Kaukonen und Jimmy Page hatten zwar schon begonnen, diesen neuen Typen des Solisten in der bis dahin eher kollektiven und auf gemeinschaftlichen Verabredungen basierenden Gattung der Rockmusik zu bestimmen, nicht als reinen Geschwindigkeits-Gniedler und phallokratischen Poser, dennoch setzte sich gerade auch bei uns sehr jungen Jungen der frühen Siebziger der »schnelle Finger« als Indikator von zu Atemlosigkeit berechtigenden Zuständen durch. Alvin Lees Auftritt im Film Woodstock tat das Seinige. Jimmy Page codierte in »Heartbreaker« von Led Zeppelin II das akzelerierende, sich von Triolen über Pentolen hochjodelnde, vollständig unbegleitete, »nackte« Gitarrensolos erst einmal als gültige Übersetzung einer Mischung aus männlicher Masturbation und (meist sexueller) Aggression. Was diesen Typus des Solo noch eine Weile rettete, entschärfte, kontextualisierte, war indes die Blues-Form, aus der es sich meistens entwickelte.
Doch Johnny Winter war nicht nur ein Schwanz, den der Blues aus seiner Hose herausholte, er war ein dramatisches Signal, eine vollkommen seltsame Präsenz. Er war komplett WEISS. Er hatte ROTEAUGEN. Und er schrie, so lang und hoch und schrill, dass Yoko Ono und Linda Sharrock daneben zu Judy Collins zusammenschnurrten. Mit seinem Bruder Edgar, der noch lauter und länger schreien konnte, aber statt des elektrischen Blues komisch pop-symphonische, kosmische Klang-Dichtungen vorzog und dessen Album Entrance zu den größten unterbewerteten Platten der Pop-Geschichte gehört, sah ich, gemeinsam mit meinem Bruder, Johnny im Fernsehen, in der Sendung »Swing In« (Live-Aufnahmen von Bands, samstags auf ARD), wie sie »Tobacco Road« performten, und Edgar schrie gestoppte zwanzig Sekunden.Hinweis So waren sie, die beiden Albino-Brüder. Und wie die aussahen! Dieser ausgemergelte (vielleicht süchtige: was weiß ich!), superdünne Körper, an dem arschlange, fettige, extrem dünne weiße Haare und Fransen von Cowboy-Klamotten herabhingen, als gelte es, die ganze Welt zu streicheln oder mit Speed-Lines zu durchpflügen. Dieser dünne, flinke, superschnelle Gitarrero flutschte aus irgendeiner Nacht des Backstage-Bereichs auf die Bühne, plugtein und katapultierte sich wie ein gesalbtes Gummiband in eine heilige Hamburger Nacht.