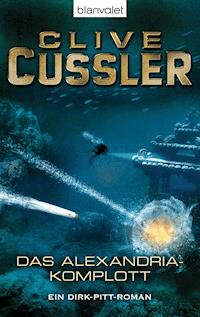
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dirk-Pitt-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach einem gesunkenem russischen Atom-U-Boot machen Major Dirk Pitt von der amerikanischen Meeresbehörde NUMA und seine Mannschaft vor der Küste Grönlands eine sensationelle Entdeckung: ein im Eis eingeschlossenes byzantinisches Handelsschiff. Alle Papiere weisen daraufhin, dass sich im Bauch des alten Schiffes die wertvollsten Stücke der verloren geglaubten Bibliothek von Alexandria befinden. Diese Bibliothek – sie galt in der Antike als eines der sieben Weltwunder – enthielt nicht nur bedeutende literarische und kulturgeschichtliche Werke, sondern auch Landkarten von unschätzbarem Wert, verzeichnen sie doch die Lage vergessener Erdölfelder, Gold- und Edelsteinminen. Major Pitt weiß eines ganz genau: Die Kenntnis dieser Fundstätten könnte das weltpolitische Machtgefüge aus den Angeln heben, wenn sie in die falschen Hände geriete. Doch noch bevor er alle Vorkehrungen treffen kann, beginnt bereits ein gnadenloser Kampf - zu Wasser, zu Lande und in der Luft -, der alles Leben auf der Erde zerstören kann...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 830
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
Das Alexandria-Komplott
Roman
Übersetzt von Dörte und Frieder Middelhauve
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Treasure«
bei Simon & Schuster, Inc., New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © der Originalausgabe 1986
by Clive Cussler Enterprises, Inc.
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613 New York, NY 10176 - 0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1989 by Blanvalet
Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter
Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-15210-9
www.blanvalet.de
Im Andenken an
ROBERTESBENSON
einen besseren Freund gibt es nicht
Die Bibliothek von Alexandria gab es tatsächlich. Wenn sie von Kriegen und religiösen Eiferern unberührt geblieben wäre, hätte sie uns nicht nur Wissen über das ägyptische, das griechische und das Römische Reich vermittelt, sondern auch über die wenig bekannten Zivilisationen, die, weit entfernt von den Küsten des Mittelmeeres, blühten und schließlich versanken.
Im Jahre 391 n. Chr. befahl der christliche Kaiser Theodosius, alle Bücher und Kunstwerke, die auch nur im Entferntesten heidnische Themen oder Motive zum Inhalt hatten, zu verbrennen und zu zerstören. Darunter befanden sich auch die Werke der unsterblichen griechischen Philosophen.
Man nimmt an, dass ein großer Teil der Sammlung im Geheimen gerettet und versteckt worden ist. Was aus der Bibliothek wurde oder wo dieses Versteck liegt, ist auch sechzehn Jahrhunderte danach noch ein Rätsel.
Prolog: DIE BEWAHRER
15. Juli 391 n. Chr.
In einem unbekannten Land
Ein kleines, flackerndes Licht tanzte zitternd durch das Dunkel des Zugangsschachts. Ein Mann in einer Wolltunika, die seine Knie bedeckte, blieb stehen und hob das Öllämpchen über seinen Kopf. Der schwache Schein beleuchtete eine menschliche Gestalt in einem mit Gold und Kristall verzierten Sarg und warf dabei einen grotesken, bebenden Schatten an die glattpolierte Wand im Hintergrund. Der Mann in der Tunika starrte einen Augenblick in die leblosen Augen, dann ließ er die Lampe sinken und wandte sich ab.
Er musterte prüfend die Umrisse der zahllosen Kisten, die vollkommen unberührt dastanden und sich in den dunklen Tiefen der Höhle bis in die Unendlichkeit fortzusetzen schienen.
Junius Venator ging weiter. Seine Sandalen, die mit langen Schnüren festgehalten wurden, verursachten auf dem unebenen Boden so gut wie kein Geräusch. Nach und nach weitete sich der Tunnel und mündete in eine geräumige Galerie. Die sanft geschwungene Decke wölbte sich in beinahe zehn Metern Höhe über ihm und wurde durch eine Anzahl Stützbögen und Säulen unterteilt.
In den Sandstein gemeißelte Rinnen verliefen vertikal an den Wänden, sodass sich das Sickerwasser in den tiefen Dränagebassins sammeln konnte. Die Wände waren von Hohlräumen übersät, die mit Tausenden von seltsam anmutenden, runden Bronzebehältern gefüllt waren.
Wenn man von den riesigen hölzernen Särgen absah, die im Zentrum der künstlichen Höhle standen, hätte man diesen furchteinflößenden Ort mit den Katakomben von Rom verwechseln können.
Venator warf einen prüfenden Blick auf die Kupferplättchen an den Kisten und verglich die Zahlen darauf mit denen auf der Schriftrolle, die er auf einem kleinen Tisch ausgebreitet hatte. Die Luft war trocken und schwer. Schweiß durchdrang allmählich die Staubschicht, die seine Haut bedeckte. Zwei Stunden später, als er sich vergewissert hatte, dass alles katalogisiert und in bester Ordnung war, rollte er das Pergament zusammen und verstaute es in einem Beutel, der an seiner Hüfte hing.
Er warf noch einen letzten, traurigen Blick auf die Kunstwerke in der Galerie und stieß einen Seufzer des Bedauerns aus. Er wusste genau, dass er sie niemals wieder sehen oder berühren würde. Erschöpft drehte er sich um, streckte den Arm mit der kleinen Lampe aus und verließ den Tunnel ebenso, wie er gekommen war.
Venator war kein junger Mann mehr; er ging auf sein siebenundfünfzigstes Lebensjahr zu, und damals war das ein greises Alter. Das graue, tiefgefurchte Gesicht, die eingefallenen Wangen, müde schlurfende Schritte spiegelten die Mattigkeit eines Menschen wider, dem nicht mehr viel am Leben lag. Die ungeheure Aufgabe war erfolgreich zu Ende geführt, die schwere Last von seinen gebeugten Schultern genommen worden. Jetzt musste er nur noch die weite Reise nach Rom überstehen.
Er wählte den ganz auf der linken Seite gelegenen Zugang und ging auf den fahlen Schimmer des Tageslichts zu. Der Eingangsschacht war in einer kleinen Grotte von Hand ausgehoben worden und maß zweieinhalb Meter im Durchmesser – gerade so breit, dass die größten Holzkisten hindurchgezogen werden konnten.
Plötzlich brach sich das Echo eines fernen Schreies, der von draußen hereindrang, im Schacht. Besorgt runzelte Venator die Stirn und lief schneller. Aus alter Gewohnheit kniff er die Augen zum Schutz gegen die blendende Helle der Sonne zusammen, als er ins Tageslicht trat. Er zögerte und warf einen prüfenden Blick auf das Lager, das nicht weit entfernt auf der sanft abfallenden Ebene lag. Eine Gruppe römischer Legionäre umringte einige Barbarenfrauen. Ein junges Mädchen schrie erneut auf und versuchte den Soldaten zu entkommen. Es gelang ihm beinahe, den Kreis zu durchbrechen, doch einer der Männer hielt es an ihrem langen, wehenden schwarzen Haar fest. Er riss es zurück, es stolperte und brach auf dem grobkörnigen Sand in die Knie.
In diesem Augenblick entdeckte ein riesiger, muskulöser Kerl Venator und kam herbei. Der Mann war ein Koloss, der jeden anderen im Lager um Haupteslänge überragte; mit ausladenden Schultern und Armen wie Eichenstämme. Seine Hände reichten beinahe bis zu den Knien.
Latinius Macer, ein Gallier, war der Oberaufseher der Sklaven. Er hob grüßend die Hand. Seine Stimme klang überraschend hoch.
»Ist alles bereit?«, erkundigte er sich.
Venator nickte. »Die Bestandsaufnahme ist beendet. Du kannst den Zugang versiegeln.«
»Der Befehl wird sofort ausgeführt.«
»Was ist das für eine Unruhe im Lager?«
Macers schwarze, kalte Augen blickten zu den Soldaten hinüber, und er spuckte auf den Boden. »Die dämlichen Legionäre sind unruhig geworden und haben fünf Lequas nördlich von hier ein Dorf überfallen und mindestens vierzig Barbaren getötet. Das Massaker war vollkommen überflüssig. Sie haben weder Gold noch Beute, die auch nur Mulikacke wert gewesen wäre, mitgebracht. Mit ein paar hässlichen Weibern sind sie zurückgekehrt, um die jetzt gespielt wird. Das war’s eigentlich.«
Venators Gesichtszüge spannten sich. »Gab es Überlebende?«
»Es heißt, dass zwei Männer ins Unterholz entkommen sind.«
»Die werden die übrigen Dörfer warnen. Ich befürchte, Severus hat in ein Hornissennest gestochen.«
»Severus!«, stieß Macer hervor und spuckte noch einmal verächtlich. »Dieser verdammte Centurio und seine Bande tun nichts weiter als schlafen und unsere Weinvorräte leersaufen. Wir haben uns nur Schwierigkeiten aufgehalst, indem wir diese Faulpelze mitgenommen haben.«
»Sie wurden angeheuert, damit sie uns beschützen«, erinnerte ihn Venator.
»Wovor denn?«, wollte Macer wissen. »Vor primitiven Eingeborenen, die sich von Insekten und Reptilien ernähren?«
»Trommle die Sklaven zusammen und versiegle umgehend den Tunnel, aber gründlich. Die Barbaren dürfen keine Möglichkeit haben, sich durchzugraben, wenn wir die Gegend verlassen haben.«
»Keine Sorge. Soweit ich gesehen habe, hat in diesem verdammten Land noch keiner die Kunst des Schmiedens erlernt.« Macer hielt inne und wies zu dem massiven Hügel aus ausgeschachtetem Erdreich, der sich über dem Stolleneingang erhob und beängstigend dürftig von einem riesigen Holzgerüst an Ort und Stelle gehalten wurde. »Wenn das erst einmal heruntergekracht ist, brauchst du dir wegen der wertvollen Altertümer keinerlei Gedanken mehr zu machen. Da kommt ein Barbar niemals dran. Jedenfalls nicht, wenn er zum Schaufeln auf seine bloßen Hände angewiesen ist.«
Zufrieden entließ Venator den Aufseher und lief zum Zelt von Domitius Severus. Er kam an den Insignien der Militärabteilung vorbei, einem silbernen Symbol, das Taurus, den Bullen, auf der Spitze einer Lanze darstellte. Den Wachposten, der versuchte, ihm den Zugang zu verwehren, schob er kurzerhand beiseite.
Er traf den Centurio auf einem Zeltstuhl sitzend an, wie er nachdenklich eine ungewaschene Barbarenfrau betrachtete, die, in Hockstellung, seltsam gutturale Laute von sich gab. Sie war noch jung, nicht älter als vierzehn. Severus trug eine kurze rote Tunika, die über der linken Schulter zusammengerafft war. Die bloßen kräftigen Oberarme zierten zwei Bronzereifen. Es waren die muskulösen Arme eines Soldaten – dazu ausgebildet, Schwert und Schild zu führen. Bei Venators plötzlichem Auftauchen machte sich Severus gar nicht die Mühe aufzusehen.
»So verbringst du also deine Zeit, Domitius?«, schnappte Venator. In seiner Stimme schwang eiskalter Sarkasmus mit. »Du schmähst den Willen Gottes durch die Vergewaltigung eines Heidenkindes?«
Langsam wandte Severus seine harten grauen Augen Venator zu. »Der Tag ist zu heiß für dein christliches Gewäsch. Mein Gott ist toleranter als der deine.«
»Richtig, aber du betest einen Götzen an.«
»Darüber lässt sich kaum streiten. Keiner von uns beiden hat seinen Gott je zu Gesicht bekommen. Wie soll man beurteilen, wer recht hat?«
»Christus war der Sohn des einzigen, wahren Gottes.«
Severus warf Venator einen wütenden Blick zu. »Was willst du hier? Sag mir, was du zu sagen hast, und dann geh.«
»Damit du dich an dieser armen Heidin vergehen kannst?«
Severus antwortete nicht. Er stand auf, packte das jammernde Mädchen am Arm und schleuderte es grob auf seine Pritsche.
»Hast du Lust, mir dabei Gesellschaft zu leisten, Junius? Du darfst den Anfang machen.«
Venator starrte den Centurio an. Ein Angstschauer überlief ihn. Von einem römischen Centurio, der eine Kohorte befehligte, wurde erwartet, dass er über eine unerbittliche Persönlichkeit verfügte. Dieser Mann aber war ein Wilder.
»Unsere Aufgabe hier ist beendet«, stellte Venator fest. »Macer und die Sklaven bereiten die Versiegelung der Höhle vor. Wir können das Lager abbrechen und zu den Schiffen zurückkehren.«
»Morgen sind elf Monate vergangen, seit wir Ägypten verlassen haben. Ein Tag mehr, um die örtlichen Freuden zu genießen, sollte da keine Rolle spielen.«
»Wir sind nicht gekommen, um zu plündern. Außerdem werden die Barbaren auf Rache sinnen. Wir sind nur wenige, die gegen viele stehen.«
»Ich halte mit meinen Legionären jeder Horde von Barbaren stand, mag sie noch so groß sein.«
»Deine Männer sind längst verweichlicht.«
»Aber sie haben nicht vergessen, wie man kämpft«, widersprach Severus mit zuversichtlichem Lächeln.
»Und du meinst, sie werden für die Ehre Roms sterben?«
»Warum sollten sie das? Warum sollte überhaupt einer von uns sterben? Die ruhmreichen Jahre des Imperiums sind gekommen und vergangen. Unsere einstmals so strahlende Stadt am Tiber ist zum Elendsviertel verkommen. In unseren Adern fließt nur noch wenig römisches Blut. Die meisten meiner Männer stammen aus den Provinzen. Ich bin Spanier, und du bist Grieche, Junius. Wer kann in diesen Tagen des Chaos einem Kaiser gegenüber, der weit im Osten in einer Stadt herrscht, die keiner von uns jemals gesehen hat, auch nur eine Unze Treue empfinden? Nein, Junius, meine Soldaten kämpfen nur, weil es ihr Beruf ist, weil sie dafür bezahlt werden.«
»Es wäre möglich, dass die Barbaren sie dazu zwingen.«
»Wir werden uns um dieses Pack kümmern, wenn die Zeit gekommen ist.«
»Es wäre besser, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Lass uns noch vor Einbruch der Dunkelheit in See stechen.«
Venator wurde von einem lauten Rumpeln unterbrochen, das den Boden erzittern ließ. Er eilte aus dem Zelt und blickte zum steilen Wall hinüber.
Die Sklaven hatten die Stützen unter dem Gerüst, das den Erdwall vor der Grotte zurückgehalten hatte, weggezogen und dadurch eine donnernde Lawine ausgelöst, die über die Höhlenöffnung hinwegfegte und sie unter Tonnen massiver Felsbrocken begrub. Eine große Staubwolke türmte sich auf und füllte die Schlucht. Hochrufe der Sklaven und Legionäre folgten dem donnernden Echo.
»Es ist vollbracht«, murmelte Venator. Seine Stimme klang ernst, sein Gesicht wirkte erschöpft. »Das Wissen der Vergangenheit ist in Sicherheit.«
Severus kam heran und blieb neben ihm stehen. »Ein Jammer, dass man das nicht auch von uns sagen kann.«
Venator drehte sich um. »Wenn Gott uns eine ruhige Heimfahrt schenkt, was haben wir dann zu fürchten?«
»Folter und Exekution«, stellte Severus mit ausdrucksloser Stimme fest. »Wir haben uns dem Kaiser entgegengestellt. Theodosius vergibt nicht leichten Herzens. Es wird im ganzen Imperium keinen Ort für uns geben, an dem wir uns verstecken können. Es wäre besser, wir würden in der Fremde Zuflucht suchen.«
»Meine Frau und meine Tochter … ich sollte sie im Landhaus unserer Familie in Antiochia treffen.«
»Die Agenten des Kaisers haben sie wahrscheinlich mittlerweile gefasst. Entweder sie sind tot oder in der Sklaverei gelandet.«
Ungläubig schüttelte Venator den Kopf. »Ich habe mächtige Freunde, die sie bis zu meiner Rückkehr beschützen werden.«
»Freunde können bedroht oder gekauft werden.«
Venators Augen blitzten trotzig auf. »Für das, was wir erreicht haben, ist kein Opfer zu groß. Alles wäre umsonst gewesen, wenn wir nicht mit den Aufzeichnungen und einer Karte unserer Reise nach Hause zurückkehren würden.«
Severus wollte gerade etwas erwidern, als er den Hauptmann Artorius Noricus erblickte, der den leichten Abhang herauf auf das Zelt zugelaufen kam. Das dunkelhäutige Gesicht des jungen Legionärs glänzte in der Mittagshitze. Aufgeregt deutete er zum Kamm der niedrigen Bergrücken hinüber.
Venator hob die Hand, um seine Augen gegen die Sonne abzuschirmen, und sah in die Richtung. Sein Mund presste sich zu einem schmalen Strich zusammen.
»Die Barbaren, Severus. Sie sind gekommen, um uns den Überfall auf das Dorf heimzuzahlen.«
Die Berge sahen aus, als wimmelten sie von Ameisen. Mehr als tausend Barbaren, Männer und Frauen, starrten auf die Eindringlinge herab, die in ihr Land eingefallen waren. Sie waren mit Pfeil und Bogen, Lederschilden und Speeren mit Obsidianspitzen bewaffnet. Einige hielten Steinkeulen in der Hand, die an kurzen, hölzernen Griffen befestigt waren. Die Männer trugen nur Lendenschurze.
In eisigem Schweigen verharrten sie auf den Hügeln, wild und bedrohlich wie ein aufziehender Sturm.
»Eine weitere Gruppe Barbaren hat sich zwischen uns und unseren Schiffen versammelt!«, rief Noricus.
Venator drehte sich mit aschfahlem Gesicht um. »Das ist nun das Ergebnis deiner Dummheit, Severus.« Seine Stimme klang schrill vor Wut. »Du hast uns alle in Gefahr gebracht.« Dann sank er auf die Knie und fing an zu beten.
»Deine Frömmelei wird die Barbaren nicht in Schafe verwandeln, Alter«, bemerkte Severus sarkastisch. »Nur das Schwert kann hier Abhilfe schaffen.« Er drehte sich um, fasste Noricus am Arm und gab seine Kommandos. »Befehle dem Bucinator, zur Schlacht zu blasen. Weise Latinius Macer an, die Sklaven zu bewaffnen. Formiere die Männer zum Schlachtkarree. In dieser Formation marschieren wir zum Fluss.«
Noricus salutierte und lief dann zum Mittelpunkt des Lagers.
Die Fußsoldaten bildeten unverzüglich ein im Innern offenes Viereck. Die syrischen Bogenschützen gingen an den Flanken, zwischen den bewaffneten Sklaven an der Außenseite, in Stellung, während die Römer Spitze und Schluss der Kolonne bildeten. Im Zentrum befanden sich Venator, sein kleiner Stab ägyptischer und griechischer Diener und eine drei Mann starke Sanitätsabteilung.
Statt schnell zum Angriff vorzurücken, nahmen sich die Barbaren Zeit und kesselten die Kolonne langsam ein. Zunächst versuchten sie, die Soldaten aus den dicht geschlossenen Reihen zu locken, indem ein paar Männer vorgeschickt wurden, die seltsame Worte schrien und bedrohlich gestikulierten. Doch die kleine Gruppe des Feindes geriet nicht in Panik und wurde nicht in die Flucht geschlagen, wie die Barbaren das gehofft hatten.
Centurio Severus war viel zu erfahren, als dass er Furcht empfand. Er trat vor die Linie, die seine Männer bildeten, und begutachtete das Terrain, in dem es von Barbaren nur so wimmelte.
Verächtlich winkte er ihnen zu. Dies war nicht das erste Mal, dass er einer überwältigenden Übermacht gegenüberstand. Mit sechzehn Jahren hatte sich Severus freiwillig zur Legion gemeldet. Er war vom gewöhnlichen Soldaten aufgestiegen und hatte in den Schlachten gegen die Goten an der Donau und die Franken am Rhein verschiedene Auszeichnungen für außerordentliche Tapferkeit errungen. Nach seiner regulären Dienstzeit war er Söldner geworden, ein Mann, der sich demjenigen verdingte, der das meiste Geld bot, und in diesem Fall war das Junius Venator gewesen.
In seine Legionäre setzte Severus unerschütterliches Vertrauen. Die Sonne glitzerte auf ihren Helmen und den gezogenen Schwertern. Das waren geübte Kämpen, schlachterprobte Männer, sieggewohnt, die noch nie eine Niederlage hatten hinnehmen müssen.
Die meisten Tiere, einschließlich seines Pferdes, waren auf der beschwerlichen Reise von Ägypten hierher gestorben. Deshalb schritt er nun an der Spitze der rechteckigen Formation und wandte sich alle paar Schritte um, um ein aufmerksames Auge auf den Feind zu richten.
In diesem Augenblick stürzten die Barbaren mit einem Gebrüll, das wie eine tosende Brandung anschwoll und sich brach, den sonnenüberfluteten Hang hinab und fielen über die Römer her. Die erste Angriffswelle wurde von den langen Wurfspeeren der Soldaten und den Pfeilen der syrischen Bogenschützen zurückgeworfen. Die zweite Welle kam, brandete gegen die dünnen Linien und wurde wie Weizen unter der Sichel niedergemäht. Die glitzernden Schwerter färbten sich rot mit Barbarenblut. Die Sklaven, getrieben von saftigen Flüchen, bedroht von der Peitsche Latinius Macers, hielten sich prächtig und gaben nicht nach.
Als von allen Seiten Barbaren heranstürmten, die immer wieder von den hinteren Reihen Verstärkung erhielten, kam die Abteilung ins Stocken. Breite rote Rinnsale durchzogen die Erde des sanften Abhangs. Nackte Körper brachen leblos zusammen, doch die Nachdrängenden beachteten während des Kampfes die Leichen ihrer Stammesgenossen nicht. Zersplitterte Waffen, die auf dem Schlachtfeld verstreut waren, schnitten in ihre bloßen Füße, während sie ihre ungeschützten Körper blindwütig gegen die schrecklichen Eisenschäfte warfen, die ihnen in Brustkörbe und Mägen fuhren. Im Nahkampf waren sie der römischen Disziplin hoffnungslos unterlegen.
Dann nahm die Schlacht eine Wende. Als die Barbaren merkten, dass sie gegen die Schwerter und Speere nicht ankamen, zogen sie sich zurück und gruppierten sich neu. Während die Frauen mit Steinen warfen, schossen die Männer Pfeilschwärme ab und schleuderten ihre primitiven Speere gegen den Feind.
Die Römer hielten die Schilde über ihre Köpfe wie große Schildkrötenpanzer und setzten standhaft ihren Marsch zum Fluss und in die Sicherheit ihrer Schiffe fort. Jetzt waren nur noch die syrischen Bogenschützen in der Lage, den Barbaren Verluste beizubringen. Es waren jedoch nicht genug Schilde verfügbar, um auch die Sklaven damit auszurüsten; diese mussten ungeschützt im Pfeilhagel kämpfen. Und die Männer waren von der langen, ermüdenden Reise und dem anstrengenden Ausschachten der Höhle erschöpft. Viele fielen und wurden zurückgelassen, wo ihre Leichen sofort entkleidet und entsetzlich verstümmelt wurden.
Mit dieser Art Kampf hatte Severus Erfahrung: dasselbe hatte er im Krieg gegen die Briten erlebt. Als er merkte, dass der Feind impulsiv und ohne jedes Konzept vorging, befahl er, haltzumachen und alle Waffen auf den Boden zu legen. Die Barbaren, die dies als Zeichen des Ergehens werteten, wurden dadurch zum Sturmangriff ermuntert. Dann, auf Severus’ Befehl hin, schnappten sich die Römer ihre Schwerter und formierten sich blitzschnell zum Gegenangriff.
Der Centurio umging zwei Felsen und schwang sein Schwert in beinahe metronomischem Rhythmus. Vier Barbaren brachen zu seinen Füßen zusammen. Mit einem wilden Schlag mit der flachen Klinge brachte er einen weiteren zu Fall und schlitzte dem, der seitwärts heranstürmte, die Kehle auf. Dann ebbte die wütende Flut ab, und die nackte Horde zog sich zurück.
Severus nutzte die Atempause, um seine Verluste zu überblicken. Von seinen sechzig Soldaten waren zwölf entweder tot oder lebensbedrohlich verwundet. Vierzehn weitere hatten die unterschiedlichsten Verletzungen erlitten. Die Sklaven hatte es am meisten getroffen. Über die Hälfte war getötet worden oder nicht mehr aufzufinden.
Er trat auf Venator zu, der sich gerade mit einem abgerissenen Stück seiner Tunika eine klaffende Wunde am Arm verband. Der griechische Gelehrte trug immer noch das kostbare Verzeichnis unter der Schärpe.
»Noch dabei, alter Mann?«
Venator blickte auf, und seine Augen glühten vor Angst und Durchhaltewillen. »Du wirst vor mir ins Gras beißen, Severus.«
»Ist das eine Drohung oder eine Prophezeiung?«
»Spielt das eine Rolle? Keiner von uns wird je das Imperium wiedersehen.«
Severus antwortete nicht, denn der Kampf flammte abrupt wieder auf, als die Barbaren eine weitere Salve von Speeren und Steinen, die den Himmel verdunkelten, abfeuerten. Schnell nahm Severus wieder seinen Platz an der Spitze des dezimierten Karrees ein.
Die Römer kämpften erbittert, doch ihre Reihen begannen sich unaufhaltsam zu lichten. Beinahe alle syrischen Bogenschützen waren inzwischen gefallen. Das Karree schloss sich noch enger zusammen, während der wütende Ansturm ohne Unterlass weiterging. Die Überlebenden, viele von ihnen verwundet, waren erschöpft und litten unter der Hitze und dem Durst. Ihre Schwertstreiche erlahmten, und sie mussten die Waffe von einer Hand in die andere wechseln.
Die Barbaren waren gleichermaßen erschöpft, und auch sie erlitten große Verluste. Dennoch verteidigten sie verbissen jeden Meter des sanften Hügels, der zum Fluss hin abfiel. Um jeden erschlagenen Legionär konnte man ein halbes Dutzend Barbarenleichen zählen. Die Körper der Söldner, von Pfeilen gespickt, sahen aus wie Nadelkissen.
Der hünenhafte Aufseher, Macer, war am Knie und in der Hüfte getroffen worden. Er blieb auf den Beinen, doch er konnte mit der Abteilung, die schleppend weiterrückte, nicht länger Schritt halten. So fiel er zurück und zog bald die Aufmerksamkeit einer Gruppe von zwanzig Barbaren auf sich, die ihn schnell umzingelte. Er fuhr herum, schwang sein Schwert wie Windmühlenflügel und köpfte drei von ihnen, bevor der Rest sich zurückzog und voller Respekt vor seiner fürchterlichen Stärke zögerte. Er schrie und winkte ihnen zu, sie sollten herankommen und kämpfen.
Aber die Barbaren hatten ihre Erfahrungen bereits bitter bezahlen müssen und waren nicht mehr bereit, sich auf einen Nahkampf einzulassen. Sie hielten sich in guter Entfernung und schleuderten einen Speerhagel gegen Macer. Sekunden später schoss aus fünf Wunden in seinem Körper das Blut. Ein Barbar lief dicht heran, schwang seinen Speer und traf Macer in die Kehle. Als dieser darauf langsam zusammenbrach und in den Staub sank, näherten sich Barbarenfrauen wie ein Rudel tollwütiger Wölfe und steinigten ihn so lange, bis sein Körper zu einer unkenntlichen Masse geworden war.
Nur ein hoher Sandsteinfelsen trennte die übrigen Römer noch vom Flussufer. Doch die Barbaren griffen beide Flanken an und attackierten sie erbittert. Einige der Sklaven ließen die Arme sinken, um sich zu ergeben, und wurden kurzerhand abgeschlachtet. Andere versuchten hinter einer Gruppe kleiner Bäume den Angriff abzuwehren, aber ihre Verfolger metzelten sie bis auf den letzten Mann nieder. Der Staub des fremden Landes wurde zu ihrem Totenhemd, das trockene Strauchwerk zu ihrem Grab.
Severus und seine wenigen überlebenden Legionäre erkämpften sich ihren Weg zum Gipfel des Felsens und hielten plötzlich wie betäubt inne. Die mörderische Schlacht, die um sie herum tobte, nahmen sie nicht mehr wahr. Stattdessen starrten sie mit namenlosem Entsetzen auf das Drama, das sich zu ihren Füßen abspielte.
Feuerzungen schossen empor und mündeten in eine anfangs dünne Rauchwolke, die sich in einer Spirale in die Luft hob. Die Flotte, ihre einzige Hoffnung auf ein Entkommen, brannte lichterloh am Flussufer; die riesigen Getreideschiffe, die sie in Ägypten requiriert hatten, wurden vom Flammenmeer verschlungen.
Venator bahnte sich seinen Weg durch die vorderste Reihe und blieb neben Severus stehen. Der Centurio schwieg. Blut und Schweiß hatten ihm Tunika und Panzer durchtränkt. Verzweifelt starrte er auf das Flammenmeer und auf den Qualm. Er beobachtete, wie sich die schimmernden Segel im Funkenhagel auflösten. Die erschütternde Gewissheit der Niederlage spiegelte sich in seinen Augen.
Die Schiffe, die am Ufer vor Anker gelegen hatten, waren nahezu ungeschützt gewesen. Eine Abteilung der Barbaren hatte die geringe Anzahl der Seeleute an Bord überwältigt und alles in Brand gesetzt. Nur ein kleines Handelsschiff war den tödlichen Flammen entkommen. Irgendwie hatte die Mannschaft es geschafft, die Angreifer abzuwehren. Vier Seeleute waren fieberhaft bemüht, Segel zu setzen, während verschiedene ihrer Schiffskameraden sich an den Rudern abmühten, um in die Sicherheit des tiefen Wassers zu gelangen.
Venator schmeckte den niederkommenden Ruß und die Bitterkeit der Katastrophe auf der Zunge. Sogar der Himmel selbst schien rot zu glühen. In hilfloser Wut stand er da. Das Vertrauen, das er in seinen sorgsam ausgearbeiteten Plan gesetzt hatte, das unschätzbare Wissen der Vergangenheit in Sicherheit zu bringen, erstarb in seinem Innern.
Eine Hand legte sich auf seine Schulter. Er wandte sich um und sah einen seltsamen Ausdruck kühlen Amüsements in Severus’ Gesicht.
»Es ist immer mein Wunschtraum gewesen«, erklärte der Centurio, »voll des guten Weines auf einer schönen Frau zu sterben.«
»Nur Gott kann den Tod eines Menschen bestimmen«, erwiderte Venator unbestimmt.
»Ich glaube, das Glück spielt dabei eine ausschlaggebende Rolle.«
»Eine Katastrophe, was für ein schrecklicher Verlust!«
»Wenigstens sind deine Kostbarkeiten sicher versteckt«, stellte Severus trocken fest. »Und die Seeleute, die entkommen, werden den Gelehrten des Imperiums berichten, was wir hier getan haben.«
»Nein.« Venator schüttelte den Kopf. »Niemand wird den Hirngespinsten ungebildeter Seeleute Glauben schenken.« Er drehte sich um und warf einen Blick zu den niedrigen Hügeln zurück. »Es ist für immer verloren.«
»Kannst du schwimmen?«
Venators Augen richteten sich wieder auf Severus. »Schwimmen?«
»Ich gebe dir fünf meiner besten Männer mit, die dir eine Bresche zum Wasser schlagen, wenn du glaubst, dass du das Schiff erreichen kannst.«
»Ich … ich bin mir nicht sicher.« Er musterte das Wasser des Flusses und den immer weiter werdenden Abstand zwischen Schiff und Ufer.
»Nimm ein Wrackteil als Floß, wenn es sein muss«, empfahl Severus rau. »Doch beeile dich. Wir alle stehen in wenigen Minuten vor unseren Göttern.«
»Und was ist mit dir?«
»Dieser Hügel ist so gut wie jeder andere Ort, dem letzten Ansturm standzuhalten.«
Venator umarmte den Centurio. »Gott sei mir dir.«
»Besser, er begleitet dich.«
Severus drehte sich um, wählte schnell fünf unverwundete Soldaten aus und befahl ihnen, mit Venator zum Fluss hinunter durchzubrechen. Dann machte er sich daran, seine verbliebenen Mannen für das letzte Gefecht in Stellung zu bringen.
Die Legionäre nahmen Venator in ihre Mitte. Dann stießen sie blitzschnell in Richtung Fluss vor, schrien und hackten sich ihren Weg durch die auseinandergezogene Front der verblüfften Barbaren. Wie Berserker schlugen sie um sich und drängten vorwärts.
Venator war restlos erschöpft, aber er zögerte nicht, sein Schwert zu benutzen, und er traf nicht ein Mal daneben. Ein Gelehrter, der zum todbringenden Kämpfer geworden war. Den Weg ohne Wiederkehr hatte er bereits vor langer Zeit beschritten. Jetzt durchflutete ihn nur noch der wütende Drang, sein Geheimnis der Nachwelt zu überbringen; jegliche Angst vor dem Tode war vergangen.
Sie kämpften sich durch den brodelnden Kessel sengender Hitze. Venator roch verbranntes Fleisch. Er riss einen weiteren Fetzen von seiner Tunika und hielt ihn sich vor Mund und Nase, als sie sich gewaltsam ihren Weg durch den Qualm bahnten.
Die Soldaten fielen, Venator bis zum letzten Atemzug beschützend. Plötzlich waren seine Füße im Wasser. Er sprang vorwärts und tauchte in dem Moment unter, in dem Wasser seine Knie erreichte. Aus dem Augenwinkel erspähte er eine Planke, die sich von einem brennenden Schiff gelöst hatte und schwamm darauf zu. Er wagte nicht zurückzuschauen.
Auf der Felsspitze wehrten Severus’ Soldaten verzweifelt die Angriffe ab. Die Barbaren wichen zurück und schrien erbittert, während sie einen schwachen Punkt in der römischen Abwehr suchten. Vier Mal sammelten sie sich in Haufen und griffen an, vier Mal wurden sie zurückgeworfen – doch nicht, bevor wieder einige erschöpfte oder verwundete Legionäre zu Boden gesunken waren. Das Karree schmolz langsam zu einer kleinen Gruppe, als die wenigen Überlebenden die Reihen schlossen und Schulter an Schulter kämpften. Berge von blutüberströmten Toten und Sterbenden bedeckten den Gipfel, Blut floss in Rinnsalen den Abhang hinunter. Und immer noch leisteten die Römer Widerstand.
Als die Barbaren sich zum letzten Sturmangriff zusammenrotteten, waren Severus’ Legionäre auf eine Handvoll zusammengeschrumpft. Einer nach dem anderen fiel, das Schwert in der Hand, getroffen von dem Hagel der Steine, Pfeile und Speere.
Severus fiel als letzter. Seine Beine gaben unter ihm nach, und er vermochte das Schwert nicht mehr zu heben. Er sank auf die Knie, versuchte vergeblich, noch einmal auf die Beine zu kommen, als die Barbaren bereits vorwärtsstürmten und wild auf ihn einprügelten, bis der Tod ihn von seinen Schmerzen erlöste.
Im Wasser hielt Venator sich krampfhaft an dem Holzstück fest und machte mit den Beinen verzweifelte Schwimmbewegungen, um das fliehende Schiff noch zu erreichen. Seinen Anstrengungen war kein Erfolg beschieden. Die Strömung des Flusses und ein Windstoß trieben das Handelsschiff weiter fort.
Er rief zur Mannschaft hinüber und winkte heftig. Eine Gruppe von Seeleuten und ein junges Mädchen mit einem Hund standen am Heck und starrten ausdruckslos in seine Richtung. Sie machten nicht die geringste Anstrengung, das Schiff zu wenden, sondern setzten ihre Flucht flussabwärts fort, als ob Venator überhaupt nicht existierte.
Hilflos erkannte er, dass sie ihn im Stich ließen. Eine Rettung würde es nicht geben. Wütend drosch er mit der Faust auf das Stück Holz ein, während er haltlos schluchzte. Sein Gott hatte ihn verlassen, davon war er überzeugt.
Die Expedition war gescheitert, versunken in einem Albtraum.
Erster Teil: NEBULA FLUG 106
12. Oktober 1991
Flughafen Heathrow, London
1
Niemand schenkte dem Piloten die geringste Aufmerksamkeit, als er sich um die Gruppe der Korrespondenten herumschlängelte, die das Innere der VIP-Lounge bevölkerte. Auch die Passagiere, die im Wartebereich vor Gate 14 saßen, bemerkten nicht, dass er statt einer Aktentasche eine große Segeltuchtasche bei sich trug. Er hielt den Kopf gesenkt, den Blick starr geradeaus gerichtet und vermied sorgsam, zu den Kameras zu schauen, die auf eine hochgewachsene, attraktive Frau mit glattem braunem Gesicht und unwiderstehlichen pechschwarzen Augen gerichtet waren, dem Mittelpunkt eines geräuschvollen Auftritts.
Schnell durchschritt der Pilot den Ziehharmonikaschlauch der Bordrampe und blieb vor zwei Sicherheitsbeamten des Flughafens stehen. Die beiden Männer trugen Zivil und versperrten den Zugang zum Flugzeug. Er winkte ihnen lässig zu und versuchte sich durchzudrängen, doch eine feste Hand umfasste seinen Arm.
»Einen Augenblick, Captain.«
Der Pilot hielt in seiner Bewegung inne. Auf seinem dunkelhäutigen Gesicht lag ein freundlicher Ausdruck. Diese Behinderung schien ihn beinahe zu amüsieren.
Seine olivbraunen Augen hatten den stechenden Blick eines Zigeuners. Die Nase war mehr als einmal gebrochen, und ein langer Schnitt verlief senkrecht über die linke Wange bis hin zum Kiefer. Das kurzgeschnittene graue Haar unter seiner Mütze und die Falten in seinem Gesicht bewirkten, dass er auf Ende fünfzig geschätzt wurde. Er war knapp einen Meter fünfundachtzig groß, untersetzt und hatte einen leichten Bauchansatz. Wie er so in seiner maßgeschneiderten Uniform dastand, abgeklärt, selbstsicher und kerzengerade, wirkte er genauso wie jeder andere der zehntausend Linienpiloten, die die internationalen Verkehrsmaschinen flogen.
Er zog seinen Ausweis aus der Brusttasche und reichte ihn dem Sicherheitsbeamten.
»Sind diesmal VIPs dabei?«, erkundigte er sich ahnungslos.
Der britische Wachposten, korrekt und makellos gekleidet, nickte. »Eine Delegation der Vereinten Nationen, die nach New York zurückkehrt – einschließlich der neuen Generalsekretärin.«
»Hala Kamil?«
»Ja.«
»Kaum der passende Job für eine Frau.«
»Premierministerin Thatcher ist schließlich auch eine Frau.«
»Die hat auch nicht bis über beide Ohren in Schwierigkeiten gesteckt.«
»Miss Kamil ist eine eindrucksvolle Lady. Die wird damit schon fertigwerden.«
»Vorausgesetzt, die moslemischen Fanatiker ihres Heimatlandes legen sie nicht vorher um«, erwiderte der Pilot mit deutlich amerikanischem Akzent.
Der Brite sah ihn seltsam prüfend an, erwiderte jedoch nichts, während er das Foto auf der Ausweiskarte mit dem Gesicht vor ihm verglich. Den Namen las er laut vor: »Captain Dale Lemke.«
»Irgendein Problem?«
»Nein, aber wir wollen auch nicht, dass eines entsteht«, gab die Wache unbewegt zurück.
Lemke streckte die Arme aus. »Wollen Sie mich auch filzen?«
»Nicht nötig. Ein Pilot würde wohl kaum das eigene Flugzeug entführen. Doch wir müssen sichergehen, dass Sie tatsächlich ein Mitglied der Mannschaft sind.«
»Diese Uniform ist kein Faschingskostüm.«
»Dürfen wir einen Blick in Ihre Tasche werfen?«
»Bitte sehr.« Er setzte die blaue Nylontasche auf dem Boden ab und öffnete sie.
Der zweite Agent nahm das Pilotenhandbuch und die Handbücher für die Flight Operations heraus und blätterte sie durch. Dann hielt er ein Metallstück in die Höhe, an dem ein kleiner Hydraulikzylinder befestigt war.
»Würden Sie uns verraten, was das hier ist?«
»Ein Spanner für eine Klappe der Ölkühlung. Sie ist in Position ›offen‹ hängengeblieben, und die Wartungsleute vom Kennedy Airport haben mich gebeten, das Teil zur Inspektion mit nach Hause zu nehmen.«
Der Agent deutete auf einen dicken Gegenstand, der fest verpackt ganz unten auf dem Boden der Tasche lag. »He, was haben wir denn da?« Dann blickte er auf. In seinen Augen schimmerte Neugierde. »Seit wann schleppen Linienpiloten Fallschirme mit sich herum?«
Lemke lachte. »Fallschirmspringen ist mein Hobby. Jedes Mal wenn ich hier einen längeren Aufenthalt habe, springe ich mit Freunden drüben auf dem Luftwaffenstützpunkt Croydon.«
»Ich nehme nicht an, dass Sie einen Sprung aus einem Linienjet in Erwägung ziehen?«
»Jedenfalls nicht von einem, der mit fünfhundert Knoten in einer Höhe von fünfunddreißigtausend Fuß über den Atlantik hinwegfliegt.«
Die Agenten warfen sich einen zufriedenen Blick zu. Die Stofftasche wurde geschlossen und der Ausweis zurückgereicht.
»Tut uns leid, wenn wir Sie aufgehalten haben, Captain.«
»Hat mich gefreut, mit Ihnen zu plaudern.«
»Einen guten Flug nach New York.«
»Vielen Dank.«
Lemke zog den Kopf ein und betrat das Cockpit. Er schloss die Tür ab und schaltete die Kabinenbeleuchtung aus, sodass ein zufälliger Beobachter, der vom oberen Rundgang aus durch die Fenster schaute, seine Bewegungen nicht wahrnehmen konnte. In immer wieder geübter Geschwindigkeit kniete er hinter die Sitze, zog eine kleine Taschenlampe aus der Jackentasche und hob die Falltür, die zum Elektronikabteil darunter führte, einem Kabuff, das ein Witzbold – niemand wusste mehr zu sagen, wer es gewesen war – auf den Namen Höllenloch getauft hatte.
Er vernahm die murmelnden Stimmen der Flugbegleiter, die die Hauptkabine für den Einstieg der Fluggäste vorbereiteten, und das Rumpeln des Gepäcks, das von den Gepäckträgern im hinteren Teil der Maschine verladen wurde. Lemke kletterte die Leiter hinunter, in die düstere Finsternis, griff nach oben und zog die Stofftasche nach, dann schaltete er die kleine Stablampe ein. Ein schneller Blick auf seine Uhr verriet ihm, dass er noch ungefähr fünf Minuten Zeit hatte, bevor seine Crew auftauchte. Mit einem Bewegungsablauf, den er ungefähr fünfzig Mal trainiert hatte, zog er den Spanner aus der Tasche und schloss ihn an einen Miniaturtimer an, den er unter seiner Uniformmütze transportiert hatte. Er brachte beides an einer kleinen Zugangstür an, die nach außen führte und die vom Bodenpersonal für Wartungsarbeiten benutzt wurde. Dann legte er den Fallschirm bereit.
Als sein Erster und Zweiter Offizier erschienen, saß Lemke im Pilotensitz über das Flughafenhandbuch gebeugt. Sie grüßten sich flüchtig und gingen dann gemeinsam die Positionen der Flugvorbereitung durch. Weder der Copilot noch der Ingenieur merkten, dass Lemke ungewöhnlich ruhig und gedankenverloren war.
Ihre Sinne wären wohl wacher gewesen, wenn sie nur geahnt hätten, dass dies ihre letzte Nacht auf Erden werden würde.
Im Innern der überfüllten Lounge sah sich Hala Kamil einem Gewirr von Mikrofonen und grellen Kamerascheinwerfern gegenüber. Mit unerschöpflicher Ausdauer, so schien es, ertrug sie die Fragen, die die Gruppe neugieriger Reporter auf sie niederprasseln ließ.
Nur wenige wollten etwas über ihre Europarundreise und die Zusammenkünfte mit den einzelnen Staatsoberhäuptern wissen. Die meisten waren an näheren Informationen über den drohenden Sturz der ägyptischen Regierung durch moslemische Fundamentalisten interessiert.
Das Ausmaß des Aufruhrs war ihr noch nicht so recht klar. Fanatische Mullahs, angeführt von Achmed Yazid, einem islamischen Rechtsgelehrten, hatten die religiöse Leidenschaft von Millionen notleidender Dorfbewohner am Ufer des Nils und der verarmten Massen in den Kairoer Slums angefacht. Hohe Offiziere der Armee und der Luftwaffe konspirierten in aller Offenheit mit den islamischen Radikalen, um den erst kürzlich gewählten Präsidenten, Nadav Hasan, aus dem Amt zu vertreiben. Die Situation stand auf der Kippe, doch Hala hatte bisher keinen aktuellen Lagebericht ihrer Regierung erhalten, sodass sie gezwungen war, ihre Antworten vage und nichtssagend zu halten.
Während sie ruhig und emotionslos die Fragen beantwortete, wirkte Hala unendlich gelassen, beinahe wie eine Sphinx. Innerlich jedoch schwankte sie zwischen Unsicherheit und Panik, fühlte sich fern und machtlos, so als ob unkontrollierbare Ereignisse jemand anderen aus der Bahn würfen, jemanden, dem nicht mehr zu helfen war und für den man nur noch Mitleid empfinden konnte.
Sie hätte für die Büste Königin Nofretetes, die im Berliner Museum stand, Modell gesessen haben können. Beide Frauen besaßen den gleichen langen, schlanken Hals, das feingeschnittene Gesicht und denselben unvergleichlichen Blick. Hala war zweiundvierzig Jahre alt, schlank, hatte schwarze Augen, einen makellosen braunen Teint und lange, pechschwarze Haare, die glatt auf ihre Schultern fielen. Mit Absätzen maß sie ein Meter fünfundsiebzig. Ihr geschmeidiger, wohlproportionierter Körper steckte in einer Modelljacke. Darunter trug sie einen Faltenrock.
Im Laufe der Jahre hatte Hala das Zusammensein mit vier Liebhabern genossen, doch sie war nie verheiratet gewesen. Die Vorstellung, einen Ehemann und Kinder zu haben, kam ihr abwegig vor. Sie lehnte es ab, ihre Zeit mit langdauernden Bindungen zu verplempern, und die körperliche Liebe bedeutete ihr kaum mehr Ekstase als das Kaufen eines Fahrscheins oder der Besuch eines Balletts.
Als Kind in Kairo, wo ihre Mutter als Lehrerin und ihr Vater als Filmproduzent arbeiteten, hatte sie jede freie Minute damit verbracht, in den uralten Ruinen, die sie von zu Hause aus mit dem Fahrrad erreichen konnte, herumzustöbern und zu graben. Hala war eine ausgezeichnete Köchin und hatte in Ägyptologie promoviert. Die Stellung als Wissenschaftlerin beim Kultusministerium war einer der wenigen Arbeitsplätze gewesen, die Moslemfrauen offenstanden.
Mit enormem persönlichem Einsatz und unerschöpflicher Energie hatte sie die Diskriminierung der Frauen in der islamischen Gesellschaft überwunden und war zur Direktorin der Altertumsabteilung aufgestiegen. Später leitete sie die Informationsabteilung. Präsident Mubarak wurde auf sie aufmerksam und drängte sie, einen Posten in der ägyptischen Delegation bei der UN-Vollversammlung zu bekleiden. Fünf Jahre später, als Javier Pérez de Cuéllar zurücktrat, weil fünf Moslemnationen wegen ihrer Forderungen nach Glaubensreformen der Charta entsagten, wurde Hala als Zweite Vorsitzende nominiert. Generalsekretärin wurde sie schließlich nur, weil sich die Männer, die Anspruch auf das Amt gehabt hätten, weigerten, diese Aufgabe zu übernehmen, und weil man hoffte, es könne ihr gelingen, die sich immer tiefer öffnende Kluft innerhalb der Organisation zu überbrücken.
Nun, da sich die Regierung ihres Heimatlandes am Rande des Zusammenbruchs befand, bestand die Möglichkeit, dass sie der erste leitende Repräsentant der Vereinten Nationen wurde, der sich nicht auf sein Land stützen konnte.
Ein Sekretär kam auf sie zu und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Sie nickte und hob die Hand.
»Mir wurde soeben mitgeteilt, dass das Flugzeug startklar ist«, erklärte sie. »Ich werde nur noch eine Frage beantworten.«
Hände flogen hoch, und ein Dutzend Fragen ertönten gleichzeitig im Raum. Hala deutete auf einen Mann, der am Eingang stand und ein Bandaufnahmegerät hielt.
»Leigh Hunt, BBC, Madame Kamil. Wenn Achmed Yazid die demokratisch gewählte Regierung Präsident Hasans durch ein islamisches Kabinett ablöst, kehren Sie dann nach Ägypten zurück?«
»Ich bin Moslem und Ägypterin. Wenn die Führer meines Heimatlandes – wobei es vollkommen egal ist, welche Regierung an der Macht ist – wünschen, dass ich nach Hause zurückkehre, werde ich diesem Ruf folgen.«
»Selbst angesichts der Tatsache, dass Achmed Yazid Sie als Abtrünnige und Verräterin bezeichnet hat?«
»Jawohl«, gab Hala ungerührt zurück.
»Wenn er auch nur halb so fanatisch ist wie der Ayatollah Khomeini, dann könnten Sie schnurstracks auf Ihre Hinrichtung zumarschieren. Haben Sie dazu etwas zu sagen?«
Hala schüttelte den Kopf, lächelte freundlich und sagte: »Ich muss nun gehen. Vielen Dank.«
In einem Kreis von Sicherheitsbeamten wurde sie von Reportern zum Einstieg eskortiert. Ihre engsten Mitarbeiter und eine umfangreiche Delegation der UNESCO hatten bereits Platz genommen. Vier Mitglieder der Weltbank teilten sich eine Flasche Champagner und unterhielten sich mit gedämpften Stimmen in der Pantry. Die Hauptkabine roch nach Düsentreibstoff und Beef Wellington.
Müde schnallte sich Hala an und blickte aus dem Fenster. Es herrschte leichter Nebel, und die blauen Lichter, die die Rollbahn abgrenzten, verschwammen zu schemenhaftem Glühen, bevor sie ganz verschwanden. Sie zog die Schuhe aus, schloss die Augen und schlief ein, noch bevor die Stewardess ihr einen Cocktail anbieten konnte.
Nachdem sie in den heißen Düsenschwaden einer TWA 747 gewartet hatten, bis sie an der Reihe waren, rollte Flug 106 der Vereinten Nationen schließlich ans Ende der Startbahn. Als vom Kontrollturm die Starterlaubnis durchgegeben wurde, schob Lemke die Schubhebel nach vorne, und die Boeing 720-B schoss über den nassen Beton und hob sich in den Nieselregen.
Sobald er die Reisehöhe von 10 500 Metern erreicht und den Autopiloten eingeschaltet hatte, löste Lemke seinen Gurt und erhob sich.
»Der Ruf der Natur«, erklärte er und ging auf die Kabinentür zu. Sein zweiter Offizier, ein Ingenieur mit hellbraunem Haar und einem von Sommersprossen übersäten Gesicht, lächelte, ohne den Blick von seiner Instrumententafel abzuwenden. »Ich warte hier so lange.«
Lemke zwang sich zu einem kurzen Lachen und betrat die Passagierkabine. Die Flugbegleiter kümmerten sich gerade um das Essen. Das Aroma des Beef Wellington stach jetzt noch stärker in die Nase. Er machte eine Handbewegung und nahm den Chefsteward beiseite.
»Kann ich Ihnen irgendetwas bringen, Captain?«
»Nur eine Tasse Kaffee«, erwiderte Lemke. »Aber machen Sie sich keine Mühe, ich hab’s nicht eilig.«
»Macht mir überhaupt keine Mühe.« Der Steward trat in die Pantry und goss Kaffee in eine Tasse.
»Da ist noch etwas.«
»Sir?«
»Die Gesellschaft hat uns gebeten, an einem von der Regierung geförderten meteorologischen Forschungsvorhaben teilzunehmen. Ungefähr zweitausendachthundert Kilometer von London entfernt gehe ich für ungefähr zehn Minuten auf fünfzehnhundert Meter hinunter. In der Zeit führen wir Wind- und Temperaturmessungen durch. Dann steigen wir wieder auf unsere normale Flughöhe.«
»Kaum zu glauben, dass die Gesellschaft dabei mitmacht. Ich wünschte mir, meinem Bankkonto würde das Geld gutgeschrieben, das wir durch den Treibstoffmehrverbrauch verlieren.«
»Sie können sich darauf verlassen, dass die knickrigen Burschen im Management Washington die Rechnung schon präsentieren werden.«
»Ich werde die Passagiere davon in Kenntnis setzen, wenn es so weit ist. Dann erschrecken wir sie nicht.«
»Sie könnten vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass irgendwelche eventuell auftauchenden Lichter von einer Fischereiflotte stammen.«
»Ich werde dran denken.«
Lemkes Blicke streiften über die Hauptkabine und blieben einen Moment lang auf der schlafenden Gestalt Hala Kamils haften, bevor sie weiterwanderten. »Ist es Ihnen nicht auch so vorgekommen, als seien die Sicherheitsmaßnahmen diesmal außergewöhnlich streng gewesen?«, erkundigte sich Lemke.
»Einer der Reporter hat mir erzählt, Scotland Yard habe Wind davon bekommen, dass es eine Verschwörung mit dem Ziel, die Generalsekretärin zu ermorden, geben könnte.«
»Die benehmen sich allmählich so, als lauere hinter jeder Ecke ein Terrorist. Ich musste meinen Ausweis vorzeigen, während die Sicherheitskräfte meine Tasche durchwühlt haben.«
Der Steward zuckte mit den Schultern. »Was soll’s? Die Vorsichtsmaßnahmen dienen ja auch unserem eigenen Schutz, nicht nur dem der Passagiere.«
Lemke deutete auf den Gang. »Wenigstens sieht keiner von denen aus wie ein Flugzeugentführer.«
»Nein, wenn die Terroristen sich nicht auf Anzüge mit Westen verlegt haben.«
»Für alle Fälle lasse ich die Cockpittür verschlossen. Melden Sie sich über die Gegensprechanlage, wenn es etwas Wichtiges gibt.«
»Selbstverständlich.«
Lemke nahm einen Schluck Kaffee, stellte die Tasse ab und kehrte ins Cockpit zurück. Der Erste Offizier, sein Copilot, blickte aus dem Seitenfenster auf die Lichter von Wales im Norden hinunter, während der Ingenieur hinter ihm damit beschäftigt war, den Treibstoffverbrauch zu addieren.
Lemke wandte den beiden den Rücken zu und holte eine kleine Schachtel aus der Brusttasche seiner Uniformjacke. Er öffnete sie und zog eine Spritze auf, die ein absolut tödliches Nervengift, Sarin, enthielt. Dann tat er einige taumelnde Schritte zurück, so, als hätte er das Gleichgewicht verloren. Er hielt sich am Arm des Zweiten Offiziers fest.
»Tut mir leid, Frank. Bin über den Läufer gestolpert.«
Frank Hartley trug einen buschigen Schnurrbart, hatte dünne graue Haare und ein schmales, attraktives Gesicht. Er spürte die Nadel gar nicht, die sich in seine Schulter bohrte. Er sah von den Instrumenten und Lämpchen seines Bedienungsbords auf und lachte gutgelaunt. »Passen Sie auf die Bananenschalen auf, Dale.«
»Geradeaus fliegen kann ich ja«, gab Lemke aufgeräumt zurück, »nur das Laufen macht mir Schwierigkeiten.«
Hartley öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, aber plötzlich breitete sich ein ungläubiger Ausdruck über seinem Gesicht aus. Er schüttelte den Kopf, als wolle er sein Sehvermögen klären, dann rollten seine Augäpfel nach hinten weg, und sein Körper wurde schlaff.
Lemke stützte Hartley mit seinem Körper, sodass er nicht seitwärtsfallen konnte, zog die Spritze zurück und tauschte sie schnell gegen eine andere aus. »Ich glaube, mit Frank stimmt irgendetwas nicht.«
Jerry Oswald, ein hochgewachsener Mann mit den verkniffenen Zügen eines Wüstenforschers, drehte sich im Copilotensitz um und sah fragend herüber. »Was ist denn los mit ihm?«
»Kommen Sie mal lieber her und sehen es sich selbst an.«
Oswald quetschte seinen massigen Körper am Sitz vorbei und beugte sich über Hartley. Lemke stieß mit der Nadel zu und drückte auf den Kolben, doch Oswald fühlte den Einstich.
»Was, zum Teufel, war das?«, stieß er hervor, wirbelte herum und warf einen verständnislosen Blick auf die Spritze in Lemkes Hand. Er war sehr viel schwerer und muskulöser als Hartley, und die Wirkung des Giftes stellte sich nicht sofort ein. Mit plötzlichem Verstehen weiteten sich seine Augen, dann trat er einen Schritt vor und packte Lemke am Genick.
»Du bist überhaupt nicht Dale Lemke«, knurrte er. »Wieso siehst du dann genauso aus wie er?«
Der Mann, der sich Lemke nannte, hätte selbst dann nicht antworten können, wenn er es gewollt hätte. Die riesigen Hände drückten ihm die Luft ab. Oswalds ungeheures Gewicht presste ihn gegen die Cockpittür. Er wollte eine Lüge hervorstoßen, doch er brachte kein Wort heraus. Er rammte sein Knie in die Hoden des Ingenieurs. Die einzige Antwort war ein kurzes Grunzen. Allmählich wurde Dale schwarz vor Augen.
Dann, ganz langsam, ließ der Druck nach, und Oswald taumelte nach hinten. Seine Augen waren schreckgeweitet, als er merkte, dass er starb. Verständnislos und hasserfüllt blickte er Lemke an.
Mit den letzten paar Herzschlägen, die ihm noch blieben, holte er mit der Faust aus und landete einen mörderischen Schlag in Lemkes Magengrube.
Lemke sank auf die Knie, halbbetäubt, der Atem ging ihm aus. Durch Nebelschleier bemerkte er, wie Oswald gegen den Pilotensitz fiel und auf den Boden des Cockpits krachte. Lemke richtete sich in Sitzposition auf, wartete eine Minute, rang nach Luft und massierte seinen schmerzenden Bauch.
Mühsam zog er sich auf die Beine und lauschte, ob irgendwelche neugierigen Stimmen von der anderen Seite der Tür her zu ihm drangen. In der Hauptkabine schien alles ruhig zu sein. Die Passagiere oder das Flugpersonal hatten wegen des monotonen Kreischens der Düsen nichts Ungewöhnliches vernommen.
Als er Oswald endlich im Sitz des Copiloten verstaut und angeschnallt hatte, war er schweißgebadet. Hartleys Sicherheitsgurt war bereits angelegt, deshalb kümmerte er sich nicht weiter um ihn. Zuletzt nahm er hinter der Kontrollkonsole auf der linken Seite des Cockpits Platz und überprüfte die Position des Flugzeugs.
Fünfundvierzig Minuten später legte Lemke den Jet in die Kurve, verließ die Luftstraße nach New York und schlug einen neuen Kurs in Richtung Antarktis ein.
2
Die Arktis ist einer der unwirtlichsten Flecken auf der Erde und überdies einer, der niemals von Touristen besucht wird. In den vergangenen hundert Jahren hat es nur eine Handvoll Forscher und Wissenschaftler gegeben, die durch diese Einöde gezogen sind. Bis auf ein paar Wochen im Jahr ist das Meer an der zerklüfteten Küste zugefroren, und im frühen Herbst schwanken die Temperaturen um minus vierzig Grad Celsius. Während der langen Wintermonate verhüllt Dunkelheit den eiskalten Himmel, und sogar im Sommer kann der blendende Sonnenschein in weniger als einer Stunde von einem undurchdringlichen Schneesturm abgelöst werden.
Dennoch war diese erhabene Einsamkeit, der Ausläufer des Ardecaple-Fjords an der Nordostküste Grönlands, die von eisbedeckten Bergen beschattet und von unablässig peitschenden Winden gepeinigt wurde, vor nahezu zweitausend Jahren von einer Gruppe Jäger besiedelt gewesen. Die Radiokarbon-Zeitbestimmung ausgegrabener Funde wies darauf hin, dass in dieser Gegend zwischen den Jahren 200 und 400 n. Chr. Menschen gelebt hatten. In der Zeitrechnung der Archäologen ist dies eine kurze Zeitspanne. Die ehemaligen Bewohner hatten zwanzig Wohnstätten zurückgelassen, die durch das kalte Klima hervorragend konserviert worden waren.
Wissenschaftler der Universität von Colorado hatten mit Helikoptern eine vorfabrizierte Aluminiumkonstruktion zu der uralten Siedlung transportiert und darüber errichtet. Eine störrische Heizungsanlage und die Isolierglaskonstruktion lieferten der Kälte eine einseitige Schlacht, doch zumindest verwehrten sie den unaufhörlich heulenden Winden, die um die Außenmauern fegten, den Zugang. Der Unterschlupf ermöglichte es einem archäologischen Team, bis zum Winteranfang an der Fundstelle zu arbeiten.
Lily Sharp, Professorin für Archäologie an der Universität von Colorado, war gegen die Kälte unempfindlich, die in das überdachte Dorf eindrang. Sie kniete auf dem Boden einer Hütte, die einst einer Familie Obdach gewährt hatte, und kratzte mit einem kleinen Schäufelchen vorsichtig die gefrorene Erde ab. Sie war allein und voll konzentriert bei der Arbeit, als sie versuchte, das Leben dieses für seine Zeit nicht besonders weit entwickelten Volkes zu ergründen.
Sie waren Jäger gewesen, die Jagd auf Meeressäuger gemacht hatten und die rauen arktischen Winter in ihren Hütten verbracht hatten, die teilweise in den Boden eingelassen waren. Die Häuser hatten niedrige Wände aus Felsgestein und Grasdächer, die oft von Walknochen gestützt worden waren. Die Menschen hatten sich an großen Öllampen gewärmt und die langen dunklen Monate damit verbracht, kleine Skulpturen aus Treibholz, Knochen und Horn zu schnitzen.
In den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt hatten sie diesen Teil Grönlands besiedelt. Dann, auf dem Höhepunkt ihrer Kultur, hatten sie ihre Siedlungen verlassen.
Lilys Beharrlichkeit machte sich bezahlt. Die drei Männer des Archäologenteams hatten sich nach dem Mittagessen in der Hütte, die ihre Behausung bildete, hingelegt, und sie war allein zu der überdachten Siedlung zurückgekehrt und hatte die Grabung fortgesetzt. Sie hatte die Stange eines Karibugeweihs freigelegt, das auf der Oberfläche mit zwanzig geschnitzten Figuren – möglicherweise Bären – verziert war; weiterhin fand sie einen sehr schönen Frauenkamm und einen steinernen Kochtopf.
Plötzlich klickte Lilys Schäufelchen gegen etwas Festes. Sie wiederholte ihre Bewegung und lauschte aufmerksam. Fasziniert tippte sie wieder gegen den unsichtbaren Gegenstand. Das war nicht das vertraute Geräusch, das die Schaufel machte, wenn sie auf Felsen traf. Wenn es auch ein wenig leise klang, so schwang doch eindeutig ein metallisches Klingeln mit.
Sie stand auf und reckte sich. Die kastanienroten Strähnen ihres dichten Haares schimmerten im Schein der Coleman-Laterne und fielen unter der dicken Wollmütze auf ihre Schultern. Ihre blaugrünen Augen verrieten skeptische Neugierde, als sie auf den winzigen Gegenstand hinuntersah, der durch die von Holzkohle geschwärzte Erde schimmerte.
Hier hatte ein sozusagen prähistorisches Volk gelebt, dachte sie. Eisen oder Bronze waren ihnen unbekannt gewesen.
Lily versuchte ruhig zu bleiben, aber sie war zu erstaunt, um besonnen vorzugehen. Sie warf die erste Regel der Archäologen, die behutsames Freilegen von Gegenständen vorschrieb, über Bord und kratzte und grub vehement in der hartverkrusteten Erde. Alle paar Minuten hielt sie inne und bürstete den losen Dreck ungeduldig mit einem kleinen Malerpinsel beiseite.
Zuletzt hatte sie das Artefakt vollkommen freigelegt. Sie beugte sich vor, um es sich näher anzuschauen, und stellte zu ihrer großen Verblüffung fest, dass es unter dem grellweißen Licht der Coleman-Laterne gelb schimmerte.
Lily hatte eine Goldmünze freigelegt.
Eine sehr alte, wenn man vom Aussehen des abgestoßenen Randes ausgehen konnte. In der Mitte befand sich ein winziges Loch, und ein Stück verrottetes Leder auf der einen Seite ließ darauf schließen, dass die Münze einstmals als Anhänger oder Amulett getragen worden war.
Sie setzte sich hin, holte tief Atem und hatte beinahe Angst, zuzufassen und die Münze zu berühren.
Lily kniete noch immer und suchte krampfhaft nach einer Erklärung, als fünf Minuten später plötzlich die Tür aufging und ein dickbäuchiger Mann, dessen freundliches Gesicht ein schwarzer Bart zierte, aus der Kälte hereinkam. Ein Schneewirbel folgte ihm, und dichte Atemwolken umgaben ihn, die Augenbrauen und der Bart waren eisbedeckt. Er sah aus wie das Eismonster aus einem Science-Fiction-Film – jedenfalls bis er in breitem Lächeln die Zähne entblößte.
Das war Dr. Hiram Gronquist, der Chefarchäologe des vierköpfigen Forscherteams.
»Tut mit leid, dich zu unterbrechen, Lily«, sagte er mit sanfter, tiefer Stimme, »aber du übertreibst. Mach eine Pause. Komm in die Hütte, wärm dich auf und lass dir von mir einen guten steifen Brandy eingießen.«
»Hiram«, antwortete Lily und versuchte mühsam, die Aufregung in ihrer Stimme zu unterdrücken, »ich möchte, dass du dir etwas ansiehst.«
Gronquist kam näher und kniete neben ihr nieder. »Was hast du gefunden?«
»Schau selbst.«
Gronquist fummelte in seinem Parka suchend nach der Lesebrille und schob sie auf seine rotgefrorene Nase. Er beugte sich über die Münze, bis sein Gesicht nur noch Zentimeter davon entfernt war. Er musterte sie von allen Seiten. Nach einigen Augenblicken sah er zu Lily auf. In seinen Augen funkelte ein amüsiertes Glitzern.
»Du willst mich verarschen, was, Mädchen?«
Lily warf ihm einen ernsten Blick zu, entspannte sich dann und lachte. »O mein Gott, du glaubst, ich habe die Münze untergeschoben?«
»Das musst du schon zugeben. Wenn nicht, dann wär’s so, als entdecke man in einem Bordell eine Jungfrau.«
»Na, na.«
Er gab ihr einen freundschaftlichen Klaps aufs Knie. »Meinen Glückwunsch, das ist eine seltene Entdeckung.«
»Wie, glaubst du, ist sie hierhergelangt?«
»Auf tausend Meilen gibt es hier keine Fundstätte für Gold, und von den ehemaligen Bewohnern dieser Siedlung ist sie sicherlich nicht geprägt worden. Der Entwicklungsstand dieser Leute war nur eine Spur weiter als der des Menschen aus der Eiszeit. Die Münze hat offensichtlich einen anderen Ursprung und stammt aus einer späteren Zeit.«
»Wie erklärst du dir dann die Tatsache, dass sie neben Artefakten liegt, die wir auf das Jahr 300 n. Chr. datiert haben – plus/minus ein Jahrhundert?«
Gronquist zuckte mit den Schultern. »Kann ich nicht sagen.«
»Was vermutest du denn?«, hakte Lily nach.
»So aus dem Stegreif würde ich sagen, dass die Münze vielleicht von einem Wikinger in den Handel gebracht oder verloren wurde.«
»Es existieren keine Berichte darüber, dass Wikinger so weit nördlich an der Ostküste waren«, erwiderte Lily.
»Okay, vielleicht haben Eskimos aus jüngeren Tagen mit den norwegischen Siedlungen im Süden Handel getrieben und diese Fundstätte benutzt, um während ihrer Jagdexpeditionen zu kampieren.«
»Quatsch, Hiram. Wir haben nicht den geringsten Hinweis gefunden, dass diese Siedlung nach dem Jahre vierhundert bewohnt wurde.«
Gronquist warf Lily einen verärgerten Blick zu. »Du gibst wohl nie auf, was? Wir können die Münze ja nicht einmal datieren.«
»Mike Graham ist Experte für alte Münzen. Sein Spezialgebiet ist die Datierung von Funden rund ums Mittelmeer. Vielleicht kann er sie identifizieren.«
»Und das kostet uns keinen Penny«, stimmte Gronquist zu. »Komm mit. Mike kann sich die Münze ansehen, und wir trinken einen Brandy.«
Lily zog sich ihre dicken, pelzgefütterten Handschuhe an, stülpte die Kapuze ihres Parkas über und löschte die Coleman-Laterne. Gronquist knipste eine Taschenlampe an und hielt ihr die Tür auf. Sie trat in die Eiseskälte hinaus. Der Wind fegte um sie herum wie ein Geist auf einem Friedhof. Die eisige Luft traf ihre bloßen Wangen und ließ sie erzittern – eine unbewusste Reaktion, die sich jedes Mal wiederholte, obwohl sie sich doch mittlerweile an das Klima gewöhnt haben musste.
Lily griff nach dem Seil, das zu den Wohnquartieren hinführte, und stolperte hinter der vierschrötigen Gestalt Gronquists her. Sie warf einen Blick nach oben. Der Himmel war wolkenlos, und die Sterne schienen zu einem weiten Teppich schimmernder Diamanten verwoben, der die kahlen Berge im Westen und den Gletscher, der im Osten durch den Fjord floss und sich ins Meer ergoss, in ein sanftes Licht tauchte. Die eigenartige Schönheit dieser Landschaft war wie eine eifersüchtige Geliebte, Lily konnte verstehen, weshalb Männer ihre Seele an ihren Zauber verloren.
Nach dreißig Schritten durchs Dunkel erreichten sie den Windfang ihrer Hütte, gingen weitere drei Meter und öffneten eine zweite Tür, die zu den Wohnräumen im Innern führte. Lily hatte nach der fürchterlichen Kälte draußen das Gefühl, als beträte sie einen Backofen. Wie Parfüm umwehte Kaffeearoma ihre Nase, und sofort zog sie ihren Parka und die Handschuhe aus und goss sich eine Tasse ein.
Sam Hoskins, dessen blondes Haar fast bis zu den Schultern reichte und prächtig zu dem blonden Seehundschnauzer passte, war über ein Zeichenbrett gebeugt. Hoskins, ein gefragter New Yorker Architekt mit einer großen Liebe zur Archäologie, nahm sich jedes Jahr zwei Monate Zeit, um sie bei Ausgrabungen rund um die Welt zu verbringen. Er erwies sich für das Anfertigen von Detailzeichnungen, die Wiedergaben, wie das Dorf vor siebzehnhundert Jahren ausgesehen haben musste, als unschätzbare Hilfe.
Das andere Mitglied der Mannschaft, ein hellhäutiger Mann mit spärlichem sandfarbenem Haar, lag auf einem Feldbett und las in einem Taschenbuchroman mit Eselsohren. Lily konnte sich nicht daran erinnern, Mike Graham jemals ohne Abenteuerbuch in der Hand oder in der Jackentasche gesehen zu haben. Mike war einer der führenden amerikanischen Ausgrabungsexperten und eigenbrötlerisch wie ein Leichenbestatter.
»He, Mike!«, polterte Gronquist. »Sieh mal, was Lily ausgegraben hat.«
Er warf die Münze quer durch den Raum. Schockiert schnappte Lily nach Luft, doch Graham fing das Metallstück gekonnt in der Luft auf und warf einen Blick darauf.
Einen Moment später richtete er sich auf. Seine Augen waren skeptisch zusammengekniffen. »Ihr wollt mich wohl verarschen?«
Gronquist lachte aus vollem Hals. »Genau das waren auch meine Worte, als ich das Ding gesehen habe. Nein, ohne Quatsch. Lily hat sie bei der Fundstätte acht freigelegt.«
Graham zog eine Aktentasche unter seinem Feldbett hervor und stöberte nach einem Vergrößerungsglas. Er hielt die Münze darunter und musterte sie aus jedem Blickwinkel.
»Na, wie lautet das Urteil?«, fragte Lily ungeduldig.
»Unglaublich«, murmelte Graham geistesabwesend. »Das ist eine Gold-Milarensia. Ungefähr dreizehneinhalb Gramm. Ich habe noch nie zuvor eine gesehen. Sie sind ganz selten. Ein Sammler würde wahrscheinlich zwischen sechs und achttausend Dollar dafür bezahlen.«
»Was ist da auf die Vorderseite geprägt?«
»Ein Standbild von Theodosius dem Großen, Kaiser von West- und Ostrom. Sein Abbild war ein gebräuchliches Motiv für die Vorderseite von Münzen aus dieser Zeit. Wenn ihr genauer hinseht, könnt ihr zu seinen Füßen Gefangene sehen, während seine Hände einen Globus und ein Labarum zu halten scheinen.«
»Ein Labarum?«
»Ja, ein Banner mit den griechischen Lettern XP, das ist eine Art Monogramm, Es bedeutet so viel wie ›Im Namen Christi‹ Kaiser Konstantin übernahm es nach seinem Übertritt zum Christentum, und seine Nachfolger haben es ihm gleichgetan.«
»Was hältst du von den Schriftzügen auf der Rückseite?«, erkundigte sich Gronquist.
Grahams Augapfel vergrößerte sich hinter dem Glas überproportional, als er die Münze studierte. »Drei Worte. Das erste sieht aus wie TRIUMPHATOR. Die beiden anderen kann ich nicht entziffern. Sie sind nahezu vollkommen abgegriffen. In einem Katalog könnte man eine Beschreibung und die Übersetzung aus dem Lateinischen finden. Ich werde warten müssen, bis wir in die Zivilisation zurückkehren, um nachzuschauen.«
»Kannst du etwas zum Alter sagen?«
Gedankenverloren starrte Graham zur Decke. »Geprägt während der Regierungszeit von Theodosius, die, wenn ich mich recht erinnere, von 379 bis 395 dauerte.«
Lily starrte Gronquist an. »Volltreffer.«
Er schüttelte den Kopf. »Das ist ein reines Hirngespinst. Es ist kaum anzunehmen, dass Eskimos im vierten Jahrhundert Kontakt zum Römischen Imperium hatten.«
»Wir können aber die entfernte Möglichkeit nicht ausschließen«, beharrte Lily.
»Wenn das herauskommt, dann gibt es eine Flut von Spekulationen und Hypothesen seitens der Medien«, stellte Hoskins fest und betrachtete die Münze zum ersten Mal.
Gronquist nahm einen kräftigen Schluck Brandy. »Alte Münzen sind schon früher an den seltsamsten Plätzen aufgetaucht. Doch Datum und Weg zu ihrer Fundstätte können wohl kaum zur vollen Zufriedenheit der archäologischen Gesellschaft bewiesen werden.«
»Schon möglich«, erwiderte Graham zögernd. »Aber ich würde mein Mercedes-Cabriolet hergeben, wenn ich erfahren könnte, wie die hierhergelangt ist.«
Sie blickten für eine Weile grübelnd auf die Münze.
Schließlich brach Gronquist das Schweigen. »Scheint, als sei das Einzige, dessen wir sicher sein können, die Tatsache, dass wir einem absoluten Geheimnis gegenüberstehen.«
3
Kurz vor Mitternacht traf der Betrüger die genau geplanten Vorbereitungen für seinen Absprung. Die Luft war kristallklar, und der verschwommene Streifen von Island zeichnete sich am flachen schwarzen Horizont des Meeres ab. Der kleine Inselstaat war von einem leichten, seltsam anmutenden grünen Schimmer umgeben, der von der Aurora borealis stammte.
Die beiden Leichen in seiner Nähe registrierte er gar nicht mehr. An den Geruch von Blut und Tod hatte er sich seit langem gewöhnt, und er bereitete ihm kein Unbehagen mehr. Tod und geronnenes Blut waren Teil seiner Arbeit. Leblosen Körpern gegenüber war er unempfindlich wie ein Pathologe oder der Metzger an der Ecke.
Das Töten selbst ließ ihn vollkommen kalt. Die Zahl der verübten Morde bedeutete ihm nur eine mathematische Größe. Er wurde gut bezahlt; er war Söldner und religiöser Fanatiker, der für eine gute Sache mordete. Komischerweise störte ihn bei seinem Job nur, dass man ihn als Attentäter oder Terroristen beschimpfte. Diese Bezeichnungen stellten einen politischen Bezug her, und er schwelgte geradezu in einer leidenschaftlichen Abneigung allen Politikern gegenüber.
Er war ein Mann mit tausend Identitäten, ein Perfektionist, der wahlloses Herumgeschieße in Menschenmengen oder schlampig gelegte Autobomben ablehnte. Das war für jugendliche Spinner. Seine Methoden waren weitaus subtiler. Nie überließ er irgendetwas dem Zufall. Die internationalen Fahnder hatten schon Schwierigkeiten, seine Anschläge überhaupt von normalen Unfällen zu unterscheiden.
Der Tod von Hala Kamil bedeutete für ihn mehr als nur die Erledigung eines Auftrags. Für ihn war es eine Pflichterfüllung. Fünf Monate hatte es gedauert, bis sein komplizierter Plan gereift war und als perfekt bezeichnet werden konnte – darauf folgte geduldiges Warten auf den richtigen Moment.
Es ist beinahe eine Vergeudung, dachte er. Kamil war eine außerordentlich attraktive Frau, aber sie bedeutete gleichzeitig eine Bedrohung, die ausgeschaltet werden musste.
Allmählich nahm er Schub weg, schob die Kontrollkonsole nach vorne und zog die Maschine äußerst behutsam runter. Für niemanden außer einem anderen Piloten war die leichte Abnahme an Geschwindigkeit und Höhe wahrnehmbar.





























