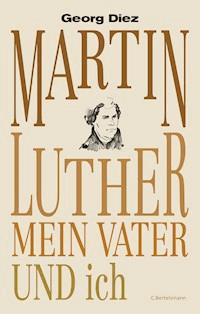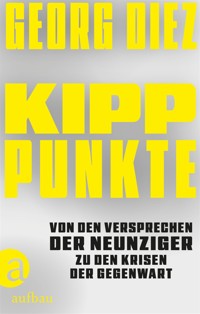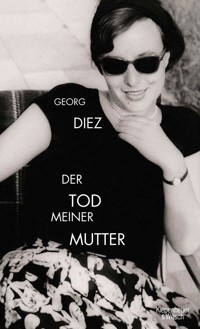9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine kritische Analyse des populistischen Rechtsrucks, der unser Land verändert hat
Wie steht es um Deutschland? Und wie wollen wir in diesem Land leben? Weltoffen und freiheitsliebend oder abgeschottet und ängstlich? Für Georg Diez markiert der Sommer 2015 in Deutschland eine Zeitenwende. Als dieses Land sich freudig und radikal zu erneuern schien und sich dann Hysterie, Hass und rechtes Geschrei Bahn brachen. Der Schock aufflammender Illiberalität, die gebannt geglaubte Gespenster nicht nur hier nach der Macht greifen ließ, sitzt tief. Genauso tief wie die eigentlichen Ursachen für den populistischen Rechtsruck, die der erfahrene Journalist vor 10 Jahren verortet, als die Finanzkrise unser Selbstverständnis und unsere Selbstgewissheit zutiefst erschütterte. Diez trägt Facetten von Solidarität und Feindseligkeit zusammen, diagnostiziert gefährliche Brüche und selbstgefällige Behäbigkeit. Aber er zeigt auch, dass dieses Jahrzehnt Strukturen geschaffen hat, die neue Möglichkeiten für ein anderes Land bergen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Die gesellschaftliche Herausforderung durch die Ankunft der Geflüchteten im Sommer 2015 war ein Generationenereignis wie in Deutschland zuletzt die Wiedervereinigung 1990 – und in beiden Fällen wurden wirkliche Veränderung, neues Denken, soziale Innovation und Gerechtigkeit verpasst oder verhindert.
Die Rechte hetzt seitdem, die Linke verharrt in Passivität, Rassismus und Ressentiment wurden salonfähig, wurden Politik. Die Demokratie taumelt. Dabei, und das ist die zentrale These von Georg Diez, liegt gerade in der gemeinsam gemeisterten Herausforderung die Chance für ein offenes, ein bürgerschaftliches, ein anderes Land – und damit das Fundament für eine neue Politik.
Zum Autor
Georg Diez, geboren 1969, studierte Geschichte und Philosophie in München, Paris, Hamburg und Berlin. Er schrieb für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die Zeit und die Süddeutsche Zeitung. Heute ist er Autor beim Spiegel und Kolumnist von Spiegel Online.
Von 2016 bis 2017 war Georg Diez als Nieman Fellow an der Harvard University. Er hat über Berlin, die Beatles, die Rolling Stones, die Jahre 1980 und 1981 sowie Martin Luther publiziert. Sein Buch Der Tod meiner Mutter (2009) wurde heftig diskutiert.
GEORG DIEZ
DAS ANDERE LAND
Wie unsere Demokratie beschädigt wurde und was wir tun können, um sie zu reparieren
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
© 2018 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-16603-8V003www.cbertelsmann.de
Für Neo
There is a crack in everythingThat’s how the light gets in
LEONARD COHEN
Inhalt
Vorwort
1 – Die Geflüchteten und die Neugründung des Landes
2 – Die autoritäre Versuchung und der Abstieg des Westens
3 – Die Krise als Normalität und der Egoismus der Deutschen
4 – Der Kampf, die Kulturen und die Deutschen als Opfer
5 – Wahrheit in Zeiten der Lüge
6 – Das andere Land
Coda
Vorwort
Dieses Buch ist Rückblick und Ausblick zugleich. Der Blick zurück ist auf die Gründe und Entwicklungen gerichtet, die dazu geführt haben, dass die Demokratie nicht nur in Deutschland in die Krise geraten ist. Der Blick nach vorne spaltet sich auf, in ein Negativszenario und eine Vision, wie aus dem, was sich so krisenhaft darstellt, etwas Besseres entstehen kann, eine gerechtere, menschlichere, offenere, echte Demokratie.
Die Situation jedenfalls ist dramatisch: Die Grundlagen, Maßstäbe, Funktionsweisen und Werte der Demokratie stehen zur Disposition, und zwar nicht weit entfernt in Diktaturen, aufflackernd in den Abendnachrichten, sondern hier, im Zentrum und Herzen der westlichen Welt, die den eigenen Abstieg und Verlust von geopolitischem Einfluss verkraften muss – es überlagern sich, mit anderen Worten, verschiedene Krisen, Transformationsprozesse, Disruptionen, und das verbindende Gefühl ist, dass man auf einem Förderband steht, das sich in verschiedene Richtungen gleichzeitig bewegt. Das Ergebnis ist Verwirrung, und der angemessene Modus wäre der des permanenten Kopfschüttelns.
Da ertrinken Menschen im Mittelmeer, und Europa schaut zu. Da stehen Demonstranten auf Marktplätzen und rufen: »Absaufen, absaufen«. Da wird eine Partei in den Bundestag gewählt, deren Vertreter auf Geflüchtete schießen lassen, den politischen Gegner jagen oder »in Anatolien entsorgen« wollen und die den Holocaust relativieren. Da zerlegt ein sexistischer Zampano die amerikanische Republik, schon länger mehr Oligarchie als Demokratie, und verwandelt sie in eine medial manipulierte Kleptokratie, verleugnet die Grundlagen von Wissenschaft und Wahrheit, verkauft die Natur und damit die Zukunft des Landes und seiner Menschen dem Meistbietenden, hofiert Diktatoren, stigmatisiert die freie Presse. Wie ist es so weit gekommen?
Diese Frage steht im Zentrum dieses Buches. Was wir gerade erleben, die Verrohung der politischen Sprache und Praxis, die offene oder schleichende Entdemokratisierung, die Schwächung der Institutionen, der Finanzkapitalismus in seiner destruktivsten Form, die ökonomische Ungleichheit, der Abstieg der Mittelschichten, die Wut der Unterschichten, die Entkopplung der Reichen vom Rest der Gesellschaft, das Ressentiment, die Gereiztheit, der Rassismus, die Aggression gegen andere, Geflüchtete, Schwache und Menschen in Not, der Egoismus und die Kälte – all das hat eine Vorgeschichte, all das ist Teil einer Entwicklung, die unterschiedlich weit zurückreicht. Ein entscheidendes Datum für viele Veränderungen ist aber das Jahr 2008, das Jahr der Wahl von Barack Obama zum amerikanischen Präsidenten, das Jahr vor allem der Wirtschafts- und Finanzkrise, die Schwächen des gegenwärtigen Kapitalismus offenbarte und in der Folge die Demokratie nachhaltig schädigte.
Das Jahrzehnt von 2008 bis 2018 ist in diesem Buch zu besichtigen, die Jahre der Bankenrettung, der Euro- und der Griechenlandkrise, die Jahre von »too big to fail« und von »Schulden werden sozialisiert, Gewinne werden privatisiert«, die Jahre der Umverteilung von unten nach oben, der »marktkonformen Demokratie«, der Alternativlosigkeit und der Austerität, die Jahre, als mit großer Selbstverständlichkeit von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen wurde und sich tatsächlich Gräben auftaten, die es vorher entweder nicht gegeben hatte oder die übersehen worden waren, die Jahre, in denen die Erde immer wärmer wurde und in Syrien ein Bürgerkrieg wütete, der erst dann wirklich zum Thema der Politik wurde, als die Geflüchteten auf einmal vor der eigenen Tür standen.
Es waren Jahre der Realitätsverdrängung im Merkel’schen Modus der Anti-Politik, die doch nur die weitgehende Weltabgewandtheit oder Weltverweigerung von wesentlichen Teilen der Öffentlichkeit und der Politik spiegelt, »the closing of the German mind«, eine Politik ohne Politik oder Prinzipien, die das Land in einen Schlaf versetzte und den demokratischen Diskurs zum Erlahmen brachte, der eh schon kurz vor dem Verschwinden war. Es waren aber auch Jahre des Realitätseinbruchs, eine Wiederkehr der Welt in Form von Angst und Terror, als der Krieg auf dem Umweg über die ehemaligen Kolonien in die Metropolen des Westens zurückkehrte, ein »Zeitalter des Zorns«, wie es der indische Denker Pankaj Mishra genannt hat, in dem sich Konflikte gegenseitig aufluden, die nicht erst seit Jahren oder Jahrzehnten, sondern oft seit mehr als hundert Jahren schwelten.
Und beides, die Verdrängung und die Rückkehr der Wirklichkeit, hing miteinander zusammen, das Sichtbare und das Unsichtbare, das Symbolische und das Reale. Da war das eine Schlüsselereignis jener Jahre, die Wirtschafts- und Finanzkrise, die 2008 voll durchschlug, Demokratie und Gesellschaft massiv veränderte und weitgehend ohne Bilder, Hauptakteure, Schuldige und damit ohne einschneidende öffentliche Wirkung stattfand, in vielerlei Hinsicht ein technokratischer Staatsstreich hinter verschlossenen Türen. Und da war die andere im Grunde unübersehbare Entwicklung jener Jahre, die Migration über das Mittelmeer, die stetig zunahm in den Jahren seit 2011, verdrängt und abgewehrt von einem Europa, das sich zur Festung verschloss, und es war eigentlich klar, dass sich so eine Abschottung nur durch die Preisgabe von demokratischen Werten aufrechterhalten lassen würde. Man kann die Grundrechte eben schlecht an die Außengrenzen exportieren.
»Moral« wurde ein Schimpfwort in den deutschen Debatten jener Jahre, der Islam wurde als Feindbild gefunden, wodurch sich Millionen von Deutschen fremd im eigenen Land fühlen mussten, Millionen von Deutschen, die mitgeholfen hatten, dieses Land nach dem Krieg wiederaufzubauen, und die sich nun sagen lassen mussten, dass sie wegen ihrer Religion nicht hierher gehörten oder genetisch minderwertig seien. Das war 2010, der Sarrazin-Schock, gefolgt 2011 von der Nachricht, dass rechte Terroristen jahrelang Deutsche mit griechischen oder türkischen Wurzeln gejagt und ermordet hatten – der Rassismus, der sich hier und in den Polizeiermittlungen zu diesen von den Ermittlern so genannten »Döner-Morden« gezeigt hatte, verbunden mit dem jahrelangen und am Ende unbefriedigenden Zschäpe-Prozess bis zum Urteil 2018, all das zeigte, wie sehr sich dieses Land von der an der Oberfläche so modernen BRD zu einem Land gewandelt hatte, in dem das Hässliche und Hassende wieder einen Platz und eine Stimme hatten.
Die AfD ist diese Stimme, sie ist die Partei der Rassisten, gegründet von Euro-Skeptikern und in den Tagen der Agitation gegen Geflüchtete und den Islam immer mehr nach rechts getrieben, übernommen von Leuten, die die Siege und die sogenannte Ehre deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg offen feiern und eine »geschichtspolitische Wende« wollen – ihr Ziel ist ein anderes Land, sie wollen ein Deutschland, das sich rassisch und kulturell homogen definiert, eine Fiktion immer schon, denn im Europa der Völkerwanderungen gibt es diese Homogenität nicht, gab es sie nie, sie ist immer ein Phantasma gewesen, und gefährlich wurde es in der deutschen Geschichte stets, wenn dieses Phantasma Politik wurde.
Vorbereitet, gefördert und flankiert wurde der Aufstieg der AfD, die mittlerweile etwa so stark ist wie die SPD, von einer Phalanx von Publizisten, Philosophen, Privatgelehrten, die die Veränderungen des Landes und implizit der Welt nicht hinnehmen wollen, die den Multikulturalismus ablehnen, also die deutsche Realität der Einwanderungsgesellschaft, und die mit paranoider Verstiegenheit einen linken Feind sehen, den es in dem moderaten Land nie gab, ein linkes Meinungsmilieu, das den Diskurs kontrolliere, so der Vorwurf – tatsächlich, und das ist eine wesentliche Entwicklung jener Jahre, war es genau umgekehrt: Der Diskurs wurde durch Leitartikel, Kolumnen und vor allem die Talkshows von ARD und ZDF Stück um Stück nach rechts verschoben, Feindbilder wurden gepflegt und Spaltungen in »die« und »wir« wurden vertieft, und der Dauervorwurf der »political correctness« hat eine direkte Verbindung zum rechtsextremen Denken der AfD.
Es war eine Art Arbeitsteilung, die sich auch in der Kampagne gegen Angela Merkel zeigte, seit 2005 im Amt und Symbolfigur dieser Epoche: Als die »Merkel muss weg«-Rufe der Pegida-Hetzer von bürgerlichen Leitartiklern und Meinungsmachern übernommen wurden, offenbarte sich eine fanatische und kopflose Bewegung, es war auch eine Form von Exorzismus der Merkel’schen Politik, der diese Meinungsmacher verfallen waren und der sie folgten, solange diese Politik ihren Interessen und Ansichten entsprach, in der Euro-Krise, im zunehmenden nationalen Egoismus, in der rigorosen und teils moralisierenden Haltung gegenüber Griechenland etwa. Als sich Merkel aber in eine andere Richtung bewegte, in dem Moment, als sie sagte: »Wir schaffen das«, da wandten sie sich ab und verfolgten die Kanzlerin mit Feuer und Zorn bis an den Rand der Lügen und darüber hinaus.
Da waren die, die Merkel eine »Volksverräterin« nannten, auf den Marktplätzen und mit verzogenen Fratzen, und da waren die, die von der »Flutung« des Landes sprachen, von »Gesetzesbruch« und von »Staatsversagen«, und diese Leute saßen in Redaktionen oder auf Lehrstühlen und bekamen Preise im Namen der Nation. Die Verschiebungen in diesem Land sind, mit anderen Worten, tiefgreifend, sie reichen weit hinein in ein kulturelles und medial-politisches Milieu, das eine andere Vorstellung davon hat, welches Land es will, und es war die Sprache, es waren Begriffe und Formulierungen, mit denen dieses Milieu mit großer Beharrlichkeit diese andere Realität herstellen wollte, die seiner Weltsicht entsprach: Da war vor allem der Begriff der »Grenzöffnung«, die es tatsächlich nicht gab, weil die deutsche Grenze im Sommer 2015 durch das Schengen-Abkommen offen war und für die Geflüchteten nicht geschlossen wurde – es ist ein Begriff, der zur Dolchstoßlegende des frühen 21. Jahrhunderts wurde, eine Lüge als Realität.
Und das, der Kampf um die Wahrheit oder wenigstens eine Annäherung daran oder ein Verständnis dafür, dass es einen gesellschaftlichen Prozess gibt, einen Konsens über das herzustellen, was als Wahrheit gilt, und dieser Prozess heißt Demokratie – dieser Kampf also ist das untergründig verbindende Thema dieser Jahre, angetrieben und befördert von den technologischen Veränderungen jener Zeit, als Facebook und Twitter zu wichtigen Aggregatoren der öffentlichen Meinung wurden und die Traditionsmedien in ökonomische Schwierigkeiten und immer mehr auch in die Defensive gerieten. Das Jahr 2016 war hier zentral, weil erst mit dem Brexit und dann mit der Wahl von Donald Trump zwei Kampagnen – zweifelhafte – demokratische Legitimation bekamen, die dezidiert auf einem Konzept von »alternativen Tatsachen« beruhten, früher Lügen genannt.
Ich bin nach der Brexit-Entscheidung vom Juni 2016 und vor der Wahl von Donald Trump im November 2016 in die USA gegangen, wo ich ein Jahr mit meiner Familie lebte. Ich habe die letzten Tage vor der Wahl von Trump erlebt, als sich niemand, so schien es, vorstellen konnte, dass dieser Demagoge Präsident werden könnte, der beständig die Lüge als Argument gebrauchte und die Rationalität durch Verschwörungstheorien ersetzte. Und doch war die Wahlveranstaltung, die ich ein paar Tage vor der Wahl in Manchester im Bundesstaat New Hampshire besuchte, ein Zeichen für die Dynamik, für die Wut und Wucht, die diese Figur entwickeln konnte, verbunden mit einer realen Unzufriedenheit, die sich nicht nur auf die USA beschränkte.
Man hat das, was Trump und andere kanalisieren, oft unter dem Begriff »Populismus« zusammengefasst, aber ich glaube, dass das zu kurz greift und die eigentlichen Zusammenhänge eher verschleiert: Die Wahl von Trump, der Erfolg von Le Pen und AfD und all den anderen rechtsextremen und rassistischen Kampagnen verweisen eben auch auf eine Schwäche in der Politik und Argumentation der eher linken Parteien, die über Jahre nicht nur in den USA, in Deutschland, Frankreich wesentliche Teile ihrer Klientel vergessen hatten.
Die Ungleichheit nahm massiv zu in jenen Jahren, in den USA, wo die »große Rezession« der Jahre seit 2008 ein Generationenereignis war, prägend bis heute, aber auch in Europa. Bislang sind die politischen Folgen eher konträr zur politischen Logik, weil die Wähler mehrheitlich die Politiker und Parteien aussuchen, die für die Malaise verantwortlich sind oder aber Lösungen anbieten, die mehr auf Sündenböcke zielen und weniger auf wirkliche Veränderungen im System. In Deutschland ist die SPD im freien Fall, sie rückt rhetorisch und politisch nach rechts, im Versuch, verlorene Wähler zu gewinnen, und geht damit in die Irre. Die Lösungen liegen nicht im Alten, sie liegen nicht in der Vergangenheit, sie liegen im Blick auf die Möglichkeiten des Neuen, die in der Gegenwart angelegt sind. Das zeigte der Blick von außen, das zeigte die Rückkehr, das zeigt der Blick auf ein verändertes Land in einer veränderten Welt.
Wir haben die Wahl. Es liegt an uns, den Bürgern in dieser Demokratie. Es gibt eine große Dringlichkeit, so empfinden es gerade viele, die sich nicht damit abfinden wollen, dass dieses Land, diese Gesellschaft, weite Teile Europas nach rechts driften – und was so abstrakt, so geometrisch klingt, hat ja reale Konsequenzen: Es werden real Grundrechte verletzt, es wird real die demokratische Praxis eingeschränkt, es werden real Menschen diskriminiert, ausgewiesen, zum Leiden verdammt, dem Tod übergeben, im Namen einer Politik der Kälte, der Ordnung, der Macht und letztlich auch des Reichtums, denn in vielem sind die Verschärfungen des Klimas und die Verhärtungen der Debatten der Spiegel eines Kapitalismus, der radikaler und rabiater und immer ungerechter und gefährlicher geworden ist, genau in den Jahren, von denen dieses Buch handelt, der Epoche seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 bis in die unmittelbare Gegenwart.
Es geht also um politische Alternativen, das ist der Hintergrund für dieses Buch. Es geht darum, aus den Krisenphänomenen der Gegenwart etwas Konstruktives zu machen. Es geht darum, dem Reaktionären und dem Rechten etwas entgegenzusetzen, das dem Geist der Aufklärung, des Individuums und der Solidarität verbunden ist. Und in sich überlagernden Emanzipationsbewegungen, von #metoo bis zu #metwo, im Kampf gegen Sexismus und Rassismus, zeigt sich auch: Diese Gesellschaft hat sich verändert und verändert sich weiter. Diese Veränderungen verbreiten vielfach Angst. Für andere sind sie Teil ihres Lebens, sie befördern und inspirieren sie. Aufgabe der Politik wäre es, das richtige Maß herzustellen, ein gesellschaftliches Gespräch darüber zu führen, in welcher Welt wir leben wollen.
Das ist der Konflikt, der alle Bereiche dieser Zeit durchdringt. Es steht eine Gegenwart gegen eine andere. Es steht eine Realität gegen eine andere. Es steht ein Land gegen ein anderes.
Es muss nicht so sein.
1
Die Geflüchteten und die Neugründung des Landes
Etwas hatte sich aufgestaut. Die Hitze, die sich all die Wochen gebildet hatte, im Juli und auch im August, im Süden vor allem, aber auch in den Ebenen des Ostens und den Hügeln in der Mitte und im weiten Rest des Landes, und die sich immer mal wieder in heftigen Stürmen entladen hatte, war immer noch nicht gewichen, sie hing wie eine leere Erinnerung über den Menschen, über dem Land, in den Städten, sie war wie eine Ahnung, aber so etwas wird erst im Rückblick klar; und vielleicht ist dieser Rückblick auch falsch, mit dem Wissen von heute geformt, denn im Sommer 2015 war die Hitze weder Vergangenheit noch Zukunft, sie war eine ganz einfache Realität, sie war für alle anders und doch eine gemeinsame Erfahrung, sie war ein Augenblick, der sich ewig zu dehnen schien, grenzenlose Gegenwart, eine Möglichkeit, erst einmal.
Von Dürre berichteten die Zeitungen in jenen Tagen, von Unwettern, von Temperaturrekorden. Der Sommer 2015 war in Deutschland der zweitwärmste, seit die Menschen Wetter, Klima, Hitze wissenschaftlich messen und erfassen. Eine Omega-Wetterlage hatte sich etabliert, so nennen das die Meteorologen, und sie wich den ganzen Sommer über nicht mehr, ein Hochdruckgebiet, das so stabil ist, weil es von zwei Tiefdruckgebieten flankiert wird. Auf diese Art bildet sich ein Korridor; die Hitze, die Deutschland und ganz Europa erfasst hatte, kam von weit her, sie wurde vom mittleren Atlantik an der Küste Westafrikas nach Norden geleitet, sie erfasste die Länder des Maghreb und pumpte heiße Luft bis weit nach Nordschweden. Im Juni hatte es begonnen, gegen Ende Juli schien ein erster Höhepunkt der Hitzewelle erreicht, 40 Grad und mehr waren gemessen worden, selbst in Deutschland, die Temperaturen flauten etwas ab, bevor die Hitze Ende August dann noch einmal einen Anlauf nahm, störrisch fast, als wollte sie einfach nicht aufhören, und unter dem weiten europäischen Himmel schien der Sommer gar nicht mehr zu enden – nicht für die, die im Garten saßen und grillten, und nicht für die, die mit ein paar Tüten unterwegs waren, ein kleines Kind auf dem Arm, eine Familie auf der Flucht. Und unter der Sonne, die gnadenlos auf sie schien, weiteten sich die Züge der Menschen, die sich nach Norden bewegten, bis sie schließlich auf Kameras trafen, die sie als Bild dorthin brachten, wo sie hinwollten, in die Länder Westeuropas, wo sie Sicherheit erwarteten und Wohlstand vermuteten und wo ihre Hoffnung zu Hause war.
Es flirrte, über dem Kontinent, wobei man diese Hitze, wie so vieles, auf verschiedene Art und Weise beschreiben kann, als Zumutung oder als Versprechen, als etwas, das einen bedrängt, oder etwas, das einen trägt, und die verschiedenen Erklärungen, die verschiedenen Erzählungen und Interpretationen dieser Tage und Wochen prallen ja seither auch kräftig aufeinander. Am einfachsten und schönsten finde ich immer noch, was mir ein paar Wochen später, im September 2015, als die Hitze langsam wich und viele der Geflüchteten schon angekommen waren, eine Frau in München sagte, die sich, wie so viele Münchner, für diese Menschen einsetzte, ihnen half mit dem Notwendigsten, mit dem Selbstverständlichen: Es war so ein magischer Sommer, sagte diese junge Frau, die ein paar Restaurants betreibt und sehr viele Tätowierungen trägt, die Nächte leuchteten, die Menschen leuchteten, sie waren an dem Fluss, der sich wieder durch die Stadt schlängelte und in sein natürliches Bett zurückgekehrt war, renaturiert, von den starren Zwängen befreit. Es war ein Sinn für Gemeinschaft in der Stadt, so beschrieb sie es, es war wie eine große Feier, es gab eine Freude an sich und an den anderen, eine alles umfassende Euphorie und den Glauben an das Gute im Menschen, und aus der Liebe zu sich, aus der Liebe zu den anderen, aus der Liebe zu der Stadt heraus erwuchs die Hilfsbereitschaft, ganz unmittelbar. Es war eine Erzählung von sich, die diese Frau im Kopf trug, es war wie ein Text, den sie an sich selbst schrieb und in die Wirklichkeit verlängerte.
Und diese Erzählungen sind wichtig, die Geschichten, in denen wir uns selbst erkennen, sie liefern die Worte und Bilder dafür, wie wir sein wollen und wer wir sein wollen, sie schaffen ihre eigene Realität, weil die Dinge, die getan werden oder die geschehen sollen, erst einmal gedacht werden müssen. Das Positive im Kopf schafft das Positive in der Welt, das ist keine Hippie-Philosophie, sondern die Grundlage der Demokratie, die auf dem Vertrauen darauf beruht, dass Menschen schon das Richtige tun werden, wenn man ihnen dazu die Möglichkeit gibt. Natürlich gibt es Checks and Balances, um sicherzustellen, dass die Regeln auch eingehalten werden. Aber im Grundsatz ist das Menschenbild der Demokratie eines, das auf das Gute vertraut. Das ist, wenn man so will, der schmale Grat, das ist der Kipppunkt dieser Regierungsform: dieses Vertrauen, das der Erfahrung der Irrationalität entgegensteht, wie sie die Geschichte geprägt hat – das ist in gewisser Weise das utopische Moment der Demokratie, dass es die Möglichkeit von Freiheit gibt. Die Menschen, so die Annahme, können als Einzelne das Richtige oder das Falsche tun, und für richtig oder falsch gibt es Kriterien, manche von ihnen ändern sich mit den Zeiten, manche von ihnen bleiben gleich, weil sie das ethische Fundament eines guten und gerechten Lebens bilden – als Gruppe aber, und das ist so etwas wie eine Wette auf die kollektive Vernunft, als Gruppe, als Menge, als Gesellschaft werden sich die Menschen so verhalten, dass sie, mit Kant gesprochen, sich gegenseitig letztlich doch so gut behandeln, wie sie selbst behandelt werden wollen.
Auch das ist eine Erzählung, es ist die angenommene Wahrheit, auf der die Demokratie beruht, mehr vielleicht noch als auf den Institutionen, die sie stabilisieren und regieren. Es sind die Menschen, die sie ausmachen, die Demokratie wie die Institutionen, in einem komplizierten Wechselspiel, es sind die Menschen, als Einzelne, als Bürger, die entscheiden, in welche Richtung sich eine Gesellschaft entwickeln will. Sie handeln als freie Individuen, sie tun das, was sie für richtig halten. Und deshalb war das, was im Sommer 2015 in Deutschland geschah, so ein besonderes und grundsätzlich demokratisches Erwachen. Viele von denen, die damals aktiv wurden, als die Geflüchteten in ihr Dorf oder in ihre Stadt kamen, schienen selbst überrascht von sich zu sein, wie sie Schlafsäcke packten und Shampoos und Plastikrasierer und Wasserflaschen und im Keller nach Kleidern suchten und die Stadt, in der sie lebten, neu entdeckten, weil sie auf einmal wussten, wo die Sammelstellen für die Armen sind, die sie sonst nicht sahen, in ihrem Leben, ihrem Alltag, oder sie fuhren direkt zum Bahnhof, wo die Menschen ankamen, in München zum Beispiel, wo die Züge hielten, die aus Wien kamen, und die Bilder der Hilfe überlagerten sich mit den Bildern der Flucht und der Not, wie sie sie in Filmen in Schwarz-Weiß gesehen hatten, wie sie aus dem Fernsehen oder der eigenen Familie bekannt waren, und die Energie, die Offenheit, die Neugier, die Menschlichkeit, die Unmittelbarkeit, die Wachheit, die Selbstverständlichkeit des Helfens wird niemand vergessen, der dabei war.
Was damals passierte, in jenen Tagen Ende August, Anfang September 2015, das war auf verschiedene Art schön und bewegend und inspirierend, es waren Tage wie keine anderen, und alles, das zeigte sich recht schnell, wirklich alles geriet in Bewegung, von der anhaltenden Hitze überspannt. Es war eine politische Erhebung im ganz grundsätzlichen Sinn des Wortes. Viele Menschen entdeckten für sich, was es heißt, ein Bürger zu sein, aktiv zu sein, Menschen direkt zu helfen, nicht abzuwarten, bis jemand kommt und einen auffordert, wie das geht, selbst zu handeln, selbst Verantwortung zu übernehmen, sich selbst als Teil dieser Gesellschaft zu definieren, die offen ist und human, sich selbst als Teil dieser Demokratie zu verstehen, die aus mehr besteht als aus Wahlen alle vier Jahre und der Erkennungsmusik der »Tagesschau«, wo dann die Politiker das sagen, was sie sagen, und die Redakteure daraus das machen, was sie eben daraus machen; und viele entdeckten die Demokratie für sich zum ersten Mal.
Das, was sie hier sahen, war real, es war ein Bruch mit der medialen Routine des Leidens, die man hinzunehmen gelernt hatte, es war eine Not, die nicht durch Ironie abgefedert werden konnte, es war eine Frage, die sich auch dem eigenen Leben, der eigenen Biographie, dem eigenen Milieu stellte. Und all das, was später an Argumenten und an Argwohn in die Diskussion eingebracht wurde, von der Verklärung des Fremden über den Hass auf das Eigene, was auch immer das sein soll, bis zu dem Vorwurf, die Hilfe für die Geflüchteten sei nur durch den Holocaust zu erklären, weil sich die, die halfen, immer noch erpressbar fühlten, immer noch schuldig, und sie ihre Gelegenheit gesehen hätten, sich von dieser Schuld zu befreien – all das also und all die anderen Absurditäten wirken wie künstlich und fern und auch bösartig diesem Moment gegenüber, der so anders war, so unmittelbar und doch reflektiert: Es zeigte sich, wie dringend nötig die gegenwärtige Form der Demokratie diese Energie hat, diese Initiative, dieses Erkennen der Bürger als Bürger, als Grundelement der politischen Ordnung, das Individuum, das begründet, was das größere Ganze ist, nicht weil es so gesagt wurde, von außen oder innen erzwungen, sondern weil sie es tun wollten, als Bürger und Mensch.
Es war ein Akt der politischen Schönheit, das war der revolutionäre Kern dieser Tage, eine neue Formel für die Veränderung des Alltags und des Gemeinwesens. Die, die halfen, erkannten beides: die Herausforderung der Humanität, also am Beispiel der Ärmsten und Hilfsbedürftigen das zu definieren, was die Gesellschaft sein soll, wenn sie gerecht und menschlich und mehr als die Akkumulation der Einzelinteressen ist; und die Energie für das eigene Leben, also jene Kraft, die daraus entsteht, dass man etwas tut, an das man selbst glaubt, das Richtige, das Menschenwürdige. Beides zusammengenommen barg die Essenz einer konkreten politischen Utopie, in der die Perspektive von Verantwortung und Moral, die so zentral ist in der Frage nach dem guten, geglückten Leben, auf neue Art reflektiert und definiert wurde. Sie fanden Abstand zu der Rolle, die sie bisher gekannt hatten, und kamen dem näher, was sie sein wollten. Sie sahen sich, wie aus einer Entfernung. Und das, zeigte sich, ist so wichtig für Veränderung, so wichtig dafür, das Neue in die Welt zu bringen, eine Gesellschaft neu zu denken, das fehlt in den politischen Routinediskursen und auch in der Ansprache oder den Anforderungen der Parteien an die Bürger. Die Voraussetzung für eine Veränderung der Wirklichkeit ist es, die Wirklichkeit von einer anderen Seite aus zu sehen. Und das geschah mit den Geflüchteten, die eine Form von Wirklichkeit zerbrachen, die geschützte, die gefilterte, die Wirklichkeit, die das Elend und das Ertrinken von Kindern im Mittelmeer ignoriert hatte; die Geflüchteten brachten eine andere Form von Wirklichkeit, eine Herausforderung erst einmal, in jeder Hinsicht, aber es sind diese Herausforderungen, aus denen die Realität einer Gesellschaft erwächst, die menschlich ist und offen und nicht kalt und schroff.
Es war damit in vielem ein amerikanischer Moment, dieser Sommer 2015, der Sommer der Flucht, der Fragen, der Angst, der Menschlichkeit, des Gelingens und des Versagens, es war ein amerikanischer Moment in einem ganz ursprünglichen und idealistischen Sinn, weil Gesellschaft auf eine so deutliche Art und Weise als etwas erschien, das direkt von Menschen gemacht wird, Tag für Tag, mit Entscheidungen und Handlungen, für die man sich verantworten muss, nicht von Politikern oder anderen Mächten, sondern von jedem Bürger, als Stückwerk, als Graswurzel, als Gemeinschaftsprojekt; weil also Gesellschaft nichts ist, das vom Menschen getrennt ist und über den Menschen hinaus existiert, als kulturelle Form oder Erinnerungsgemeinschaft oder gar prophetisch oder völkisch gedeutete Schicksalsschmiede, wie es all die autoritären oder nationalkonservativen Gesellschaftsfatalisten formulieren, die dem Einzelnen einen Platz zuweisen wollen und in eine Ordnung zwingen, die größer ist als er oder sie selbst. Was sich hier zeigte und was viele Deutsche zum ersten Mal in ihrem Leben verstanden, war der Kern dessen, was John F. Kennedy so schön und klar formuliert hatte: Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt – ein Satz, der erst einmal die Direktheit der amerikanischen Demokratie ausdrückt, eine idealtypische Durchlässigkeit, die dieses Land mehr prägt als alle anderen Demokratien dieser Welt. Das ist jedenfalls das Versprechen, das immer auch mit einer Verpflichtung kommt: Demokratie ist kompliziert und anstrengend und eine tägliche Erfahrung.
Der Kern dessen, was im Sommer 2015 geschah, als die Geflüchteten in das Land kamen, dem ihre Sehnsucht galt – ohne dabei all die anderen Fragen auszublenden, die die Geflüchteten mit sich brachten und die so lange vergessen schienen, von der grundlegend ungerechten Weltwirtschaftsordnung über die Veränderung des Klimas und das Ignorieren von Migrationsbewegungen bis zur Hochrüstung an den Grenzen Europas, der Kälte im Hinnehmen von Bildern des Grauens, der Gefühllosigkeit dem Sterben im Mittelmeer gegenüber, eine Schule des Schreckens also, in der über viele Jahre das Leiden anderer als eine Art von Normalität präsentiert wurde und diese anderen mit dem ethischen Makel versehen wurden, dass sie schon irgendwie selbst dafür verantwortlich sind, dass sie zum Beispiel nicht in Deutschland geboren sind und einen BMW fahren können und in einem Reihenhaus am Rande der Stadt wohnen, ohne also den weltpolitischen Kontext und die Zeitzäsur zu vergessen, die wir als globale Gemeinschaft gerade erleben –, der Kern dessen also, was im Sommer 2015 geschah, als die Geflüchteten in das Land kamen, dem ihre Sehnsucht galt, war ein gesellschaftliches Erwachen und Erkennen, eine bürgerschaftliche Epiphanie, der Nukleus einer kommenden politischen Philosophie, die Staat und Bürger, Verantwortung und Zugehörigkeit, Rechte und Pflichten anders formuliert als bisher, mit anderen Konzepten und Ideen und anderen Begriffen. Das war die Radikalität dieser Ruptur, mit der sich auch die Radikalität der Reaktion erklärt, die rasch einsetzte und so destruktiv war: Es war aufseiten der Helfenden erst einmal keine eingeübte politische Erfahrung in dem Sinn, dass es über etwas abzustimmen galt, über Personen oder Themen, die Routine also, die in der repräsentativen Demokratie angelegt ist und ein Teil ihrer Krise. Es war eine konstruktive Art, die bestehende Ordnung auf so vielen Ebenen infrage zu stellen, und die Provokation war so grundlegend und so groß, dass der Rassismus und das Ressentiment, die darauf folgten, erst einmal wie ein Akt der Hilflosigkeit und Überforderung wirkten.
Tatsächlich ging es um etwas so elementar Politisches, wie es sich für viele zum ersten Mal darstellte, es ging um das direkte Erlebnis von Helfen, es ging darum, die Verfahren zu hinterfragen, an die man gewöhnt war, die Verwaltung zu erleben, wo sie funktionierte und wo nicht, das dichte Netz der Verordnungen zu verstehen, wo es wie eine Fußfessel fungierte und wo es nützlich war, es ging um eine Offenheit für Innovation und die Starrheit von Institutionen, es ging also durchaus darum, die Gelegenheit zu nutzen und aus der Herausforderung, die die Geflüchteten bedeuteten, einen Prozess des Nachdenkens über die Grundfragen der politischen Ordnung in diesem Land zu beginnen, die direkter, experimenteller, unfertiger, offener, von mehr Vertrauen und mehr Möglichkeiten geprägt sein sollte.
Wie also könnte diese kommende Ordnung aussehen, was sind die Bestandteile, was ist daran planbar, was muss man zulassen, wie kann man Wandel institutionalisieren oder skalierbar machen, wie es heute heißt, wie kann man also Institutionen und Prozesse schaffen, die für Veränderung offen sind, porös und stabil zugleich, was ist, wenn man keinen Plan hat oder haben sollte, weil die Wirklichkeit sich zu schnell wandelt und nicht mehr planbar ist, wenn man statt eines Plans nur eine Art Kompass besitzt, eine Vorstellung für das Gute und Richtige und moralisch Notwendige, eine Richtung also für den Wandel? Oder, genauso wichtig fast, wie kann man Scheitern etablieren als Form von Veränderung, wie würde eine Politik aussehen, die nicht auf das Gelingen setzt und damit oft auf Versprechen, die gebrochen werden, eine Politik, die die Möglichkeit des eigenen Scheiterns offenlegt? Und wie kann bei all dem das Neue in die Welt kommen und sich das Alte auf eine Art bewegen, die weniger verschreckt und mehr verbindet – wie also ist Veränderung möglich für Institutionen und Regime, durch Reform oder durch Revolution, in diesem Fall eine neue, andere Ordnung? All das sind Fragen, die vielem zugrunde liegen, was die Geflüchteten in die Diskussion brachten, von der Zwischennutzung von Turnhallen bis zur Flexibilität von Schulklassen, von Arbeitsverträgen und Bauverordnungen bis hin zu digitalen Lösungen und Apps für Hilfe, Kommunikation, Unterstützung von Geflüchteten – die Veränderung also von Prozessen und Gewissheiten, wie sie das 20. Jahrhundert geprägt haben, die analog, eher mechanisch als flexibel, eher linear als netzwerkhaft und offen waren, orientiert an Kriterien von Zugehörigkeit und Disziplin und am Muster der Nation. Die Fragen, die die Geflüchteten mit sich brachten, waren die nach einer ganz fundamentalen Veränderbarkeit von Gesellschaft im frühen 21. Jahrhundert, nach Reform, Disruption, Erneuerung und Energie. Der Widerstand und die Aggression gegen die Geflüchteten ist damit teils rein rassistisch oder kulturell-rassistisch zu erklären, er ist teils aber auch ein Widerstand gegen das Neue überhaupt, gegen die Unsicherheit, die die Welt ausmacht, gegen eine Veränderung von Gesellschaft, die unvermeidbar ist und von einer universellen Perspektive aus wünschenswert, jenseits der Fragen von Wirtschaft, Rente und der Notwendigkeit von Zuwanderung für ein Land wie Deutschland, das auf eine demographische Klippe zusteuert, weil die Sozialsysteme zusammenzubrechen drohen, wenn hier zu wenige Menschen leben und ihre Beiträge bezahlen. Es ist ein Widerstand, der an die Wurzeln dessen geht, was die Ängste von Menschen sind, die eine Welt verschwinden sehen und die neue nur erahnen – und dabei oft hören, dass es für sie schwierig sein wird, einen Platz in dieser neuen Welt zu finden, die von Maschinen bestimmt sein wird und von Algorithmen und einer Technologie, die nur wenige verstehen. Die Unsicherheit ist das Zittern der Zeit, und die Verweigerung vieler Menschen ist der Rückzug aufs Bekannte, selbst wenn es dieses Bekannte so nie gegeben hat, selbst wenn der Blick zurück immer voller Lügen und Verdrehungen ist, weil Geschichte das ist, was im Sieb der Gegenwart hängen bleibt, immer neu sortiert. Die Wahrheit liegt in der Zukunft, weil das, was kommt, als Möglichkeit pur und roh ist. Die Abschaffung der Zukunft, wie sie in den vergangenen Jahren in Deutschland geschehen ist und weitergehend im Westen überhaupt, bedeutet damit in gewisser Weise auch die Abschaffung der Wahrheit, also das zu sehen und zu benennen, was gut und richtig ist, gegenüber dem, was faul und falsch ist.
Es gab eine regelrechte Kampagne gegen das Richtige, in Teilen der Medien und der Politik, getragen von dem eigenen Anspruch, das Richtige zu tun, realistisch zu handeln, was auch immer mit Realismus gemeint war – es war jedenfalls in dieser Rede immer das Gegenteil von Moral, dieses Schimpfwort der kalten Krieger dieser Zeit, die sich nicht nachsagen lassen wollten, dass sie weinten, wenn sie Menschen sterben sahen. Nein, nein, das hatten sie lange hinter sich gelassen. Sie erschauderten vielleicht, wenn sie Bilder aus der Nazi-Zeit sahen. Aber die Gegenwart konnte sie nicht erschüttern. Dagegen hatten sie sich immunisiert, mit Ironie oder Zynismus oder Opportunismus oder einer anderen ansteckenden Disposition in Krisenzeiten. Sie waren bereit zum ultimativen Verrat, dem an den Rechten der Menschen, und sie waren stolz darauf, denn Stolz ist das Gegenteil von Zweifel, und nur wenn man zweifelt, so dachten sie, so sagten sie es sich gegenseitig, ist man angreifbar. Ist man stolz darauf, dass Menschen im Mittelmeer sterben, dann kann man es auch als moralische Verlogenheit abtun, wenn Menschen sagen, man müsse helfen. Der Tod wird nur real, wenn man ihn zulässt, als Emotion, als Bild, als etwas, das einen erreicht. Wenn man sich verbaut, zusammentut, wenn sich also eine gesellschaftliche Basis bildet für einen Feldzug gegen die Moral, dann konnte man sich in der Menge verstecken. Moral also als das, was eine Gesellschaft zusammenhält, wurde systematisch diskreditiert als etwas, das einem bestimmten Milieu zugeordnet werden konnte, auf eine sehr deutsche Art und Weise, diese Moralverachtungstradition, die sich leicht mit einem Verweis auf Friedrich Nietzsche verbinden lässt. Unklar bleibt bei diesem Argument, wenn man es Argument nennen will, was genau mit Moral gemeint war, außer dem Klischee, dass es irgendetwas mit evangelischen Kirchentagen zu tun haben sollte. Sie konnten oder wollten es nicht benennen, die Gegner der Moral, sie mussten es auch nicht benennen, so schien es ihnen, weil sie nur stigmatisieren wollten und nicht überzeugen oder argumentieren.
Diese Kampagne war destruktiv, und sie war undemokratisch, weil sie die Grundlage eines gerechten Zusammenlebens von Menschen verleugnete. Überhaupt war Gerechtigkeit nichts, was in diesen »Realismus«-Diskurs von rechts passte. Es war ein Abschied von Gerechtigkeit oder Solidarität, gesellschaftlich formuliert, es war der Versuch, den Egoismus durch das Feindbild des Moralisten ins Recht zu setzen. Bis weit hinein in die Kreise, die bürgerlich genannt werden, konnte man diese Bewegung beobachten, diese Art, sich von allem zu distanzieren, was sie mit Moral benennen konnten: Anfangs ging es um die ursprüngliche Hilfe für die Geflüchteten, die unter den Verdacht gestellt wurde, nur ein Ablasshandel für den Judenmord zu sein, also nicht genuin, denn, so die Logik, wie könnte Helfen an sich genuin sein, was würde Menschen wohl dazu bringen, anderen Menschen zu helfen, wenn es nicht die eigene Schuld wäre.
Es war die 2015er-Variante der »Auschwitz-Keule«, von der einst Martin Walser gesprochen hatte, also die speziell deutsche Variante, das eigene Monsterverbrechen gegen andere in Stellung zu bringen, die Verbrechen, Unglück, Tote in der Gegenwart verhindern wollten: eine doppelte Instrumentalisierung der Schuld und eine Relativierung zugleich, denn sie war nicht real in dieser Argumentation, die deutsche Schuld, sie war ein Defizit oder Defekt. Und dieser Defekt eben musste überwunden werden, diese Selbsterniedrigung der Deutschen, das war die weitere Logik, diese Moral-Knechtschaft. Die Härte und Unmenschlichkeit der eigenen Position war notwendig, die Vernichtung von moralischen Regungen war die Voraussetzung für politische Handlungen, die folgen sollten. Die Abschottung, die Deals mit Diktaturen, die Abschiebungen in Kriegsgebiete. Jede Regung von Humanität schien eine Gefahr zu sein für einen rasenden Status quo, der sich gegen alles sperren wollte, was die Veränderungen der Welt ins Land bringen wollte – um den Preis, und das wurde durchaus so gesehen, dass die Grundlagen der Menschlichkeit aufgegeben werden sollten, und damit letztlich das, was das Bürgerliche im politischen Sinn ausmacht. Die Erosion der Demokratie, die von Ungarn bis zum deutschen Innenminister und in den Feuilletons zu beobachten war, begann nicht mit der Reaktion auf die Geflüchteten – sie beschleunigte sich aber dadurch und schied die Gesellschaft in die, die halfen, und die, die die Helfer dafür verurteilten, dass sie naiv genug waren, an das Gute zu glauben und das Richtige zu tun.
Im Rückblick wird das einmal eines der großen Rätsel sein, wenn es wieder darum geht zu verstehen, wie Menschen zulassen konnten, dass unter ihren Augen schreckliche Dinge passieren. Die Abschottung gegenüber Menschen, die mit legalistischen Argumenten unterfüttert wurde: Gesetzesbruch durch Merkel, das war die rechte Parole, wurde dabei flankiert von einer Abschottung gegenüber Gedanken, die, wie die Geflüchteten, das Neue in diese schlafwandelnde Gesellschaft hätten bringen können. Es war eine kombinierte Weltverweigerung und Verantwortungslosigkeit, die sich hinter der Scheindebatte darum verbarg, was denn nun »konservativ« sei, in diesem Land, in dieser Zeit. Die Antworten auf diese hohlen Fragen waren dann genauso hohl, weil einerseits »konservativ« aus dem Wörterbuch abgeschrieben wurde und als »Bewahrung« definiert wurde, was an sich noch nicht mal der Versuch ist, eine politische Analyse zu wagen, und weil andererseits in der politischen Apathie, in die alle verfallen waren, die Grenze zwischen konservativ und rechtsextrem immer mehr verwischte, weil die Argumente, die von rechts in den Mainstream drangen, immer mehr zum Wesen des Mainstreams selbst wurden. Es schien, als ob bestimmte Kreise begriffen hätten, dass sie sich vorbereiten müssten, dass sie etwas einüben müssten, eine Zurüstung für die Grausamkeiten, die durch die Extremwirkungen etwa des Klimawandels auf die Bewohner dieses Planeten zukommen, die Reichen wie die Armen, wobei sich ebendie Reichen mit Mauern, die physisch wie psychisch sein können, und geflissentlicher Amoralität davor zu bewahren suchen, sich für die Grundlagen ihres Reichtums, also die weltweite Ungleichheit, verantworten zu müssen.
Die Geflüchteten sind damit, auf einer phänomenologischen Ebene, nur ein Bestandteil einer kommenden globalen Ordnung, direkt verbunden, wie es Bruno Latour beschreibt, mit den Folgen von kapitalistischer Ungleichheit und einer Klimakatastrophe, deren Konsequenzen kaum abzuschätzen sind. Im Guten wie im Schlechten ist schwer zu sehen, wie auf die Herausforderungen der Zukunft reagiert werden soll, das Experiment scheint die beste Form, sich auf das vorzubereiten, was man nicht kennt, die einen ziehen sich zurück und igeln sich ein, die anderen streben nach vorne und wagen das Neue, auch wenn sie nicht wissen, was es ist. Das ist einer, vielleicht der entscheidende Zwiespalt unserer Zeit, diese Mischung aus Nicht-Wissen und Handeln-Müssen, weil Abwarten einerseits keine Option ist und man doch nicht weiß, was genau zu tun ist. Diese Haltung, diese Offenheit also gilt es einzuüben, und die Geflüchteten selbst, in ihrem Mut, ihrer Verzweiflung, ihrem Optimismus und ihrer Energie, sind dabei in gewisser Weise ein Bild des Neuen überhaupt, dem sie sich stellen, ohne zu wissen, was es letztlich bedeutet.
Hannah Arendt hat das für ihre Zeit und aus ihrer Sicht beschrieben in ihrem Text »We Refugees« von 1943, sie spricht von sich als »Neuankömmling« oder »Einwanderer«, weil der Optimismus so wichtig ist, der mit den Worten kommt, die man für Menschen verwendet, die sich auf den Weg machen, und sich der Begriff der Flucht immer neu justiert und wandelt, je nach Situation und Epoche. Arendt schreibt dazu, die »größten Optimisten unter uns gingen gewöhnlich sogar so weit zu behaupten, sie hätten ihr gesamtes vorheriges Leben in einer Art unbewusstem Exil verbracht und erst von ihrem neuen Leben gelernt, was es bedeutet, ein richtiges Zuhause zu haben«. Der Geflüchtete als Gestalt der Stärke, der Autonomie, der Veränderung, der Unabhängigkeit, nicht der Not, der Bedrohung, der Armut und des Elends – dieses Bild ist real, es ist die Wirklichkeit vieler Menschen auf der Flucht, die bereit sind, alles hinter sich zu lassen und alles zu riskieren, etwas, das die Dagebliebenen, auch und gerade hier in Deutschland, nie tun würden, was ihre Ablehnung noch bestärkt. Und so wird dieses Bild des Geflüchteten als eines starken Individuums nicht gewollt: Der Geflüchtete wird in der Position der Abhängigkeit und der Schwäche gehalten, metaphorisch, bürokratisch, konkret, weil er sonst die bestehende Ordnung gefährden würde. Der Geflüchtete bleibt nur erträglich, wenn er schwach ist. Wäre der Geflüchtete stark, autonom, jemand, der die Wirklichkeit verändert durch sein Tun, seine bloße Anwesenheit, seine Bewegung durch Raum und Zeit, wäre er eine Chance – und das wirkt in unserer Epoche, in unserer Stillstandsgesellschaft wie ein Menetekel.
Es war der indische Schriftsteller Aman Sethi, der mich auf diesen Widerspruch hingewiesen hat. Ich hatte ihn im Zuge der Diskussion um die Aufnahme der Geflüchteten im Herbst 2015 kennengelernt und einen E-Mail-Wechsel begonnen, den das Goethe-Institut veröffentlichte. Von Anfang an mochte ich die Direktheit des Austauschs, vor allem aber die Art und Weise, wie Aman vieles von dem infrage stellte, was ich aus meiner Sicht formulierte. Im Grunde war unser Dialog, jedenfalls für mich, idealtypisch für das, was die mit sich bringen, die von außen kommen, in diese Gesellschaft, es ist die beste Reaktion auf das Neue, auf Geschichten von Menschen, es ist das Fundament von Demokratie: zuhören und die Perspektive des anderen einnehmen.
Er schrieb mir, und ich zitiere hier ziemlich ausführlich, weil ich seine Gedankenführung so mag und seinen Blick, der sich auf die größeren Widersprüche weitet, die in der deutschen Diskussion so oft ausgeblendet werden. Es ging um die Frage, wie wir von den Menschen reden, die weltweit in Bewegung sind, zum kleinsten Teil nur in Richtung Europa, die allermeisten von ihnen auf der Flucht oder auf dem Weg innerhalb von Asien und Afrika, weil Flucht und Migration eine Lebensrealität des frühen 21. Jahrhunderts sind, vor der eigentlich niemand mit offenem Herzen die Augen verschließen kann:
»Vielleicht«, so begann Aman, »können wir sie im Rahmen unserer Konversation ›Musafir‹ nennen, sie mit einem Wort in Urdu bezeichnen, das mit jeweils leicht abweichender Bedeutung auch im Arabischen, Persischen und Türkischen geläufig ist. Ein Musafir ist ein Reisender aus einem fernen Land, in einigen Sprachen ein Pilger, ein nach Wegen und Wahrheiten Suchender, und im Türkischen benennt das Wort, glaube ich (ich könnte mich da auch täuschen), einen Gast. Warum aber reist dieser Musafir? An dieser Stelle sei an ein wundervolles Wort im Persischen erinnert – an die Idee des ashina-zada