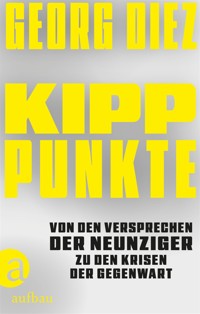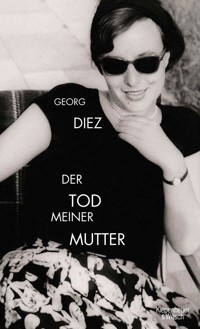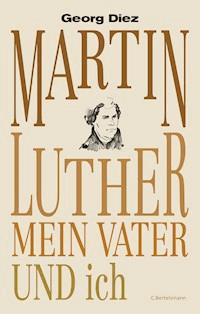
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wut, Glaube, Luther – mit diesem Dreiklang unterlegt Georg Diez seine Reise durch die eigene Gegenwart und den lutherschen Kosmos. Was können wir in dieser Welt, in der Glaube und Wut zu beherrschenden Koordinaten werden, von dem schroffen, störrischen Luther lernen?
Der Pfarrerssohn Diez verspricht mit seiner Spurensuche keine kurz geratene Aktualisierung dieses widersprüchlichen deutschen Revolutionärs, der immer mit dem Rücken zur Zukunft stand, weil er hinter sich den Teufel wähnte. Luther war ein Mann des Mittelalters und nicht der Moderne. Aber es ist gerade diese Distanz, die die Begegnung für den Zeitgenossen Diez in seiner politisch-biografischen Neulektüre Luthers so aufregend macht. Luther zeigt uns, wie wir wurden, was wir sind. Luther zeigt uns aber auch, wer wir sein könnten, wenn wir nur wollten. Und so ist dieses Buch eine Anleitung für mutige Veränderung, für widerständige Eigenheit im Denken und Handeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Was können wir heute, 500 Jahre nach der Reformation, von Martin Luther lernen? Für Georg Diez, protestantischer Pastorensohn, ist dies auch eine Frage der eigenen Familiengeschichte: Was haben Luther und der protestantische Glaube seinem Vater bedeutet, was ihm selbst als Kind und Erwachsener? Diez spürt den dunklen Seiten und Widersprüchen des oft verklärten Reformators nach. Luther ist für ihn der Mann zwischen Mittelalter und Moderne, Revolutionär und Reaktionär in einem, hin und her gerissen zwischen Befreiung und Unterwerfung, Wut und Gehorsam. Mit Blick auf die Gegenwart fragt Diez sich aber auch: Wie lässt sich die einst in Glauben gebannte Wut in einer durch Globalisierung, Finanzkrise, Migration aus den Fugen geratenen Welt sinnvoll wenden?
Autor
Georg Diez, geboren 1969, ist Autor beim »Spiegel« und Kolumnist von »Spiegel Online«. 2009 erschien sein Memoir »Der Tod meiner Mutter«. 2013 gründete er die digitale Diskurs-Plattform »60pages«. Bis Sommer 2017 arbeitet er als Fellow an der Universität Harvard.
Georg Diez
MARTIN LUTHER,MEIN VATER UND ich
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage© 2016 by C. Bertelsmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: Herburg WeilandCoverillustration: Carsten FockSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-16607-6V001www.cbertelsmann.de
INHALT
1 – Die Frage
2 – Der Riss
3 – Der Mann
4 – Das Wort
5 – Der Glaube
6 – Das Leben
7 – Die Revolte
Für Balthazar
1 DIE FRAGE
Der Tag, an dem ich aus der Kirche austrat, zu der mein Vater und sein Vater und sein Vater und sein Vater so viele Jahre lang gehört hatten, war ein klarer, kalter Wintertag. Ich hatte im Internet nachgeschaut, wo man hingehen und was man mitbringen muss, ich war in der Arbeit gewesen und hatte ein paar Mails geschrieben, ich wollte auf dem Weg nach Hause noch einkaufen. Da könnte ich, dachte ich, vorher noch beim Gericht vorbeifahren, die haben bis 15 Uhr geöffnet.
Es war Dezember, der Tag vor Silvester, und in dieser zeitlosen Zwischenzeit schien auf einmal möglich, was ich all die Jahre hinausgeschoben hatte. Die Entscheidung war ja längst gefallen. Und dass ich immer wieder gewartet hatte, lag weniger an mir. Ich hatte vielmehr eine Scheu davor, was diese Entscheidung für andere bedeuten würde. Erst wollte ich meinen Vater nicht verletzen, als er noch am Leben war. Dann hatte ich die Sehnsucht, meinen Kindern etwas von dem Glauben ihrer Vorfahren zu zeigen. Und schließlich fand ich es schlicht zu klischeehaft, aus der Kirche auszutreten, zu pompös, eine zu große Geste für etwas, an das ich kaum dachte.
Ich wollte niemandem etwas beweisen. Ich wollte nur konsequent sein. Ich glaube nicht an Gott, ich gehe an Weihnachten und manchmal an Ostern in die Kirche, und jedes Mal denke ich, wie falsch es ist, an einem Ort zu sein, der auf dem Glauben aufbaut, und selbst nicht zu glauben. Ich schalte den Kopf aus in diesen Momenten, ich reagiere mechanisch, ich mache, was man dort macht. Es ist eine Überlieferung, die nicht meine ist, und ich schaue mir selber zu, in diesem Museum des Glaubens, das in manchem auch das Museum meiner Familie ist.
Diese alten Worte, diese alten Gedanken, diese alten Gesten. Ich habe versucht zu verstehen, was sie mir bedeuten könnten. Ich habe versucht zu verstehen, warum sie mich nicht erreichen. Ich habe versucht zu verstehen, was sie für die anderen bedeuten, für die zum Beispiel, die um mich herum sitzen an Weihnachten, Gläubige, Ungläubige, Alte, junge Eltern und Familien, die die Kirche betreten und in sich hineinhören, ob da etwas ist, ob da mehr ist als der unbestimmte Wunsch nach einer Erinnerung, die es möglicherweise nie gegeben hat.
Glaube, so sehe ich das, ist zuerst einmal Selbstbeschreibung, Glaube ist Selbstentwurf. Der Einzelne als Teil des Göttlichen, der Zufall als Wesen des Plans, das Vergebliche als Bestimmung und die Erlösung als Belohnung, wenn man es aushält, wenn man mitmacht, wenn man sich fügt und dient und den Kopf beugt. Der Glaube soll der Willkür einen Sinn geben. Für mich hat das nie funktioniert, und ich würde auch sagen, dass es heute für die meisten Menschen nicht funktioniert, die, wie ich, etwas verloren im Gottesdienst stehen und die Lieder nicht mitsingen können. Wir kennen nur noch die Melodie. Wir summen sie mit. Oder wir bewegen einfach nur den Mund.
Manche von denen, die an Weihnachten oder Ostern um mich herum sitzen, glauben. Und manche von ihnen würden gern glauben und strengen sich an und schaffen es. Und manche würden gern glauben und schaffen es nicht und täuschen sich darüber hinweg und singen umso kräftiger mit. Und manche wollen gar nicht glauben, sie sind einfach da, weil sie da sind, sie machen das, was sie schon immer an Weihnachten und Ostern gemacht haben, es gibt ihrer Zeit ein Gerüst und für das Fest einen Anlass. Manche fühlen sich wohl dabei und manche nicht.
Als ich das Gerichtsgebäude in der Möckernstraße betrat, war ich beschwingt. Ich würde es endlich tun. Ich hatte meine Zweifel im Auto gelassen und meinen Personalausweis in der Tasche. In der dunklen Eingangshalle war eine große Ruhe, und die drei Beamten am Metalldetektor waren freundlich. Es war kaum etwas los an diesem letzten Arbeitstag des Jahres. Zuerst, erklärte mir einer der Beamten, müsste ich im Zimmer F 53 eine Gebühr von 30 Euro bezahlen, dann im Zimmer A 27 meinen Antrag ausfüllen. Es war, wie ich es haben wollte: ein Akt ohne Bedeutung, ein bürokratischer Vorgang, kein Pathos, kein Bekenntnis, kein Abschwören.
Die Frau im Zimmer A 27 trug einen schwarz-weißen Fleece-Pullover mit einem weihnachtlichen Wintermuster. Sie erklärte mir, dass ich den schmutzig grauen Zettel, den sie vor mich auf den Tisch gelegt hatte, gut aufbewahren müsste, zehn Jahre lang behalten sie die Akten im Gericht, dann werden sie zerstört, und wer aus der Kirche ausgetreten ist, sagte sie, der muss das auch beweisen können. Eine Art umgekehrte Unschuldsvermutung, dachte ich. Am besten, sagte sie, wäre es, wenn ich den Zettel einscanne, für die digitale Ewigkeit. Denn wer nicht beweisen kann, dass er aus der Kirche ausgetreten ist, der muss Kirchensteuer nachzahlen. Sie hätten schon mehrere solche Fälle gehabt, sagte sie und schaute mich warnend an, Menschen, die vor zwanzig oder dreißig Jahren aus der Kirche ausgetreten seien. Manchmal verlange das Finanzamt nur eine symbolische Zahlung, manchmal mehr. Sie schien über etwas nachzudenken. Dann drifteten ihre Gedanken weg. Sie schob mir den Zettel zu, und ich stand auf und ging.
Den Zettel faltete ich und steckte ihn in die tiefe Tasche meines warmen Wintermantels. Formal gesehen war die Kirchensteuer das, was mich am direktesten mit der Kirche verbunden hatte. Ich hatte sie immer ohne Emotionen bezahlt, das Geld war mir nicht wichtig. Ich sah in dieser Steuer keinen Ablass für nicht geleisteten Glauben. Sie war für mich so sinnvoll oder sinnlos wie ein Dinosaurierskelett oder altes Besteck. Ich verstand ihre Bedeutung und schaute doch achselzuckend auf ihre Existenz.
Mein Vater, und das überraschte mich damals, als er mir davon erzählte, fand sie falsch, diese Steuer. Ein Pfarrer, dachte ich, der die Grundlage für die Existenz jener Institution infrage stellt, die ihm die Miete und das biblische tägliche Brot bezahlt. Er hätte sich gewünscht, sagte er, dass die Kirchensteuer mit der Wiedervereinigung abgeschafft worden wäre, was durchaus möglich gewesen wäre, aber wie so viele andere Chancen der Erneuerung gedankenlos übergangen wurde. Mein Vater sagte damals, dass es ihm um den lebendigen Glauben gehe und dass die Menschen stärker mit einer Sache oder in diesem Fall mit der Kirche verbunden wären, wenn sie selbst entscheiden könnten, ob sie zahlen oder nicht, ob sie es wirklich wollen oder ob es ihnen letztlich egal ist. Das war seine Vorstellung vom Glauben: Der Einzelne sucht seinen Gott, der Einzelne formt seinen Glauben, der Gläubige erschafft die Kirche. Wenn es anders läuft, wird die Institution zum Problem.
Mein Vater war kein Rebell. Er war aber, und das ist eines der Rätsel, die ich mit diesem Buch ergründen will, ein freier Geist, der sich in ein System begab, die evangelische Kirche, das keinen besonderen Wert auf Freiheit legte. Er war ein Mann, der Worte liebte und der mir gegenüber doch ein wenig geizig damit war. Er war ein Mann, der viele Ideen hatte und Pläne und der mir wenig von dem Glauben zeigte, der ihn anscheinend so begeistert hatte, dass er sein Leben damit verbrachte, ihn anderen Leuten zu vermitteln, Sonntag für Sonntag, im Gottesdienst, auf der Kanzel, in der Predigt und jeden Tag im Gemeindebüro, wo er an seinem Schreibtisch saß, der neben dem schweren braunen Schrank stand, in der Ecke ein niedriger Tisch, auf dem eine Decke lag, die sich so seltsam anfühlte, das fand ich als Kind immer, wenn ich ihn dort besuchte, es war wohl eine Art Samt, und ich saß dort und wartete, bis er fertig war, und es roch nach alten Büchern und der Flüssigkeit, die er brauchte, um die Blätter für den Gottesdienst zu vervielfältigen. Es gab noch keine Kopiergeräte, er verwendete, so hieß das, Matrizen.
Mein Vater und meine Mutter hatten sich damals schon getrennt. Mein Vater hatte noch einmal geheiratet, die Gemeinde musste darüber entscheiden, ob der geschiedene Pfarrer Diez bleiben durfte, und hätte nur ein Gemeindemitglied dagegen gestimmt, er hätte gehen müssen. So waren die Zeiten, und vielleicht lag es auch daran, am Geist der 70er-Jahre, diesem Zwischenjahrzehnt, aus den 60ern in die Moderne geschossen, in der Melancholie der Utopielosigkeit gestrandet, dass er mir so wenig von Gott erzählte oder Jesus. Es schien fast, als ob er eine gewisse Scheu hatte. Es war, als ob er mich nicht damit behelligen wollte. Als ob er sich nicht traute, mich zu überzeugen. Als ob er nicht glaubte, dass mich sein Glaube überzeugen würde.
Warum aber hat er nicht versucht, seinem einzigen Sohn zu erklären, warum Gott seinen einzigen Sohn geopfert hat und warum das ein Zeichen der Liebe und der Hoffnung ist für die gesamte Menschheit? Warum hat er mir nicht erklärt, dass dieser Gott gut und gnädig ist, obwohl es auf der Welt so viel Elend gibt? Wie hat er sich dieses Durcheinander erklärt, das auf der Welt herrscht, obwohl sein Gott doch allmächtig ist und also leicht für Ordnung sorgen könnte? Warum straft Gott, was er liebt? Warum straft Gott, was er geschaffen hat? Was ist der Sinn der Schöpfung, wenn sie so viel Leiden bedeutet? Gäbe es keinen Glauben ohne Leiden? Ist, andererseits, eine Welt ohne Leiden überhaupt denkbar?
Der Mensch ist, wie er ist. Und Gott kennt den Menschen. Er kennt ihn so gut, könnte man sagen, weil er ein Geschöpf der Menschen ist. Die Menschen haben sich Gott erfunden, nicht umgekehrt. Es gibt Gott also, weil die Menschen an ihn glauben. Es ist ein, ja, Teufelskreis. Warum tut Gott, was er tut, wenn es ihn gibt?
Mein Vater ließ mich in Ruhe mit diesen Fragen, er war nicht besonders streitlustig, und ich war es damals auch nicht, und so herrschte eine mehlige Stille, die ich mit der Kirche verbinde und mit den Bildern, die ich aus der Kinderbibel kannte, die mein Vater mir geschenkt hatte. Es waren diese heiter-naiven Zeichnungen, die so typisch waren für einen Protestantismus, der seine Radikalität vor langer Zeit verloren hatte. Ungelenk schauen die Menschen dort aus und unelegant, als ob es zum Wesen des modernen Glaubens gehört, dass die Menschen auch ästhetisch hilfsbedürftig sind. Abraham mit dem schneeweißen Bart, Jakob, dem der eckige Kopf schief auf dem halslosen Körper sitzt, Josef mit den groben Händen und den großen Füßen, und auch Jesus hat einen müden Blick und Hände und Füße, die seltsam von seinem Körper abstehen, wie drangeklebt. Überhaupt sind sie alle etwas klumpig und lebensarm, diese Figuren, sie wirken selbst nicht sonderlich überzeugt von ihrer Geschichte, und eine Geschichte ist es ja, vor allem.
Die Metaphysik war aus diesen Bildern genommen, sie waren absichtsvoll abgemildert, die Dramatik der Existenz war reduziert auf Gesten der Hoffnung und der Versöhnung. Ist es aber das, wovon die Bibel erzählt? Die Geschichte vom barmherzigen Samariter zum Beispiel, eine eher dunkle Geschichte in den Bildern meiner Kindheit. Auf dem Titel des dünnen Buches, das ich so oft las und das jetzt mein Sohn Balthazar liest, sitzt auf einem Esel der mühsam bandagierte Mann, der in der Nacht von Räubern überfallen worden war, die ihn mit Keulen und Stöcken halb tot geschlagen hatten und im Graben liegen ließen. Sie trugen Schnurrbärte, diese Männer der Nacht, mächtige, böse Vorurteils-Schnurrbärte, die die Kinder wohl verschrecken sollten. Der erste Mann, der vorbeigeht und den Verletzten liegen lässt, ist ein Priester, er trägt Rot und reckt das Kinn hochmütig in die Höhe. Der zweite Mann ist ein Diener und schaut etwas zweifelnd zum Verletzten und lässt ihn doch liegen. Erst der dritte Mann aus Samarien hält an und hilft, obwohl sie Feinde sind, wie es im Text heißt, »die Leute von Jerusalem und die Samariter«.
Die Geschichte ist anrührend und schön. Wie der Samariter dem Verletzten zu trinken gibt und dem Mann, der ihn weiter versorgt, etwas Geld dalässt für die Pflege, das hat mich schon als Kind am meisten fasziniert – die vorausschauende Art dieses Helfers und das Vertrauen in den Mann, bei dem er den Verletzten zurücklässt. Die Geschichte ist wichtig und wahr in dem Sinn, dass Menschen anderen Menschen helfen sollten. Sie handelt von Liebe und Versöhnung. Aber braucht man dafür einen Gott? Jesus erzählt die Geschichte vom guten Samariter, um die Frage zu beantworten, was es bedeutet, seinen Nächsten zu lieben. Er erzählt sie auch, um zu zeigen, wie falsch und verlogen die mächtigen Priester im Tempel sind und wie gut und richtig die einfachen Menschen denken und handeln. Er ist die Stimme dieser Menschen. Das macht ihn gefährlich. Die Geschichte des Samariters ist die Botschaft des Umsturzes und der Revolution, verpackt in die Worte der Barmherzigkeit.
Und sie ist deshalb so beliebt, glaube ich, weil sie heute dem Selbstbild vieler Christen entspricht. Von der Gefahr, die in ihrem Glauben steckt, spüren sie wenig. Vom revolutionären Potenzial, das darin verborgen ist. Von der Wut, die im Glauben verpackt ist, gebannt, sozial abgefedert. Sie sehen die Güte, sie sehen die Liebe, sie sehen den Dienst am Menschen. Und sie fühlen sich gut dabei. Sie wären gern so. Sie hätten gern ihren Glauben von der Gefahr befreit, die einmal, auf ganz direkt politische Art, von Jesus ausging und die der Grund für seinen Tod war, weil er ein Aufrührer war, ein Umstürzler, ein Revolutionär. Sie werden durch die Geschichte auf eine ganz andere Weise bestätigt, in ihrem Selbstbild als kritische, konstruktive Christen: Es ist ein Ressentiment gegenüber Autoritäten, an das hier appelliert wird, ein Ressentiment gegenüber dem Priester, ein Ressentiment, das sich besonders gut anfühlt innerhalb eines Rahmens, der von Autoritäten gesetzt wird, der Kirche. Es ist ein Ressentiment, aus dem nichts folgt – im Gegenteil, das Gefühl, gegen die Macht zu sein, wirkt oft wie ein Beruhigungsmittel.
Das ist der eine Widerspruch dieser Geschichte. Der zweite Widerspruch ist, dass sie ganz grundsätzlich von einer Welt erzählt, die eben keinen Gott braucht, der den Menschen sagt, was sie tun und lassen sollen, was die Regeln und Pflichten sind und was die Vergehen und Verbrechen. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter handelt nicht vom Gesetz Gottes, sondern vom moralischen Handeln des Menschen. Und wenn es einen Gott brauchte, um diese Werte zu etablieren, dann ist dieser Gott spätestens seit dem Zeitpunkt nicht mehr nötig, als der Mensch sich dieser Regeln selbst bewusst wurde, spätestens seit der Aufklärung also.
Anders gesagt: Viele Fragen stellen sich so nicht mehr. Es braucht in der Beziehung zwischen den Menschen eigentlich keinen Gott mehr, diese Dreiecksbeziehung, die das Alte Testament geprägt hat, ist aufgehoben. Dort thronte noch über allem die strafende, fordernde, regelnde Instanz. Der Mensch des Neuen Testaments hat sich schon teilweise davon befreit, sein Gott ist kein Gesetzesgott mehr, er hat eine eher emotionale Präsenz. Gott ist Mensch geworden, wie es heißt. Doch was bedeutet das?
Der Gott des Alten wie des Neuen Testaments hat keine besondere spirituelle Kraft. Er schreibt viel vor, er hält die Zügel der Geschichte in der Hand, er schafft und schiebt an, der Mensch entsteht aus seinem Willen, aber sonst ist dieser Gott, als Figur, als Idee, als Gedanke, seltsam abwesend. Er straft, er zürnt, er verdammt und tötet. Der Mensch hat sich diesen Gott ausgedacht, um seine Stellung im Universum besser zu verstehen, um den Alltag zu regeln, um dem Leben einen Sinn und eine Richtung zu geben. Aber alles in allem kann man sagen, dass der Mensch der Bibel besser dasteht ohne Gott.
Für mich ist das eines der zentralen Probleme, wenn ich über den Glauben nachdenke, wie er im Christentum angelegt ist: Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die eigentlich vom Menschen gekappt werden könnte, gekappt wurde in der Aufklärung. Der Protestantismus, wie er mir in den ungelenken Bildern und der kargen Sprache der Kinderbibel begegnete, ist durchzogen von dieser Ratlosigkeit. Und der Protestantismus, wie ich ihn im Gottesdienst erlebt habe, ist da nicht anders. Der Gott, den sich die Christen einmal erfunden hatten, in aller Größe und Grausamkeit, ist hier nicht zu Gast. Es kann auch gar nicht anders sein. Dieser Gott ist lange tot. Die Protestanten feiern nicht mehr den strafenden, sondern den liebenden Gott, so wie ihn Paulus sich erdacht hat. Damit aber fehlt etwas, es ist nur ein Teil der Geschichte. Und so spürt man die Scheu, der Härte der Existenz auf den Grund zu gehen und das tiefe Schwarz des Lebens auszumessen, wie es die Bibel eigentlich tut. Aber sie trauen sich nicht mehr. Sie haben es verlernt.
Dabei ist die Strafe der Anfang dieses Glaubens, und der Leichnam Jesu ist das Symbol einer grausamen Liebe. Aber Jesus am Kreuz ist kein Zeichen des Endes, sondern das Versprechen für einen Anfang, heißt es. Er ist für euch gestorben, sagen die Evangelisten, sagt Petrus und vor allem Paulus, sagen die, die ihre Religion auf den Tod ihres Propheten bauten, der sich nicht mehr wehren konnte. Sie machten aus Jesus, dem Täter, ein Opfer, das zum Erlöser wurde. Sein Tod wäre damit aber auch kein Opfer mehr, sondern Mittel zum Zweck, Teil des Plans. Ohne den Tod Jesu gäbe es kein Christentum. Judas wäre demnach auch kein Verräter, er ist der Mann, der Gottes Willen erfüllt hat. Denn Gott wollte seinen Sohn opfern. Es ist kein Versehen. Es ist nicht einfach so passiert. Es musste geschehen. Merkwürdig bleibt: Der offensichtlich grausame Gott des Alten Testaments verschont Abrahams Sohn Isaak, der angeblich gütige Gott des Neuen Testaments lässt seinen eigenen Sohn bis zum Ende elendig leiden. Ein Unterschied: Die Toten des Alten Testaments blieben generell tot, der berühmteste Tote des Neuen Testaments darf wiederauferstehen.
Es ist unklar, was Gott dazu gebracht hat, seine Meinung zu ändern und sein Vorgehen zu überdenken. Er ließ ja noch vor nicht allzu langer Zeit und ohne große Skrupel praktisch die gesamte Menschheit untergehen und rettete nur Noah und seine Frau und ihre drei Söhne mit deren Frauen. Acht Menschen gegen alle. Im Garten Gethsemane dagegen lässt er einen sterben, um alle anderen zu retten. Ist das also noch derselbe Gott? Oder hat er in der Zwischenzeit etwas gelernt über die Menschen, die er von Anfang an mit Misstrauen betrachtete und denen er die Schuld und die Sünde mit auf den Weg gab? Ist er also weicher geworden mit der Zeit? Hat er von den Menschen gelernt? Ist er diese Art von Gott? Ein pädagogisch weichgezeichneter Gott? Oder haben sich die Menschen verändert? Aber was würde das für eine Rolle spielen? Gott war immer eine Projektion der Menschen, die sich ihre Schuld-, Straf- und Erlösungssehnsüchte so formen, wie es zu den Interessen der jeweiligen Zeit und deren Machtverhältnissen passt.
Wer ist also dieser Gott? Warum schickt er seinen Sohn? Warum geht sein Experiment überhaupt dauernd in die falsche Richtung? Er ist doch allmächtig. Oder eben doch nicht so ganz? Eher 80 Prozent allmächtig? 70 Prozent? Das Paradox des Glaubens ist, dass man ihn braucht, um zu glauben. Deshalb spielt es auch keine Rolle, dass die Geschichten so windschief sind, die Konstruktionen so wacklig, der Glaube so sehr strapaziert wird, um den Geschehnissen selbst einen Anschein von Plausibilität zu geben. Der Glaube wird ein Mittel zum Zweck, weil er nötig ist, um die Voraussetzungen für sich selbst zu schaffen. Ohne Glauben kein Glaube. Ein Hauptteil der interpretatorischen Arbeit für Priester und Prediger wie für die Gläubigen selbst besteht deshalb auch darin, sich das Schiefe wieder gerade zu denken, die Widersprüche mit Watte auszukleiden, die Bilder in die Welt zu holen, ohne dass eines von beidem Schaden nimmt, die Bilder oder die Welt.
Die jungfräuliche Geburt zum Beispiel. Was sich »durch Fleisch Werk besamet und schwängert, das trägt auch ein fleischlich und sundliche Frucht«, schreibt Martin Luther in seiner Schrift Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei von 1523, in der es darum ging, aus Christus einen Christen zu machen, der zwar als Jude geboren wurde, aber weil er Gottes Sohn ist, der Sohn des christlichen Gottes, der doch eigentlich auch der Gott des Alten Testaments ist, also auch der Gott der Juden, nach Luther kein Jude ist. Wie kann es sein, dass dieser Mensch als Mensch geboren wurde und doch ein Botschafter der Liebe wurde, ohne Fehler, ohne Erbsünde? Wir anderen, die wir durch Lust gezeugt wurden, sind »von Natur alle Kinder des Zorns«, so zitiert Luther an dieser Stelle Paulus. Aber zur Erlösung der Menschen ist eben deren vorherige Verdammnis nötig. Die Befreiung durch Jesus, durch das Christentum geschieht auf der Grundlage einer Sünde, die wiederum vom Christentum festgestellt wird, in diesem Fall in Gestalt von Paulus und Luther.
Es ist ein geschlossenes System, ein Zirkelschluss, und die Widersprüchlichkeit dieses Systems wird wiederum als Zeichen dafür genommen, wie wahr es sei, denn gerade in den Widersprüchen offenbare sich das Wunder des Ganzen. Für einen angstgetriebenen, von einem Teufel sich verfolgt fühlenden, von der Vorstellung einer Hölle besessenen, vom Hass auf die Juden immer mehr verzehrten Menschen wie Luther mag das alles noch einleuchtend gewesen sein. Aber selbst er braucht Windungen und Verbiegungen, um seinen Weg durch den Wust der Worte zu finden.
Tatsache ist: Jesus ist tot, und die Idee, diesen Tod als sinnvoll darzustellen, war genial. Sie war aber auch riskant. Wer sollte das mit der Auferstehung glauben? Die Idee war gerade deshalb genial, weil sie riskant war. Sie verband den Anfang des Glaubens mit einem Widerspruch, mit einem Test: Glaubst du, dass all das möglich ist, wiederauferstanden, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes? Dann wiederhole es, wiederhole es so oft, bis du es wirklich glaubst. Oder glaubst du es nicht? Dann bist du unser Feind. »Und wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende«, so heißt es in der Offenbarung des Johannes, ganz am Ende des Neuen Testaments, wo Gott wieder wie der alte klingt, blutdurstig, rachdurstig, »dem will ich Macht geben über die Heiden, und er soll sie weiden mit einem eisernen Stabe, und wie eines Töpfers Gefäße soll er sie zerschmeißen, wie ich von meinem Vater empfangen habe; und ich will ihm geben den Morgenstern.« (Offb 2,26–29)
Der Glaube, der doch eine grundsätzliche und gute Beziehung zur Welt beschreiben könnte, wird hier benutzt als Mittel, die Welt in Richtig und Falsch einzuteilen, in Gut und Böse, in Wir und die Anderen – das führt zu Gruppenbildung via Einschüchterung, Herrschaft über das Gewissen des Einzelnen mit den Mitteln der Angst und der Schuld. Freiheit gibt es demnach vor allem in der Unterwerfung unter den Willen Gottes. Freiheit gibt es in der Selbstaufgabe. Die Welt steht und vergeht, wie Gott es will. Der Mensch machte sich klein, kleiner, als er es gewesen war, als etwa die Griechen auf die Welt schauten. Kleiner als beim römischen Dichter Lukrez, der seine Poesie der Vernunft, der Natur, der Wissenschaft in dem Großgedicht De rerum natura schildert und die so frei und schön war, dass sie von der Kirche im 15. Jahrhundert bekämpft werden musste.
»Jeweils denkst du vielleicht von den dräuenden Worten der Priester
Heftig bedrängt und bekehrt aus unserem Lager zu fliehen!
Denn was könnten sie dir nicht alles für Märchen ersinnen,
Die dein Lebensziel von Grund aus könnten verkehren
Und mit lähmender Angst dein Glück vollständig verwirren!
Und in der Tat, wenn die Menschen ein sicheres Ende vermöchten
Ihrer Leiden zu sehn, dann könnten mit einigem Grunde
Sie auch der Religion und den Priesterdrohungen trotzen.
Doch so fehlt für den Widerstand wie die Kraft so die Einsicht,
Da uns die Angst umfängt vor den ewigen Strafen der Hölle.«
Das schrieb Lukrez in dem Jahrhundert, bevor Christus geboren wurde. Wo ist diese Helligkeit im Christentum, wo ist die Welt, die so reich und widersprüchlich ist, wo ist die Natur, die kein Feind des Menschen ist, sondern Rätsel, wie der Mensch selbst? Die christliche Botschaft dagegen braucht die Drohung, die Verdammnis, die Hölle, um ihr Versprechen der Erlösung zu unterfüttern. Der Glaube wurde dabei von der Vernunft geschieden – eine Trennung, die im Alten Testament angelegt ist und im Neuen Testament vollzogen wurde. Wenn Glaube und Vernunft auseinanderfallen, dann ist Raum für alle möglichen Manipulationen, für Wahn, für Radikalismus und bibeltreuen Fundamentalismus, für Hexenverbrennungen, für die Lehre vom Heiligen Geist, für das Verhütungsverbot, für das Abtreibungsverbot, für einen Streit darüber, ob sich beim Abendmahl der Wein tatsächlich in das Blut Jesu verwandelt, für die christliche und heilsgeschichtliche Begründung der Unterwerfung weiter Teile der Welt, für die Lehre von der Wiederauferstehung Christi, für das Bild dieses Gottes als Patriarchen mit wallendem Bart, für das Versprechen des ewigen Lebens, für die Herrschaft durch die ewige Angst.
Glaube und Angst sind eine gefährliche Kombination, sie bedingen sich auf gewisse Weise, sie produzieren eine Wut, die sich entladen kann, wenn sie das richtige Opfer findet. Die Religion, könnte man denken, hat neben all den spirituellen Fragen gesellschaftlich die Aufgabe, die vorhandene Wut zu bündeln und zu bändigen, sie in ein Deutungssystem zu überführen und zu entschärfen. Oft allerdings ist es anders herum, oft schafft die Religion erst Raum für eine Wut, die vorher gebunden war und die es so nicht geben würde ohne die harte Scheidung der Welt in Gläubige und Ungläubige, ohne die Intoleranz, die im Herzen der Religion schlummert.
»Und da es das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die erwürgt waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie schrieen mit großer Stimme und sprachen: HERR, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächest unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben einem jeglichen ein weißes Kleid, und war zu ihnen gesagt, daß sie ruhten noch eine kleine Zeit, bis daß vollends dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten noch getötet werden gleich wie sie. Und ich sah, daß es das sechste Siegel auftat, und siehe, da ward ein großes Erdbeben, und die Sonne ward schwarz wie ein härener Sack, und der Mond ward wie Blut.«
Das ist die Offenbarung des Johannes (Offb 6, 9–13) in der Übersetzung Martin Luthers, das ist beeindruckend besonders für Menschen, die sich beeindrucken lassen wollen. Erzwingungsprosa, Überwältigungsprosa, und das soll es ja auch erst einmal sein. Denn der da kommt »war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war; und sein Name heißt ›das Wort Gottes‹. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, daß er damit die Heiden schlüge; und er wird sie regieren mit eisernem Stabe; und er tritt die Kelter des Weins des grimmigen Zorns Gottes, des Allmächtigen.« (Offb 19, 13–15)
Die Sprache, das wird hier deutlich, ist das Mittel der Herrschaft, für Luther wie für so viele, die die Menschen davon überzeugen wollen, das Offensichtliche zu verleugnen – dass wir altern und sterben und die Sonne und der Mond ihre Kreise ziehen, egal, was mit uns passiert. Die Sprache ist das Mittel, die archaischen Kräfte zu bündeln, die sich im Glauben zeigen, die im Glauben aufgehen, die nie ganz verschwinden aus dem Glauben. Es ist die Gewalt, die im Glauben bleibt, es ist das Bild, das die Offenbarung des Johannes beschwört, als der Engel die Vögel ruft: »Kommt und versammelt euch zu dem Abendmahl des großen Gottes, daß ihr esset das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die daraufsitzen, und das Fleisch aller Freien und Knechte, der Kleinen und der Großen!« (Offb 19, 17–18)
Die Offenbarung des Johannes ist ein furioses Finale mit maximaler sprachlicher Feuerkraft, die Sätze spannen sich weit und drohend über dem Menschen auf und lassen ihn zurück in der Ohnmacht seiner Existenz, abhängig allein von Gottes Gnade. Mit großem Tamtam endet die Bibel, die sich vorher von der alttestamentarischen Zornesreligion in eine paulinische Zuwendungslehre verwandelt hat. Ganz anders die Kinderbibel, aus der mir mein Vater manchmal vorlas, die zum Ende lichte und hoffnungsvolle Töne findet, was einerseits verständlich ist – die Kinder sollen eben nicht verschreckt werden. Andererseits ist die Naivität dieser Erleuchtungsbotschaft so offensichtlich, dass sich die Frage stellt, was dem Glauben mangelt, wenn der Schrecken fehlt und die Sprache schwächelt.
»So wird es am Ende der Tage sein«, heißt es in meiner Kinderbibel, es ist ein Text aus dem Lukas-Evangelium. »Sie werden kommen von Norden und Süden, von Osten und Westen und mit Jesus zu Tisch sitzen und das Fest Gottes mit ihm feiern. Dann wird es keine Tränen, keinen Schmerz und kein Leid und keinen Tod mehr geben. Dann wird Jesus für immer bei den Menschen sein. Und sie werden alle miteinander Gott loben ohne Ende.«
Das ewige Leben, das dort versprochen wird, ist ein Leben ohne Leben, ein einziges Singen und Preisen und Loben, ein Aufgehen in Gott, das den Sinn des Menschseins ausblendet. Die grundsätzliche Furcht, die auch Luthers Religiosität unterfütterte, ist dabei längst gewichen, die Dornen des Leids wurden in den Jahrhunderten nach Luther sauber gekappt, die Botschaft wurde entschärft. Die Kraft, das Wagnis, die Unbedingtheit des Glaubens sind nicht mehr zu haben. Zu viel ist passiert in der Zwischenzeit, der Auszug des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit hat stattgefunden. Was bleibt also von der gewalttätigen Botschaft, die die Gottes-Behauptung auch immer war? Was bleibt von der Sprengkraft der Sprache, wenn das Dröhnen verklungen ist?
Gott hat die Menschen wieder und wieder in die Dunkelheit gestoßen, er hat sie in die Angst entlassen, er hat ihnen ihre Abhängigkeit damit versüßt, dass er ihnen am Ende ein ewiges Leben versprach. Aber wenn sie gar nicht in dieser Abhängigkeit waren, die Menschen, dann wäre die Erfindung der Verdammnis und der Erlösung auch nur ein Mittel, um die Abhängigkeit der Menschen zu etablieren. Versprich den Menschen, dass du sie befreist, und du kannst sie mit diesem Versprechen unterdrücken! Oder sie wenigstens gehorchen lassen. Du kannst ihnen Geld abnehmen für das ewige Heil. Du kannst allerhand anstellen mit dieser Höllenangst. Du kannst eine ganze Religion darauf aufbauen.
Das ist es, was ich auf einer ganz grundsätzlichen Ebene nie verstanden habe am Christentum, oder besser: an den Christen der frühen Zeit. Warum sie sich mit solcher kindlichen Freude selbst die Schauerbilder malten, die sie nachts am Schlafen hinderten und morgens blass erwachen ließen, sodass sie auf die Knie fielen, die schon blutig waren, und um Gnade flehten, winselten, beteten, getrieben von einem Wahn, der ihr eigener war. Wie sie die eigenen Ängste ins Gigantische vergrößerten und daraus eine Religion formten. Wie aus Negativität etwas letztlich Gutes entstehen sollte. Was das Versprechen von Strafe und die Idee der Sünde so attraktiv machte. Und wie die Angst vor dem Körper, die Angst vor dem Begehren, die Angst vor der Sexualität so groß sein konnte, dass man all das bezwingen musste.
Unterdrückung ist das Wesen dieses frühen Glaubens, wie er im Alten Testament formuliert wird und der seine Regeln fand, weil sie die Gruppe zusammenhielten und letztlich sicherten und beschützten. Diese Unterdrückung blieb aber auch im neuen Glauben bestehen, sie musste bleiben, weil es die Funktion dieses Glaubens war, eine zivilisatorische Richtschnur zu sein, ein Maß, an das man sich halten sollte, ein Mittel, um Gemeinschaften zu bändigen. Die Freiheit konnte immer nur relativ sein, nie absolut, weil sie die Menschen sonst zu sich geführt hätte. Sie hätten die Religion dann nicht mehr gebraucht. Zugleich stellten sich ein paar Fragen: Was ist der Glaube ohne das Versprechen der Metaphysik? Wie kann man im Glauben das Diesseits denken, ohne das Jenseits zu visionieren? Das sehr direkt Lebenszugewandte, das im Alten Testament seitenlang mit den Regeln der Ernährung und der Sitten zum Ausdruck kommt, wird im Neuen Testament abgelöst von einer Lehre, die sich von der Notwendigkeit emanzipiert, dass es einen Gott braucht, um das Entstehen der Welt zu erklären und den Lauf der Dinge.
Das war die Herausforderung, vor der Luther stand, das war seine Mission: Gott an dem Platz zu halten, den er innehaben musste, wenn das Gebäude der Autorität nicht zusammenkrachen sollte. Aus diesem Konflikt formten sich sein Glaube und seine Praxis. Er war an der Grenze von Mittelalter und Moderne, er sah das Problem und löste es auf seine Art: Er schritt nach vorn, mit dem Blick nach hinten. Er war ja eben frommer als fromm. Luthers Glaube wurde aus der Angst geboren, und er wurde wieder zu Angst, die ihre Beruhigung im Himmel suchte, im Jenseits, im Leben nach dem Tod, an jenem Ort, an dem sich Religionen besonders gut auskennen, Fremdenführer im Nichts. Diese Angst trieb ihn vor sich her, sie wohnte in Luther, so wie sie in vielen Menschen jener Zeit wohnte, tief, existenziell, ausweglos. Die Angst war die Welt, und die Welt war Angst. Gott wiederum war das Mittel gegen die Angst, er war aber auch der Grund der Angst. Luther konnte und wollte das nicht sehen. Er konnte nicht aus seiner Zeit heraus. Und wir wiederum können nicht in Luthers Zeit zurück. Wir können nicht so tun, als hätte es Descartes, Darwin, Nietzsche und Freud nicht gegeben.
Freunde haben mich gefragt, was ich an Luther mag, und ich habe ihnen geantwortet, dass ich an ihm gern mehr mögen würde, aber es ist so schwer, wenn man ihn dort besucht, wo er war, und nicht die eigenen Bilder davorschiebt. Der junge Luther, mit seinem offenen, wachen Gesicht, scheint mir ein anderer Mensch gewesen zu sein als der alte Luther. Aber was besagt das? Wer wüsste das zu bestätigen? Und ist es nicht bei so vielen Menschen so, dass sie ein paar Jahre haben, in denen sie ihr Wissen, ihr Wesen, ihre Kunst und ihr Schaffen formen, und danach bleibt vieles Verwaltung des Ruhms und auch der Einsichten?
Ich mag den Mut an diesem Mann, das immerhin kann ich sagen. Ich mag die störrische Art, die Unnachgiebigkeit, ich mag, dass er sich Feinde machte. Ich mag, wie er die Sprache benutzte, und ich mag, wie er sich selbstbewusst auf die Höhe seiner Gegner schraubte. In Worms war er einmal kurz davor, persönlich zu scheitern, so wie es ist, wenn Menschen anderen Menschen gegenübertreten, und auf einmal ist eine viel größere Macht im Raum, mit der sie nicht gerechnet haben. Ich mag das anarchische Moment, auch wenn es das falsche Wort ist, weil er seinen Widerstand ja wieder an eine Autorität band, die nicht aus ihm kam. Ich mag, dass er Raum für Neues schuf, ich mag, dass er die Form zerbrach, ich mag, dass er Scherben hinterließ.
Was ich nicht mag, ist die Angst. Es war Luthers Glaubensfuror, der die Spaltung der Kirche vorantrieb, gegen die, wie er es sah, unfrommen Antichristen in Rom. Aber diese Frömmigkeit funktionierte vor allem innerhalb der christlichen Droh- und Abhängigkeitssysteme. Durch die Jahrhunderte rieb sich das ab. Durch die Jahrhunderte nahm der Mensch den Platz ein, den ihm die Bibel verspricht, aber nicht zugesteht. Durch die Jahrhunderte veränderte sich das Bild des Menschen als Gläubigen – das Problem der Frömmigkeit, so wie Luther es gesehen hatte, blieb bestehen. Konkret gesagt: Was bleibt vom Glauben, wenn die Angst fehlt? Was bleibt vom Glauben, wenn der Himmel verschlossen ist? Was macht der Mensch ohne seinen Himmel? Ist das der Kern der Wut? Ist das die Ratlosigkeit, dieses Rennen gegen eine Wirklichkeit, die keine Antwort bietet, die Trost spenden könnte? Wenn der Glaube also die Wut nicht mehr bindet, was passiert dann mit der Wut? War im Anfang die Wut?
Die Antwort gab die Zeit. Es ist das Wesen des Menschen, dass er sich oft an etwas festhält, was es längst nicht mehr gibt. Der Versuch, diese Distanz zu überqueren, geht meistens schief. Für die Frömmigkeit in der alten Form gab es nach dem Aufblitzen der Rationalität während der Aufklärung keinen Platz mehr. Es sei denn, man wollte das verleugnen, was unabweisbar war. Ansonsten galt: Zurück blieb die Kultur. Zurück blieb dieses Gebäude des Glaubens, das aus Worten bestand und Sätzen und Liedern, aus Gesten und Gebräuchen, zurück blieben das Lesen der Bibelstellen am Morgen, das Gebet vor dem Essen, die Danksagung, die Demut, der Kopf, der geneigt wurde, die Ordnung, die sich über die Welt wölbte und die doch im Widerspruch zu all dem steht, was die Welt ist.