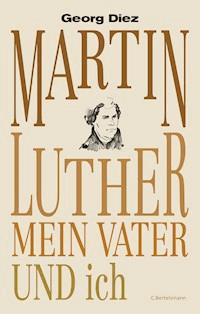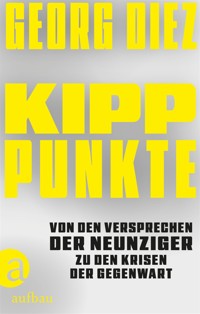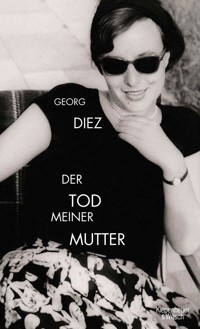
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die Mutter stirbt. Der Sohn erzählt. Ein bewegendes Buch über das Leben, zu dem auch der Tod gehört. Georg Diez, Autor der Süddeutschen Zeitung, berichtet mit atemberaubender Genauigkeit vom Sterben seiner Mutter, ihrem Kampf um Selbstbestimmung und Würde und seinem eigenen Umgang mit dem Unausweichlichen. Wenn das Sterben und der Tod ins Leben eines Menschen treten, ist die Reaktion oft Schweigen und Sprachlosigkeit. Für den unwiederbringlichen Abschied eines geliebten Menschen fehlen uns die Worte, die das Leiden und den Schmerz angemessen fassen. Der Autor und Journalist Georg Diez aber hat nach dem Krebstod seiner Mutter den Mut zu erzählen, wie sich ein solcher langer Abschied vollzieht. Mit größter Genauigkeit und Schonungslosigkeit beschreibt er, wie er als Sohn den Tod in sein Leben hereinlassen musste, während er zugleich seine Hochzeit feierte und darauf wartete, zum ersten Mal Vater zu werden. Mit liebevollem, aber präzisem Blick begleitet er den langen Weg einer Frau, deren Leben vom Kampf um Selbstständigkeit und von leidenschaftlichem sozialen und beruflichen Engagement geprägt war, bis in die Einsamkeit der Krankheit und der Schmerzen. Die langsamen Verschiebungen in den Beziehungen zu Freunden und Kollegen, die letzten Reisen, die letzten Spaziergänge, die letzten Feste, die vielen kleinen und großen Abschiede, die wiederkehrenden Hoffnungen, die praktischen Nöte bei der Organisation des Alltags: All das schildert Georg Diez so intensiv wie die Erschütterungen, die das Sterben seiner Mutter für sein eigenes Leben bedeuten. So ist ein Buch entstanden, das im Angesicht des Todes auch das Porträt zweier Generationen auf eine ganz neue Weise zeichnet: die Generation, die von den Befreiungsideen von 68 geprägt war, und ihre Adidas-Kinder, die in der Zeit des Wohlstands und der Sorglosigkeit aufwuchsen und nun mit Krankheit und Tod der Eltern konfrontiert werden. Georg Diez ist ein kleines Wunder gelungen: Er hat ein Buch voller Traurigkeit und Abschied geschrieben, das durch seine erzählerische Brillanz für den Leser eine befreiende Kraft entfaltet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Georg Diez
Der Tod meiner Mutter
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Georg Diez
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Georg Diez
Georg Diez, Jahrgang 1969, ist Journalist und lebt mit seiner Familie in Berlin. Er hat für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, den Spiegel und Die Zeit geschrieben und ist heute Autor der Süddeutschen Zeitung.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die Mutter stirbt. Der Sohn erzählt. Ein bewegendes Buch über das Leben, zu dem auch der Tod gehört.
Georg Diez, Autor der Süddeutschen Zeitung, berichtet mit atemberaubender Genauigkeit vom Sterben seiner Mutter, ihrem Kampf um Selbstbestimmung und Würde und seinem eigenen Umgang mit dem Unausweichlichen. Wenn das Sterben und der Tod ins Leben eines Menschen treten, ist die Reaktion oft Schweigen und Sprachlosigkeit. Für den unwiederbringlichen Abschied eines geliebten Menschen fehlen uns die Worte, die das Leiden und den Schmerz angemessen fassen. Der Autor und Journalist Georg Diez aber hat nach dem Krebstod seiner Mutter den Mut zu erzählen, wie sich ein solcher langer Abschied vollzieht. Mit größter Genauigkeit und Schonungslosigkeit beschreibt er, wie er als Sohn den Tod in sein Leben hereinlassen musste, während er zugleich seine Hochzeit feierte und darauf wartete, zum ersten Mal Vater zu werden. Mit liebevollem, aber präzisem Blick begleitet er den langen Weg einer Frau, deren Leben vom Kampf um Selbstständigkeit und von leidenschaftlichem sozialen und beruflichen Engagement geprägt war, bis in die Einsamkeit der Krankheit und der Schmerzen. Die langsamen Verschiebungen in den Beziehungen zu Freunden und Kollegen, die letzten Reisen, die letzten Spaziergänge, die letzten Feste, die vielen kleinen und großen Abschiede, die wiederkehrenden Hoffnungen, die praktischen Nöte bei der Organisation des Alltags: All das schildert Georg Diez so intensiv wie die Erschütterungen, die das Sterben seiner Mutter für sein eigenes Leben bedeuten. So ist ein Buch entstanden, das im Angesicht des Todes auch das Porträt zweier Generationen auf eine ganz neue Weise zeichnet: die Generation, die von den Befreiungsideen von 68 geprägt war, und ihre Adidas-Kinder, die in der Zeit des Wohlstands und der Sorglosigkeit aufwuchsen und nun mit Krankheit und Tod der Eltern konfrontiert werden. Georg Diez ist ein kleines Wunder gelungen: Er hat ein Buch voller Traurigkeit und Abschied geschrieben, das durch seine erzählerische Brillanz für den Leser eine befreiende Kraft entfaltet.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2009, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Tom Ising für Herburg Weiland
Covermotiv: © privat
Lektorat: Christian Döring
ISBN978-3-462-30058-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Danksagung
Für Lou
1
Sie wirkte wackelig auf ihren drei roten Kissen. Sie war auf ihrem Stuhl etwas nach vorne gesunken und ich war nicht sicher, ob sie zur Seite kippen würde. Sie schob ihre Gabel ziellos auf dem Teller herum, den Fisch von der einen Seite auf die andere, ein Stück Brokkoli von links nach rechts und den Tellerrand hoch. Früher machte mich das auf eine Art wütend, über die ich mich selbst ärgerte; heute machte es mich auf eine Art traurig, die ich seltsam tröstlich fand.
Meine Mutter war an diesem Tag nur mit Mühe aus dem Bett gekommen, und als ich die Wohnung betrat, die Tüte mit dem Essen in der Hand, stand Silvia neben ihr, die Pflegerin, die sie mochte, so wie sie manche Menschen mochte, sofort und bedingungslos, so wie sie manche Menschen nicht mochte, entschieden und nicht immer ohne Grund. Meine Mutter saß am Tisch im Wohnzimmer, sie hatte ihre Perücke auf, die Sonne schien aus dem Garten hell herein, meine Mutter war im Gegenlicht nur als Umriss zu sehen, Silvia beugte sich zu ihr herunter und sagte etwas, meine Mutter antwortete und drehte den Kopf zu mir und ihre Augen leuchteten.
Vielleicht will ich mich auch nur so an diesen Moment erinnern. Vielleicht saß sie gar nicht am Tisch.Vielleicht lag sie im Bett, als ich kam, in ihre wattierte schwarze Jacke gewickelt, die sie fast nie mehr auszog in den letzten Monaten, die rote Bettdecke weggeschoben, im Zimmer tote Luft. Sie hatte den Kopf zur Seite gedreht, sie starrte an die weiße Wand oder auf das Bild, das schräg über ihr hing, ein Poster von Miró, auf dem vor einem tiefschwarzen Hintergrund ein Wal zu sehen ist, der senkrecht nach oben zu schwimmen scheint. Dünn ist dieser Wal und schmal, fast wirkt es, als ob er schwebt, als sei er schon fort.
Vielleicht war sie auch auf der Toilette, als ich kam, und durch die Tür waren nur die wütenden Worte zu hören, mit denen sie sich gegen das wehrte, was sie so verzweifeln ließ, die Abhängigkeit, die körperliche Abhängigkeit, die Unfreiheit, die mit der Krankheit kam.
Vielleicht hatte sie auch gerade mit einer ihrer Freundinnen telefoniert und ihr gesagt, dass niemand sie verstehe und ihr Sohn schon gar nicht, oder sie hatte ihr gesagt, dass nur ihr Sohn sie verstehe und sonst niemand.
Vielleicht hatte sie einfach zu lange gewartet, bis ich kam.
Es waren traurige, es waren schöne, es waren Abschiedstage, jedes Mal, wenn ich da war, jedes Mal, wenn ich sie sah, wie sie im Sommer und auch noch im Herbst auf ihrer Terrasse saß, auf ihrem Holzstuhl, mit vielen Kissen und zwei Decken, auf dem Kopf einen Hut und meistens eine Sonnenbrille im Gesicht – es wirkte so, als habe sie nicht eine Stunde oder zwei dort gesessen, sondern Tage, Wochen, ihr ganzes Leben lang, auf dieser Terrasse in dem Garten, den sie so mochte. Die hohen Rosen, die vielen Blumen, deren Namen ich nicht kannte, die Büsche und der Baum, den der Sturm vor ein paar Monaten entwurzelt und den ein Gärtner mit einem Holzgestell fixiert hatte. Ich hatte den Gärtner angerufen, ich hatte ihn bezahlt, ich hatte das Gefühl, dass ich etwas getan hatte, das sie freute, das blieb, das sie an mich denken ließ, wenn ich weg war, wenn sie noch da war, wenn sie diesen Baum sah, der nun wieder gerade stand und hielt, es war wohl ein Lorbeerbaum. Jedes Mal erschrak ich, wenn ich sie dort sitzen sah, denn jedes Mal wusste ich, dass ich sie bald verlieren würde.
Und was kann man schon machen mit so einem Gefühl.
Der Tod schlich sich langsam in mein Leben in diesen Wochen und Monaten, der Tod, der schon so lange um meine Mutter war, als Krankheit, als Krebs, aber immer nur als Ahnung, nie als Realität. Merkwürdig war, wie der Tod in dieser Zeit eine sanfte Klarheit bekam und trotzdem nur vorsichtig seine Macht entfaltete.
Und merkwürdig war auch, dass meine Mutter immer schöner wurde in dieser Zeit. Ihr Gesicht hatte so weiche, entspannte Züge, wie ich es selten bei ihr gesehen hatte, wie ein Kind erschien sie mir. Ihre Augen waren voll Ruhe und Traurigkeit, sie erzählten von ihrer Einsamkeit und den Schrecken der Krankheit, und als sie aufgehört hatte zu kämpfen, sah ich in ihren Augen eine neue Gelassenheit, die fast wie Vertrauen wirkte. Sie trug ihre kurzen babyweichen Haare, die seit der Chemotherapie nachgewachsen waren, mit stolzer Würde. Sie waren grau, diese Haare, nicht rot, wie meine Mutter sie sich all die Jahre gefärbt hatte, seit ihrer Scheidung, seit ihrer Unabhängigkeit, hennarot.
Sie hatte sich eine Perücke gekauft, als die Haare anfingen auszufallen, die Perücke stand ihr gut, sie trug sie gern. Und wenn sie sich die Perücke vom Kopf zog, dann lächelte sie, wie ein Mädchen, das etwas getan hat, was ihre Eltern nicht wissen sollen.
Der nahe Tod hatte sie schöner gemacht und jünger.
Es dauerte ein wenig, bis wir so weit waren. Ich hielt sie an der Hand, sie ging mit langsamen, zögernden Schritten in den Flur, wo sie sich auf den durchsichtigen Stuhl aus Plexiglas setzte und erschöpft ausatmete. Wie dünn sie war; und wie schwach. Ich zog ihr den Mantel an und kniete mich vor sie hin, um ihr die Hausschuhe auszuziehen. Sie hob kurz die Füße, die sich leicht anfühlten. Ich zog ihr die Straßenschuhe an und suchte oben auf dem hellen Bauernschrank nach Handschuhen, fand aber keine.
Der Rollstuhl stand vor der Wohnungstür. Seit zwölf Jahren lebte sie hier. Eine kleine Wohnung mit zwei Zimmern und einem Garten, mitten in München.
»Hier will ich sterben«, hatte sie immer wieder gesagt, »und nicht in einem Krankenhaus, mit Schläuchen im Arm und all dem anderen. Ich will daheim sterben, versprich mir, dass du dafür sorgst.«
Ich versprach es ihr, obwohl ich nicht sicher war, dass ich das Versprechen halten konnte. Und obwohl ich noch nicht verstand, was es bedeutet, daheim zu sterben. Oder überhaupt, sterben.
Als ich sie nun über den Hof schob, ihre rosa Fellmütze fast heiter auf dem Kopf und über dem Schoß eine Wolldecke, unter der ich ihre Hände verpackt hatte, schaute sie hinauf in den blauen Himmel.
»Föhn«, sagte ich.
»Das ist kein Föhn«, sagte sie.
Da tauchte weit oben ein Flugzeug auf. Meine Mutter lachte, es war ein helles Gurgeln.
»Immer an dieser Stelle fliegt das Flugzeug durchs Bild.«
Ich wollte etwas sagen. Sie drehte sich um zu mir.
»Und immer an dieser Stelle schaust du so.«
»Wie schaue ich denn?«
»Das sagst du auch immer.«
»An dieser Stelle?«
»Natürlich an dieser Stelle. Das ist alles so lustig.«
»Was ist so lustig?«
»Ach, frag nicht so doof.«
Ich schwieg. Es hatte eine Weile gedauert, bis ich akzeptiert hatte, dass sie ihre Wahrheit hatte, die nur am Rande mit meiner zu tun hatte.
»Wohin willst du?«, fragte ich sie, als wir auf der Straße standen. Sie war schon länger nicht mehr mit dem Rollstuhl draußen gewesen, und die Unsicherheit, die sie seit dem Sommer gespürt hatte, war einer Art von Paranoia gewichen, die ich mir damit erklärte, dass meine Mutter merkte, wie ihr da jemand ihr Leben stehlen wollte. Wie es langsam eng wurde. Wie sie immer abhängiger wurde, von anderen und von mir.
Wohin ich wollte, wusste ich. Ich wollte zu dem Kinderladen in der Hans-Sachs-Straße. Als ich meiner Mutter im Mai erzählt hatte, dass meine Frau schwanger ist, hatte sie gesagt: »Dann kann ich ja noch gar nicht sterben.« Ich wollte, dass wir Kleider kaufen für das Kind, das sie nicht mehr sehen würde.
»Lass uns eine kleine Runde durchs Viertel machen«, sagte sie, und wir bogen nach rechts ab, vorbei an dem kleinen Zeitschriftenladen und vorbei an dem Schmuckatelier, in dem ich nie jemanden arbeiten sah, durch diese Straße, die ihre war, durch die Jahnstraße. Es gibt hier einen Metallbetrieb, mit einer breiten Einfahrt und einem Schiebetor, so schwer, dass es zwischen all den Blumenläden und Restaurants fast brutal wirkt; es gibt das griechische Restaurant Anti, wo im Dunkeln Figuren hocken wie aus Fassbinders Film »Katzelmacher«; es gibt an der Ecke die Chocolaterie, wo in der Sonne junge Väter und Mütter sitzen, ihren Kaffee trinken und ihre Kinder bewundern; es gibt das Restaurant Cooperativa, wo Studenten sich über ihre Freiheit ohne Kinder freuen. Und es gibt, genau gegenüber vom Haus meiner Mutter, einen Neubau, der sich bis vor zur Ecke zieht, das Altersheim Tertianum mit einem Restaurant, das Rosenkavalier heißt.
»Ich liebe dieses Viertel«, sagte sie, wie so oft. Sie sagte es, um sich aufzumuntern, sie sagte es, um sich anzutreiben. Es klang wie: »Wer hätte das gedacht?« Oder wie: »Toll, dass ich das geschafft habe.« Oder wie: »Halt, muss ich wirklich schon gehen?« Es klang wie der Schlussstrich unter ihr Leben, und es schien sie zu freuen, dass dieses Leben im Glockenbachviertel in München enden würde. Zu Hause und nicht im Tertianum oder im Krankenhaus.
»An dieser Stelle biegen wir immer ab«, sagte sie, als wir vorne an der Ecke standen, vor dem Gasthaus Rumpler, wo wir manchmal im Sommer in der Sonne gesessen und Schweinebraten oder Käsespätzle gegessen hatten. Ich beugte mich zu ihr vor, um zu hören, ob sie noch etwas sagte. Aber sie schaute nur.
Ich schob sie weiter, an dem kleinen Park entlang, mit dem Spielplatz in der Mitte. Ich machte vorsichtig Schritt um Schritt. Ich wusste, dass ich mich an das erinnern wollte, was jetzt war.
»Halt mal«, sagte sie. Wir waren an dem Spielplatz angekommen, und eine Weile schaute sie den Kindern zu, die zwischen den Bäumen hin und her rannten und deren Stimmen so hell klangen und so traurig an diesem Tag. Normalerweise hätte sie jetzt etwas gesagt, zum Beispiel, dass ich als Kind auf dem Spielplatz immer Sand gegessen hatte und dass sie das gut fand, weil Sand den Magen reinigt, und ich hätte gedacht, ja, ich weiß schon, das ist das, was von der antiautoritären Erziehung übrig bleibt, eine Erinnerung. Und ich hätte sie angeschaut wie eine Frau, die meine Mutter war und auch jemand anderes.
Heute schwieg sie. Es war ja auch alles gesagt.
»Weiter?«, fragte ich irgendwann.
Sie nickte.
Wir kamen an den Bach, der durch das Viertel fließt, die meiste Zeit verborgen unter Häusern, Straßen, Beton und nur selten an der Oberfläche.
»Die Leute denken immer, das ist der Glockenbach«, sagte sie, als wir an der Brücke standen, die über den Bach führte zur Pestalozzistraße, wo sie einmal gearbeitet hatte, wo sie eine Familienberatungsstelle geleitet hatte, ein halbes Leben schien das her. »Nur weil das hier das Glockenbachviertel ist. Dabei ist das der Westermühlbach.«
Es war wie Sonne, die durch Wolken bricht. Augenblicke von Klarheit, die schöne Geschenke waren in all der Verwirrtheit, die sie fortgenommen hatte in ein Reich aus Watte, Angst und verstreuten Gedanken. Meistens war es erschreckend, wenn sie verschwand; manchmal war es auch komisch. Und wenn sie wieder auftauchte, war ich zwar erleichtert, merkte aber, wie sehr ich sie schon verloren hatte.
Wir schauten von der Brücke auf das Wasser unter uns. Hell war es und ging dahin. Meine Mutter hob den Kopf. Von der anderen Seite des Baches kam eine junge Frau auf uns zu, mit einem Fahrrad und einem Kindersitz, in dem ein Mädchen saß mit langen brauen Haaren. Die Frau lächelte uns an, meine Mutter lächelte zurück. Ich kannte die Frau, wir hatten gemeinsame Freunde, und so unterhielten wir uns kurz. Als wir uns verabschiedeten, merkte ich, wie das Lächeln meiner Mutter an dem Mädchen hängen blieb.
»Ich weiß schon, ich weiß schon«, sagte sie, als die beiden über die Brücke gegangen waren, »die treffen wir immer an dieser Stelle.«
»Was meinst du denn genau damit? An dieser Stelle?«
»Na immer an dieser Stelle.«
»Du meinst, dass sich alles wiederholt?«
»Das hast jetzt du gesagt. Komm, fahr mich weiter.«
Ich weiß nicht, ob wir immer so waren. So hilflos, wenn es darum ging, die Distanz zu überwinden, die wir um uns hielten. So vorsichtig, wenn es darum ging, die Dinge zu benennen, die uns wichtig waren. So fremd, wo wir einander doch eigentlich die nächsten Menschen waren. Es ist seltsam. Im Grunde weiß ich erst, seit ich eine Tochter habe, wie sich Familie anfühlt.
Meine Mutter hatte Familie immer mit großer Skepsis betrachtet, als etwas, von dem man sich frei machen sollte, und nicht etwas, das einen trägt. Familie, das hatte sie in ihrem Beruf als Therapeutin oft genug gesehen, war ein Nest, in dem die Lügen wachsen. Dass es auch anders sein konnte, hatte sie nie erfahren. Ihre eigene Familiengeschichte und die Geschichte ihrer Ehe blieben für sie der Beweis, dass Unabhängigkeit einen am ehesten davor schützt, vom Leben verletzt zu werden. Stärke war darum für sie überlebenswichtig. Als sie schwach wurde, war der Tod eine doppelte Bedrohung und in gewisser Weise sogar eine persönliche Beleidigung.
Aber sie lernte, mit dieser Kränkung zu leben, sie anzunehmen, so wie sie auch annehmen konnte, dass ich sie durch ihr Stadtviertel schob, in einem Rollstuhl, mit einer rosa Fellmütze auf dem Kopf, die ich ihr vor ein paar Wochen zum 71. Geburtstag geschenkt hatte und die sie sich nicht mehr selbst aufsetzen konnte und nur dreimal trug in ihrem Leben. Das war das Vertrauen, das sie gewann, das war eine Ergebenheit, die nichts mit Glauben zu tun hatte. Sie hatte akzeptiert, dass sich unsere Rollen umgedreht hatten.
Und so standen wir uns am Ende zwar als Mutter und Sohn gegenüber. Unsere Bande waren nun aber stärker, schwächer, anders. Es blieb ihre Zurückhaltung, wenn es darum ging, mich zu beeinflussen. Es blieb meine Scheu, wenn es darum ging, sie zu befragen. Ich, das Einzelkind, das Scheidungskind. Sie, meine Mutter, die mich alleine ließ mit meiner Frage, was eine Familie ist, jenseits der Wut, die sie in sich trug, wegen der Feigheit und Verlogenheit ihrer eigenen Eltern.
»Ich habe doch gut gelebt«, das hatte sie immer wieder gesagt, und wie so vieles war auch dieser Gedanke lange entschwunden. »Ich habe doch ein gutes Leben gehabt«, das war für sie mehr eine Feststellung als eine Frage gewesen, das hatte wie eine Aufmunterung geklungen, wie ein Antrieb, das war ein Satz, der ihr half, der Enge zu entfliehen, die das Sterben für sie bedeutete.
Sie saß jetzt etwas nach vorne gebeugt im Rollstuhl, es schien nicht so, als ob sie über etwas Bestimmtes nachdachte. Die Sonne war hinter den Häusern verschwunden, und eine Ahnung von Dämmerung blieb über uns. Ich schob den Rollstuhl so vor mir her, dass ich das Gesicht meiner Mutter ein wenig sehen konnte. Sie schlief nicht. Sie hatte gesagt, dass sie noch zu dem Getränkeladen wollte, wo sie ihr Wasser kaufte, das ein Nachbarsjunge für sie abholte und ihr in die Wohnung brachte. Ein Klosterwasser, das besonders schonend sein sollte, es standen immer ein paar Flaschen in ihrer Nähe, aber sie trank zu wenig, sie trank viel zu wenig, das sagte ihr Arzt, das sagte ich, und irgendwann antwortete sie nicht einmal mehr.
Sie richtete sich auf und winkte durch die offene Tür in den Getränkeladen hinein.
»Ja hallo, Frau Diez«, sagte die Frau und kam zwischen den Bierkästen hervor, die fast den ganzen Raum verstellten. »Schön, Sie mal wieder zu sehen. Wie geht es denn?«
Die Frau trug eine graue Schürze und ein graues Gesicht. Sie wollte meiner Mutter erst die Hand auf die Schulter legen, hielt dann aber mitten in der Bewegung an und ließ die Hand etwa zehn Zentimeter über der Schulter meiner Mutter in der Luft schweben.
Meine Mutter lächelte und bewegte dabei ihre Hand so, als würde sie eine Glühbirne in die Fassung drehen und wieder hinaus.
»Wie viel schulde ich Ihnen denn?«
»Das kann ich Ihnen gleich sagen.«
Die Frau ging zurück in den Laden. Sie war klein und alt auf eine unbestimmte Art. Sie schaute einen kaum an, wenn sie mit einem sprach. Aber immer, wenn ich da war, um eine Rechnung zu bezahlen, fragte sie nach meiner Mutter. Kurz schien es dann, als ginge ein Licht an, weit hinten in ihren Augen. Sie versuchte zu lächeln, was ihr nicht gelang, und das Licht ging wieder aus.
»Elf Euro zehn«, sagte sie, als sie zwischen den Bierkästen hindurch zu uns zurückkam.
Meine Mutter zog unter ihrer Decke die schwarze Plastiktasche heraus, die sie sogar im Bett bei sich hatte, neben ihrem Kopfkissen in einem roten Pappkarton, ihre EC-Karte war darin und ihr Personalausweis, 1000 Euro in bar waren darin und viele Zettel, auf die sie mit verwackelter roter Schrift Sachen geschrieben hatte, die sie nicht vergessen wollte. Den Namen der Pflegerin zum Beispiel, die sie abends wusch. Sie gab mir die Tasche, und ich holte aus einem der kleinen Reißverschlussfächer das Geld heraus. Ich zahlte und gab die Tasche meiner Mutter zurück, die sie wieder unter ihre Decke schob.
»Auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen.«
»Eine nette Frau«, sagte meine Mutter, als wir ein paar Meter entfernt waren. Dann drehte sie den Kopf erst nach rechts und dann nach links, wo ein Laden war, in dem man Tee und Kissen kaufen konnte.
»Der ist neu, der Laden«, sagte sie, »den kenne ich noch gar nicht.«
Kurz blieben die Worte stehen, dann fielen sie in sich zusammen.
Wir bogen in die Hans-Sachs-Straße ein. Vor dem Fahrradladen hielt ich an und klopfte an die Tür. Aus dem Halbdunkel kam ein Mann und öffnete.
»Grüß Gott, Frau Diez«, sagte er zu meiner Mutter, »Sie wollen wissen, ob das Rad schon verkauft ist?«
Meine Mutter nickte. Es war ein Fahrrad mit besonders niedriger Stange, das sie sich gekauft hatte, als sie die Füße nicht mehr so hoch heben konnte. Bis vor einem Jahr war sie damit ins Theater gefahren und manchmal auch zum Einkaufen.
»Jetzt wird es ja bald Winter.«
»Wir können das Rad gern bei uns aufheben und im nächsten Frühjahr verkaufen.«
»Das wäre schön.«
Es wirkte einen Moment so, als wollte einer von beiden noch etwas sagen, dann drehte sich meine Mutter zu mir um und ich schob sie weiter. Vor dem Buchladen hielt ich an, weil ich dachte, dass sie das freuen würde, sie hatte so viele Bücher hier gekauft.
»Eine nette Frau«, sagte sie und meinte die Buchhändlerin, aber weil sie sich im Fenster spiegelte, schien es, als spräche sie zu sich selbst.
Ein paar Häuser weiter war der Kinderladen. Wir hatten schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir zusammen Kleider kaufen wollten für das Baby, auf das sie sich so freute. Aber jetzt, wo wir so nah waren, wirkte es, als sei sie sich nicht mehr sicher. Vielleicht, dachte ich in diesem Moment, dachte sie in diesem Moment, können wir den Tod etwas vertrösten, wenn wir den Einkauf verschieben.
Der Laden hatte eine alte, schmale Tür aus Holz, an der die Farbe abblätterte. Ich versuchte, die Tür mit der Schulter aufzuhalten. Dann drehte ich den Rollstuhl um, meine Mutter stöhnte etwas, ich hielt die Tür mit meinem Fuß auf und zog den Rollstuhl rückwärts die Betonstufe hoch in den Laden.
»Hallo«, sagte meine Mutter und war wohl selbst überrascht, wie kräftig ihre Stimme klang. Aus dem hinteren Teil des Ladens kam eine junge Frau.
»Wir suchen etwas für meine Enkelin.«
»Wie alt ist sie denn?«
»Sie ist noch gar nicht geboren.«
Die Frau schaute meine Mutter an und dann mich und zeigte uns ein paar kleine Strampelanzüge in Rosa und eine Bluse mit Rüschen. Meine Mutter sah sich die Kleider kaum an.
»Und da drüben?«
»Das ist schon für ein bisschen ältere Babys.«
»Lass mich das mal anschauen«, sagte meine Mutter.
An der Stange hingen Pullover und Hosen, etwas darüber Mützen, Schuhe und Socken. Meine Frau und ich wussten nicht, ob es ein Mädchen werden würde oder ein Junge. Meine Mutter war sich sicher.
»Diese gelben Socken da«, sagte sie, »die will ich, das sind die Socken für die rosa Prinzessin.«
Das Sterben passiert meistens nicht plötzlich. Es zieht sich hin, das Leben entweicht in vielen kleinen und ein paar großen Schüben, jedes Mal erschrickt man ein bisschen, trauert ein bisschen, findet sich damit ab, macht weiter. Dann geht es wieder ein wenig besser, das Leben drängt sich in den Tod hinein.
Wenn man sieht, wie ein Mensch stirbt, dann ist die Trauer etwas, das in einem wächst. Trauer hilft dem Überlebenden und nicht dem, der stirbt. Manchmal habe ich mich dafür geschämt, dass ich die Trauer genossen habe. Manchmal auch nicht.
Ich war oft bei meiner Mutter in diesen letzten Monaten; das sagte meine Frau. Ich war nicht oft bei meiner Mutter; das ist mein Eindruck. Ich war so oft da, wie ich konnte; das sagte meine Mutter, auf diese zwiespältige Art, die viele nicht verstanden.
Hochmütig, harsch, schwierig, das waren Worte, die Menschen benutzten, um sie zu beschreiben, das sind immer noch die Worte, die sie benutzen, und es sind ihre Freunde, die so reden. Missionarisch, sagen sie, war sie, geradlinig, unbedingt.
Ambivalent, das würde ich sagen. Und ausweichend.
Wir konnten über alles sprechen? Meine Mutter glaubte das sicher, sie hatte in ihren jahrelangen Therapiesitzungen gelernt, dass Reden hilft. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass wir redeten. Ich kann mich erinnern, wie wir zusammen beim Essen saßen, an dem hellen Holztisch, der bis zuletzt in ihrem Wohnzimmer stand, und ich war zwölf und las Asterix. Und sie, schwieg sie? Wahrscheinlich schwieg sie nicht, aber sie sagte auch fast nichts.
Es war eine eigentümliche Stille zwischen uns, die aus Worten bestand, die wir austauschten, ohne sie genau anzusehen. Wir steckten sie weg, diese Worte, oder wir ließen sie einfach fallen und hoben sie nicht mehr auf. Wir waren uns nah, ohne uns jemals nah zu sein.
Eine Weile dachte ich, dass das an ihr lag. Dann dachte ich, dass das an mir lag. Dann dachte ich, vielleicht liegt es an der Scheidung. Und erst nach ihrem Tod habe ich verstanden, dass diese Distanz, diese Kühle, diese Kälte etwas war, das sie aus ihrer Familie, aus ihrem Elternhaus mitgebracht hatte, eine Verschwiegenheit und Gefühlsverleugnung, die sie nicht mehr loswurde und von der auch ich mich erst nach und nach frei machen konnte.
Etwas verwirrend war dabei, dass sie beides zugleich sein konnte, direkt und ausweichend, aggressiv und schwach, ambivalent eben, selbst in ihrem Versuch, die Lügen im fremden und im eigenen Leben zu finden. »Verlass deinen Mann«, sagte sie ihren Freundinnen, die über ihre Ehe klagten, sie hatte es ja auch getan, sie hatte ihren Mann verlassen, und wenn ihre Freundinnen in der Ehe blieben, war sie enttäuscht. »Die führen eine total verlogene Beziehung«, wie oft habe ich diesen Satz gehört.
In den siebziger Jahren gründete sie eine Gruppe, um die Frauen feministisch wachzurütteln. Eine Weile ging das gut, sie redeten über das Kochen und den Haushalt und die Arbeit. Als es dann aber auch um Sex ging und andere intime Dinge, kamen immer weniger Frauen und die Gruppe zerbrach. Offenheit hat Grenzen, und es schien nur so, als wollte meine Mutter das nicht akzeptieren.