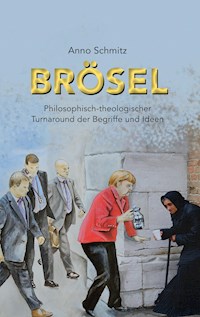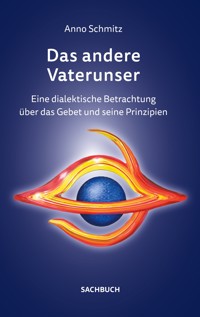
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das andere Vaterunser Hunderttausende treten aus der Kirche aus. Sollen Dogmen erhalten bleiben, ist es notwendig, Glaubwürdigkeit zu bewahren, sowie mit Mut und Klugheit die Traditionen aufrecht zu erhalten und Reformen oder Ergänzungen anzugehen. Das wird dann zwingend, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse unumkehrbar sind und sich Rechtsstaatlichkeit nicht mehr beugen lässt. Von der Theologie wird in einem solchen Fall erwartet, dass aufgeblähte Strukturen, Überhöhungen und auch strafrechtliches Fehlverhalten gerichtet werden. Ein jahrzehntelang verordnetes Lehramtsschweigen gefährdet den Kulturkreis der Theologie in gleicher Weise. Derartiges Verhalten führt zur Vertrauensfrage. Für jede Religion ist das fatal, weil in der Folge die Gläubigen aus der Kirche und aus der Religion austreten oder sich in eine Stille zurückziehen, die in einem Irrtum führen kann. Eine lebendige Religion zweifelt und strauchelt nicht an Herausforderungen, sondern meistert diese ohne Malheur. Eine gesunde Theologie muss sich für die Philosophie interessieren, um auf Konflikte vorbereitet zu sein. Auf diese Weise können dann an den Schlüsselstellen Theologie und Philosophie zusammengeführt werden. Derartige Übungen sind kein Menetekel, sondern zwingend notwendige Dialektik, um den Glauben letztendlich noch sicherer und stärker werden zu lassen. Eines dieser Themen ist das Gebet, das in allen Religionen und auch im Buddhismus von zentraler Bedeutung ist. Das Gebet wirkt als Zement in allen Religionen und bleibt ein verbindendes Prinzip, auch für alle die aus der Kirche ausgetreten sind und auf sich selbst gestellt bleiben. Diese Gebetsbetrachtung richtet sich an alle Opfer von schwerer Gewalt und Missbrauch. Zu oft wurden sie alleingelassen. Das andere Vaterunser spiegelt eine andere Betrachtungsweise wider, und zeigt dialektische Schwachstellen an, die nicht mehr tragfähig sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet ist diese allen, die aus der Religionsgemeinschaft ausgetreten sind, und jenen, die Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch wurden.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Ein spekulativer Irrtum
Das gescheiterte Gebet
Das Gebet an sich
Ist das Gebet eine Tugend?
Die Tugend des Gebetes führt zum Glauben
Allgemeines Gebetsverständnis
Der Ereignishorizont aus dem Sein Gottes
Kann man Gott überhaupt lieben?
Die Liebe Gottes, eine Voraussetzung
Umstände der Liebe – eine Voraussetzung zum Gebet
Liebe in der Übersicht
Der Mensch als Bettler
Was ist unter Demut zu verstehen?
Demut an sich
Was erstaunt uns an der Demut?
Die Demut, ein Kalkül
Leiden
Glaube
Hoffnung
Die Frömmigkeit und das Gebet
Gott, der Namenlose
Manipulation durch Beten
Das aussichtslose Gebet
Das traditionelle Vaterunser
Das andere Vaterunser
Betrachtung
Ein Gebet für Frauen
Was Christen gar nicht mögen
Die Fürsprache
Die Sequenz einer Synthese
Literaturverzeichnis
Vorwort
Gelegentlich schwankt und taumelt die Theologie mit den globalen Herausforderungen. Die damit verbundenen Fragen und Veränderungen mit den zwingend notwendigen Anpassungen wirken elektrisierend und scheinen den religiösen Fundamentalismus zu erschüttern. Die in diesem Sinne verstandenen gesunden Traditionen ruhen scheinbar auf einem stabilen Fundament. Veränderungsabsichten lösen Misstrauen aus, die der Tradition schaden könnten, wenn die Fragen nicht nur emotional, sondern auch rational und naturwissenschaftlich angegangen werden. Stellt sich die Theologie diesen Herausforderungen nicht, wird das zwangsläufig in den Konflikt führen, wie das gerade in der christlichen Kirche geschieht. Hunderttausende treten aus der Kirche aus. Sollen Dogmen erhalten bleiben, ist es notwendig, Glaubwürdigkeit zu bewahren, sowie mit Mut und Klugheit Reformen oder Ergänzungen anzugehen. Das wird dann zwingend, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse unumkehrbar sind und sich Rechtsstaatlichkeit nicht mehr beugen lässt. Von der Theologie wird in einem solchen Fall erwartet, dass aufgeblähte Strukturen, Überhöhungen und auch strafrechtliches Fehlverhalten gerichtet werden. Gelingt ihr das nicht, kann gemutmaßt werden, dass die Kirchen sich in solchen Fällen selbst im Wege stehen. Ein jahrzehntelang verordnetes Lehramtsschweigen gefährdet den Kulturkreis der Theologie in gleicher Weise. Derartiges Verhalten führt zur Vertrauensfrage. Für jede Religion ist das fatal, weil in der Folge die Gläubigen aus der Kirche und aus der Religion austreten oder sich in eine Stille zurückziehen, die in einen Irrglauben führen kann. Da bilden die tiefgreifenden Gebete keine ausreichende Basis mehr. Eine lebendige Religion zweifelt und strauchelt nicht an Herausforderungen, sondern meistert diese ohne Malheur. Mit zunehmendem Bildungsgrad und wissenschaftlichem Fortschritt wachsen die Fragenkomplexe, an der jede Theologie gemessen wird. Und diese muss sich den neuen Fragen mit Methodik, logischem und analytischen Denken und Handeln stellen. Eine stabile, traditionsreiche Theologie schafft das mit Leichtigkeit, allerdings nicht, wenn sie sich selbst die Toleranz verbittet. Im Grunde bedeutet das: Eine gesunde Theologie muss sich für die Philosophie interessieren, wie das vom Hl. Thomas von Aquin propagiert und wissenschaftlich vorgelebt wurde, um auf Konflikte vorbereitet zu sein. Auf diese Weise können dann an den Schlüsselstellen Theologie und Philosophie zusammengeführt werden. Derartige Übungen sind kein Menetekel, sondern zwingend notwendige Dialektik, um den Glauben letztlich noch stärker und sicherer werden zu lassen. Eines dieser Themen ist die Ethik mit ihren vielen Ebenen an normativen Strukturen und der Deontologie (Lehre von Rechten und Pflichten), die dann Moral genannt wird. In diesem Sinne müssen Fragen zu Tugendethiken wie Glaube, Liebe und Hoffnung immer wieder neu gestellt werden.
Aus dieser Notwendigkeit ist auch den folgenden Fragen nachzugehen: Wie unterscheiden sich die Kardinaltugenden der Weisheit und Klugheit von den Charaktertugenden? Was versteht man unter den christlichen Tugenden des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung? Woher stammt dieser Zement, der so stabil für alle Glaubensstrukturen ist? Allerdings muss dann auch gefragt werden: Wie wirkt der Zement zwischen der Weisheit, der Klugheit, der Tapferkeit, der Besonnenheit und der Gerechtigkeit? Sind alle diese Begriffe ethisch fundiert nachvollziehbar, und was bleibt diesen wiederum vorgelagert? Können diese Fragen medizinisch, mathematisch und soziologisch ausreichend beschrieben werden? Bleibt alles mit der Vernunft erfasst und wird vom Verstand strukturiert einer phänomenologischen Gewissheit zugeführt? Ist es so einfach, diese Fragen in kategorische und geisteswissenschaftliche ›Setzkästen‹ abzulegen?
Einleitung
In allen Kulturen, auch in der frühgeschichtlichen, hat der Mensch als einzige Spezies immer eine höhere Lebensform, eine Entität in Betracht gezogen. In dieser Frühphase des Menschen wurden aus Unkenntnis über die natürlichen Erscheinungen starke Kräfte durch Geistwesen, Göttinnen und Götter vermutet, die über Naturerscheinungen in dieser Form mit dem Menschen interagieren. Das bedeutet: Alle Phänomene werden vermenschlicht und diesen Gottheiten zugesprochen, die selbst wieder charakteristischen anthropomorphen Qualifizierungen ausgesetzt werden. Die Suche nach dem Ursprung dieser Natur und der Umstand einer Vermenschlichung des Gottesgedanken und der Geistwesen führten in einen Mono- oder Polytheismus mit allen tugendethischen, sittlichen Erscheinungen im guten und im schlechten Urteil über das menschliche Dasein. Die Individualethik des Einzelnen ist in vielfacher Form permanent aktiv, denn ohne diese Individualität wäre eine Sozialethik nur schwer zu verwirklichen. Doch mit zunehmenden naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und der Zeit der Aufklärung veränderte sich diese Betrachtungsweise. Mithilfe der geisteswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen und medizinischen Forschung wurde sie schließlich auf ihren Wahrheitsgehalt hin geprüft. Neben einer ›rationalen Verschiebung‹ hin in eine heroisierte digitale KI-und IT-Technologie (künstliche Intelligenz) verändert sich zurzeit das Glaubensverständnis mit allen Glaubensriten. Im gleichen Maße ist verstärkt mit tugendethischen Konflikten und Dilemmata zu rechnen. Mit dieser Problematik ist jede Weltreligion konfrontiert. Die parallel damit einhergehenden ethischen Erschütterungen betreffen die Individualethik genauso wie die Sozialethik. Es kann, durch die sozialen Medien befeuert, zu kulturellen Verlagerungen kommen, wie es der Konsequentialismus zum Nachteil der Individualethik und damit verbunden auch zum Nachsehen der Demokratie immer wieder vorführt. Ansätze sind in den Bereichen der individuellen Freiheit, des Links- und Rechtsradikalismus, des Populismus und Rassismus, der Gewaltverharmlosung, des Klimawandels, des Lobbyismus und anderen zu finden.
Die theologische Überzeugung mündet im Glauben in die Maxime einer göttlichen Liebe und eines tiefen Respekts vor einer Gottheit.
Verstanden wird diese Quelle als das Gutsein aller Schöpfung und ist mit einer Jenseitserwartung und einer Wiedererweckung in den verschiedenen Glaubensrichtlinien offenbart. Alle Weltreligionen gehen von einer Jenseitserwartung aus. Das wiederum setzt ein Seelenbewusstsein voraus. Die Philosophie hingegen prüft den Wahrheitsgehalt dieser Begriffe wie Gott und die Seele mit der Metaphysik und der Ontologie, die in einem vollkommenen Sein wurzeln und auf diese Weise an eine intelligible, menschliche Grenze geraten. Dieser Glaube wird nicht mit dem digitalen Technologieverständnis (KI, künstliche Intelligenz) verwirklicht, sondern nur durch den Menschen selbst mit seiner ›NI‹ (natürliche Intelligenz). Der Glaube ist gezielt auf den Einzelnen und die Gemeinschaft gerichtet. Er wird getragen von einer religionsorientierten Offenbarung.
Die Philosophie benutzt eine Form von ontologischen Begriffen wie Sein und Seiendes, um abstrakte und wahrnehmbare Phänomene zu umschreiben. Sie verlässt den Boden der mathematischen Logik, weil diese Metaphysik in ihrer letzten Konsequenz nicht bestimmbar ist, und verweilt so in einer Umschreibung des vollkommenen Seins. Die Theologie steht vor ähnlichen Problemen, doch sie geht bestimmter vor. Sie ordnet die intelligiblen Formen der höheren Entität in eine unbestimmte Hierarchie wie Gott, Göttin und Geistwesen ein. Sie benutzt Rollenfunktionen wie Vater, Sohn, Heiliger Geist oder Schöpfer und stellt darüber hinaus eine notwendige Jenseitserwartung fest. Sie besetzt diese vermenschlichten Glaubensformen mit Werten der positiven Individualethik.
Bei den Christen wird Jesus als menschgewordener Sohn Gottes verehrt und ist somit der einzige Namensgeber einer ›menschlichen Gottheit‹. Alle diese Betrachtungen sind auf ihre Weise widerspruchsfrei, da sie apodiktisch sind. Die Mathematik ihrerseits benutzt eine abstrakte Sprache für die Prinzipien der Logik und Wahrscheinlichkeit, die sie so widerspruchsfrei, beweisbar und wiederholbar gestalten kann. Diese Mathematik kann den Gottesbegriff in der letzten Konsequenz nicht erfassen, er bleibt unendlich.
Der Buddhismus geht ohne klassisches Gottesverständnis vor. Er übt sich in einem gewaltfreien Erwachen dem Bodhi das in ein Nirwana, eine Erleuchtung führt oder in eine Illuminationslehre steuert. So werden Leid, Gier, Narzissmus, Egoismus und alle Laster überwunden.
Diese Lehren trainieren permanent alle menschlichen guten Tugendethiken: Das geschieht sowohl im Konfuzianismus, Laozi (Laotse), wie auch im Buddhismus. Sie haben unterschiedliche Schwerpunkte mit verschiedenen Herangehensweisen, die es zulassen, dass von Ebenen, Arten und Wegen gesprochen wird oder von achtfachen Radspeichen.
Auf diese Weise lassen sich unterschiedliche Strömungen realisieren wie die des Zen-Buddhismus. Am Ende steht nicht eine Jenseitserwartung, sondern die Absicht einer Erleuchtung. Die erste Speiche (Ebene genannt) sucht nach der rechten Erkenntnis. Diesem Gedankengut schließen sich auch alle antiken Philosophen an. Hier geht es um die Suche nach tugendethischen Prinzipien und Wahrheiten. Gleichzeitig verfolgt eine kleine semitische Völkerfamilie in Vorderasien schon länger den Glauben an einen Gott (Monotheismus) und signalisiert somit, dass sie eine ›rechte‹ Erkenntnis gefunden hat. Die zweite Speiche ist bereits zielgerichtet, denn sie sucht die richtige Absicht, die ebenfalls ethisch fundamentiert ist. Die dritte Speiche übt sich in der rechten Rede, in der Antike wird noch die richtige Dialektik hinzugefügt. Die vierte Speiche folgt der rechten Rede durch den freien Willen und sucht das richtige Handeln aus, das ursächlich durch die Tugendethiken bestimmt wird. Dazu kann auch der Edelmut gehören. Die fünfte Speiche verwirklicht sich durch den richtigen Lebenserwerb, dieser ist nur möglich, wenn die zuvor genannten Stufen, Speichen und Ebenen beachtet bleiben. Die sechste Speiche verwirklicht sich durch das ›Tun‹, ein ständiges Üben der bereits erlangten Erfahrungen und das geschieht durch Disziplin, Askese, Besonnenheit und das Wissen um die Sterblichkeit. Die siebte Speiche beschäftigt sich mit der Achtsamkeit, einem Bewusstsein für den Leib, die Seele und das Leben aller Lebewesen. Die achte und letzte Speiche oder Ebene fordert eine ernste und rechte Meditation, da nur durch diese intensive Meditation wahre Erleuchtung möglich ist. Um diese Vorhaben zu verwirklichen, braucht es die freiwillige Disziplin und Askese. Der Buddhist sucht eine Befreiung von allen Lastern und irdischer Verbundenheit und lehnt jegliches Güterverständnis ab. Er übt sich darin, die Sprache zu überwinden, um sich so auf die vorgelagerte reine Vernunft zu stützen, die er sprachlos erfahren möchte. Dieses Verhalten ist meditativ nach innen gerichtet. Alle Religionen, auch der Buddhismus, brauchen aber den Begriff der Seele, die im Mittelalter analytisch durch die Substanzanalyse des Hl. Thomas von Aquin in Anlehnung an Aristoteles, Platon, Plotin und Augustinus als ein immaterielles Vermögen ausdifferenziert wurde. Diese Begriffe erscheinen dann in einem Glaubensverständnis über die Seele und den Geist hinweg in ein Gottesverständnis. Der Buddhismus unterscheidet sich hier ganz erheblich von der westlichen Doktrin. Die Darstellungen von Seele und Gott lassen sich im Religionsverständnis nicht trennen, sie sind von ihrem ›Wesen‹, ihrer Seiendheit (essentia) und ihrem Sein (esse) aber verschieden. Diese in der Ontologie durchdeklinierten Erkenntnisse sind bis heute gültig und mit der modernen Medizin, der Psychologie und der Bewusstseinsanalyse ergänzt und bestätigt worden. Um aber mit der Seele und der Gottheit zu interagieren, üben alle Religionen das Gebet. Der Buddhismus hat ein sehr intensives Seelenbewusstsein, aber kein oder zumindest nur sehr geringes Gottesverständnis.
Durch die Gebete werden auf sehr vielfältige Weise die individuellen Tugendethiken und Glaubensethiken mit dem menschlichen Vermögen, der Vernunft, der Intelligenz, dem Bewusstsein, dem Gewissen und dem freien Willen verknüpft. Diese Verknüpfung soll hier näher betrachtet werden. Es braucht also Voraussetzungen im Menschen, beginnend mit dem Dasein, dem Vernunftvermögen, der Fähigkeit, glauben zu können, und dem Bewusstsein einer Seele, die in eine Gottheit, den Monotheismus oder Polytheismus, führen. Auf diese Weise wird der theologische Anfang umschrieben, der sich im philosophischen Kontext so nicht widerspiegelt, weil die Philosophie den Wahrheitsgehalt für ein tragfähiges Weltbild in der Religion nicht prüfen kann. Dieser sollte möglichst widerspruchsfrei sein. Zum Vergleich spricht Platon von einem voraussetzungslosen Anfang, in dem der Gottesgedanke nicht vorkommen kann. Gleichzeitig bezeichnen Platon und Aristoteles diese Suche nach dem Anfang, sowohl der weltliche wie auch der theologische Anfang als die erste und schwierigste aller Wissenschaften.
In der Antike gab es ganze Götterfamilien und ›Clans‹ von Göttern. Auch dieser Polytheismus erfährt schon sehr früh entsprechende Vermenschlichung (Anthropomorphismus), diese wird heute noch unterschiedlich gepflegt. Derartige Darstellungsformen dienen dem Menschen immer noch für sein Glaubensverständnis und seine ethischen Weltbilder.
Zitate werden mit Doppelklammern (» «) versehen, umgangssprachlich bearbeitete Texte und Hervorhebungen sind mit einfachen Klammern (› ‹), Quellen und Querverweise sind mit Hochzahlen gekennzeichnet.
Ein spekulativer Irrtum
Tom Judas, ein Broker, ist ein Hecht und Lauerjäger im Edelzwirn, er wird sehr spät geweckt. Der Summer seines Radioweckers klingt ganz leise, schwillt an, setzt aus und beginnt von Neuem. Tom steht spät auf, sein Tagesgeschäft und alle seine Spekulationen kommen erst ab neun Uhr richtig in Schwung. An der heimischen Börse geht es meistens gemächlich zu. Die Geschäfte beginnen schon weitaus zeitiger an der asiatischen Börse. Da Tom Judas ein einzigartiges weltweites Netzwerk von Informanten pflegt, können die Veränderungen an den Börsen früh bedacht werden.
Seine Mitarbeiter, allen voran seine rechte Hand Frau Genie Luck, sind brillante Spezialisten, die ihm das vorbörsliche und nachbörsliche Geschäft vom Schreibtisch abarbeiten. Genie Luck ist gelernte Bankkauffrau. Sie hat die besondere Gabe, Kombattanten in einen Kokon zu wickeln, fällt noch das Wort Gier, sind sie verloren.
Bevor Tom Judas nach Hause geht, wird es sehr spät. Er richtet die Orders für den nächsten Tag und sein Team schafft das alles, in Rekordzeit an den Markt zu bringen. Das war eines seiner Erfolgsgeheimnisse, ein gutes Team zu formen, und Tom Judas achtet sehr penibel darauf, dass er seinen Leuten auf Augenhöhe begegnet. Er motiviert sie auch immer mit entsprechenden Boni oder Jahresgewinn-Beteiligungen. Die Mitarbeiter sind geradezu euphorisch, es braucht nicht mehr viele Worte. Er lehrt sie immer wieder, dass sich jeder als Unternehmer zu betrachten habe. Dabei kann es vorkommen, dass er seinen Teams auch schon einmal etwas über die Kosten-Nutzen-Rechnung oder die Kostenstellenrechnung referiert. Sein Ziel war es, diese Teams zu sensibilisieren, um Schwachstellen in Unternehmen schnell zu erfassen, auch die in ihren Fonds, die diese verwalten oder verkaufen. Es müssen Hebel gefunden werden, mit denen man die Unternehmen zerlegen kann, um sie dann am Markt zu veräußern. Eine sehr wichtige Maxime lautet: Man darf in dieser Branche kein Mitgefühl und keinerlei Begeisterung zeigen, sonst bleibt der Erfolg gefährdet. Ein ›Pokerface‹ ist ein Maßstab und Ausdruck für jede Vorgehensweise. Das Legen von Lunten, falschen Fährten und Nebelkerzen gehört genauso zur Jagd, wie Halbwahrheiten zu vermitteln. Tom stützt sich auf ein Netzwerk von Spezialisten aller Couleur, und seine ungewöhnlich sichere Intuition, das Richtige zu tun, den richtigen Riecher zu haben, lässt ihn so erfolgreich sein.
Seine Mitbewerber nennen ihn scherzhaft Hans im Glück, gelegentlich auch Gustav Gans, weil er so siegreich ist. Immer wieder versuchen sie seine Gunst zu erlangen, um an diesem Erfolg teilzuhaben.
Es klopft an der Wohnungstür. Genie holt ihren Chef mit dem firmeneigenen blutroten Sportwagen ab wie jeden Morgen. Die Tür öffnet sich per Fernbedienung. Sie stürmt direkt auf ihn zu. Er reißt sofort den linken Arm, mit der leicht geballten Faust, hoch. Genie weicht der Faust aus, begrüßt ihn kurz und knapp, schiebt ihren Ordner zur Seite, erfasst das Handgelenk und legt die Schweizer Armbanduhr um sein Handgelenk, die so teuer war wie der Sportwagen, den sie fährt. Jeden Morgen das gleiche Prozedere. Tom sieht in dieser Uhr einen Mahner, nach dem Motto ›time is money‹. Das signalisiert ihm, stets wachsam zu sein, gleichzeitig erinnert ihn der Wert dieser Uhr daran, was er heute mindestens zu leisten hat. Für ihn ist das ein Glaubensgrundsatz und zugleich sinnliche Wahrnehmung einer Zielvorgabe.
Tom verzehrt sein englisches Frühstück, stürzt den Fruchtsaft hinunter und schlürft dann den Kaffee nach. Während er die ersten Entwicklungen am Markt abfragt, überprüft er seine Hosentaschen.
Einer alten Tradition gemäß hat er immer dreißig Dollar in den Taschen, obwohl er alles mit Kreditkarte bezahlt. Eine weitere Eigenart ist die, sein goldenes Brustkreuz zu küssen, möglichst unbeobachtet, um es dann unter dem Hemd zu verstecken. Er lauscht sehr aufmerksam den Ausführungen seiner Assistentin. Auf dem Weg ins Büro spricht er so gut wie nie. Von seinem Beifahrersitz betrachtet er die vorbeiziehenden Plakatwände, Werbebanner und Großbildschirme nicht. Die überall zu lesenden Aufrufe für Spenden aller Art wie, Brot für die Welt, Caritas, Diakonie, Ärzte ohne Grenzen, Aktion Kinder in Not, Hilfsfonds für Bedürftige, Greenpeace, Klimawandel und vieles mehr, erreichen ihn ebenso wenig. Sein Fokus liegt auf etwas Besonderem. Er betet:
Mein Schöpfer, ich brauche deine Hilfe. Ich habe hoch gepokert. Wir haben einen Konzern auftragsgemäß ›gesundgeschrumpft‹, Tausende Arbeitsplätze sind wegrationalisiert worden. Die Arbeiter demonstrieren immer noch, und das schon seit Tagen. Die Gewerkschaften haben die von mir eingeplanten Zugeständnisse bekommen, nicht ohne meinen vorher inszenierten und kalkulierten Widerstand. Alles hat reibungslos funktioniert. Es werden mehrere Tausend Arbeitsplätze verloren gehen. Die alte Firma soll neu aufgestellt und für die Zukunft sicherer gemacht werden, damit die Rendite steigen kann. Die Arbeiter haben plangemäß eine Abfindung erhalten, das muss reichen. Wir haben den regierenden Parteien entsprechende Spenden zugeführt, das hat gut funktioniert. Diese scheinbare Firmensanierung ist nur ein Täuschungsmanöver. Der Auftrag lautet, in aller Stille den Konzern fürs Filetieren vorzubereiten, den Vorstand haben wir fest im Griff. Alle Welt schimpft uns deshalb Heuschrecken, das ist ungerecht. Die Gewerkschaftsvertreter und einige Lokalpolitiker wurden von mir heroisch und medienwirksam in den Fernsehsendern in Szene gesetzt. Noch ein halbes Jahr, dann wird alles über die Bühne gegangen sein. Die Presse wird poltern, aber wir werden sie mit einem anderen Skandal ablenken. Herr, dafür brauche ich deine Hilfe. Ich danke dir jetzt schon. Wenn der Rest gewinnbringend verkauft ist und die Börsenaufsicht nicht eingreift, sorge ich dafür, dass deine Institutionen entsprechende Zuwendungen erhalten. Gelingt das nicht, kann ich dir und deinen Einrichtungen nichts versprechen.
Andere Gedanken lenken ihn kurz ab. Wir sind die Guten, die sich nicht für die »Cum ex« Geschäfte mit der mehrfachen Steuerrückerstattung durch wiederholte Aktienverkäufe stark gemacht haben. Im Grunde haben wir uns doch an die Rahmenbedingungen gehalten.
Mein Gott, ich gestehe ein, dass wir mit den verschiedenen Geldwäschegeschäften sehr erfolgreich sind. Unser Vorgehen legalisiert die Gelder mit entsprechendem gerichtlichen Urteil. Wir simulieren mit Firmen in Panama und andernorts Geschäfte über verschiedene Warenlieferungen und Beraterverträge eine rege Geschäftsbeziehung. Dazu werden auch echte Zollpapiere eingesetzt. Es gibt ja immer wieder eifrige Beamte, die alles besser wissen. Unseren Handelspartnern reklamieren wir dann schlechte Leistungen und es kommt zu entsprechenden gerichtlichen Streitereien, in denen hohe Schadensersatzforderungen vorgetäuscht werden. Regelmäßig verurteilt das Gericht unsere Handelspartner zu entsprechendem Schadensersatz, und wir können dann durch den Gerichtsbeschluss hohe Schwarzgeldsummen einziehen und an unsere Auftraggeber weiterleiten. Sehr gerne vergleichen wir uns auch vor Gericht, was wiederum kostengünstiger ist. Da fallen große Gewinnspannen an, die ich gerne mitnehme. Diese Methode ist immer noch wasserdicht. Genauso wie der Handel mit überteuerten Immobilien, da lässt sich sehr schnell viel Schwarzgeld in Umlauf bringen. Geld aus schwarzen Kassen kann auch erfolgreich über ausländische Hedgefonds legalisiert werden. Interessant sind auch die Digitalwährungen, die zu unserer Freude von den Banken und vom Staat lange nicht ernst genommen wurden.
Wieder schweift Tom ab. Dank der digitalen Möglichkeiten können wir clever agieren, weil wir auch die EU-Subventionen geschickt für unsere Projekte nutzen. So ergeben sich die Möglichkeiten, mit diesen EU-Geldern unsere Offerten noch zu versilbern. Dadurch realisiert sich auch naives, inkonsequentes politisches Establishment zu unseren Gunsten, was sich für uns als sehr profitabel erweist.
Dass wir so schnell sind, liegt am Trend der Zeit, es ist nicht meine Schuld, dass der Staat so langsam ist. Doch dank deiner Hilfe bin ich immer zum rechten Zeitpunkt ausgestiegen. Wir haben auch einige halbstaatliche Konzerne fixiert und für weitere Veräußerungen nach China vorbereitet. Einen Ausverkauf, den die Politiker irrigerweise freie Marktwirtschaft nennen, obwohl eine vergleichbare Option in China ohne chinesische Majorität lange gar nicht möglich war. Trotzdem achte ich bei meinen Geschäften sorgfältig darauf, dass die Gewinne privatisiert und die Verluste, wo es möglich ist, sozialisiert werden. Uns kann gar nichts anbrennen, da uns die Politiker diese Spielräume bewahren. Dafür habe ich der Opposition versprochen, sie bei der nächsten Wahl zu unterstützen, sowohl wirtschaftlich wie auch ideologisch. Entsprechendes brisantes Material gegen die amtierende Regierung liegt bereits im Safe.
Wenn du mir jetzt nicht zur Seite stehst, kann es Probleme geben und die Märkte könnten erschüttert werden. Ich bitte dich: Gib mir und meinen Teams eine sichere und glückliche Hand. Meine Mitarbeiter brauchen mich und unseren Erfolg, sonst gibt es dieses Jahr keine Boni. Du weißt, ich habe dich und deine Organisationen immer unterstützt, das soll auch so bleiben.
Genie stoppt an einer Ampel, ein großer Bildschirm an der Hausfassade gegenüber fordert mit entsprechendem Bildmaterial zu Spenden für hungernde Kinder in Afrika auf. Tom Judas liest den Spot und meint an sich gerichtet: ›Ich bedaure es, dass durch die Termingeschäfte und EU-Preisvorgaben subventionierter Mais und ebenso Getreide aller Art als Saatgut so teuer geworden sind. Dadurch wird auf dem Weltmarkt Saatgut speziell für Afrika nicht mehr bezahlbar. Wenn die EU auf dem Weltmarkt so stark eingreift und wir damit Geld verdienen, trifft mich keine Schuld, dann ist es die Aufgabe der EU mit entsprechender Entwicklungshilfe gegenzusteuern.‹
Er denkt weiter an die erwirtschafteten Gewinne vergangener Jahre mit Panama Papers, Leerverkäufen, Lehman-Brothers-Optionen deren Schuldverschreibungen rückversichert waren. Dadurch konnten keine Verluste realisiert werden, weil es systembedingt war und nicht in unserer Hand lag. So habe ich den Profit nur legitim mit der anderen Hand abgeschöpft.
Die Fahrt geht weiter, und Tom ist augenblicklich wieder beim Gebet:
Herr, wir sollten in den Termingeschäften für Getreide und Mais bleiben. Mit den EU-Fördermitteln und Entwicklungshilfen können wir Afrika auch gleich die Insektizide und Düngemittel verkaufen, aber nur, wenn sie uns vorab 30 Prozent Sicherheitsleistungen abtreten. Dann bieten wir Afrika unsere Altlasten an, die haben doch viel Platz. Wir liefern den Müll mit den nicht ausgelasteten Containerschiffen, das sorgt für Einkünfte, hohe Renditen und Effizienz. Da würden meine Anleger sehr zufriedengestellt sein. Mein Schöpfer, das wäre ein brauchbarer Deal, von dem alle etwas haben. Anschließend besorgen wir den afrikanischen Autokraten und totalitären Regimen zur Selbstverteidigung leichte Waffen im Bausatz. So umgehen wir das Waffenembargo. – Die lieben dieses Kriegsspielzeug, weil sie damit auch ihre Macht sichern sollen und wir im Geschäft bleiben. – Mein Schöpfer, stehe mir bei, damit alles glatt geht.
Ich danke dir. Amen
Tom Judas spricht in die Richtung seiner Fahrerin Genie Luck: ›Eigentlich sollte mein Konterfei einmal auf den Plakatwänden erscheinen, bei dem, was ich alles bewegt habe.‹ Sie nickt nur kurz und fährt wieder los. Mit ihrer Multitasking-Fähigkeit schmiedete sie bereits mehrere Ablaufpläne für das Tagesgeschehen.
Es folgte eine unscheinbare Handbewegung von Tom an seine Stirn, den Mund und die Brust. Er war wieder in der Realität.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Glaubens- und Religionsriten individuell ausgestaltet werden. Diese Freiräume nutzen viele Gläubige und entwickeln ein eigenes Glaubensverständnis, so individuell wie ihr Fingerabdruck. Allzu oft gehen aber die eigentlichen Botschaften verloren oder werden überdehnt und so irrelevant. In der Folge kreiert man dann Verhaltensregeln, die dem eigenen Narzissmus dienen, aber auch, um sich selbst zum Richter zu erheben. Auf diese Weise entschuldigt Tom sich selbst, sieht in Gott einen Kumpel, mit dem er auf Augenhöhe agieren kann wie auf dem Basar.
Für ihn ist das alles ein ernstes Spiel, gespeist von einem kindlichem Glaubensgemüt und entsprechenden erzieherischen Erinnerungen. Diese ›Gebete‹, die er immer wieder pflegt, dienen ihm als geeignete Bühne, sich strategisch zu mobilisieren, und offensichtlich pflegt er auf diese Art sein Ego. Er badet in Selbstgerechtigkeit und träumt zugleich von göttlichem Segen. Immerhin wird so oft geglaubt, wer die göttliche Omnipotenz auf seiner Seite hat, erscheint unbesiegbar. Vielleicht handelt es sich auch um die betrügerische Form einer Gewissensmanipulation. Sicher bleibt es ein naives, skrupelloses Unterfangen mit einer zweifelhaften Gesinnung und einem gehörigen Maß an Gier. Ein Gebet in Augenschein zu nehmen, das fernab von ethischen Prinzipien und Glaubenswahrheiten eingeordnet wird, kann nicht ernsthaft überzeugen.
Das gescheiterte Gebet
Bei diesem Narzissmus des Spekulanten Tom Judas, seiner Gier und Empathielosigkeit kann nicht von Tugendethiken gesprochen werden und auch nicht von einem ernsthaft wahrnehmbaren Gebet. Er handelt ethisch verwerflich, gegen die guten Sitten, selbst wenn er deontologische Vorgaben einhält und diese bis an den Rand des Möglichen ausreizt und vermischt. Er schöpft alle steuerrechtlichen Möglichkeiten aus, dehnt das Recht für seine Klienten wider alle normativen Ethikvorstellungen und moralischen Skrupel. Mit zweifelhaften spekulativen Winkelzügen sucht er systematisch grenzwertigen Subventionsmissbrauch, Steuervorteile und Rechtsbeugung. Er achtet sorgfältig darauf, straffrei zu bleiben, im Zweifel greift er auf verschiedene Briefkastenfirmen in Drittstaaten zurück, die kein Auslieferungsabkommen mit seinen Jagdgebieten haben. So wird erkennbar, dass Moral und Ethik, Vertrauensethik und Gesinnungsethik unterschiedliche Ansichten haben können. Diese sind nicht immer adäquat mit der Moral und stellen öfter ein ethisches Dilemma dar. Der Missbrauch der Vertrauensethik ist geprägt von der Gier.
In diesem Falle erscheint sein Handeln abwegig. Nicht alles, was erfolgsorientiert ist, verhält sich ethisch tragfähig. Das Gute in der Ethik kommt von der Vernunft, dem Verstand und der Absicht, dem ›Tun‹. Die Entscheidungen realisieren sich durch den freien Willen. Begehrlichkeiten werden vom Ziel oder Objekt bestimmt und können auch durch Affektion (Liebe, Freude, Leid, Trauer, Hass, Gier, Erfolgssucht u. a.) gesteuert und ursächlich sein. Die positive Ethik ist wirkfähig aus einem Gutsein (areté), das auf ein natürliches, geschultes Vernunftvermögen zurückgreift (Gesinnung). Oft findet dieses Vermögen seinen Niederschlag im ›Gebet‹. Daraus erwachsen unterschiedliche Absichten, die einen göttlichen Beistand suchen. Mit diesem Beistand sollen das eigene Schicksal oder das eines anderen zu den eigenen Gunsten beeinflusst werden, denn so lassen sich die Tugendethiken auch noch nachhaltig manipulieren.
Mit dieser Selbstsuggestion überspielt Tom Judas seine Skrupel und manipuliert sich dahingehend, scheinbar doch das Richtige getan zu haben. Sein Auftritt erscheint eher frevelhaft. Alles Frömmeln bleibt hier durch missbräuchliche Tugendethik einem spekulativen Schicksal verhaftet und weist in seiner Zielsetzung eine lasterhafte Verbundenheit zur Gier auf. Dieses Gebaren gleicht mehr einer Show und dient seinem Narzissmus, als dass es einer zwischenmenschlichen Verbundenheit und noch weniger einem Glaubensbewusstsein folgt. ›Es spricht Hohn‹, und häufig wird das gar nicht bemerkt. Sein Verhalten kann nicht als ethisch nachhaltig verstanden, sondern muss als lasterhaft beurteilt werden. Es schädigt nicht nur die Volkswirtschaften, sondern beeinträchtigt auch noch die Sozialethik.
Gebete lassen sich in der Glaubensabsicht zielgerichtet einsetzen, im ethischen Lasterverständnis auch irrtümlich und missbräuchlich benutzen. In ihrem Ursprung bleibt das Gebet durch den Einzelnen oder die Sippe zielgerichtet. Die Zielsetzung ruht im Guten. Das ist ihr Prinzip. Mit der positiven Unterstützung einer höheren Macht, und selbst, wenn es sich nur um eine Absicht zur Änderung des Schicksals handelt, sucht der Betende eine Unterstützung zur Bewältigung seiner Ziele, Ängste, Sorgen und Glaubensauffassungen.
Das Gebet von Tom Judas ist ein verwerflicher Akt und muss im Sinne der Ethik und des Glaubens als gescheitert verstanden werden.
Das Gebet an sich
Alle Religionen brauchen Bedingungen, um wirkungsfähig zu werden. Neben dem Dasein des Einzelnen ist die faszinierende Form eines Phänomens durch ein höheres Wesen (Entität, Gottheit) eine treibende Kraft. Fehlt diese Einstellung, versucht man das Schicksal, den Zufall oder das Glück auf andere Art zu beeinflussen und wahrzunehmen.
Diese kategorisch höherstehenden Geistwesen sind notwendig und ursächlich, um den Begriff der Seele auch den der Geistseele, die Entitäten und den Gottesgedanken zu reflektieren. Die Bedingung einer Seele ist ein notwendiger, intelligibler Schlüsselbegriff, eine Voraussetzung zum Glauben und nicht trennbar mit der Entität oder einer Gottheit verbunden. Beide bleiben aber selbstständige Begriffe in sich.
Ein Seelenbewusstsein ist nicht möglich ohne ein Gottesverständnis. Der Ursprung der Seele wird in der Philosophie über das Sein und Seiende (de ente et essentia) beschrieben. Somit bleiben zwei Betrachtungsmöglichkeiten über den Ursprung einer Seele: Die erste Betrachtung geschieht durch das göttliche ›Dazutun‹ einer Seele in den Fötus. Das führt zu Irritationen, ab wann denn die Seele wir kungsfähig wird. Thomas von Aquin spricht davon, dass die Seele erst 80 Tage nach der Zeugung in Erscheinung tritt und dazu bei Jungen und Mädchen unterschiedliche Zeitspannen in Anspruch nimmt. Eine solche Betrachtung ist nicht mehr zeitgemäß. Besser ist die Variante einer ›zellulären Seelendynamik‹. In dieser philosophischen Betrachtung wird von der permanent bestehenden Seele ausgegangen, die sich aus der Ei- und Samenzelle manifestiert. Beide Zelltypen sind durch das Leben bereits beseelt, sie besitzen ein Strebevermögen (Entelechie) hin ins Leben. Durch ihre Verbindung wird keine Seele gezeugt. Der Mensch kann nicht etwas verwirklichen, das ewig lebt, denn das übersteigt seine Fähigkeiten bei Weitem. Somit muss die Seele aus der Verbindung des zellulären Seelenvermögens der Samen- und Eizelle generiert werden, die ›zelluläre Seelendynamik‹. Dadurch wird keine neue Seele gezeugt, sondern ein Seelendasein vermittelt. Das wiederum geschieht in den ›Zygoten‹:1 in ihnen findet eine Individualisierung, eine Identifikation statt, die als eine eigene Seele angesprochen werden kann. Der bloße Kontakt der beiden Samenzellen und ihre Verschmelzung lassen unmittelbar die generierte Bestimmung einer Individualität zu. Eine Ursache ruht in dieser Entelechie (dem Strebevermögen) der Zygote (eine frühe zelluläre Form des ›Fötus‹). Im gleichen Moment geht die Seelenbestimmung in den verantwortlichen Ei-und Samenzellen unter, weil das neue Leben (Bios) die bestimmbare Dominanz übernimmt. Somit ist jede Zygote unmittelbar beseelt, Ursache ist die Entelechie der zellulären Seelendynamik.
Dieses Modell hat viele Vorteile. Man muss nicht mehr rätseln, ab wann ein Fötus beseelt ist. Auch erhält jede Samen- und Eizelle als Träger des Lebens über die eigene DNA einen besonderen Status des Lebens. Im weiteren Sinne kann sogar eine sokratische Weltseele zitiert werden, die diesen Vorgang unterstreicht. Dort wird die Gegenwart der Seele als passiv im Körper betrachtet, die zu Lebzeiten vom Geist beherrscht wird. Am Ende des Lebens nach dem Ableben verlässt die Seele den lästigen Körper und sucht Vereinigung mit der Weltseele. Von nun an herrscht die Seele über den Geist (Sokrates).2
Im buddhistischen Verständnis bildet die Seele eine alleinige fundamentale Größe, die wiederum einer anhaltenden Läuterung unterworfen bleibt, bis das Ziel einer Erleuchtung erfahrbar wird. Im Buddhismus geschieht das nur über das Seelenverständnis und die Reinkarnation, die durch Meditation und Askese stufenweise in eine Erleuchtungsabsicht strebt und nicht in einer erlösenden Gottesauffassung mit einer entsprechenden Jenseitsoffenbarung wurzelt.
In den Weltreligionen wird das menschliche Sprachvermögen mit seinen dialektischen Möglichkeiten in Verbindung mit der Vernunft durch eine höhere Entität verbunden, was unter anderem über die Seele geschieht. Die wiederum ist vorausgesetzte Substanz, um über das Gebet einen Kontakt zur geistigen Gottheit herzustellen. Aus dieser Notwendigkeit der Bedingungen kommuniziert der Glaubende über das Gebet an sich und andere Religionsriten mit dieser höheren Entität ›Gott‹. Das geschieht in sehr stiller Weise oder im Kollektiv mit der Glaubensgemeinschaft, was zu unterschiedlichen Wirkmechanismen führt.
Aus den jeweiligen soziokulturellen Umfeldern und Lebensräumen entwickelten sich unterschiedliche Religionen mit den ihnen eigenen Glaubensriten. Dazu benutzen alle Religionen das Gebet. Ein Gesprächsmonolog mit einer Gottheit und die damit verbundene Meditation stehen immer in Verbindung mit der Seele in Form eines virtuellen ›Transmitters‹.
Zum Beten gehören unterschiedliche religionsspezifische Riten, wie etwa das in Andacht versunken sein an einem besonderen Ort das in eine bestimmte Richtung gewendet sein (christliche Kirchen sind mit ihrer Apsis immer nach Osten ausgerichtet, Muslime richten ihre Gebetshaltung ebenfalls nach Osten aus). Das wird verbunden mit einer entsprechenden Körperhaltung. Das Beten mit Unterstützung von Gebetskränzen (Rosenkranz, Mishaba, Tespih, dem Buddha Mala, im semitischen Schemoneh Esreh und Scham Jisrael) soll durch ständiges Wiederholen helfen, ein gewisses Maß an Meditation und Frömmigkeit zu erreichen. Neben vielen Gebetsarten gibt es auch Gebetsmühlen und Liturgien zu unterschiedlichen Anlässen und Gegebenheiten. Es bleibt fraglich, ob auf diese Art Spiritualität erfahrbar ist. Ganz sicher aber werden die Tugendethiken geschult und das Religionsverständnis gepflegt.
Das stille Gebet in aller Zurückgezogenheit führt in seiner Form in die größte Spiritualität. Dieses Beten im eigenen ich, wo immer man auch gerade verweilt, lenkt in eine perzeptive (intuitive, aber auch sinnliche wahrnehmbare) dynamische Verbundenheit, die zugleich eine weitere Grundlage der Tugendethik des Glaubens erfasst.
Beten ist eine Tätigkeit, die den Menschen in eine innere Ausgewogenheit versetzt. Es fördert die Harmoniefunktion im Einzelnen, in der Gemeinschaft und in allen religiösen Völkern. Angetrieben wird diese von der Glaubensethik, von situativen Gegebenheiten, den Akzidenzien (Hinzufügungen) und den Affektionen. Dieser Glaube kann bestimmt werden durch Mitleid und ebenso durch Empathie und Furcht. Im Menschen leben