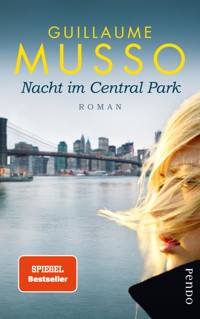8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein abgelegenes kleines Atelier am Ende einer Allee, mitten in Paris: Hier hat sich die Londoner Polizistin Madeline eingemietet, um eine Weile abzuschalten. Doch plötzlich sieht sie sich Gaspard gegenüber, einem mürrischen amerikanischen Schriftsteller. Offenbar gab es einen Irrtum, denn auch er hat das Atelier gemietet, um in Ruhe schreiben zu können. Der Ärger legt sich, als die beiden erkennen, an welch besonderen Ort sie geraten sind. Das Atelier gehörte einst einem gefeierten Maler, von dem aber nur noch drei Gemälde existieren sollen – alle drei verschollen und unermesslich wertvoll. Als sie sich gemeinsam auf die Suche nach den Bildern begeben, wird ihnen schnell klar, dass den Maler ein grausames Geheimnis umgibt … Für Madeline und Gaspard beginnt eine spannende Jagd, die sie von Paris nach New York führt und sie nicht nur mit ungeahnten menschlichen Abgründen, sondern auch mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.pendo.de
Für Ingrid und Nathan
Übersetzung aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Bettina Runge (Kollektiv Druck-Reif)
ISBN 978-3-492-99032-5
© XO Éditions 2017
Titel der französischen Originalausgabe: »Un appartement à Paris«, XO Éditions, Paris 2017
© der deutschsprachigen Ausgabe: Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Motto
Der kleine Junge
Mitten im Winter
Dienstag, 20. Dezember
1. Das Paris-Syndrom
Anmerkungen
2. Die Theorie von den 21 Gramm
3. Die Schönheit der Stricke
4. Zwei Fremde im Haus
Der besessene Maler
Mittwoch, 21. Dezember
5. Das Schicksal an der Gurgel packen
6. Eine Summe von Zerstörungen
7. Die es verbrennt
Gaspard
8. Die Lüge und die Wahrheit
9. Ein Mittel, den Tod zu besiegen
Der Ruf des Lichts
Donnerstag, 22. Dezember
10. Hinter dem Licht
Pénélope
11. Cursum Perficio
Anmerkungen
12. Schwarzes Loch
Freitag, 23. Dezember
13. Madrid
Anmerkungen
14. New York
Anmerkungen
15. Rückkehr in die Bilberry Street
Pénélope
Erlkönig
Samstag, 24. Dezember
16. Die amerikanische Nacht
Anmerkungen
17. Der Erlkönig
18. Stadt aus Eis
19. Am Rand der Hölle
20. Der Lieblingssohn
Bianca
21. Fundamentalpunkt
Anmerkungen
Sonntag 25. Dezember
22. Night Shift
Fünf Jahre später ...
Die 22. Pénélope
Quellen
Quellenverzeichnis
Mitten im Winter erfuhr ich endlich,
daß in mir ein unvergänglicher,
unbesiegbarer Sommer ist.[01]
Albert Camus, Hochzeit des Lichts,
Heimkehr nach Tipasa
Der kleine Junge
London, an einem späten Samstagmorgen.
Du weißt es noch nicht, doch in weniger als drei Minuten wirst du mit einer der härtesten Belastungsproben deines Lebens konfrontiert werden. Eine Belastungsprobe, die du nicht hast kommen sehen, die dich aber so schmerzhaft treffen wird wie das Einbrennen eines Brandzeichens.
Vorerst aber schlenderst du noch unbekümmert durch das Einkaufszentrum, das angelegt ist wie ein antikes Atrium. Nach zehn Regentagen hat der Himmel wieder eine wunderschöne tiefblaue Färbung angenommen. Die Sonnenstrahlen, die das Glasdach des Kaufhauses zum Schimmern bringen, haben dich in gute Laune versetzt. Um den Frühlingsanfang zu feiern, hast du dir selbst sogar dieses rote Kleid mit den weißen Tupfen geschenkt, das dich seit zwei Wochen lockt. Du fühlst dich leicht, regelrecht beschwingt. Der Tag verspricht, amüsant zu werden: zunächst ein Mittagessen mit Jul’, deiner besten Freundin, eine Maniküresitzung mit den Mädels und höchstwahrscheinlich eine Ausstellung in Chelsea, dann am Abend das Konzert von PJ Harvey in Brixton.
Eine ruhige Fahrt durch die sanften Flussläufe deines Lebens.
Doch plötzlich siehst du ihn.
Es ist ein kleiner blonder Junge in einer Jeanslatzhose und einem marineblauen Mäntelchen. Vielleicht zwei Jahre oder ein wenig älter. Große helle, lachende Augen, die hinter Brillengläsern leuchten. Ein rundliches Kindergesicht, zarte Züge, eingerahmt von leuchtenden weizenblonden Locken. Du beobachtest ihn schon seit einer Weile, zunächst aus gebührendem Abstand, doch du näherst dich langsam, mehr und mehr fasziniert von seinem Gesicht. Unberührt und strahlend, weder von Leidnoch von Angst gezeichnet. Auf diesem Gesichtchen siehst du nur ein Spektrum an Möglichkeiten. Lebensfreude, Glück in Reinkultur.
Jetzt schaut er dich an. Ein verschmitztes, argloses Lächeln erhellt seine Züge. Stolz zeigt er dir das kleine Metallflugzeug, das er mit seinen Patschhändchen über seinem Kopf kreisen lässt.
»Brmmmmm ...«
Während du sein Lächeln erwiderst, erfasst dich eine seltsame Emotion. Das langsam wirkende Gift eines unergründlichen Gefühls infiziert dein ganzes Wesen mit einer unerklärlichen Traurigkeit.
Der Kleine hat seine Arme ausgebreitet und trippelt um den Steinbrunnen herum, der Wasserfontänen unter die Glaskuppel sprüht. Einen kurzen Augenblick glaubst du, er käme auf dich zugelaufen, um sich in deine Arme zu werfen, aber ...
»Papa, Papa! Schau, ich bin ein Flieger!«
Du hebst die Augen, und dein Blick begegnet dem jenes Mannes, der das Kind im Flug auffängt. Eine eisige Klinge durchbohrt dich, und dein Herz krampft sich zusammen.
Du kennst diesen Mann. Vor fünf Jahren hattet ihr eine Liebesbeziehung, die ein gutes Jahr gedauert hat. Seinetwegen hast du Paris verlassen, bist nach Manhattan gezogen und hast dir einen neuen Job gesucht. Sechs Monate lang habt ihr sogar vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. Dann ist der Mann zu seiner Ex-Frau zurückgekehrt, mit der er bereits ein Kind hatte. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan, um ihn zu halten, aber es war nicht genug. Diese Zeit war äußerst schmerzhaft für dich, und jetzt, da du glaubtest, dieses Kapitel abgeschlossen zu haben, begegnest du ihm wieder, und es bricht dir schier das Herz.
Nun verstehst du deine eigene Verwirrung besser. Du sagst dir, dieses Kind hätte eures sein können, nein, müssen.
Der Mann hat dich sofort wiedererkannt und weicht deinem Blick nicht aus. Seine bekümmerte Miene zeigt, dass er genauso überrascht ist wie du, verlegen, irgendwie beschämt. Du glaubst, er wird mit dir sprechen, doch wie ein Tier in Bedrängnis greift er schützend nach der Hand seines Sprösslings und macht auf dem Absatz kehrt.
»Komm, Joseph, wir gehen.«
Vater und Sohn entfernen sich, und du traust deinen Ohren nicht. »Joseph« war einer der Vornamen, die ihr für euer zukünftiges Kind ausgesucht hattet. Dein Blick verschleiert sich. Du fühlst dich betrogen. Eine schwere, lähmende Müdigkeit überwältigt dich, du bist wie vor den Kopf gestoßen und glaubst, ersticken zu müssen.
Unter Aufbietung all deiner Kräfte erreichst du den Ausgang des Einkaufszentrums. In deinen Ohren rauscht es, du bewegst dich wie ein Roboter, deine Gliedmaßen sind tonnenschwer. Auf der Höhe des St. James’ Park gelingt es dir, den Arm zu heben, um ein Taxi anzuhalten, doch du zitterst während der ganzen Fahrt, versuchst, gegen die dich bedrängenden Gedanken anzukämpfen, und fragst dich, was dir gerade widerfährt.
Nachdem du die Tür zu deiner Wohnung von innen abgeschlossen hast, lässt du dir sofort ein Bad einlaufen. In deinem Schlafzimmer machst du kein Licht. Ohne dich auszukleiden, fällst du auf dein Bett. Völlig apathisch. In deinem Kopf ziehen die Bilder von dem Jungen mit dem Flugzeug vorbei, und bald verwandelt sich die ganze Verzweiflung, die dich beim Anblick deines ehemaligen Geliebten ergriffen hat, in ein schreckliches Gefühl totaler Leere. Ein Mangel, der dir den Atem nimmt. Du weinst natürlich, sagst dir aber, dass die Tränen eine reinigende Wirkung haben und die Krise von selbst vorübergehen wird. Nur dass der Schmerz sich tiefer gräbt, anschwillt, dich erfasst, all deine Deiche bricht und Jahre der Unzufriedenheit, des Grolls und enttäuschter Hoffnungen freisetzt. Verletzungen wiederaufleben lässt, die du längst für geheilt hieltest.
Dann ergreift die kalte Hydra der Panik Besitz von deinem Körper. Du springst auf. Dein Herz rast. Du hast vor einigen Jahren schon mal eine ähnliche Phase durchlebt, und die Dinge nahmen kein gutes Ende. Doch auch diese Erinnerung kann das Rad des Unausweichlichen nicht aufhalten. Von unkontrollierbarem Zittern ergriffen, taumelst du ins Badezimmer.
Der Arzneischrank. Die Röhrchen mit den Schmerzmitteln. Du legst dich in die übervolle Badewanne, obwohl du nur zur Hälfte entkleidet bist. Das Wasser ist zu heiß oder zu kalt, du weißt es nicht einmal mehr, und es ist dir auch egal. Deine Brust scheint in einen Schraubstockgespannt zu sein. In deinem Bauch tut sich ein Abgrund auf. Vor deinen Augen ein pechschwarzer Horizont, für immer versperrt durch deinen Kummer.
Dir war gar nicht bewusst, dass es so weit mit dir gekommen ist. In den letzten Jahren warst du zugegebenermaßen ein wenig verloren, und seit Langem weißt du, dass das Leben eine zerbrechliche Angelegenheit ist. Aber du hast nicht damit gerechnet, heute den Boden unter den Füßen zu verlieren und sorasch aus dem Gleichgewicht zu geraten. Vor allem wusstest du nicht, welche Massen an Schlamm dich durchströmen. Diese Schwärze, dieses Gift, dieses Elend. Dieses Gefühl stetiger Einsamkeit, das plötzlich in dir erwacht ist und dich in Panik versetzt.
Die Medikamentenröhrchen treiben an der Wasseroberfläche wie Schiffe bei Windstille. Du öffnest sie und schluckst sämtliche Kapseln. Doch das reicht nicht. Du musst die Dinge zu Ende führen. Und so nimmst du die Klinge aus dem kleinen Rasierer, der auf dem Badewannenrand liegt, und ziehst sie über deinen Unterarm.
Du hast dich immer tapfer geschlagen, aber heute bist du nicht mehr dazu in der Lage, denn dein Feind, der dich besser kennt als du dich selbst, lässt nicht mehr von dir ab. Als die Klinge deine Haut berührt, denkst du mit einer gewissen Ironie an dieses euphorische Glücksgefühl, das dich erfüllte, als heute Morgen die Sonne durch dein Fenster schien.
Dann dieser sonderbare und beruhigende Moment, als du begreifst, dass die Würfel gefallen sind, dass deine Reise ohne Rückkehr bereits begonnen hat. Wie hypnotisiert betrachtest du dein Blut, das namenlos schöne Arabesken ins Wasser zeichnet. Während du spürst, wie das Leben aus dir entweicht, sagst du dir, dass nun wenigstens der Schmerz aufhören wird, und in diesem Augenblick ist das von unschätzbarem Wert.
Während dich der Teufel davonträgt, hast du noch einmal das Bild von dem kleinen Jungen vor dir. Du siehst ihn an einem Strand am Meer. Ein Ort, vielleicht in Griechenland oder Süditalien. Du bist ganz nahe bei ihm. So nah, dass du sogar seinen Geruch nach Sand, nach Getreide wahrnimmst, beruhigend wie die leichte Brise eines Sommerabends.
Als er den Kopf in deine Richtung hebt, siehst du gerührt sein hübsches Gesicht, seine Stupsnase, seine weißen Kinderzähne, die sein Lächeln unwiderstehlich machen. Und jetzt breitet er die Arme aus und kreist um dich herum.
»Schau, Mama, ich bin ein Flieger!«
Mitten im Winter
Dienstag, 20. Dezember
1. Das Paris-Syndrom
Paris is always a good idea.[02]
Audrey Hepburn, in dem Film Sabrina
1.
Roissy-Charles-de-Gaulle, Ankunftsbereich.
In gewisser Weise eine Definition der Hölle auf Erden.
Vor der Passkontrolle drängten sich Hunderte von Reisenden in einer Warteschlange, die sich ausdehnte und wand wie eine dickbäuchige Boa. Gaspard Coutances hob den Kopf zu den Plexiglaskabinen zwanzig Meter vor ihm. Nur in zwei davon saßen unglückselige Polizisten, die den schier endlosen Passagierstrom zu kontrollieren hatten. Gaspard stieß gereizt einen Seufzer aus. Jedes Mal, wenn er diesen Airport betrat, fragte er sich, wie die verantwortlichen Politiker die verheerenden Auswirkungen eines so negativen Frankreich-Bilds ignorieren konnten.
Er schluckte seinen Ärger hinunter. Zu allem Überfluss herrschte hier eine Bruthitze. Die Luft war feucht, drückend, durchtränkt von ekelhaftem Schweißgeruch. Er stand neben einem Jugendlichen im Bikerlook und einer Gruppe von Asiaten. Die Anspannung war deutlich spürbar: Nach einem zehn- bis fünfzehnstündigen Flug mussten die Jetlag-Geschädigten empört feststellen, dass sie noch nicht am Ende ihres Leidenswegs angelangt waren.
Das Martyrium hatte kurz nach der Landung begonnen. Seine Maschine, aus Seattle kommend, war pünktlich gewesen und kurz vor neun Uhr morgens gelandet, doch sie hatten über zwanzig Minuten warten müssen, bis die Gangway an die Tür herangeschoben wurde und sie das Flugzeug verlassen konnten. Es folgte ein längerer Marsch durch die altmodischen Gänge. Eine Art Schnitzeljagd an komplizierten Wegweisern vorbei und über defekte Rolltreppen, gefolgt vom Überlebenskampf in einem überfüllten Pendelbus, um dann schließlich, in einen finsteren Raum eingepfercht, warten zu müssen. Willkommen in Frankreich!
Den Gurt seiner Reisetasche über der Schulter, lief Gaspard der Schweiß über die Stirn. Er hatte den Eindruck, schon mindestens drei Kilometer zurückgelegt zu haben, seitdem er das Flugzeug verlassen hatte. Deprimiert fragte er sich, was er hier zu suchen hatte. Warum bürdete er sich jedes Jahr einen Monat der Gefangenschaft in Paris auf, um ein neues Theaterstück zu schreiben? Er stieß ein nervöses Lachen aus. Die Antwort war einfach und klang wie ein Slogan: Kreatives Schreiben in feindlicher Umgebung. Jedes Jahr um dieselbe Zeit mietete ihm Karen, seine Agentin, ein Haus oder eine Wohnung, damit er in Ruhe arbeiten konnte. Gaspard hasste Paris so sehr – vor allem zur Weihnachtszeit –, dass er problemlos rund um die Uhr in seinen vier Wänden bleiben wollte. Resultat: Das Stück schrieb sich von ganz allein – oder fast. Auf alle Fälle war sein Text jedes Mal Ende Januar fertig.
Die Schlange vor dem Schalter löste sich mit trostloser Langsamkeit auf. Das Warten wurde zur unerträglichen Prüfung. Übererregte Kinder rannten schreiend zwischen den Zollschranken herum, ein älteres Paar stützte sich gegenseitig, ein Baby erbrach einen Schwall Milch in die Halsbeuge der Mutter.
Verdammte Weihnachtsferien wetterte Gaspard und atmete tief die verbrauchte Luft ein. Als er den Verdruss auf den Gesichtern seiner Leidensgenossen sah, erinnerte er sich an einen Artikel zum Thema »Paris-Syndrom«, den er in einem Magazin gelesen hatte: Jedes Jahr wurden mehrere Dutzend japanischer und chinesischer Touristen ins Krankenhaus eingeliefert oder in ihre Heimat überführt, weil sie unter schweren psychischen Störungen litten, die sich bei ihrem ersten Besuch in der französischen Hauptstadt eingestellt hatten. Kaum in Frankreich eingetroffen, klagten diese Urlauber über sonderbare Symptome – Wahnvorstellungen, Depressionen, Halluzinationen, Paranoia. Mit der Zeit fanden die Psychiater eine Erklärung: Die Beschwerden der Touristen resultierten aus der Diskrepanz ihrer überhöhten Erwartungen an die Ville lumière, der Stadt der Lichter, mit der Realität. Sie hatten geglaubt, »Die fabelhafte Welt der Amélie« zu entdecken, wie sie in Filmen und der Werbung angepriesen wird, und waren stattdessen mit einer harten und feindseligen Stadt konfrontiert worden. Ihr idealisiertes Paris-Bild – das der romantischen Cafés, der Bouquinisten am Seine-Ufer, der Maler am Montmartre und der Intellektuellen des Quartier Latin – traf auf die harte Realität: Dreck, Taschendiebe, allgemeine Unsicherheit, die allgegenwärtige Luftverschmutzung, ein hässliches Stadtbild, veraltete öffentliche Verkehrsmittel.
Um sich abzulenken, zog Gaspard mehrere gefaltete Blätter aus seiner Tasche. Die Beschreibung und Fotos von seinem »Luxusgefängnis« im 6. Arrondissement, das seine Agentin ihm gemietet hatte. Das ehemalige Atelier des Malers Sean Lorenz. Die Aufnahmen waren ansprechend – ein weiter offener Raum, lichtdurchflutet, entspannend, perfekt für den Schreibmarathon, der ihn erwartete. Normalerweise misstraute er solchen Fotos, doch Karen hatte die Wohnung selbst besichtigt und ihm versichert, sie würde ihm sicherlich gefallen. Mehr sogar, hatte sie auf geheimnisvolle Weise hinzugefügt.
Wenn er nur schon dort wäre.
Er musste sich noch eine gute Viertelstunde gedulden, bis einer der Beamten der Grenzpolizei sich bereitfand, einen Blick in seinen Pass zu werfen. Der ausgesprochen unfreundliche Typ ließ sich weder zu einem Bonjour noch zu einem Merci herab und antwortete auch nicht auf sein Bonne journée, als er ihm die Papiere zurückgab.
Erneutes Rätselraten vor den Hinweisschildern. Gaspard schlug die falsche Richtung ein, machte dann kehrt. Kaskaden von Rolltreppen. Eine Reihe von automatischen Türen, die sich jedes Mal mit Verzögerung öffneten. Er hastete an den Laufbändern vorbei. Zum Glück hatte er nur Handgepäck dabei.
Jetzt würde er der Hölle bald entkommen. Unter Einsatz der Ellenbogen kämpfte er sich durch das außergewöhnliche Gedränge in der Ankunftshalle, rempelte dabei ein sich küssendes Paar an, stieg über am Boden schlafende Passagiere hinweg. Die Drehtür mit dem Schild »Sortie – Taxis« darüber kündigte das Ende seines Martyriums an. Nur noch wenige Meter, und er wäre von diesem Albtraum befreit. Er würde ein Taxi nehmen, seine Kopfhörer aufsetzen und sich mental entfernen, indem er dem Piano von Brad Mehldau und dem Bass von Larry Grenadier lauschte. Dann, noch an diesem Nachmittag, würde er anfangen zu schreiben und ...
Der Regen kühlte seinen Enthusiasmus ab. Sintflutartige Wolkenbrüche ergossen sich auf den Asphalt. Tiefschwarzer Himmel. Tristesse und aufgeheizte Luft. Kein Taxi weit und breit. Stattdessen Wagen der Bereitschaftspolizei und desorientierte Touristen.
»Was ist los?«, fragte er einen Kofferträger, der seelenruhig neben einem Aschenbecher stand und seinen Glimmstängel paffte.
»Haben Sie denn noch nicht davon gehört? Wieder mal Streik, Monsieur.«
2.
Zur selben Zeit, genauer gesagt um 9:47 Uhr, stieg Madeline Greene an der Gare du Nord aus dem Eurostar, der sie aus London hierhergebracht hatte.
Ihre ersten Schritte auf französischem Boden waren zögerlich, denn sie hatte Probleme, sich zurechtzufinden. Ihre Beine waren schwer und zitterten. Zur Müdigkeit gesellten sich Schwindelgefühl, schmerzhafte Übelkeit und Sodbrennen. Obwohl der Arzt sie vor den Nebenwirkungen der Behandlung gewarnt hatte, war ihr nicht klar gewesen, dass sie über Weihnachten in so schlechter Verfassung sein würde.
Der Koffer, den sie hinter sich herzog, schien Tonnen zu wiegen. Der Lärm der Laufrollen auf dem Beton dröhnte in ihrem Kopf, zerriss gleichsam ihr Gehirn und intensivierte ihre Migräne, die sie quälte, seit sie wach geworden war.
Madeline blieb stehen, um den Reißverschluss ihres mit Lammfell gefütterten Lederblousons ganz hochzuziehen. Sie war schweißgebadet und zitterte trotzdem vor Kälte. Da sie kaum atmen konnte, glaubte sie einen Augenblick, ohnmächtig zu werden, fing sich aber am Ende des Bahnsteigs wieder, so als würde das geschäftige Treiben sie stimulieren.
Trotz seines wenig schmeichelhaften Rufs war die Gare du Nord, der Pariser Nordbahnhof, ein Ort, der Madeline schon immer fasziniert hatte. Sie empfand diesen Bahnhof nicht als gefährlich, sondern eher als eine Art Bienenstock – in ständiger Bewegung. Tausende von Leben, von Schicksalen, die sich kreuzten. Ein reißender Strom, eine Brandungswelle, die man bezwingen musste, um nicht zu ertrinken.
Vor allem aber wirkte der Bahnhof auf sie wie eine Bühne mit unzähligen Schauspielern: Touristen, Pendler, Geschäftsleute, Asoziale, Polizisten auf Streife, Schwarzhändler, Dealer, Angestellte aus den Cafés und Läden ringsumher ... Während sie diese Miniaturwelt unter der großen Glaskuppel sah, fühlte sich Madeline an die Schneekugeln erinnert, die ihr die Großmutter von jeder ihrer Reisen mitbrachte. Eine gigantische Glaskugel ohne Schnee, die von dem in ihr brodelnden Leben Risse bekam.
Draußen auf dem Vorplatz wurde sie von heftigen Böen empfangen. Das Wetter war noch mieser als in London: dichter Regen, trüber Himmel, feuchte, stickige Luft. Wie Takumi ihr prophezeit hatte, blockierten Dutzende Taxen den Zugang zum Bahnhof. Weder Busse noch Privatwagen konnten Reisende aufnehmen; sie blieben ihrem Schicksal überlassen. Vor einer Fernsehkamera erregten sich die Menschen: Streikende und Fahrgäste spielten die ewig gleichen Szenen für die Zeitungen und Nachrichtensender.
Madeline machte rasch einen Bogen um die Gruppe. Warum hab ich nicht daran gedacht, einen Regenschirm mitzunehmen, verfluchte sie sich, während sie auf den Boulevard de Magenta zusteuerte. Da sie zu nahe am Bürgersteigrand ging, wurde sie von einem vorbeifahrenden Wagen nass gespritzt. Wütend lief sie die Rue Saint-Vincent-de-Paul hinunter bis zum Eingang der Pfarrei. Dort, am Steuer eines Lieferwagens, der in zweiter Reihe parkte, wartete Takumi wie verabredet. Sein bunter Lieferwagen war mit einer fröhlichen Beschriftung versehen, die in krassem Gegensatz zur Umgebung stand: »Le Jardin Extraordinaire – Fleuriste – 3 bis, Rue Delambre – 75014 Paris«. Madeline winkte, als sie ihn sah, und kletterte erfreut in den Wagen.
»Salut, Madeline, willkommen in Paris!«, begrüßte der Blumenhändler sie und reichte ihr ein Handtuch.
»Hello, mein Lieber, ich freue mich, dich zu sehen!«
Während sie sich ihre Haare trocknete, betrachtete sie den jungen Asiaten. Takumi hatte kurzes Haar, trug eine Cordsamtjacke und dazu einen Seidenschal. Eine karierte Flanellkappe thronte auf seinem runden Kopf, unter der zwei kleine abstehende Ohren herausschauten, die an winzige Mäuse erinnerten. Der spärliche Schnurrbart über seiner Oberlippe erinnerte eher an einen pubertären Knaben als an Thomas Magnum. Sie fand, er war überhaupt nicht gealtert, seit sie nach London umgezogen war und ihm ihren hübschen Pariser Blumenladen überlassen hatte, in dem er zuvor ein paar Jahre angestellt gewesen war.
»Toll, dass du mich abgeholt hast, danke«, sagte Madeline und legte ihren Sicherheitsgurt an.
»Gern geschehen, heute wärst du anders nicht vom Fleck gekommen.«
Der junge Blumenhändler legte einen anderen Gang ein und bog in die Rue Abbeville ab.
»Wie du siehst, hat sich, seitdem du gegangen bist, in diesem Land nichts verändert«, erklärte er und deutete auf eine Gruppe von Demonstranten. »Es wird sogar mit jedem Tag ein bisschen schlimmer ...«
Die Scheibenwischer des alten Renaults hatten Mühe, die Sturzbäche an Regen, die sich über die Windschutzscheibe ergossen, zu bewältigen.
Trotz des Unwohlseins, das sie erneut überkam, bemühte sich Madeline, das Gespräch in Gang zu halten.
»Und, wie geht’s dir so? Gönnst du dir nicht einen kleinen Weihnachtsurlaub?«
»Nicht vor Ende nächster Woche. Wir feiern Silvester mit der Familie von Marjolaine. Ihre Eltern besitzen eine Brennerei im Département Calvados.«
»Wenn du den Alkohol immer noch so schlecht verträgst, kann man sich ja auf einiges gefasst machen!«
Das Gesicht des Floristen lief purpurrot an. Noch immer so empfindlich, der kleine Takumi, dachte Madeline amüsiert, während sie die verschwommene Stadtlandschaft an sich vorbeiziehen sah. Der Lieferwagen erreichte den Boulevard Haussmann und bog nach fünfhundert Metern in die Rue Tronchet ein. Trotz des Wolkenbruchs, trotz der angespannten sozialen Lage war Madeline glücklich, hier zu sein.
Sie hatte gern in Manhattan gelebt, aber nicht jene vermeintliche Energie wahrgenommen, die von manchen ihrer Freundinnen so gepriesen wurde. Um ehrlich zu sein, hatte New York sie nur erschöpft. Ihre Lieblingsstadt würde immer Paris bleiben, weil es der Ort war, an den sie zurückkehrte, um ihre Wunden zu heilen. Sie hatte hier vier Jahre lang gelebt. Nicht unbedingt die schönsten Jahre ihres Lebens, doch auf jeden Fall die wichtigsten: die der seelischen Heilung, der Festigung, des Neubeginns.
Bis 2009 hatte sie in England bei der Mordkommission von Manchester gearbeitet. Und dort war sie an einem schrecklichen Fall, dessen Ermittlungen sie geleitet hatte – die Affäre Alice Dixon[1] – gescheitert und gezwungen gewesen, den Polizeidienst zu quittieren. Diese Niederlage hatte ihr alles genommen: ihren Beruf, die Achtung ihrer Kollegen, ihr Selbstvertrauen. In Paris hatte sie dann einen kleinen Blumenladen aufgemacht und sich ein neues Leben im Viertel Montparnasse aufgebaut, weit entfernt von den Ermittlungen in Mordfällen oder Kindesentführungen. Doch dieses ruhige Dasein hatte eine radikale Wendung genommen, als eine Begegnung sie auf eine unerwartete Spur brachte und sie in der Lage war, die Ermittlungen fortzuführen. Schließlich hatte der Fall Alice Dixon in New York ein glückliches Ende gefunden. Die Umstände dieses Erfolgs hatten es ihr ermöglicht, in der Verwaltung des WITSEC, des Zeugenschutzprogramms, zu arbeiten.
Sie hatte ihren Blumenladen Takumi überlassen und war nach New York aufgebrochen. Ein Jahr später war das NYPD, die New Yorker Polizei, an sie herangetreten, um ihr einen Vertrag als Beraterin in der Abteilung für ungelöste Fälle anzubieten. Madeline sollte alte Ermittlungen, die ohne Ergebnis geblieben waren, wiederaufnehmen. Eine Arbeit, die in einer Fernsehserie oder einem Krimi von Harlan Coben aufregend gewesen wäre, sich in der Realität aber nur als ein unendlich langweiliger Schreibtischjob herausstellte. Innerhalb von vier Jahren hatte Madeline nicht an einem einzigen Einsatz mehr teilgenommen. Und nicht in einem einzigen Fall eine Wiederaufnahme des Verfahrens erreicht. Ihrer Abteilung fehlte es an den nötigen finanziellen Mitteln, und sie hatte gegen eine Bürokratie zu kämpfen, derer sich die französische Verwaltung geschämt hätte. Für den Antrag auf eine DNA-Untersuchung mussten Berge von Formularen ausgefüllt werden, und jede Anfrage zur Vernehmung ehemaliger Zeugen oder zur Akteneinsicht stieß meist auf eine eindeutige Absage des FBI, das für die interessantesten Ermittlungen zuständig war.
Ohne das geringste Bedauern hatte sie diesen Job gekündigt, um nach England zurückzukehren. Sie nahm es sich sogar fast übel, so lange mit der Entscheidung gewartet zu haben. Und seitdem Jonathan Lempereur – der Mann, den sie geliebt hatte und dem sie nach Manhattan gefolgt war – wieder zu seiner Frau zurückgekehrt war, hatte wirklich nichts mehr sie in den USA zurückgehalten.
»Marjolaine und ich erwarten im Frühjahr ein Baby«, vertraute ihr der Blumenhändler unvermittelt an.
Diese Eröffnung riss Madeline aus ihren Gedanken.
»Wie ... wie schön für euch«, erwiderte sie und versuchte, einen Anflug von Freude in ihre Stimme zu legen.
Aber ihre Reaktion klang derart falsch, dass Takumi schnell das Thema wechselte.
»Du hast mir immer noch nicht gesagt, was dich nach Paris führt, Madeline?«
»Dieses und jenes«, erwiderte sie ausweichend.
»Wenn du Heiligabend mit uns verbringen möchtest, bist du herzlich eingeladen.«
»Das ist sehr nett, aber sei mir nicht böse, ich muss einfach allein sein.«
»Wie du willst.«
Erneutes Schweigen. Lastend. Madeline bemühte sich gar nicht erst, das Gespräch wieder in Gang zu bringen. Die Stirn an die Fensterscheibe gedrückt, versuchte sie, sich zurechtzufinden, jeden Ort mit einer Erinnerung ihres Pariser Lebens zu verknüpfen. Die Place de la Madeleine ließ sie an eine Ausstellung mit Werken von Raoul Dufy denken; die Rue Royale an das Bistrot mit dem köstlichsten Kalbsfrikassee; der Pont Alexandre IIIan einen Unfall, den sie an einem Regentag mit ihrem Motorrad gehabt hatte ...
»Hast du berufliche Pläne?«, insistierte Takumi.
»Natürlich«, log sie.
»Und hast du Jonathan unlängst gesehen?«
Kümmer dich um deinen eigenen Kram!
»Gut, bist du jetzt fertig mit deinem Verhör? Ich bin hier schließlich der Bulle.«
»Eben nicht; wenn ich es recht verstanden habe, bist du nicht mehr ...«
Sie seufzte. Der junge Tollpatsch ging ihr langsam echt auf die Nerven.
»Okay, ich werde ehrlich sein«, sagte sie. »Ich will, dass du mit deiner Fragerei aufhörst. Du warst mein Lehrling, und ich habe dir mein Geschäft vermacht. Das gibt dir aber nicht das Recht, mich mit Fragen nach meinem Leben zu bedrängen!«
Während der Lieferwagen die Esplanade des Invalides überquerte, sah Takumi Madeline von der Seite an. Sie war so geblieben, wie er sie gekannt hatte – ihr barscher Charakter, ihre grobe Lederjacke, ihre blonden Strähnen und der Bubikopf, der ein wenig old fashioned war.
Noch immer wütend, kurbelte Madeline das Seitenfenster runter und zündete sich eine Zigarette an.
»Rauchst du etwa noch?«, fragte der Florist mit mahnendem Unterton. »Wie unvernünftig.«
»Halt die Klappe«, gab sie zurück und blies, um ihn zu provozieren, eine Rauchwolke in seine Richtung.
»Nein! Nicht in meinem Wagen! Ich will nicht, dass es hier drinnen nach Tabak stinkt!«
Als der Lieferwagen an einer roten Ampel hielt, nutzte sie die Gelegenheit, um nach ihrem Koffer zu greifen und die Beifahrertür zu öffnen.
»Aber, Madeline, was machst du denn?«
»Ich muss mir in meinem Alter keine billigen Moralpredigten mehr anhören. Ich gehe zu Fuß weiter.«
»Nein, warte, du ...«
Sie warf die Tür zu und entfernte sich mit weit ausholenden Schritten.
Es regnete immer noch heftig.
3.
»Der Streik?«, rief Gaspard. »Welcher Streik?«
Schicksalsergeben zuckte der Kofferträger mit den Schultern und machte eine vage Geste.
»Ach, wie immer, Sie kennen das ja ...«
Um sich gegen die Regenböen zu schützen, beschattete Gaspard die Augen mit der Hand. Er hatte natürlich nicht daran gedacht, einen Regenschirm mitzunehmen.
»Das heißt also, es fahren keine Taxen?«
»Nada. Sie können versuchen, den RER-B zu nehmen, aber da geht nur jeder dritte Zug.«
Na toll, lieber sterben.
»Und die Busse?«
»Keine Ahnung«, erwiderte der Angestellte und zog ein letztes Mal an seiner Zigarette.
Wütend kehrte Gaspard ins Gebäude zurück. In einem Zeitungsshop blätterte er in der aktuellen Ausgabe von Le Parisien. Der Titel sagte alles: »Le grand blocage«. Taxifahrer, Eisenbahner, Angestellte der Pariser Verkehrsbetriebe, Fluglotsen, Stewardessen und Flugbegleiter, Fernfahrer, Dockarbeiter, Postboten, Müllmänner: Sie alle hatten sich zusammengetan und drohten der Regierung, das Land lahmzulegen, um die Politiker zu zwingen, einen bestimmten Gesetzestext zurückzunehmen. Der Zeitungsartikel präzisierte, man könne sich auf andere Streiks gefasst machen, und auch eine Blockade der Raffinerien sei nicht auszuschließen, sodass dem Land in den nächsten Tagen das Benzin ausgehe. Um alles noch zu verschlimmern, führte die Seine – nach einer starken Luftverschmutzung Anfang des Monats – historisches Hochwasser. Es gab überall in und um Paris Überschwemmungen, was den Verkehr zusätzlich erschwerte.
Gaspard rieb sich die Augenlider. Immer dasselbe, wenn ich einen Fuß in dieses Land setze ... Der Albtraum dauerte an, aber nach und nach siegte die Mattigkeit über den Zorn.
Was tun? Hätte er ein Handy gehabt, hätte er Karen anrufen können, damit sie eine Lösung für ihn fände. Aber Gaspard hatte nie ein Mobiltelefon haben wollen. Ebenso wie er auch keinen Computer, kein Tablet, keine E-Mail-Adresse hatte und auch nie das Internet benutzte.
Also machte er sich auf die Suche nach einer Telefonzelle in der Ankunftshalle, doch sie schienen alle verschwunden zu sein.
Die Busse blieben seine letzte Hoffnung. Er trat nach draußen und suchte vergebens nach einem Angestellten, um sich zu erkundigen, brauchte eine gute Viertelstunde, bis er das System der Air-France-Busse verstanden hatte, und sah zwei davon völlig überfüllt davonfahren.
Nach einer halben Stunde Wartezeit – der Regen war noch heftiger geworden – konnte er schließlich in eines der Fahrzeuge steigen. Kein Sitzplatz, nein, das wäre zu schön gewesen, doch er war wenigstens im richtigen Bus, demjenigen, der zur Gare Montparnasse fuhr.
Dicht gedrängt wie Heringe und triefend nass, mussten die Fahrgäste den Kelch bis zur bitteren Neige leeren. Seine Reisetasche fest an sich gepresst, dachte Gaspard an Dostojewskis Definition des Menschen: »Der Mensch ist ein Wesen, das sich an alles gewöhnt.«[03] Und so ließ er sich auf die Füße treten und schubsen, sich ins Gesicht husten und teilte diesen Brutkasten und die bakterienverseuchte Metallstange mit schwitzenden Fremden ...
Erneut war er versucht, alles aufzugeben und Frankreich zu verlassen, dann aber tröstete er sich damit, dass sein Martyrium ja nicht länger als einen Monat dauern würde. Wenn es ihm gelänge, das Stück in weniger als fünf Wochen fertigzustellen, würde er das Winterende und den Frühlingsanfang in Griechenland verbringen, wo er auf Sifnos ein Segelboot im Hafen liegen hatte. Das würde sechs Monate Schiffsreise zwischen den Kykladen-Inseln bedeuten, ein Leben im Einklang mit den Elementen und einer Explosion der Gefühle und der Farben: das blendende Weiß der Sonne, das Kobaltblau des Himmels, die türkisgrünen Tiefen der Ägäis. In Griechenland fühlte sich Gaspard eins mit der Landschaft, den Pflanzen und den Düften. Nachdem er sich an der Meeresluft berauscht hatte, würde er eintauchenin die Baumheide, sichan den Gerüchen von Thymian, Salbei, Olivenöl und gegrilltem Tintenfisch laben. Ein Glück, das etwa bis Mitte Juni andauerte. Wenn dann die Touristen die Inseln zu überschwemmen drohten, flüchtete er nach Amerika in sein Chalet in Montana.
Dort veränderte sich der Lebensstil: ein Zurück zur Natur – in ihrer wildesten und rauesten Form. Seine Tage waren bestimmt von Angelpartien, endlosen Spaziergängen durch die Birkenwälder, an See- und Flussufern entlang. Ein einsames, aber intensives Leben, weit entfernt vom Krebsgeschwür der Städte und ihren gestressten Einwohnern.
Meter für Meter schob sich der Bus über die Autobahn A3. Durch die beschlagenen Fenster konnte Gaspard bisweilen vage die Schilder der nordöstlichen Vororte erkennen: Aulnay-sous-Bois, Drancy, Livry-Gargan, Bobigny, Bondy ...
Er brauchte dieses einsame Eintauchen in die Natur, um sich zu entgiften, sich reinzuwaschen von den Auswüchsen der Zivilisation. Denn seit Langem schon stand Gaspard Coutances auf Kriegsfuß mit dem Treiben und dem Chaos einer Welt, die ihrem Untergang entgegenging. Einer Welt, die an allen Ecken und Enden ins Wanken geriet und die er nicht mehr verstand. Als guter Misanthrop fühlte er sich den Bären, Raubvögeln und Schlangen näher als seinen sogenannten Mitmenschen. Und er war stolz darauf, mit einer Welt gebrochen zu haben, für die er nur Hass empfand. Stolz darauf, einen Großteil der Zeit außerhalb der Gesellschaft und ihrer Regeln leben zu können. Deshalb hatte er seit fünfundzwanzig Jahren keinen Fernseher mehr eingeschaltet, wusste so gut wie nichts vom Internet und fuhr einen Dodge aus den späten 1970er-Jahren.
Sein Einsiedlerleben resultierte aus einer entschiedenen, aber nicht radikalen Askese. Er erlaubte sich bisweilen, wenn sich die Gelegenheit bot, einen Verstoß gegen seine eigenen Grundsätze. So kam es vor, dass er seine Berge oder sein Versteck in Griechenland verließ, um ein Konzert von Keith Jarrett in Juan-les-Pins, eine Brueghel-Retrospektive in Rotterdam oder eine Tosca-Aufführung in der Arena von Verona zu besuchen. Und dann gab es besagten Schreib-Monat in Paris. Nachdem er sein Theaterstück während eines Jahres im Kopf hatte reifen lassen, setzte er sich täglich für etwa sechzehn Stunden an seinen Schreibtisch. Jedes Mal glaubte er, es könnte ihm an Ideen und Inspiration mangeln, doch jedes Mal kam ein mysteriöser Prozess in Gang. Worte, Situationen, Dialoge ergaben sich wie von selbst und bildeten ein kohärentes Ganzes.
Seine Stücke wurden heute in fast zwanzig Sprachen übersetzt und auf der ganzen Welt aufgeführt. Allein im letzten Jahr wurden an die fünfzehn Inszenierungen in Europa und den Vereinigten Staaten gespielt; eines seiner letzten Stücke, Ghost Town, sogar an der Schaubühne, dem mythischen Berliner Theater, und für einen Tony Award nominiert. Seine Geschichten gefielen vor allem den intellektuellen Kritikern, die seine Arbeit ein wenig überinterpretierten und irgendwie vielleicht auch überschätzten.
Gaspard wohnte nie den Aufführungen seiner Stücke bei und gab auch keine Interviews. Anfangs hatte Karen sich Sorgen gemacht, weil er nicht in den Medien präsent war, diese Reserviertheit dann aber genutzt, um das »Mysterium Gaspard Coutances« zu erschaffen. Je weniger er sich blicken ließ, desto mehr lobte ihn die Presse. Man verglich ihn mit Kundera, Pinter, Schopenhauer, Kierkegaard. Gaspard fühlte sich alles andere als geschmeichelt durch diese Komplimente, hatte er doch immer gedacht, sein Erfolg rühre von einem Missverständnis her.
Hinter Bagnolet schlich der Bus eine Ewigkeit über den Périphérique, bevor er über den Quai de Bercy den Bahnhof Gare de Lyon erreichte. Dort angekommen, legte er einen endlos langen Stopp ein, um die Hälfte der Fahrgäste aussteigen zu lassen, bevor er weiter in Richtung Westen fuhr.
Gaspards Theaterstücke resultierten alle aus derselben Grundhaltung – der Absurdität und Tragik des Lebens, der Einsamkeit der conditio humana. Sie zeigten seine Aversion gegen den Wahnsinn seiner Epoche und waren bar jeder Illusion, jeder Form von Optimismus oder Happy End. Doch wenn seine Arbeiten auch von Verzweiflung und Grausamkeit geprägt waren, wiesen sie doch eine gewisse Komik auf. Gewiss, es war nicht Die große Sause oder Ein Käfig voller Narren, aber es waren dynamische Stücke voller Leben. Wie Karen sagte, ließen sie den Zuschauer glauben, er sei frei, und den Kritiker, er sei intelligent. Das erklärte vielleicht die Begeisterung des Publikums und auch die der gefragtesten Schauspieler, die sich darum rissen, seine Rollen verkörpern zu dürfen.
Eben hatten sie die Seine überquert. Auf dem Boulevard Arago erinnerte die triste und zerrupfte Weihnachtsdeko Gaspard daran, wie sehr er diese Zeit hasste und was aus diesem Fest geworden war: ein kommerzielles und banales Event. Schließlich hielt der Bus an der Place Denfert-Rochereau, direkt vor dem Eingang zu den Katakomben. Um den mächtigen Lion de Belfort herum schwenkte eine kleine Gruppe von Demonstranten ihre Fahnen in den Farben der CGT, FO und FSU, den drei wichtigsten französischen Gewerkschaften. Der Fahrer ließ das Seitenfenster herunter, um mit einem Polizisten zu sprechen, der den Verkehr regelte. Gaspard lauschte angestrengt und verstand, dass die Avenue du Maine sowie alle Straßen zur Tour Montparnasse gesperrt waren.
Die Bustüren öffneten sich quietschend.
»Endstation, alle aussteigen!«, verkündete der Fahrer in belustigtem Tonfall, obwohl er seine Passagiere einem traurigen Schicksal überließ.
Draußen tobte das Gewitter immer heftiger.
4.
Wegen des Streiks und der Blockade der Anlagen zur Abfallaufbereitung versank Paris im Müll. Berge von Unrat türmten sich vor den Restaurants, Gebäudeeingängen und Geschäften. Verärgert, hin- und hergerissen zwischen Abscheu und Wut, machten manche Touristen sogar Selfies vor den überquellenden Abfallcontainern.
Im peitschenden Regen lief Madeline die Rue de Grenelle entlang und zog ihren Rollenkoffer, der alle hundert Meter ein Kilo mehr zu wiegen schien, hinter sich her. Tapfer und unverzagt hatte sie beschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Um sich Mut zu machen, stellte sie sich ihr Programm für die nächsten Tage vor. Spaziergänge auf der Île Saint-Louis, ein Musical im Châtelet, ein Theaterstück im Édouard-VI, die Hergé-Ausstellung im Grand Palais, Manchester by the Sea im Kino und bisweilen ein Restaurantbesuch, auch wenn sie allein war ... Es war wichtig für sie, dass ihr Aufenthalt gut verlief. Sie war hierhergereist, in der Hoffnung, sich zu erholen und wieder zu sich zu kommen, und davon überzeugt, dass die Stadt magische Fähigkeiten besaß.
Sie setzte ihren Weg fort und zwang sich, nicht an den medizinischen Eingriff zu denken, der ihr in den nächsten Tagen bevorstand. Jenseits der Rue de Bourgogne hörte es schlagartig auf zu regnen. Auf der Höhe der Rue du Cherche-Midi wagte sich sogar ein schüchterner Sonnenstrahl hervor und zauberte ein Lächeln auf ihre Lippen. Sie suchte in ihrem Smartphone nach der Bestätigungsmail des Vermietungsportals, bei dem sie die Wohnung gebucht hatte.
»Eine Wohnung in Paris«: Diese Anfrage hatte sie einen Monat zuvor in die Suchmaschine eingegeben, um ein Quartier in Paris zu finden. Nach einigen Dutzend Mausklicks und einer halben Stunde intensiven Suchens war sie auf die Site eines Maklerbüros gestoßen, das auf Mietwohnungen mit außergewöhnlichem Flair spezialisiert war. Der Preis überstieg bei Weitem ihr Budget, aber sie hatte sich sofort in das Haus verliebt, sodass sie sich nicht vorstellen mochte, anderswo zu wohnen. Aus Angst, jemand könnte ihr die Wohnung vor der Nase wegschnappen, hatte Madeline ihre Kreditkarte gezückt, um definitiv zu buchen.
In der Bestätigungsmail waren die Adresse des Hauses sowie die verschiedenen Zugangscodes vermerkt. Gemäß den Angaben befand sich das Gebäude in der Allée Jeanne-Hébuterne, einer Sackgasse, deren Zugang mit einem Eisentor gesichert war. Als sie vor dem Gitter mit der abgeblätterten Farbe stand, sah sie auf das Display ihres Handys und tippte dann den Code ein.
Nachdem sie das Tor hinter sich geschlossen hatte, fühlte sich Madeline in ein Refugium außerhalb der Zeit versetzt. Das üppige Grün der Pflanzen – Geißblatt, Bambus, Jasmin, Magnolien, Orangenblumen, japanische Lavendelheide, Schmetterlingsflieder – verlieh dem Ort eine idyllische, ländliche Note, die meilenweit von der Hektik der Hauptstadt entfernt schien. Als sie weiter über die gepflasterte Gasse lief, entdeckte sie eine Gruppe von vier einstöckigen Häuschen, deren Fassaden von Efeu und Passionsblumen überwuchert und von Gemüsebeeten umgeben waren.
Das letzte Haus war jenes, das sie gemietet hatte. Es hatte nichts mit den anderen gemein. Von außen betrachtet, war es ein Kubus aus Stahlbeton mit einem schachbrettartig angeordneten Fries aus roten und schwarzen Ziegelsteinen. Madeline tippte erneut einen Code ein, um die große Tür zu öffnen, über der eine Inschrift aus Gusseisen prangte:
Cursum Perficio
Als sie den Flur betrat, geschah etwas Sonderbares: Sie empfand eine Begeisterung, fast schon wie Liebe auf den ersten Blick, die sie mitten ins Herz traf. Woher kam es, dass sie sich hier sofort zu Hause fühlte? Dieser Eindruck von undefinierbarer Harmonie? Lag es an der Raumaufteilung oder an dem ockerfarbenen Schimmer des natürlichen Lichts? Oder an dem Gegensatz zu dem Chaos, das draußen herrschte?
Madeline war seit jeher empfänglich für Interieurs. Lange Zeit war das sogar Bestandteil ihres Berufs gewesen: die Orte zum Sprechen zu bringen. Doch die Orte, mit denen sie damals zu tun gehabt hatte, besaßen die Besonderheit, dass es sich um Tatorte handelte ...
Sie stellte ihren Koffer in einer Ecke des Eingangs ab und nahm sich Zeit, alle Zimmer anzuschauen. Cursum Perficio[2] war ein perfekt restauriertes Atelierhaus aus den 1920er-Jahren, bestehend aus drei Etagen rund um einen bepflanzten Innenhof.
Im Erdgeschoss öffnete sich eine Küche auf ein Esszimmer und einen großen, spärlich möblierten Salon. Über eine Treppe aus unbehandeltem Holz gelangte man hinab auf die Gartenebene mit zwei Schlafzimmern, die auf einen von Kletterpflanzen umwucherten Brunnen hinausführten. Der erste Stock bestand aus einem großen Atelier, einem Schlafzimmer und dem Bad.
Wie verzaubert verweilte Madeline mehrere Minuten im Atelier und betrachtete beeindruckt die bis zu vier Meter hohen Fenster, die den Blick in den Himmel und auf die Baumkronen ermöglichten. In der Beschreibung auf der Website hatte sie gelesen, dass das Haus früher dem Maler Sean Lorenz gehört hatte. Tatsächlich erweckte das Atelier den Eindruck, als hätte der Künstler es eben erst Hals über Kopf verlassen – mit dem Boden voller kräftiger Farbflecken, den Staffeleien und Rahmen in allen Größen, der leeren Leinwand in den Gestellen. Und überall Farbtöpfe, Bürsten, Pinsel, Spraydosen.
Es fiel ihr schwer, das Atelier zu verlassen. Es war berauschend, sich in der Privatsphäre eines Künstlers zu bewegen. Zurück im Salon, öffnete sie die große Glastür, die auf die Terrasse führte. Gerührt beobachtete sie zwei Rotkehlchen, die in anmutigen Pirouetten um ein Futterhäuschen kreisten. Hier befand man sich eigentlich auf dem Land und nicht in Paris. Jetzt wusste sie, was sie tun würde: ein Bad nehmen und sich mit einer Tasse Tee und einem guten Buch auf der Terrasse niederlassen!
In diesem Haus hatte sie sofort ihr Lächeln wiedergefunden. Sie hatte recht gehabt, ihrem Instinkt zu folgen und hierherzukommen. Paris war wirklich die Stadt, in der alles möglich war.
5.
Die schwere Tasche über der Schulter und die Jacke schützend über den Kopf haltend, sprang Gaspard über die Pfützen und verfluchte den sturzbachartigen Regen. Von Denfert Rochereau aus rannte er bis zur Metrostation Edgar Quinet. Als er schließlich in die Rue Delambre bog, befand er sich endlich auf bekanntem Terrain. Zwei Jahre zuvor hatte Karen ihm eine große Wohnung am Square Delambre gemietet. Er konnte sich gut an die Straße erinnern: die kleine Schule, das Hotel Lenox sowie die Restaurants, in denen er bisweilen zum Essen gewesen war: das Sushi Gozen und das Bistrot du Dôme.
Auf Höhe des Boulevard Montparnasse hörte es plötzlich auf zu regnen. Gaspard nutzte die Gelegenheit, um seine Jacke wieder anzuziehen und seine Brille zu trocknen. Ein rauer und diffuser Lärm schlug ihm entgegen. Knallkörper, Tröten, Pfeifen, Sirenen, regierungsfeindliche Slogans. Ein großer, dicht gedrängter Demonstrationszug, angefeuert von einer Lautsprecheranlage, hatte sich um einen Heißluftballon geschart und wartete darauf, sich auf der Rue de Rennes in Bewegung setzen zu können. Gaspard erkannte die fluoreszierenden gelben und roten Westen der Gewerkschaft CGT.
Gaspard tauchte in das Meer von Transparenten und Fahnen ein, um es zu durchqueren. Erleichtert, sich in ruhigeren Gefilden zu befinden, lehnte er sich an einen Laternenpfahl und atmete tief durch. Schweißgebadet zog er den Zettel, den Karen ihm geschickt hatte, aus der Tasche und las noch einmal die Adresse des Hauses und den Zugangscode. Als er seinen Weg fortsetzte, zauberten schüchterne Sonnenstrahlen einen freundlichen Schimmer auf die Bürgersteige.
An der Kreuzung Rue du Cherche-Midi besserte die Auslage eines Weingeschäfts seine Laune sofort. »Le Rouge et le Noir«. Bevor er eintrat, vergewisserte er sich, dass kein Kunde im Laden war. Da er genau wusste, was er wollte, hielt sich das Gespräch mit dem Eigentümer in Grenzen. Bereits zehn Minuten später brach er, beladen mit einer Kiste erlesenster Weine, auf: Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny, Saint-Estèphe, Margaux, Saint-Julien.
Der Alkohol ...
Als er sein Spiegelbild in den Schaufenstern sah, musste er kurz an die schreckliche Szene am Anfang des Films Leaving Las Vegas denken, als der Protagonist, verkörpert von Nicolas Cage, in einem Liquor Store anhält, um einen Caddie mit Dutzenden Flaschen Alkohol zu füllen. Ein Vorspiel zum Abstieg in die Hölle des Selbstmords.
Nun, Gaspard war noch nicht ganz so weit, doch der Alkohol war ein fester Bestandteil seines Alltags. Wenn er auch die meiste Zeit allein trank, genehmigte er sich trotzdem gelegentlich in irgendwelchen Spelunken von Columbia Falls, Whitefish oder Sifnos einen ordentlichen Rausch. Heftige Besäufnisse mit frustrierten Typen, die keine Ahnung von Brueghel, Schopenhauer, Milan Kundera oder Harold Pinter hatten.
Alkohol war das einfachste Hilfsmittel, um die Bruchstellen seines Lebens abzudichten und die Tragik zu verringern. Ein Verbündeter, der ihm half, seiner Existenz einige Fragmente der Sorglosigkeit abzuringen. Mal Freund, mal Feind, diente er ihm als Schutzschild, der die Gefühle auf Distanz hielt, als Kettenhemd, das ihn gegen die Ängste schützte, und als bestes Schlafmittel. Er erinnerte sich an den Satz von Hemingway: Ein intelligenter Mann ist manchmal gezwungen, sich zu betrinken, um Zeit mit Narren zu verbringen.[04]Genau das war es. Der Alkohol löste im Grunde kein Problem, doch er bot die Möglichkeit, die Mittelmäßigkeit zu ertragen, die nach seinem Empfinden die Menschheit infiziert hatte.
Gaspard war hellsichtig, er wusste, es war nicht auszuschließen, dass der Alkohol am Ende gewinnen würde. Er hatte sogar eine sehr präzise Vorstellung von der Art und Weise, wie sich das abspielen könnte: Es würde ein Tag kommen, an dem ihm das Leben so unerträglich wäre, dass er es nicht mehr nüchtern in Angriff nehmen konnte. Das Bild seines eigenen Leichnams, der in seinen alkoholisierten Abgründen untergegangen war, ging ihm durch den Kopf. Eine albtraumartige Vision, die er eilig verscheuchte, als er ein leuchtend blau gestrichenes Tor erreichte.
Die Weinkiste unter einen Arm geklemmt, tippte Gaspard die vier Zahlen des Codes ein, der den Zugang zur Allée Jeanne-Hébuterne schützte. Sobald er in die kleine Sackgasse trat, entspannte sich etwas in seinem Inneren. Einen langen Augenblick blieb er stehen und betrachtete ungläubig die Pflanzenvielfalt dieses geradezu ländlich wirkenden, baumbestandenen Durchgangs. Hier schien die Zeit langsamer als anderswo zu verstreichen, als würde er sich in einer anderen Welt befinden. Zwei Katzen aalten sich in der Sonne. Vögel zwitscherten in den Zweigen der Kirschbäume. Das Chaos draußen schien mit einem Mal sehr weit entfernt, und es war kaum vorstellbar, dass er sich nur wenige Hundert Meter von der scheußlichen Tour Montparnasse befand.
Gaspard machte ein paar Schritte auf der gepflasterten Gasse. Weiter vorn, halb verborgen hinter Büschen, erahnte man kleine Steinhäuser, deren Fassaden hinter Efeu und wildem Wein verschwanden. Am Ende des Weges erhob sich schließlich eine gewagte Konstruktion aus geometrischen Formen. Ein Kubus aus Stahlbeton, eingerahmt von einem Fries aus schachbrettartig angeordneten, roten und schwarzen Ziegelsteinen, durch dessen Fassade sich ein breiter Glasstreifen zog. Über der Tür eine schmiedeeiserne Inschrift: Cursum Perficio, der Name des letzten Hauses von Marilyn Monroe. Gaspard folgte Karens Instruktionen, gab einen weiteren Code ein, woraufhin sich die Stahltür mit einem leichten Klicken öffnete.
Neugierig trat Gaspard direkt in den Salon. Er sah nicht so aus wie auf den Fotos. Er war viel beeindruckender. Auf geniale Art war das Haus um einen rechteckigen Innenhof mit einer L-förmigen Terrasse angeordnet.
Verdammt ... murmelte er, tief beeindruckt von der Eleganz des Hauses. Die Anspannung, die sich in den letzten Stunden aufgestaut hatte, fiel von ihm ab. Es war, als befände er sich hier in einer anderen Dimension, einem Ort, der zugleich vertraut und tröstlich wirkte. Funktionell, gastlich, puristisch. Er versuchte einen Moment lang, den Ursprung dieses Gefühls zu ergründen, doch weder Architektur noch die Harmonie der Proportionen waren eine Grammatik, deren Regeln er kannte.
Normalerweise war Gaspard nicht so sehr empfänglich für Interieurs, sondern eher für Landschaften: für das Spiegelbild verschneiter Berge auf der Oberfläche der Seen, für das bläuliche Weiß der Gletscher, für die berauschende Weite der Tannenwälder. Er glaubte nicht an diesen Humbug rund um Feng Shui und den vermeintlichen Einfluss des Mobiliars auf den Energiekreislauf in einem Raum. Fest jedoch stand, dass er hier »gute Schwingungen« wahrnahm, zumindest die Gewissheit, dass er sich hier wohlfühlen würde und voller Elan arbeiten könnte.
Er öffnete die Glastür, trat auf die Terrasse, stützte sich auf die Balustrade und erfreute sich am Gesang der Vögel und dieser ländlich anmutenden Atmosphäre. Ein leichter Wind wehte, aber die Luft war mild, und die Sonne schien ihm ins Gesicht. Und zum ersten Mal seit langer Zeit lächelte Gaspard. Um seine Ankunft zu zelebrieren, würde er eine Flasche von diesem Gevrey-Chambertin öffnen und sich ein Glas gönnen, das er genüsslich ...
Ein Geräusch riss ihn aus seinem Glücksgefühl. Da war jemand im Haus. Vielleicht die Putzfrau oder der Hausmeister. Er kehrte in den Salon zurück, um sich zu vergewissern.
Und plötzlich stand ihm eine Frau gegenüber. Nackt bis auf ein Badetuch, das sie sich um die Brüste geschlungen hatte und das bis zu ihren Oberschenkeln reichte.
»Wer sind Sie? Und was machen Sie hier bei mir?«, fragte er.
»Genau diese Frage wollte ich Ihnen auch gerade stellen«, erwiderte sie.
Anmerkungen
[1]siehe Musso »Nachricht von dir«, Pendo Verlag 2012
[2]»Hier endet mein Weg.«
2. Die Theorie von den 21 Gramm
Ein Teil dessen, was uns an Künstlern fasziniert,
ist ihre Andersartigkeit, die Verweigerung
jeglichen Konformismus’, der Stinkefinger,
den sie der Gesellschaft zeigen.[05]
Jesse Kellerman, The Genius
1.
»Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht ganz, was Sie mir vorwerfen, Mademoiselle Greene.«
Die silbergraue Mähne stolz in den Nacken geworfen, erweckte Bernard Benedick den Eindruck, als halte er Wache vor dem großen monochromen Gemälde, das in seiner Galerie an der Rue Faubourg-Saint-Honoré ausgestellt war. Da er in der letzten Zeit abgenommen hatte, versank er förmlich in seinem Hemd mit dem Mao-Kragen und der grünen Jägerjacke. Das Gestell der großen Le-Corbusier-Brille betonte die obere Hälfte seines Gesichts, die runden Augen funkelten lebhaft hinter den Gläsern.
»Die Anzeige auf der Website ist irreführend«, wiederholte Madeline mit erhobener Stimme. »Es war keine Rede davon, dass es sich um eine Mietgemeinschaft handelt.«
Der Galerist schüttelte den Kopf.
»Das Haus von Sean Lorenz wird auch nicht als solche angeboten«, versicherte er.
»Sehen Sie doch selbst«, erregte sich Madeline und reichte ihm zwei ausgedruckte Blätter – ihren eigenen Vertrag und den, den ihr Gaspard Coutances gezeigt hatte, als sie ihm vor einer Stunde beim Verlassen des Badezimmers plötzlich gegenüberstand.
Benedick griff nach den Papieren und überflog sie, schien allerdings auch nichts zu begreifen.
»Anscheinend liegt da tatsächlich ein Irrtum vor!«, gab er schließlich zu und rückte seine Brille zurecht. »Wahrscheinlich handelt es sich um einen Fehler bei der Onlinebuchung, aber, ehrlich gesagt, verstehe ich nicht viel davon. Nadia, eine unserer Praktikantinnen, hat die Annonce ins Netz gestellt. Ich kann versuchen, sie zu erreichen, doch sie ist heute Morgen nach Chicago in Urlaub gefahren und ...«
»Ich habe schon eine Mail an die Kontaktadresse geschickt, aber das löst das Problem nicht«, unterbrach Madeline ihn. »Der Mann, der im Moment in dem Haus ist, kommt aus den USA und hat nicht die Absicht, zurückzufahren.«
Die Miene des Galeristen verfinsterte sich.
»Ich hätte das Haus nicht vermieten dürfen. Lorenz macht mir das Leben sogar noch aus dem Grab heraus schwer!«, brummte er, offensichtlich wütend auf sich selbst.
Dann seufzte er gereizt.
»Wissen Sie, was?«, entschied er schließlich, »ich gebe Ihnen das Geld zurück.«
»Ich will kein Geld. Ich will das, was abgemacht war: Allein in dem Haus wohnen!«
Von der irrationalen Überzeugung getrieben, dass sie in ebendiesem Haus wohnen müsse, betonte sie jedes Wort mit besonderem Nachdruck.
»Na gut, dann zahle ich eben diesen Monsieur Coutances aus. Sollen wir ihn anrufen?«
»Sie werden es nicht glauben, aber er hat kein Handy.«
»Schön, dann übermitteln Sie ihm mein Angebot.«
»Ich habe ihn nur fünf Minuten getroffen, und er scheint nicht gerade umgänglich.«
»Das Gleiche könnte man von Ihnen behaupten«, entgegnete Benedick und reichte ihr eine Visitenkarte. »Rufen Sie mich an, wenn Sie mit ihm gesprochen haben. Und wenn Sie sich in der Galerie ein wenig umsehen wollen, habe ich Zeit, ihm ein paar Zeilen zu schreiben, um mich zu entschuldigen und ihm eine Entschädigung anzubieten.«
Madeline schob die Karte in die Tasche ihrer Jeans und wandte sich ab, ohne sich zu bedanken, denn sie hatte größte Zweifel daran, dass die Zeilen des Galeristen etwas bei diesem Coutances ausrichten könnten, der ganz offensichtlich ein aggressiver, halsstarriger Griesgram war.
Ende der Leseprobe