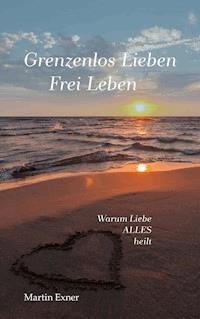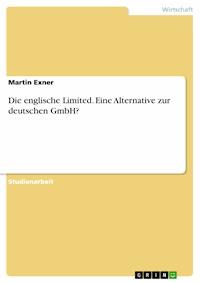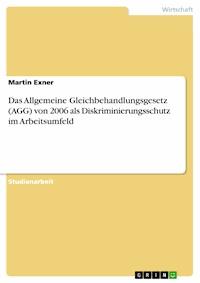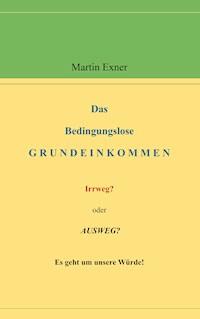
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Nach meiner tiefen Überzeugung wird das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) in absehbarer Zeit unser bisheriges Sozialsystem ablösen." Dies zeigt sich auch an der öffentlichen Diskussion, die mittlerweile an einem Punkt angelangt ist, bei dem es immer weniger um die Frage geht, ob es realisierbar ist, sondern vielmehr darum, wann, wo und wie es kommt. Inwieweit das BGE einen Irrweg oder Ausweg darstellt, wird sich erst dann zeigen, wenn die Form der Umsetzung geklärt ist. Daran ist auch die wichtige Frage der Finanzierungsmodalitäten geknüpft. Setzen sich neoliberale Vorstellungen durch, wird es für die meisten Menschen ein Irrweg sein, weil hierdurch das bestehende Ungleichgewicht zwischen Reichtum und Armut verschärft wird. Insbesondere auch durch eine Besteuerung (z.B. Konsumsteuer), die hohe Einkommen überproportional entlastet und niedrigere zu stark belastet. Wird das BGE sozial ausgewogen realisiert, kann es zusammen mit flankierenden Maßnahmen, wie beispielsweise durch den Wandel des Geld- sowie des Wirtschaftssystems, ein Ausweg und sogar Erfolgsschlager werden. Statt krampfhaft am bisherigen System festzuhalten, das langfristig dem Untergang geweiht ist, weil es mit den strukturellen Veränderungen nicht mehr kompatibel ist, sollten wir gemeinsam für einen sanften Übergang in ein neues, nachhaltiges System sorgen. Je mehr Menschen sich in diesem gesellschaftlichen Umbruch an der Realisierung beteiligen, um so besser wird das BGE den Interessen der Bevölkerung gerecht und nicht irgendwelchen Lobbyisten. Dieses Buch gibt die Möglichkeit, sich auf eine verständliche Weise umfassend zu informieren und zeigt Wege zur sozial ausgewogenen Realisierung. Außerdem wird darin ein Pilotprojekt zur bundesweiten Erprobung vorgestellt, bei dem praktische Erfahrungen gesammelt werden können, ohne wesentlich in das bestehende System einzugreifen. Der Autor befasst sich seit dem Jahr 2000 intensiv mit der Thematik und kann deshalb als Experte bezeichnet werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt:
Vorwort
Wie wollen wir in Zukunft leben?
Warum ist ein Wandel der sozialen Sicherung erforderlich?
Stimmen aus Wirtschaft und Wissenschaft
Thesen zum Grundeinkommen
Welche Initiativen gibt es?
Was bedeutet BGE?
In welcher Höhe ist ein BGE in der BRD angemessen und notwendig?
Die polarisierende Wirkung der BGE – Idee
Wie das BGE bei mir zu wirken begann
Vom Sollen zum Wollen
Was ist Arbeit?
Das Solidarische Bürgergeld nach Dieter Althaus
Das BGE nach Götz Werner
Das BGE nach Martin Exner (Exner-Modell)
Wie kann das BGE möglichst reibungslos in das bisherige System der BRD implementiert werden?
Pilotprojekt eines sozialen Umbaus im Überblick
Wie soll mit beitragsfinanzierten Sozialleistungen verfahren werden?
Diagramm des Exner- Modells
AUSBLICK - Auswirkungen des BGE
Weitere visionäre gesellschaftspolitische Ansätze und Finanzierungsmodelle
Monetative - Alle Macht dem Volk statt den Banken
Das Lebensgeld der Joytopia Akademie
Dezentralisierung des Geldsystems durch Blockchain und Kryptowährungen?
Visionen - Eine Gesellschaft ohne Geld?
Der Autor
Schlusswort
Literatur- und Quellenverzeichnis
Vorwort
Ist das Grundeinkommen ein "Irrweg", weil es "Solidaritätsgedanke und Leistungsprinzip außer Kraft setzt", wie die ehemalige Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) einst behauptete?
Oder ist es eine zukunftsweisende Lösung für die digitalisierte Welt, in der ein Großteil der bisherigen Lohnarbeit zunehmend von Robotern erledigt wird?
Während der anfänglichen Automatisierungswelle im Zuge des Wirtschaftswunders der 1960-er Jahre und den folgenden Jahrzehnten der weiteren Technisierung, ging die Angst um, dass Fabriken bald vollkommen ohne menschliche Arbeitskraft auskommen würden. Tatsächlich verschwanden auch viele Jobs, nicht nur in Fabriken, und mit ihnen die Mitarbeiter*innen, die entweder umgeschult, frühverrentet oder arbeitslos wurden. Diese sozialverträglichen Maßnahmen sowie die Reduzierung der Wochenarbeitszeit trug damals dazu bei, dass diese Veränderungen für die Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt stattfinden konnten. Denn der Wohlstand nahm insgesamt zu und vom Erwerbseinkommen konnte man - bis auf ganz wenige Ausnahmen - noch gut leben.
Die Berufsbilder verändern sich seit dieser Zeit in rasanter Geschwindigkeit. Die Veränderungen am Arbeitsmarkt durch die Digitalisierung führen dazu, dass eine breite Masse von ihrer Erwerbsarbeit nicht mehr leben kann und die Armut insgesamt zunimmt. Die Hartz-IV-Gesetzgebung (Arbeitslosengeld II) mit stärkeren Sanktionen hat diesen Prozess zusätzlich verschärft.
Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) mag daher auf den ersten Blick als Ausweg zur Existenzsicherung entzücken.
Dieses Buch beschäftigt sich mit dem Für und Wider dieser Idee sowie mit flankierenden Lösungsvorschlägen.
Ist die Zeit reif dafür oder kann die Gesellschaft so eine tiefgreifende Veränderung noch nicht denken?
Sind die Ängste und das Festhalten am Gewohnten noch stärker als der Mut zu Neuem?
Tatsache ist, dass Umfragen zufolge über die Hälfte der deutschen Bevölkerung ein BGE befürwortet.
Aber in welcher Form könnte es umgesetzt werden?
Im Gegensatz zu vielen Konzepten mit vagen Aussagen der Autoren zur Höhe sowie Finanzierung, geht dieses Buch mit einem ganzheitlichen Blick sehr tiefgreifend, konkret auf die praktische, lösungsorientierte Umsetzung ein und zeigt auch detaillierte Wege zum schrittweisen, sanften Einstieg in ein neues, sozial ausgewogenes System.
Es soll damit auch einen Beitrag zur Versöhnung zwischen Befürwortern und Gegnern bzw. Kritikern leisten.
Wie wollen wir in Zukunft leben?
Dies ist die entscheidende Frage, welche die Befürworter des BGE antreibt, sich für diese Idee stark zu machen.
Im Gegensatz dazu ist die Frage: „Wie werden wir zukünftig leben?“, gekennzeichnet von einem sorgenvollen Blick, der suggeriert, man sei hilflos ausgeliefert und müsse tatenlos zusehen, was sich verändert.
Das Engagement für ein BGE erwächst hingegen aus einem aktiven Gestaltungswillen hin zu einer lebens- und liebenswerteren Gesellschaft des kooperativen Miteinanders. Es resultiert aus den eigenen Lebenserfahrungen mit dem bestehenden verkrusteten System von Kampf und Konkurrenz sowie der Erkenntnis, dass die von der herrschenden Politik vertretenen alten Instrumente nicht mehr zeitgemäß sind und insgesamt wirkungslos in eine Sackgasse führen.
Dies spüren immer mehr Menschen, macht den Beteiligten dieser real werdenden Vision Mut und gibt ihnen die Kraft, das BGE zeitnah Wirklichkeit werden zu lassen.
Ich beobachte die Entwicklung um das BGE sowie die Reaktionen von Politik und Gesellschaft darauf seit dem Jahr 2000 und finde in diesem Zusammenhang das Zitat von Mahatma Gandhi sehr passend:
„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“
Sobald die kritische Masse davon überzeugt ist, dass das BGE ein Gewinn für Alle darstellt, wird es Realität.
In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
Wollen wir wirklich so weiter machen, wie bisher?
Wollen wir uns weiterhin fremdbestimmen lassen und den auferlegten Zwängen unterordnen?
Wollen wir in ständig zunehmender Bürokratie ersticken und uns als Bittsteller gängeln lassen?
Wollen wir uns gegenseitig ausgrenzen durch Schuldzuweisungen zwischen Jung und Alt, Arbeitslosen, Arbeitnehmern, Beamten und Selbstständigen, Arm und Reich etc.?
Wollen wir weiterhin Geiz, Neid, Kampf und Konkurrenz in unserer Gesellschaft?
Wollen wir einen Wertschöpfungsausfall und Krankheitskosten von rund 200 Mrd. Euro jährlich wegen berufsbedingter psychischer und physischer Überforderung auf Dauer zulassen?
Wollen wir weiter hinnehmen, dass prekäre Arbeitsverhältnisse zunehmen und man von Erwerbsarbeit nicht mehr leben kann?
Wollen wir, dass die Masse der Menschen zunehmend verarmt?
Wollen wir weiter unnötig Resourcen verschwenden und riesige Müllberge produzieren?
Oder wollen wir ein neues, würdevolles, gesellschaftliches Miteinander entwickeln, das jedem Menschen eine menschenwürdige, finanzielle Existenzsicherung zubilligt, die auch gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht?
Wollen wir ein selbstbestimmtes Leben fördern, bei dem jeder Mensch die freie Wahl hat, nach seinen Bedürfnissen zu leben und dafür auch die eigene Verantwortung übernimmt?
Wollen wir unsere Lebensqualität durch Entschleunigung verbessern?
Wollen wir „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ fördern und damit gleichzeitig eine bessere Basis für soziale Gerechtigkeit sowie gesellschaftlichen Frieden schaffen?
Wollen wir endlich bisher unbezahlte wichtige gesellschaftliche Arbeit finanziell honorieren?
Wollen wir generell sinnhafte Tätigkeiten fördern, die den elementaren Bedürfnissen der Menschen entsprechen und damit der Gemeinschaft dienen?
Wollen wir uns wieder die Entscheidungsgewalt und Wahlfreiheit darüber zurückholen, was und wieviel wir arbeiten?
Wollen wir das Individuum und die Familie als demokratische Keimzellen wieder in den politischen Mittelpunkt unserer Gesellschaft rücken?
Wollen wir nachhaltigen Bürokratieabbau und die hierdurch entstehenden Einsparpotenziale und zeitlichen Freiräume für sinnhafte, gesellschaftlich notwendige Arbeiten nutzen?
Wer die bisherigen Strukturen beibehalten und nach dem Motto des Altkanzlers Kohl1 „Die Karawane zieht weiter“ verfahren möchte, weil er glaubt, mit dem Drehen von ein paar Stellschrauben sowie weiteren unzähligen Reparatur- und Kosmetikarbeiten, sind alle Probleme gelöst, der legt dieses Buch am besten weg.
Denn für diese Menschen bleibt das BGE in ihrer eigenen Lebenswelt eine Utopie und ist daher nicht vorstellbar.
Nur was man sich vorstellen kann, lässt sich auch denken. Und was sich denken lässt, führt zu Wegen der Umsetzung. Wer in diesem Sinne sein Blickfeld erweitern will, die grundsätzliche Notwendigkeit eines Strukturwandels erkennt und hierfür das BGE zumindest als eines von mehreren Instrumenten für möglich und sinnvoll hält, dem empfehle ich weiterzulesen, sich Inspirationen zu diesem spannenden Thema zu holen, um möglicherweise neue Erkenntnisse gewinnen zu können.
Dieses Buch beleuchtet das Thema von vielen Seiten. Dabei werden auch Pro- und Kontra-Argumente gegeneinander abgewogen, um sich ein eigenes Meinungsbild verschaffen zu können. Denn es geht aus meiner Sicht nicht darum, Menschen zu überreden oder sie gar vor vollendete Tatsachen zu stellen. Dies würde einem konsensfähigen Entwicklungsprozess eher schaden.
Da meine Entscheidung dafür seit langem getroffen und durch zahlreiche Diskussionen gefestigt wurde, freue ich mich natürlich über jeden weiteren Menschen, den das BGE begeistert und der sich deshalb für dessen Einführung mit Herzblut engagiert.
Ich akzeptiere allerdings gleichzeitig alle Menschen, die sich dagegen entscheiden. Denn das ist aus deren Sicht ihr gutes Recht.
Warum ist ein Wandel der sozialen Sicherung erforderlich?
„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
(Albert Einstein)
Die auf Initiative von Bismarck2 beruhende deutsche Sozialversicherung galt lange Zeit als fortschrittlich und Errungenschaft zur Sicherung des innerstaatlichen Friedens. Sie war vor rund 150 Jahren eine Antwort auf die zunehmende Industrialisierung, die gesellschaftlich einen Wandel von der Eigenversorgung (Landwirtschaft) zur Fremdversorgung (Konsum) vollzog.
Es begann 1845 mit einem Gesetz, das die Gründung von Krankenkassen genehmigte. Weitere Gesetze folgten nach der kaiserlichen Botschaft 1881 zur finanziellen Absicherung der Arbeiter gegen Krankheit, Unfall, Invalidität und Alter.
1911 wurde die Rentenversicherung dann auf den Personenkreis der Angestellten ausgedehnt. 1995 wurde die Sozialversicherung zusätzlich um die Pflegeversicherung erweitert.
Sicherlich gab es zur Gründungszeit zahlreiche Skeptiker bzw. Gegner und auch heute noch Menschen, die diese einschneidende Reform im Rahmen der Industrialisierung für unnötig oder sogar als Unfug betrachten. Insofern stehen wir heute mit dem BGE vor der gleichen Situation wie damals. Allerdings können wir nun eine politische Volksdebatte führen und das Thema von der Basis in die politische Ebene bringen. Damit bekommt es einen ganz anderen Stellenwert.
In der Nachbetrachtung hat uns dieser wichtige Strukturwandel durch Einführung der Sozialversicherung über viele Jahrzehnte hinweg gedient und den sozialen Frieden erhalten bzw. sogar gestärkt.
Doch die Verhältnisse haben sich geändert. Dieser berühmte Generationenvertrag zwischen Beitragszahlern und Leistungsbeziehern funktioniert zunehmend schlechter, weil die Sozialversicherung durch das bestehende Wirtschafts-, Finanz- und Steuersystem in immer stärkere finanzielle Schwierigkeiten gerät. Trotzdem versucht die etablierte Politik weiterhin innerhalb dieses Systems die Probleme zu lösen, wodurch sie entstanden sind. Unzählige Reformen mit immer neuen bürokratisch verworrenen Regelungen sind ein Beleg dafür.
Die hochgepriesene soziale Marktwirtschaft steht vor einem Trümmerhaufen, weil sie mittlerweile mehr Verlierer als Gewinner hinterlässt, was sich entsprechend bei den Sozialversicherungen zeigt.
In der Öffentlichkeit argumentieren die politisch Verantwortlichen fortwährend wider besseren Wissens, dass das beitragsfinanzierte System stabil sei. Tatsächlich wird der Bundeszuschuss, also der Steueranteil an den Einnahmen der Sozialversicherung immer höher. 91 Milliarden Euro waren es im Jahr 2017.3 Mit weiteren 20 Milliarden Euro in einem Nebenhaushalt der BRD sollen die Lohnnebenkosten stabil gehalten und die zusätzlichen Schulden vernebelt werden. Damit wird das Versicherungsprinzip und die vermeintliche Unabhängigkeit vom Staatshaushalt durch selbstständige Rentenversicherungsträger ad absurdum geführt.
Es gibt einige Ursachen, warum die negativen Auswirkungen der sozialen Sicherung heute so fatal sind. So führte beispielsweise die deutsche Wiedervereinigung zu einer großen Belastung, weil Ostdeutsche Renten erhalten, die nach dem Niveau der westlichen Einkommen bemessen wurden und deren jährliche Steigerungen seit 1990 außerdem höher ausfallen, als im Westen. Diesen hohen Renten (gemessen am damaligen niedrigen DDR-Lohnniveau) stehen aber nur die geringen Beiträge aus dem Osten gegenüber, die aus der dort vorherrschenden hohen Arbeitslosigkeit und den im Durchschnitt niedrigeren Löhnen resultieren.
Die Hauptursache liegt allerdings in der Altersstruktur unserer Gesellschaft. Während 1960 noch 6 Beitragszahler einen Rentner bezahlt haben, wird dies heute von 2 Erwerbstätigen geleistet. Aufgrund der höheren Lebenserwartung werden heutige Renten im Durchschnitt 10 bis 15 Jahre länger gezahlt, als noch vor 50 Jahren.4 Hinzu kommt, dass durch das fallende Lohnniveau im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarländern auch das Beitragsniveau sinkt.
Die aktuelle Diskussion um die erneute Anhebung der Altersgrenze auf das 69. oder 70. Lebensjahr beweist, wie wackelig die ganze Struktur ist.
Das System der gesetzlichen Rentenversicherung funktioniert nach dem Umlageprinzip, d.h. die Beiträge werden nicht angelegt (wenn man von der geringen Mindestreserve absieht), sondern direkt für die Zahlung der laufenden Renten verwendet. Die Folgen sind bekannt. Jede Rentenerhöhung muss vom derzeitigen Beitragszahler (je zur Hälfte Arbeitgeber und Arbeitnehmer) über höhere Beiträge oder ersatzweise vom Steuerzahler finanziert werden. Die vergangenen Bundesregierungen haben versucht, über viele Eingriffe und eine komplizierte Rentenformel zwischen Beitragszahlern und Rentnern zu vermitteln. Das Problem wird dadurch aber nicht behoben, sondern nur verschleiert bzw. verlagert. Insbesondere die Instabilität durch Konjunkturschwankungen ist damit nicht beseitigt. Bei schlechter Konjunktur ist das System besonders anfällig, weil durch höhere Arbeitslosigkeit Beiträge ausfallen, die nur über Beitragserhöhungen für die verbleibenden Erwerbstätigen aufgefangen werden können, und den Faktor Arbeit zusätzlich verteuern, mit der Folge von weiterer Arbeitslosigkeit. Denn Unternehmer*innen sparen in erste Linie an den Personalkosten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Alternative einer höheren Staatsverschuldung ist im Grunde das nicht ausgesprochene Eingeständnis, dass das Versicherungsprinzip nicht mehr funktioniert. Es schränkt den Staat zusätzlich in seiner Handlungsfähigkeit ein und trägt somit auch nicht zur wirklichen Lösung bei.
Nach einer OECD-Studie bekommt ein Durchschnittsverdiener in Deutschland nach 45 Beitragsjahren aus der gesetzlichen Rentenversicherung 43 % seines Bruttoeinkommens. Im Durchschnitt aller OECD-Länder sind es mit 71,9 Prozent bedeutend mehr. Die Zahl der Grundsicherungsempfänger*innen (Renten auf Hartz IV-Niveau) hat sich zwischen 2005 und 2017 auf über eine Million Menschen verdoppelt!5
Das bestehende Sozialversicherungssystem ist nicht nur anfällig für Konjunkturschwankungen. Es begünstigt außerdem Arbeitgeber, die nur wenig Personal benötigen und dadurch höhere Gewinne erzielen können. Darüber hinaus vertraut es darauf und ist davon abhängig, dass eine große Mehrheit der Arbeitgeber sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anbietet. Da in der Bundesrepublik der Kostenfaktor Arbeit durch Sozialversicherungsbeiträge und Steuern teuer geworden ist, weichen viele Arbeitgeber*innen auf sozialversicherungsfreie geringfügige oder scheinselbstständige Beschäftigungsverhältnisse aus. Hinzu kommt, dass in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt das klassische sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnis langfristig wahrscheinlich nicht mehr die Regel sein wird, sondern eher die Ausnahme. Viele Arbeitsangebote über Internet sind auf selbstständiger Basis (z.B. Projektarbeiten, network marketing etc.)
Die durch die vergangenen Bundesregierungen geförderten Leiharbeitsverhältnisse (Zeitarbeit) mit wesentlich niedrigerem Lohnniveau und damit einhergehenden geringeren Beitragseinnahmen, wirken sich ebenfalls negativ auf die Stabilität der Sozialversicherung aus. In einer Wirtschaftsflaute zahlen die Arbeitnehmer*innen, die noch einen Arbeitsplatz haben, sowie die Arbeitgeber *innen, die trotz Konjunkturschwäche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze aufrecht erhalten wollen, die Zeche durch höhere Beiträge. Bei schlechtem Absatz von Waren werden nämlich die hohen Personalkosten, die den größten Ausgabenanteil eines Unternehmens ausmachen, über Arbeitsplatzabbau reduziert, was den Teufelskreis der steigenden Beiträge in der Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherung weiter verschärft. Immer weniger Zahler stehen dadurch immer mehr Leistungsempfängern gegenüber. Ein notwendiges antizyklisches Gegensteuern durch den Staat wird dadurch verhindert, es sei denn er hält die Beiträge über eine höhere Staatsverschuldung stabil. Dieser Trend wird immer stärker.
Hinzu kommt, dass im Laufe der Jahre neben der existenziellen Absicherung immer mehr Lebensrisiken und sozialpolitische Aspekte in das staatliche Sozialversicherungssystem hineingepackt wurden, wie beispielsweise die Anrechnung von Erziehungszeiten, Mütterrente, Rehabilitation, Ausbildungs- und Familienförderung, Pflege etc.
Arbeitslose in Deutschland sind im EU-weiten Vergleich am stärksten von Armut bedroht. Wie das EU-Statistikamt Eurostat berichtet, lag das Armutsrisiko unter Arbeitslosen hierzulande im Jahr 2016 bei 70,8 Prozent und damit so hoch wie in keinem anderen Land der Europäischen Union. In der gesamten EU betrug das Armutsrisiko für Arbeitslose zwischen 16 und 64 Jahren 48,7 Prozent. Im Jahr 2006 waren es noch 41,5 Prozent. Das ist ein Armutszeugnis für unser gesamtes Sozialsystem und beweist letztlich, wie uneffektiv es arbeitet.
Nun gibt es besonders Schlaue (insbesondere aus der SPD und bei den Grünen), die sagen, dass man alle (beispielsweise auch Beamte und Freiberufler) in die Sozialversicherung einbinden muss, um mehr Beiträge zu erzielen. Abgesehen davon, dass der neue Personenkreis dann auch Ansprüche aus dem System hat, wird das Faktum des hohen Kostenfaktors Arbeit und die Auswirkungen bei Wirtschaftsschwankungen dadurch nicht beseitigt, allenfalls geringfügig gemildert. Die Probleme werden dadurch nicht gelöst, sondern das Elend und die Altersarmut nur auf eine breitere Ebene verlagert. Das soll die Lösung sein? So etwas kann man nicht ernst nehmen! Außerdem wird der bürokratische Aufwand wegen der dadurch zusätzlich aufgeblähten und noch unbeweglicheren Mammutbehörden enorm erhöht. Ich halte es darüber hinaus nicht mehr für zeitgemäß, den ohnehin bestehenden hohen Zwang in unserer Gesellschaft noch weiter auszubauen. Wir sollten vielmehr die persönliche Freiheit und Eigenverantwortung stärken, bei der jede*r über eine gesicherte Grundversorgung hinaus freiwillig entscheiden kann, wie er/sie sich für die Wechselfälle des Lebens versichern möchte.
Sinnvoll wäre es hingegen, die Versorgungswerke für Ärzte, Anwälte etc. in die gesetzliche Rentenversicherung zu integrieren, um sie allen als Option zu eröffnen.
Unbestritten ist, dass auch die Pensionslasten gigantisch steigen. Statt Rücklagen zu bilden, wie dies in privaten Firmen für die Betriebsrenten selbstverständlich ist, geben die öffentlichen Arbeitgeber das Geld lieber für Prestigeobjekte aus, die Milliarden verschlingen und – falls sie jemals fertiggestellt werden – ein Vielfaches des ursprünglichen Ansatzes kosten. In der öffentlichen Diskussion verweisen einige Politiker*innen dann auf die Höhe der Pensionen als Ursache, um die wahren Hintergründe vor der Bevölkerung zu verschleiern. Das ist ein ziemlich verwerfliches Verhalten.
Nicht nur vor diesen genannten Hintergründen hat sich die Diskussion zur Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) in den letzten Jahren verstärkt.
Diese Idee ist nicht neu. Bereits im Jahr 1526 spricht sich Juan Luis Vives6 für eine Grundsicherung für alle, nicht nur für die Armen, aus. Milton Friedman7 greift in dem Zusammenhang die negative Einkommensteuer in den 1960er Jahren auf und stellt sie in den USA durch Modellversuche ernsthaft zur politischen Diskussion.
Auch der Psychologe und Sozialphilosoph Erich Fromm8 hat sich bereits 1955 in seinem Buch „Wege aus einer kranken Gesellschaft“ sowie in seinem Aufsatz „Psychologische Aspekte zur Frage eines garantierten Einkommens für alle“ für eine Art unbedingtes Grundeinkommen ausgesprochen. Er begründete dieses u.a. mit dem Recht, aus persönlichen Gründen eine Arbeit auszuschlagen, ohne Hunger oder soziale Ächtung zu erleiden.
Mehr als 50. 000 Bürger*innen haben die von Susanne Wiest9 initiierte Petition an den Deutschen Bundestag „Reformvorschläge in der Sozialversicherung – Bedingungsloses Grundeinkommen“ vom 10. Dezember 2008 elektronisch unterzeichnet. Die parlamentarische Beratung ist nach langer Verschleppung mittlerweile abgeschlossen. Es wurde zwar in Aussicht gestellt, in Arbeitsgruppen weitere Erkenntnisse zu sammeln. Allerdings hat man bis heute nichts mehr davon gehört.
Aber die Befürworter*innen lassen sich nicht unterkriegen. Sie wollen das spannende Thema auf die parlamentarische Ebene bringen. Susanne Wiest lebte auf dem Land in Vorpommern. Es ist geprägt von kleinen Dörfern, riesengroßen Feldern und einer sehr hohen Erwerbsarbeitslosigkeit. Wo fruher ein ganzes Dorf in der Landwirtschaft tätig war, drehen heute riesige Traktoren ihre Runden, oft im Auftrag von Firmen, die gar nicht aus der Region kommen. GPS-gesteuert übernehmen sie Aussaat und Ernte – fast ohne Menschen. Diese Dörfer sind ohne Erwerbsarbeit, Menschen ohne Einkommen, oft wie gelähmt und gefangen in einem komplizierten Behörden- und Antragswirrwarr. Dies unmittelbar vor ihren Augen, machte Susanne Wiest die Schizophrenie deutlich, die sich in der Aussage etablierter Politiker *innen „Sozial ist, was Arbeit schafft“ widerspiegelt. Diese so genannten Volksvertreter*innen begrüßen und fördern einerseits den technischen sowie digitalen Fortschritt, ignorieren jedoch andererseits den dadurch bedingten Rückgang von qualifizierter Erwerbsarbeit. Mit diesen weltfremden Parolen und alten Rezepten wollen sie die Probleme der heutigen Zeit lösen, wohlwissend, dass dies nicht mehr möglich ist.
Susanne Wiest hat daraus entsprechende Konsequenzen gezogen, trat 2013 bei den Piraten an und hat sich danach als Bundesvorsitzende der neu gegründeten Partei „Bündnis Grundeinkommen“ bei der Bundestagswahl 2017 zur Wahl gestellt. Nachdem sie dort jedoch keine Erfolge sah, wechselte sie Anfang 2018 zur SPD, um dort erneut ihr Glück zu versuchen.
Ich war bei der Sammlung der Unterstützer-Unterschriften für das Bündnis dabei. Dieses Sammelverfahren ist die hohe Hürde nach dem Bundeswahlgesetz, die von einer nicht etablierten Partei fordert, dass ihre Landesliste von 1 vom Tausend der zur letzten Bundestagswahl Wahlberechtigten des jeweiligen Bundeslandes, höchstens von 2.000 Wahlberechtigten, unterzeichnet sein muss. Die für jedes einzelne Bundesland erforderlichen Unterschriften waren innerhalb von 2 bis 3 Monaten rasch zusammengekommen. Eine enorme Leistung, wenn man bedenkt, dass die Bundespartei erst Ende September 2016 gegründet wurde und einige Landesverbände sogar danach in 2017 hinzukamen.
Die Idee des BGE hat durch den Kollaps der Finanzmärkte in 2008 und seine Folgen inzwischen ungeahnte Aktualität hinzugewonnen. Die Rettungsversuche für Unternehmen wie Opel oder Arcandor sowie die Zahlung staatlicher Milliardenzuschüsse zur Standorterhaltung, wie bei Nokia, wären im Zusammenhang mit einem BGE wohl gänzlich anders verlaufen. Das Schicksal der Unternehmen würde dann unter rein wirtschaftlichen Aspekten betrachtet, nicht mit dem starren Blick auf die Rettung von Einkommensplätzen für die Beschäftigten, die früher oder später trotz dieser teuren Maßnahmen oftmals dennoch verloren sind.
Das BGE verwandelt einerseits die Erwerbsarbeit, stärkt die Arbeitnehmerposition, durch eine stärkere Trennung zwischen Arbeit und Einkommen und macht andererseits spezielle Sozialleistungen mit hohem Verwaltungsaufwand (wie die sozialversicherungspflichtige Altersrente oder Hartz IV) entbehrlicher. Es bietet eine Existenzsicherung für alle ohne Gegenleistungen und schafft gleichzeitig einen Leistungsanreiz für selbst gewählte Lohnarbeit, weil es keiner Kürzung unterliegt.
In erster Linie unterstützt es einen umfassenden Wandel der Gesellschaft. Bei dieser philosophischen Idee geht es um Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit und damit letztlich um die Würde des Menschen in einer Gesellschaft, in der die Symbiose aus Kapitalismus und Demokratie nicht mehr zum Wohle aller Bürger*innen zu funktionieren scheint. Menschenwürde ist das auszeichnende Merkmal des Menschen im Unterschied zu anderen Lebewesen. In der mittelalterlichen Tradition wurde sie aus der Gottebenbildlichkeit abgeleitet.
Vor allem die Einführung von „Hartz IV“ veranlasste viele Menschen zum Nachdenken über die Menschenwürde und die Zukunft des Sozialstaates.
Stimmen aus Wirtschaft und Wissenschaft
Der Erfurter Ökonom Gerhard Wegner10 glaubt, auf der Basis der empirischen Arbeitsmarktforschung Ergebnisse vorwegnehmen zu können.
„Die besten Chancen auf eine neue Stelle haben Menschen, die sich aus einem Job heraus bewerben. Je länger sie draußen sind, umso schwieriger wird es,“ ist seine These. Das Bedürfnis, zeitweise aus dem Beruf auszuscheiden, lasse sich besser beim Arbeitgeber organisieren - etwa durch Zeitwertkonten. „Wenn man das gesellschaftlich verwaltet, entstünde eine ungeheuerliche Bürokratie.“
In den Denklaboren des Silicon Valleys und bei ihren Geldgebern dagegen ist viel Platz für utopische Vorstellungen. Der Investor und Netscape-Gründer Marc Andreessen nannte das BGE im „New York“-Magazin „eine sehr interessante Idee“.
Sam Altman vom Gründerzentrum Y Combinator sieht die Einführung sogar als „offensichtliche Schlussfolgerung“.
SAP-Vorstandsmitglied Bernd Leukert sagte der F.A.Z.:
„Davon würden langfristig auch diejenigen profitieren, die weiterhin höhere Gehälter beziehen. Wenn wir an dieser Stelle nichts tun, droht die Gesellschaft auseinanderzubrechen.“
Auch der MIT-Professor Erik Brynjolfsson11, Ko-Autor des Bestsellers „The Second Machine Age“, befürwortet ein Grundeinkommen. Die Einkommen entkoppelten sich von der Produktivität der Individuen. „Es ist aber nicht so, dass wir keine Wahl hätten. Wir haben die Möglichkeit, wieder Systeme zu schaffen, die den Wohlstand auf eine große Zahl von Menschen verteilen“, sagte er in Davos.
Es wirkt so, als schüfen sich die Treiber der Digitalisierung so ein ruhigeres Gemüt. Andererseits ist jedes berechtigte Interesse für ein BGE wertzuschätzen. Ich empfinde es daher nicht als verwerflich, wenn Wirtschaftsführer für ein Einkommen sorgen wollen, um weiterhin Abnehmer für ihre Produkte zu haben, wenn Erwerbsarbeitsplätze immer weniger werden.