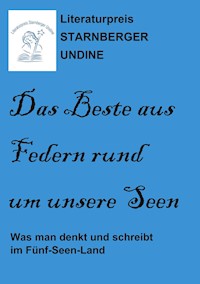
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch fasst die besten Beiträge zur Literaturpreisausschreibung Starnberger Undine, welcher seit mehreren Jahren von der Bücherjolle gestiftet wird. Erstmals kommt als Modifikation das Angebot an die Teilnehmer hinzu, Ihren Beitrag in einem Book on Demand wiederzufinden. In diesem Buch findet sich also eine Sammlung vieler kleiner Geschichten, die sich mit dem diesjährigen Motto "Glück 2022" beschäftigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Stifter
Vorbemerkung
Grußworte
Herrn Landrat Stefan Frey
Grußwort von Herrn Bürgermeister Patrick Janik
Grußwort von Herrn Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Andreas Frühschütz
Jury
1. Preisträger 2022
Susanne Leontine Schmidt – Das Glück des Herrn Schmelcher
2. Preisträger 2022
Joachim Meissl – Rennradeln
3. Preisträger 2022
Barbara Müller-Funk – Curriculum Vitae
Jugendpreisträger 2022
Emma von Staden – Das große Glück
Klassenaufsätze 2022
S13A – Staatliche Fachoberschule Starnberg
8a Mittelschule Starnberg
Best of Jury
Emilia Gottwald – Ein Tropfen Glück
Alexander Horvath – Che barba!
Christine Johne – Thujen-Feuer
Tina Blome – Sonst nichts
Angela Dylakiewicz – Der Puppenmann
Claudia Sack – Mailand
Lucie Jückstock – Glückskind
Nicole Raabe – Der Sprung
Peter Amann
Irmtraut Helm – Glück im Unglück
Marina Strothmann – Löwenzahn für Iphigenie
Hedwig Wasmer – Glück!
Christopher von Gruben – Ein Versuch an den Sommer
Melsene Schramm – Muttertag ist immer
Jewel Visochkova – Silikon-Dino
Susanne Nunn – Glück gehabt
Beiträge aus den letzten Jahren
Simon Weinhart - Mario und Luigi
Susanne Leontine Schmidt - Als ich mein letztes Hemd verkaufen wollte
Karin Schreiber - Der Hund
Kaan Günal - Von blutroten Schlachten (z)um Salatgrün
Fabian Müller – Atmosphären
Vanessa Lange - Tartufo
Patricia Czezior - Himmel und Hölle
Roland Bise, Pfr. i. R. - Osterlachen mitten im Sommer, bei großer Hitze?!
Leni Gwinner - Haus am See
Julia Behr - Das Ziel ist das Ziel
Stefan Reuter - Im Kaufhaus
Bernadette Mayr - Schön und trostlos
Annegret Liegmann - Föhrliebt, verlobt, verstarnbergert
Danksagungen
Dank an Frau Dr. Ute Eiling-Hütig, MdL
Dank an Al Gallo Nero
Dank an die Starnberger Eiswerkstatt
Dank an ELA
Dank an das Gasthaus „Zur Sonne“ & Metzgerei Scholler
Dank an Frau Indi Herbst, Galeristin und Fotografin – am Kirchplatz in Starnberg
Dank an FRERICKS Feine Goldschmiedekunst & FRERICKS Feine Edelsteine
Schlusswort
Humoristisches Finale
Die Stifter
Von Links aus:
Dr. E. Quester, Verlag Starnberger Hefte
T. Bartelmann, Geschäftsführerin BÜCHERJOLLE
E. Lakopoulos, Geschäftsführerin Restaurant ELA am Kirchplatz
W. Bartelmann, BÜCHERJOLLE
Vorbemerkung
Die reizende Mädchengestalt „Undine“ aus de la Motte Fouqués gleichnamiger Novelle lieh dem Literaturpreis „STARNBERGER UNDINE“ den Namen.
Initiiert wurde er von Wolfgang Bartelmann, Geschäftsführer der BÜCHERJOLLE, wobei ihn Dr. Ernst Quester, Herausgeber der „Starnberger Hefte“, unterstützte.
Zu dem Wettbewerb aufgerufen waren literaturbegeisterte Mitbürgerinnen und Mitbürger, welche Starnberg „mit einem Tagesritt“ erreichen. Das ist die humoristische Umschreibung für alle Teilnehmer aus dem Fünf-Seen-Land.
Einen besonderen Anreiz sollte bei der diesjährigen Ausschreibung dieses Buch bieten.
Um die Kontinuität dieses Literaturpreises darzustellen, befinden sich im Buch neben den Preisträgern 2022 und den „Best of Jury“-Beiträgen auch gute Beiträge aus den vergangenen Jahren.
Wolfgang Bartelmann, Dr. Ernst Quester
Starnberg, im Winter 2022
Grußworte
Herrn Landrat Stefan Frey
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser,
Gedichte, Geschichten, Erzählungen und Bücher begleiten uns ein Leben lang und wenn ich ehrlich bin, könnte ich mir ein Leben ohne sie gar nicht vorstellen. Schon für Kinder sind Vorlesestunden ganz besondere, oft unvergessliche Momente. Ich persönlich schätze das Privileg des Lesens immer wieder ganz bewusst, gibt es doch keine bessere Möglichkeit, die eigene Gedankenwelt zu erweitern, die Menschen kraft der durch Bücher verfeinerten Empathie besser zu verstehen, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und auch gesellschaftliche und politische Zusammenhänge zu erkennen.
Gerade in einer Welt, in der wir umgeben sind von flackernden Lichtern und Bildschirmen, in der man in den sozialen Medien geradezu überflutet wird, bieten gedruckte Werke, Bücher oder Hefte einen entspannenden Ausgleich für all die uns umgebenden Reize.
Die Förderung des Schreibens durch den Literaturpreis STARNBERGER UNDINE ist eine großartige Sache. Den Initiatoren gilt mein Dank und meine Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz um das geschriebene Wort. Den Schreiberinnen und Schreibern danke ich, dass Sie uns an ihren glücklichen Momenten und Erlebnissen teilhaben lassen.
Ihr
Stefan Frey
Landrat
Starnberg, Winter 2022
Grußwort von Herrn Bürgermeister Patrick Janik
Liebe Leserinnen und Leser,
es freut mich sehr, dass im vorliegenden Sammelband die besten Beiträge von Nachwuchsautorinnen und -autoren aus dem Fünf-Seen-Land ihren verdienten Platz finden. Die gewähren uns einen Einblick in ihre Lebens- und Gedankenwelten und stellen auch viele Bezüge zu Starnberg und der Region her. Danke an alle Autorinnen und Autoren für den Mut, sich ans professionelle Schreiben zu wagen. Damit sind vielleicht sogar die ersten Weichen gestellt, um eine Schriftstellerkarriere zu starten.
Mein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Ernst Quester von den Starnberger Heften“ und Herrn Wolfgang Bartelmann von der „Bücherjolle“. Sie sind als Initiatoren und Organisatoren der Starnberger Undine stets um die Kultur und Literatur unserer Region bemüht und die Herausgeber des Sammelbandes. Sie setzen sich sehr engagiert fürs Lesen, die Literatur sowie für Geschichten und Autoren aus Starnberg und dem Fünf-Seen-Land ein. Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine spannende Lektüre!
Ihr
Patrick Janik Erster Bürgermeister
Starnberg, Winter 2022
Grußwort von Herrn Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Andreas Frühschütz
Liebe Leserinnen und Leser,
die Beiträge dieser Ausgabe widmen sich in diesem Jahr dem Motto „Glück“. Was für ein schönes Leitmotiv für einen Band unterschiedlicher Autorinnen und Autoren. Garantiert es doch unbedingte Vielfalt - beinahe nichts ist so individuell wie das Glück!
Neben vielen persönlichen Glücksmomenten, wie sie wohl jeder von uns in sich trägt, empfinde ich es auch als großes Glück, dass wir mit dem gesellschaftlichen Engagement der Kreissparkasse in unserem Geschäftsgebiet viele tolle Aktionen und ein lebendiges Miteinander fördern können. Seit jeher unterstützen wir mit unseren vier Stiftungen und als Sparkasse selbst Projekte und Initiativen auch in Starnberg und im Fünf-Seen-Land und leisten so unseren Beitrag unter anderem für die kulturelle Vielfalt.
In diesem Sinne ist es ein wahres Glück, dass auch die Kreissparkasse den 4. Literaturpreis Starnberger Undine zu einem kleinen Teil unterstützen konnte! Allen Preisträgern herzliche Gratulation!!
Ihr Andreas Frühschütz Vorstandvorsitzender der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
Starnberg, Winter 2022
Jury
Bruno Habersetzer (hinten links)
Vanessa Lange (hinten rechts)
Karin Strauß (vorne links)
Petra Morsbach (vorne Mitte)
Ernst Quester (vorne rechts)
Im Anschluss an die Beiträge unserer Preisträger, hat jedes Mitglied der Jury noch bis zu vier Texte ausgesucht, welche ihm oder ihr besonders gefallen.
1. Preisträger 2022
Susanne Leontine Schmidt – Das Glück des Herrn Schmelcher
Als letztes ziehe ich meine alte Malschürze aus der von einer Staubschicht bedeckten Umzugskiste, und ich beschließe, sie als einziges Stück aus dem ganzen Sammelsurium, das da jetzt vor meinen Füßen liegt, zu behalten. Doch bevor ich sie in die Waschmaschine stopfe, untersuche ich noch die beiden Taschen und ziehe ein paar Bonbonpapierchen, zerknüllte Taschentücher und einen alten Kassenzettel heraus. Ich entfalte ihn – nie kann ich irgendeinen Zettel einfach wegwerfen, ohne zu lesen, was draufsteht.
Die Schrift ist kaum mehr zu erkennen. „Nah und Gut“ kann ich noch entziffern ‒ das war der kleine Dorfladen gegenüber von unserem früheren Haus gewesen ‒ und zwei der Posten, die darunterstehen: weiße Gelstifte, die der Inhaber damals extra für mich bestellt hatte, sowie eine Tüte Haribo „Happy Cubes“, die ich geliebt habe. Leider sind sie wieder vom Markt verschwunden, an mir kann es aber nicht gelegen haben, ich habe sie fleißig konsumiert.
Ich setze mich an meinen Küchentisch, streiche den Zettel glatt und denke an das kleine Geschäft und die mächtige Dorflinde daneben.
Wenn ich zurückblicke, so erscheint es mir, als hätte ich mein halbes Leben in dem Haus gegenüber verbracht. In den ersten Jahren hatte die Mutter des Inhabers noch gelebt. Der Sohn, alleinstehend und ungebunden, war aus der Stadt in das Dorf gekommen, um der Mutter nach dem Tod des Vaters mit dem kleinen Lebensmittelladen zu helfen.
Nur die hölzernen Brezeln am Dachfirst des Hauses erinnerten noch daran, dass der Vater Bäcker gewesen war und die Eheleute einmal eine Bäckerei geführt hatten. Jetzt leuchtete ein blau-gelbes Schild an der Hauswand: „Nah und Gut“ stand darauf, und darunter: Inhaber Gerhard Schmelcher. Semmelblond war der Sohn, mit Haaren wie kurz geschnittene Strohhalme, in den Vierzigern, schweigsam und schüchtern.
Wenn man ihn in ein Gespräch verwickelte, färbte sich sein flächiges Gesicht hellrosa, und seine wässerig blauen Augen hinter der Pilotenbrille blickten etwas unstet nach links und rechts. Dass viele Kunden bei ihm nur die Samstagsbrötchen oder mal ein Stück Butter kauften, erbitterte ihn. Nur die älteren Bauersfrauen aus dem Ort tätigten ihre Großeinkäufe in dem kleinen Laden. „Lebensmittel sind nichts wert“, bemerkte er einmal verächtlich, „kriegt man an jeder Ecke“. Dennoch ging er Tag für Tag unerschütterlich seinen Pflichten als Ladeninhaber und Sohn einer greisen Mutter nach. „Wir lieben Lebensmittel“, stand auf seinem schwarzen T-Shirt, das er unter dem weißen Arbeitskittel trug. Auch seine Mutter trug so ein T-Shirt unter ihrer grauen Strickjacke. Klein, gebeugt und ausgemergelt war sie schon damals gewesen, fast achtzig Jahre alt, doch ihre dunklen Augen funkelten energiegeladen hinter ihren Brillengläsern. Unermüdlich saß sie von früh bis spät an der Kasse, auf einem Bürostuhl mit einem dicken Schaumstoffkissen darauf, den schlichten grauen Pagenkopf über die Tastatur und die Waren auf dem Band gebeugt, und unterhielt die Kunden während des Kassierens mit Bemerkungen aller Art, vom Standardspruch „Hams alles?“ bis zu Bemerkungen über das Wetter – „es rengalet“ sagte sie, wenn es regnete, „es schneibalet“, wenn es schneite, und „Schatzale“ sagte sie zu jedem Kind. Später, als sie müder wurde und das Leben unübersichtlicher, fing sie zunehmend an, sich zu verrechnen und reagierte auf vorsichtige Korrekturen von Seiten der Kunden mit einem unwirschen „Hab i scho gsehn“. Die Währungsumstellung war dann endgültig zu viel für sie ‒ „Euro“ kam ihr nicht über die Lippen, „Taler“ sagte sie stattdessen. Von nun an musste ihr Sohn das Kassieren übernehmen. Sie stand jetzt immer hinter der Kasse bereit, um den Kunden beim Verstauen des Einkaufs zu helfen, eine Prozedur, während derer ihr jeder mehrmals versichern musste, dass er alles hätte. Müßiggang war ihre Sache nicht ‒ dem Sohn einer Bekannten, der ausgezehrt, zahnlos und abgerissen täglich hereinkam, um Futter für seine Katzen und für sich selbst Zigaretten und ein paar Chantrefläschchen zu kaufen, brummelte sie immer ein paar kaum verständliche Sätze hinterher, in denen Worte wie „Faulpelz“ oder „Tagedieb“ vorkamen. Jeden Morgen um fünf, begleitet vom minutenlangen Läuten der Kirchenglocken, ging das Licht an hinter den noch geschlossenen Ladenjalousien, und Mutter und Sohn bereiteten den Verkaufstag vor. Abends, nach Ladenschluss, sah man das Licht noch bis acht Uhr durch die Ritzen schimmern. Dann wurde es dunkel und still, und es gab es im ganzen Haus kein Anzeichen von Leben mehr, genauso wie das Haus am Wochenende stets in einen Dornröschenschlaf zu verfallen schien. Ein einziges Mal habe ich die beiden an einem Sonntagabend im Hochsommer auf der Bank neben ihrer Haustür sitzen sehen, ihn in blauer Badehose, die sich leuchtend abhob von seiner weißen Haut, sie daneben in ihrer Strickjacke und ihrem langen dunklen Rock. Von Zeit zu Zeit gingen sie gemeinsam außer Haus, eingehakt trippelte die winzige, gebückte Mutter neben ihrem Sohn zur Bürgermeisterwahl oder in feierliches Schwarz gekleidet die Straße hinauf zum Kirchhof, auf dem auch der Vater sein Grab hatte, wenn einer der alten Einwohner aus dem Dorf bestattet wurde. Die Verlässlichkeit, mit der der kleine Laden jeden Tag geöffnet wurde und viele Dinge des täglichen Lebens bereithielt, die gleichförmige Wiederkehr der Sprüche an der Kasse, die gedämpfte Schlagermusik im Hintergrund, sogar die gleichbleibend angegilbten Lauchstangen und die runzligen Zucchini in der Gemüseabteilung, all das vermittelte den Eindruck, dies würde nun für alle Zeiten so weitergehen. Doch der Wandel kam schneller als gedacht.
Zuerst verschwand plötzlich die einzige langjährige Angestellte des Ladens. Wie ich später erfuhr, hatte sie nach einem Streit wortlos ihre Schlüssel auf den Tisch gelegt und war gegangen. Auch sie war eine Institution gewesen – eine in der Wolle gefärbte Katholikin, die man bei jeder Prozession unter den in sich gekehrt das Ave Maria wiederholenden Bauersfrauen fand ‒ doch nicht intolerant und in ihrer Art so etwas wie eine weise Frau, die vieles wahrnahm, was andere übersahen. Ein paar Wochen später war eine neue Ladenhilfe da – eine unscheinbare, mittelalte Person mit einem etwas neckischen Pferdeschwanz, der sich von ihrem Hinterkopf ringelte wie der aufgelöste Rest von einem Wollknäuel. Still, eifrig, wortkarg, aber nicht unfreundlich versah sie ihre Arbeit, doch ehrlich gesagt, ich vermisste ihre glaubensstarke Vorgängerin. Dann fehlte die Mutter im Geschäft, erst nur alle paar Tage, doch schließlich war sie öfter ab- als anwesend. Der Mutter sei wieder schwindlig, erhielt man auf Fragen nach ihrem Befinden zur Auskunft. Die Schwester, die auch am Ort wohnte, musste am Samstag einspringen, und irgendwann gab es dann wieder eine Bestattung auf dem Kirchhof, zu der sich die halbe Einwohnerschaft des Ortes einfand. Die Mutter fand ihre Ruhestätte neben ihrem Ehemann, auf dem Friedhof neben der schönen, schlichten Barockkirche, von der aus man über den halben Ort und bei Föhnwetter bis in die Berge schauen kann.
Längere Zeit sah es nun so aus, als würde das Geschäft demnächst aufgegeben. Die Öffnungszeiten wurden reduziert, nur mit Hilfe der Schwester wurde der Betrieb aufrechterhalten. Der Ladeninhaber war urplötzlich im Krankenhaus, eine Herzoperation war nötig, danach war er für längere Zeit in Kur.
Am Anfang kamen an den Nachmittagen, an denen jetzt geschlossen war, noch vereinzelt Kunden und schauten ratlos auf die heruntergelassenen Jalousien. Mit der Zeit sprach es sich jedoch herum, und sie blieben weg, manche ganz und für immer. Einzig der Samstagvormittag war annähernd so betriebsam wie in früheren Zeiten. Jedoch ‒ der Ladeninhaber kehrte zurück und nahm sein Leben wieder auf. Etwas schmaler als früher, doch ansonsten unverändert saß er eines Tages wieder hinter seiner Kasse, und der Betrieb ging weiter, wenn auch ohne die Standardfrage an der Kasse. Mit seiner neuen Mitarbeiterin, die still und fleißig ihren Dienst versah, schulterte der verwaiste Sohn sein Joch erneut und hielt den kleinen Laden weiterhin am Leben. Man gewöhnte sich an neue Öffnungszeiten, und die Routine kehrte wieder ein. Als ich nach längerer Abwesenheit wieder einmal in dem kleinen Laden einkaufte, fiel mir auf, dass der Inhaber sich in der Zwischenzeit einen Vollbart stehen lassen hatte. Sein Gesicht wirkte auf einmal markanter, weniger rosa und glänzend. Mein Kompliment nahm er mit etwas unverständlichem Gemurmel auf, doch es schien ihn tatsächlich zu freuen. Als ich das nächste Mal im Laden stand, vor dem Süßigkeitenregal nach Haribo Happy Cubes spähend, stand ein Mädchen neben mir, das, den Zeigefinger an die Nase gelegt, wie ich intensiv die Regale musterte. Sie war groß wie eine 15- oder 16-Jährige, pummelig, und hatte blonde Zöpfe, die so gebunden waren, dass sie auf beiden Seiten von ihren Schläfen herabschaukelten. Ein hellgelbes T-Shirt, auf dem ein großäugiger Hase aufgedruckt war, hing ihr bis zu den Oberschenkeln, die in pinkfarbenen Leggins steckten. Auf einmal drehte sie den Kopf zu mir. „Ich wohn jetzt hier!“, verkündete sie und starrte mich aus runden, wasserblauen Augen an. „Äh, ja“, antwortete ich verblüfft, „das ist ja schön …“. Sie legte den Kopf schief und strahlte, wobei eine riesige Lücke zwischen ihren Schneidezähnen sichtbar wurde. „Jaaa!“, setzte sie dann mit Nachdruck hinzu und nickte dabei heftig mit dem Kopf. Und dann machte sie einen kleinen Hüpfer. Sie folgte mir bis zur Kasse, mich weiterhin intensiv betrachtend, und als ich bezahlte, entging mir nicht die Verlegenheit des Ladeninhabers, aber sein Gesicht war so verschlossen, dass ich auf Nachfragen verzichtete.
Als ich den Laden verließ, rief sie mir nach: „Und meine Mama auch!“ Und dann winkte sie heftig. „Das ist ja toll“, antwortete ich, winkte zurück und ging etwas verwirrt nach Hause. Was es damit auf sich hatte, erfuhr ich ein paar Tage später. In der Zeit, nachdem die alte Mutter gestorben war, hatte sich ganz heimlich und leise ein zartes Band gesponnen zwischen der neuen Angestellten und ihrem Chef. Vielleicht hatten sie sich immer öfter angeregt unterhalten, vielleicht hatte er sie irgendwann einmal nach der Arbeit auf ein Glas Wein eingeladen, vielleicht hatten sich ihre Hände beim Einräumen von Erbsen- und Tomatendosen irgendwann einmal plötzlich berührt und gefunden. Das Mädchen mit der geistigen Behinderung war ihre ältere Tochter ‒ sie hatte auch noch eine jüngere Tochter, mit beiden war sie allein gewesen und hatte sich durchs Leben geschlagen, so gut es ging. Und jetzt waren sie eingezogen in das große dunkle Haus mit den Brezeln am Dachfirst, bei Gerhard Schmelcher. Man sah sie manchmal Hand in Hand auf der Straße oder abends gemeinsam in der Abendsonne auf der Bank vor dem Haus. An den Wochenenden pflegten sie gemeinsam den Vorgarten des Ladens, und die große Tochter winkte und juchzte jedes Mal, wenn jemand vorbeikam.
Nach ein paar Monaten rückte nun plötzlich ein Bagger an und fing im hinteren Teil des Grundstücks an, eine Baugrube auszuheben. Es begann ein großes Rätselraten im Dorf.
Was hatte er jetzt wieder vor, der Schmelcher Gerdl? Man hatte ja die jüngsten Veränderungen noch kaum verdaut – und jetzt schon wieder etwas Neues? Der neue Lagerraum war doch erst vor Kurzem fertig geworden? Gerüchte schwirrten hin und her.
Bei meinem nächsten Einkauf fasste ich mir ein Herz und fragte den Ladeninhaber, was denn da auf seinem Grundstück gebaut würde. Er lächelte fast ein wenig verschämt, und seine Wangen färbten sich leicht rosa. „Die Veronika schwimmt so gern“, sagte er. Das war die ältere Tochter. Und da habe er sich gedacht, er baue ein Schwimmbad. Für sie, damit sie jeden Tag schwimmen könnte. „Toll“, sagte ich beeindruckt, „das finde ich toll“. Dann ging ich nach Hause, und obwohl es ein grauer, regnerischer Tag war, lag an diesem Nachmittag auf einmal ein warmer Schein über allem.
2. Preisträger 2022
Joachim Meissl – Rennradeln
Zu dritt schauen wir durch die Schaufensterscheibe auf die Straße nach draußen. Der Blick geht über die Schrägparker auf die heruntergelassene, abgeblätterte Jalousie des Gemüsehändlers gegenüber, bei dem wir auch manchmal eingekauft haben, als wir noch hier wohnten. Auf den rostigen, verblichen grünen Rolladengliedern ist ein flüchtiges „Werner wir vermissen dich“ aufgesprüht. Die Metallständer für die Obststeigen mit der Ware vor dem Laden sind verschwunden.
Hier habe ich in einem anderen Leben mal eine Flugmango für drei Mark 98 auf der Schiefertafel angeboten gelesen und den Händler, vermutlich den Werner, gefragt, was eine Flugmango ist. Der untersetzte Mann, ein gemächlicher Kneipentyp mit Überresten jugendlicher Schwerathletik, vielleicht war der mal Ringer, meinte: „Des glab’ I scho, dass du dir sowas gar net leisten konnst! Die san mit optimaler Reife geerntet und mit dem Fliaga von Südamerika rübergflogn wordn. So a Mango kost’ normal mindestens acht Mark!“ Ich habe die Mango damals gekauft.
„Für mich hat Rennrad fahren etwas mit Italien zu tun und nicht mit Amerika! Diese Dosnradl aus Alu mit Schweißnähten wie Blinddarmnarben aus den 60er-Jahren, das ist doch eine Beleidigung fürs Auge!“, sage ich. Die Altingers lächeln versonnen und schauen beide ins Unbestimmte raus.
„Die Zeiten haben sich geändert. Man muss den Kunden heute so viel erklären.“ Das klingt müde und enttäuscht. Der Laden ist gesteckt voll mit edlen Rahmen und komplett montierten Rädern. Carbon, Stahl und vielleicht auch ein, zwei Alurahmen. So genau schaue ich lieber nicht hin.
„Ich mag diese klassischen Stahlrahmen mit einem filigranen Umfang, nicht diese klobigen Rohre von heute!“ Schon ein abfallendes Oberrohr und diese verzwergten Rahmengrößen mit übertrieben langer Sattelstütze, um Gewicht zu sparen und trotzdem die erforderliche Sitzhöhe wieder hinzubekommen, finde ich unästhetisch. Das ist, als würde ich einen zierlich eleganten Mercedessportwagen aus den 50ern diesen Testosteronboliden mit Protzauspuffanlagen gegenüberstellen. Ein klassischer Stahlrahmen mit verchromten Muffen und Metallic-Pulverlack ist das einzig Wahre.
„Schon der Lenkervorbau! Diese filigranen Halterungen für den alten schlank geschwungenen Stahllenker, verglichen mit den wuchtigen Teilen und den dicken Alulenkern, die von Klemmen mit Bolzen gehalten werden wie die Sechskantschrauben am Hirn von Frankenstein.“
„Die kann man in die modernen Rahmen nicht mehr verbauen. Der Steuerungssatz wird im Rahmen anders befestigt. Selbst die modernen Stahlrahmen haben deshalb nicht mehr die alten Gewinde“, relativiert Herr Altinger.
„Herr Altinger, das können Sie mir nicht antun. Wenn ich durch die Landschaft fahre und zwischen meinen Beinen nach unten blicke, schaue ich doch voll auf den Vorbau. Mehr sehe ich selbst doch von dem Radl gar nicht. Da will ich doch nicht auf so ein dickes Wasserrohr vom Sanitärinstallateur schauen müssen.“
„Ich schau mal, was ich auftreiben kann.“
Das Radsportgeschäft ist ein paar hundert Meter im gleichen Viertel umgezogen. Der Laden ist jetzt viel größer und moderner, aber trotzdem so voll wie damals der alte. Dort habe ich mir Ende der Achtziger mein erstes richtiges italienisches Rennrad gekauft. Im Jahr der Überschwemmungen in der Po-Ebene und des Erdbebens in Kobe, zwei wichtigen Regionen der damaligen Rennradproduktion. Der Rahmen ist dann nach neun Monaten aus Italien gekommen, in der falschen Farbe. Statt italienischem Azurblau in eher auberginefarben anmutender Zurückhaltung.
Ich habe es trotzdem genommen. Diese Lackierung habe ich sonst niemals wieder gesehen.
Heute, ein gutes Vierteljahrhundert später, schauen wir also gemeinsam raus zum Schaufenster, Frau Altinger, Herr Altinger und ich.
„Ich verkaufe mittlerweile schon wieder mehr Stahlrahmen als Carbon.“
Das ist doch ein Aufheller! „Wie das?“
„Meine Kundschaft wird natürlich auch älter. Selbst die totalen Technikfreaks, die alle zwei Jahre ein neues Rad kaufen, sagen sich heute: lieber fahre ich die zwei oder drei Prozent langsamer als mit Carbonrahmen und komme dafür am nächsten Tag wieder aus dem Bett. Die Stahlrahmen sind vom Fahrkomfort einfach angenehmer, nicht so beinhart.“
Das werde ich nie überprüfen können, weil ich mich nicht mehr auf etwas anderes als einen italienischen Stahlrahmen setzen werde.
Bei alten Rädern spricht man manchmal von flatternden Rahmen und dass diese mit der Zeit weich würden. Ich habe das nie verstanden. Das Einzige, was bei mir mal flattert, sind vielleicht etwas zu große Trikots aus dem Sonderangebot.
Das Schönste beim Rennrad fahren ist die absolut geräuschlose Geschwindigkeit bei einem mühelos wirkenden runden Tritt. An einem Spätsommerabend bei 24° Celsius und Windstille mit neuen Pedalplatten und einem gut eingestellten Rad durch die Landschaft zu gleiten, wenn möglich mit unmerklichem Gefälle, das dann noch fünf Stundenkilometer Bonus draufpackt, verbunden mit der Illusion, dass dies alles mit reiner Muskelkraft passiert. Ein lauer Luftzug umschmeichelt die Beine. Es riecht nach Sommer und schon ein bisschen nach Herbst. Die Sonne scheint weich und friedlich. Kühe warten am Gatter auf ihre Abholung. Irgendwo in den Bergen zieht ein Gewitter auf. Das bleibt dort aber sicher noch zwei Stunden hängen.
Hinter mir höre ich ein rotziges Knattern. Ein Moped zieht etwas mühsam an mir vorbei. Vorne sitzt ein Junge tief über den Lenker gebeugt. Dahinter seine Freundin. Er kann sich wegen der erforderlichen Aerodynamik keine lässige Haltung leisten. Das ist noch ein harmloses Moped, nichts Getuntes. Dahinter folgen noch zwei weitere. Es geht gerade ganz unmerklich bergauf. Eine Steigung, die kein Mensch sonst wahrnimmt, nur ein Rennradler, der eben noch in gleichmäßigem Rhythmus über den Asphalt schwebte. Die Grundgeschwindigkeit muss immer da sein, weil bei einer Unterschreitung eines gewissen Tempos der Kraftaufwand unverhältnismäßig hoch wird.
Die drei Mopeds überholen mich. Alle mit einem Mädchen hintendrauf. Das Mädchen auf dem letzten Moped dreht sich nach mir um und lächelt anerkennend. Als ich so alt war wie die drei Burschen, hatte ich noch keine Freundin. Nur Schwärmereien. Jetzt geht es wieder eben weiter, mein Lieblingsabschnitt auf der Strecke. Wahrscheinlich doch ein Prozent Gefälle. Ich werde schneller. Ich komme näher. Das letzte Moped steuert der dickste Junge von den dreien. Ich überhole. Der Junge tut mir leid. Aber in meinem Alter muss man solche seltenen Erfolgserlebnisse einfach mitnehmen. Der kommt schon darüber hinweg. Die anderen beiden vorne haben das ja auch nicht mitbekommen.
Schleifgeräusche oder irgendein Klappern sind das Schlimmste. Deshalb darf ein Rennrad keinerlei Anbaufirlefanz haben. Keine Schutzbleche, keine Glocke, um Gottes willen keinen Radständer. Fahrradschlösser sind völlig sinnlos, weil ein Rennradler möglichst durchfährt und normalerweise nicht zwischendurch im Biergarten einkehrt und wenn, dann mit dem abgestellten Rad in Blickkontakt und Sprungnähe.
In meinen besseren Radljahren habe ich Rennradler in drei Gruppen unterteilt: die Guten, Puddingbübchen und Pappnasen. Ich kann sie schon an der Sitzposition und am Tritt unterscheiden,wenn ich mich von hinten nähere. Auf dem Rad bin ich schon manchmal ein kleiner Kotzbrocken. Da passiert etwas mit dem Adrenalin. Meine gnadenlose Skalierung des Radlertyps habe ich jetzt etwas relativiert, nachdem ich mich in den letzten Jahren selbst zunehmend in den letzten beiden Gruppen finde. Man muss seine Ziele eben den Möglichkeiten anpassen.
Am späten Nachmittag bis abends macht mir das Rennradeln am meisten Spaß. Vorausgesetzt, man geht ausgeruht und mit genügend Kohlehydraten auf die Strecke. Das ist schon ein tolles Hobby, bei dem man vor Ausübung erst richtig Kalorien schaufeln muss, damit man während der Fahrt nicht plötzlich und ohne Vorankündigung völlig entkräftet auf einen Hungerast kommt, verbunden mit Dehydrierung und einem komplett ausgetrockneten Mund. Wer nicht isst, geht unter, kein Sport für chronische Diätsklaven.
Am Abend sitze ich nach der Dusche daheim auf dem Balkon, die Beine hochgelegt auf einem zweiten Stuhl, überblicke die stillen Nachbargärten und schenke mir ein kühles, schäumendes Glas Bier ein.
Die Vögel verstummen so nach und nach. Der Abendwind trägt das Bimmeln einer Kuhglocke von der Reismühle bis zu uns hoch. In den Wohnzimmern werfen die Flachbildschirme bunte Bilder in die Räume. Stille. Der Körper ist so angenehm durchblutet.
Das Leben ist eine Schau!
3. Preisträger 2022
Barbara Müller-Funk – Curriculum Vitae
Amalie Sievermann war das einzige Kind aus der späten Verbindung eines hanseatischen Bankdirektors mit seiner Sekretärin. Die im fortgeschrittenen Alter stehenden Eltern vergötterten die unerwartet geborene Tochter.
Die Schule durchlief Amalie als gute, wenn gleich schüchterne Schülerin; in den Entwicklungsjahren versuchte sie einige Male, sich bei unbedeutenden Anlässen der Meinung des Vaters zu widersetzen, was zu Fassungslosigkeit und, es muss leider gesagt werden, zu Anwendung physischer Gewalt von Seiten des Vaters gegenüber der Tochter führte.
Als Amalie nach dem Abitur in eine südwestdeutsche Universitätsstadt übersiedele (dass sie damit bei einem Studium innerhalb der deutschen Grenzen größtmögliche geographische Entfernung zwischen sich und ihre Eltern legte, war ihr zum damaligen Zeitpunkt nicht bewusst), lösten die Eltern ihr Stadthaus auf und zogen in eine ehemalige Künstlerkolonie auf dem Lande, die seit einiger Zeit eine gewisse Anziehungskraft auf im Ruhestand befindliche Angehörige der gehobenen Mittelschicht ausübte.
In den folgenden Jahren besuchte Amalie ihre Eltern zu Weihnachten für drei Tage; ebenso hielt sie an der Gewohnheit fest, im Sommer vier Wochen mit ihnen auf Kampen zu verbringen. Da die Eltern infolge ihres Alters die Reise in den Süden scheuten, sahen sich Eltern und Tochter selten außerhalb der beiden erwähnten Gewohnheiten.
Amalie hatte ein Dachzimmer im vierten Stock eines Bürohauses in unmittelbarer Nähe der zentralen Universitätseinichtung gefunden, was ihr entgegenkam, da sie kein Auto besaß und ihre Idee, einen öffentlichen Bus zu benützen, nie gekommen war. Zu dem Zimmer gehörte kein Bad, die Toilette befand sich im Keller. Nach Geschäftsschluss war Amalie allein im Haus, auch konnte sie nicht durch eine Klingel erreicht werden. Wer sie besuchen wollte, musste sich telefonisch anmelden. Bei ihrem Einzug ahnte Amalie nicht, dass sie vierunddreißig Semester in diesem Raum leben würde, sonst hätte sie sich vielleicht doch nach einem Zimmer mit Klo und Klingel umgesehen.
Sie hatte sich für das Studium der Altphilologie eingeschrieben; ihre sprachliche Begabung sowie fundierte Schulkenntnisse ermöglichten es ihr, die ersten Semester ohne bedeutenden Arbeitsaufwand mit erfreulichen Ergebnissen zu durchlaufen.
Erheblich mehr Zeit und seelische Kraft beanspruchten dagegen die von Semester zu Semester wechselnden Männerbeziehungen, in denen sich Amalie, fast zu ihrem Erstaunen, immer wieder fand.
Der bejahrte, wissenschaftlich renommierte Vorstand des griechischen Seminars verliebte sich mit jugendlichem Ungestüm in das sanfte, blonde Mädchen mit den guten Manieren (er hatte diesen Typus Studentin schon lange, entbehrungsreiche Jahre nicht mehr erlebt) und überhäufte Amalie mit einer Flut von leidenschaftlichen
Briefen.
In der Tat stach ihre damenhafte Erscheinung von den sich aus ideologischen Gründen vernachlässigenden Kommilitoninnen ab — wo schmutzigbraune Windjacken vorherrschten, wurde Amalie nie anders gesehen als in dunklen Flanellhosen, gestreiften Hemdblusen oder Cashmerepullovern; an kühlen Tagen trug sie einen Kamelmantel.
Im nächsten Frühjahr brannte ein schriftstellernder Tutor darauf, ihr im Anschluss an kurze, meist unerfreuliche Begegnungen im Bett (Amalie war viel zu wohlerzogen, als dass sie sich gestattet hätte, eine solche Feststellung zu äußern) lange Lesungen aus seinem gerade entstehenden Roman zu halten. Ihr Urteil (das gleichwohl ein positives zu sein hatte, wie Amalie richtig erkannte) war ihm außerordentlich bedeutsam. Seine Frau fand an diesem Arrangement eher erfreulich, dass Amalie ihr von Zeit zu Zeit die Kinder einhütete und so dem Ehepaar einen gemeinsamen Ausgehabend ermöglichte. Auf einem Kongress lernte Amalie in den Sommerferien den bekannten Philosophieprofessor kennen, mit dem sie faszinierende Stunden am Rande der Tagung erlebte. Als der Arzt einige Wochen später eine leichte venerische Erkrankung bei ihr diagnostizierte, fragte sie den Professor brieflich, ob er als Überträger in Frage käme. Da der Brief an seine Privatadresse gerichtet war (die Möglichkeit einer Einsichtnahme durch seine Frau also nahelag), die Beziehung zu Amalie darüber hinaus infolge nervöser Überlastung des Professors keineswegs zu dem von ihm gewünschten Ergebnis gediehen war, fühlte er sich, milde ausgedrückt, irritiert und verzichtete sowohl auf eine Antwort als auch auf die Fortsetzung der Bekanntschaft, was bedauerlich für Amalie war, denn seine Protektion hätte ihr im wissenschaftlichen Feld sehr wohl von Nutzen sein können. Jedoch kamen ihr, zurückgezogen von weltlichen Geschäften wie sie war, solche karriereorientierten Gedanken nicht, so dass sie den Verlust des Professors nicht als schmerzlich empfand. Außerdem hatte er geschielt.
Amalies mangelnde Berücksichtigung banaler menschlicher Gegebenheiten zeigten sich auch in ihrer Gewohnheit, in heißen Sommertagen im städtischen Friedhof nicht nur an Grabsteine gelehnt zu lesen, sondern hin und wieder ein kurzes erfrischendes Bad in dem steinernen Becken zu nehmen, aus dem die Friedhofsbesucher Wasser zum Blumen gießen schöpften. Mit Erstaunen, gefolgt von Erschrecken bemerkte sie, dass ihr Bad von einer hierbei unzüchtigen Handlung an sich selbst vornehmenden Friedhofsarbeiter beobachtet wurde. Von da an mied sie den Friedhof. Der praktische Arzt hingegen, den sie anlässlich eines hartnäckigen fiebrigen Infekts aufgesucht hatte, fühlte sich durch Amalies Realitätsferne derartig herausgefordert, dass er sie verschiedentlich schlug und sie, als sie von ihm schwanger war, zu einer Abtreibung in ein Ostblockland schickte. Nach dieser einschneidenden Erfahrung (der Eingriff war ohne Narkose vorgenommen worden) begab sich Amalie in Psychotherapeutische Behandlung. Hierzu fuhr sie jeden Mittwoch mit dem Zug in eine
Nachbarstadt, wo sie einen jungen Psychiater gefunden hatte. Zum reduzierten Studententarif lag sie oft die ganze Stunde auf der Liege im Behandlungszimmer ohne ein Wort zu sprechen. Während der Heimfahrt pflegte sie dann so heftig zu weinen, dass sie noch am nächsten Tag eine dunkle Sonnenbrille tragen musste, ihre verquollenen Augen zu verstecken.
In der Folge steigerte sie sich in eine selbst für eine psychoanalytische Übertragungssituation ungewöhnlich starke Hassliebe zu ihrem Therapeuten, die ihren Niederschlag in einer Unzahl mittelmäßiger Gedichte fand, die Amalie in Schuhschachteln aufbewahrte ohne je den Mut zu finden, sie ihrem Analytiker auszuhändigen. Die Produktion dieser Gedichte schien ihre gesamte Energie aufzubrauchen, für ihr Studium hatte sie keine Kraft mehr. Sobald sie ein Fachbuch zu lesen versuchte bekam sie erhöhte Temperatur und musste sich zu Bett legen. Pro forma besuchte sie Vorlesungen, die sich allerdings in einem jährlichen Turnus wiederholten. Ansonsten verbrachte Amalie die Jahre ihrer Analyse mit dem Legen von Patiencen und dem Lesen indischer Traumdeutungsbücher. Das einzig greifbare Ergebnis das Behandlung bestand darin, dass Amalie sich aufs heftigste gegen ihre Eltern wandte, ohne allerdings zu einer tatsächlichen Loslösung von ihnen zu gelangen, was sich auch darin ausdrückte, dass diese weiterhin für den Lebensunterhalt der fast dreißigjährigen Tochter aufkamen und sie so der vielleicht heilsamen Notwendigkeit enthoben, entweder ihr Studium zu einem Abschluss zu bringen oder sich einem Broterwerb zuzuwenden.
Die Spannung zwischen Amalie und ihrem Therapeuten erreichten einen Höhepunkt, als sie ihn während einer ihrer unzähligen nutzlosen Sitzungen mit einem zu diesem Zweck im linken Pulloverärmel mitgeführten feststehenden Messer auf dem Handrücken verletze. Der überraschte Mann reagierte wohl zum ersten Mal so, wie Amalie es immer erhofft hatte, nämlich menschlich, indem er sie ohrfeigte und daraufhin in die geschlossene Abteilung der Universitätspsychiatrie einwies.
Bis zu einem gewissen Grad genoss Amalie die neuartige Umgebung, nur die Notwendigkeit, ein Kliniknachthemd tragen zu müssen (sie hatte kein Nachtgepäck bei sich gehabt), störte sie. Als sie sich bei dem Versuch, sich aus einem vergitterten Parterrofenster der Anstalt zu zwängen, ertappen ließ (sie hatte doch einmal aus einer geschlossenen Abteilung ausbrechen wollen, erklärte sie), erhielt sie eine Strafpredigt der entnervten Stationsschwester, die darauf hinwies, dass Amalie schließlich jederzeit auf eigenen Wunsch hin entlassen werden könnte. Dies geschah am nächsten Tag zur Erleichterung nicht nur ihres eigenen Psychiaters, der seine Therapiebemühungen für gescheiter und die Behandlung als beendet ansah, wie Amalie in einem abschließenden Gespräch erklärte.
Merkwürdigerweise verbesserte sich Amalies seelischer Zustand in der Folgezeit, die depressiven Stimmungen ließen nach, sie interessierte sich wieder für ihr Studium, besuchte sogar ein Seminar und erwog, eine Semesterarbeit anzufertigen. Kollegen, die sie aus der zeit des Studienbeginns kannte, waren inzwischen Dozenten geworden und freuten sich, in Amalie ein bekanntes





























