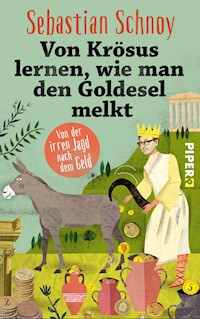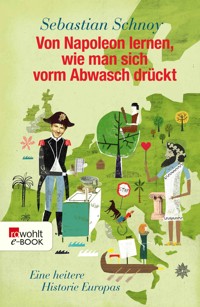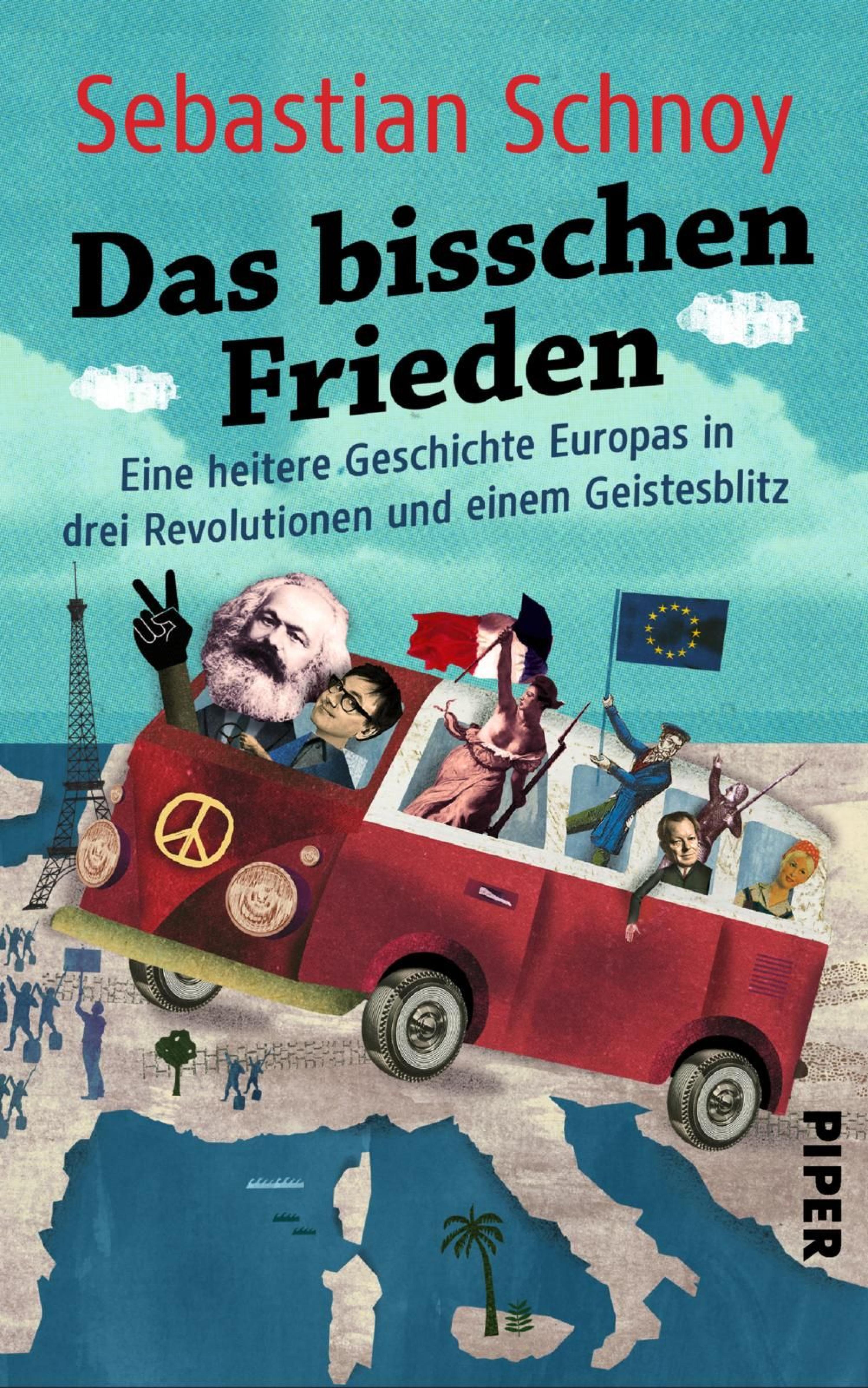
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Geschichtsschreibung für notorische Optimisten Karl der Große ist bekannt für seine Eroberungskriege – wie aber hießen die Bauern, die vor 500 Jahren die Menschenrechte erfanden? Den Dreißigjährigen Krieg kennt jedes Schulkind, wer aber weiß, dass es schon damals eine Friedensphase gab, die doppelt so lang anhielt? Unfallstatistiken oder die Bakterienanzahl in Spülschwämmen kennen wir bis auf die zweite Dezimalstelle, wer aber hatte noch mal die Idee für die Deutsche Einheit? Historiker Sebastian Schnoy hat genug von unserer negativen Weltsicht und zeigt, dass die Menschheit schon immer besser war als ihr Ruf. Seine Geschichte des Friedens und der Geistesblitze zaubert jedem Pessimisten ein Lächeln ins Gesicht und liefert neue Argumente für müde Aufklärer. »Schnoy ist unterhaltsam und tiefgründig zugleich« SPIEGEL Online Geschichte unterhaltsam und kenntnisreich erzählt vom beliebten Bestseller-Autor und Bühnenkünstler
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover & Impressum
Europa war nie das Problem, sondern immer die Lösung
Grenzenloses Glück
Als die Bauern im Jahre 1525 die Freiheit entdeckten
Was Macht mit uns macht – und wozu die Gewalten geteilt wurden
Die europäische Aufklärung – Therapie mit tödlichen Nebenwirkungen
Wie Europa den Krieg abschaffte
Warum gibt es Krieg?
Wer sind wir? Und wer sind die anderen?
Freiheit günstig abzugeben
Der Jakobsmuschelkrieg
Das ultimative Friedensrezept: Fraternisierung
Die Migration ist die Mutter aller Lösungen
Katholische Grundstücke nur für Katholiken
Liebe kennt keine Grenzen
Was geht, Bruder? Alles, wenn du Bruder zu mir sagst
Peace – wie in Nordirland der Frieden gelang
Der deprimierende Weg zum Frieden: So lange kämpfen, bis alle des Kampfes müde sind
Ganz allein Europa retten: Georg Elser
Der Russe kommt! Wirklich?
Der Türke kommt! Wann?
Wer Frieden will, muss handeln
Glaubt doch, was ihr wollt!
Die Befreiung von der Mühsal
Schnöde Welt, bleib mir gestohlen
Emilia und die Geschichte der Zukunft
Europa für Anfänger
Die »Volksgemeinschaft« gegen Andersdenkende
Der Geistesblitz: Die Netten werden die Welt retten
Wann befreien wir die letzten Unfreien?
Europa ist heute wahr, gut und schön.
Das Wahre
Das Gute
Das Schöne
Grenzenloses Glück
Grenzen sind Narben der Geschichte.
Bevor die Menschen begannen, die Erde zu besiedeln, gab es auf der Welt keine Grenzen. Die ursprünglichen Bewohner unseres Planeten, die schon lange vor uns da waren, sind auch heute noch unsere Nachbarn, und wir können viel von ihnen lernen, zum Beispiel von den Störchen. Sie reisen in jedem Jahr, ganz ohne Papiere, von Nordeuropa nach Afrika und machen das, was wir eigentlich alle tun sollten: dem schönen Wetter folgen. Wieso verbringen wir nicht auch den Winter in Afrika, den Frühling am Mittelmeer, den Sommer an der Ostsee und den Herbst wieder in Andalusien? Jetzt mal ernsthaft, weil wir eine Wohnung in Hannover haben? Wer hat sich denn so was ausgedacht?
Sicher gibt es auch viele Tiere mit fester Adresse, etwa den Eisfrosch, der nicht so weit hüpfen wie der Storch fliegen kann und nur deshalb in seinem Teich mitsamt dem Wasser im Winter einfriert. Zum Glück friert sein Gehirn mit ein, sodass er in den endlosen Eis gewordenen Wochen nicht denken kann: »Was, zur Hölle, mache ich hier eigentlich?«
Doch seine wunderbare Anpassung an die Natur zeigt, dass wir auch von ihm nichts gelernt haben. Durch den Umstand, dass er mit gefrorenem Gehirn nicht denken kann, ist der Winter für ihn gefühlt ein kurzer Augenblick. Vier Monate Eis und Schnee fühlen sich für ihn so an: »Huch, es wird ja kalt. Oh, schön, es wird wieder warm.« Nur wir Menschen verbringen den monatelangen Winter in vollem Bewusstsein. Wie blöd kann man sein?
In der Natur gibt es keine Grenzen, man kann in ihr nur an seine eigenen stoßen. Der Übergang vom Land zum Meer ist für viele so eine Grenze, doch was würden Seehunde und Pinguine dazu sagen? Sie kennen diese Grenze nicht. Seemöwen machen nicht nur an Land und im Wasser, sondern auch in der Luft eine gute Figur, hocken auf den Felsen, fliegen tagelang aufs Meer hinaus und lassen sich, wenn es unter der Wasseroberfläche etwas zu essen gibt, einfach hineinfallen. Zur Verdauung machen sie ein Schläfchen auf dem Ozean. Ich glaube, Seemöwen könnte man am schlechtesten erklären, was eine Grenze ist. Sie würden es einfach nicht begreifen.
Warum gibt es überhaupt Grenzen? Es gibt sie erst, seit Menschen sich streiten. Auch deshalb sind Grenzen die Narben der Geschichte. Und von ihnen gab und gibt es viel zu viele. Sie markierten immer den Machtbereich eines Herrschers: In seinem Tal bis hinauf zu den Bergen konnte er Steuern erheben und sich den Bauch mit dem von seinen Untertanen abgepressten Gütern vollschlagen. Auf der anderen Seite der Berge im nächsten Tal unterdrückte ein anderer Despot die Menschen, deshalb war der Bergkamm die Grenze. Wir haben uns schon so an Grenzen gewöhnt, dass sie uns natürlich erscheinen, dabei sind sie immer Menschenwerk.
Flüsse scheinen uns stimmige Grenzen zu sein, dabei wurden sie erst in der jüngeren Geschichte zu Grenzen, einst war ihr natürlicher Charakter viel prägender. Flüsse trennten nicht, sie verbanden als Wasserstraßen Menschen über Hunderte von Kilometern. Es gab nicht die Menschen diesseits und jenseits des Flusses, es gab nur die Menschen am Fluss, die dieselben Geschichten erzählten, ob als Schiffer, Fährmann, Fischer und Angler mit ihren Familien, die im Rhythmus von Hoch- und Niedrigwasser lebten und die sowohl die Liebe zum als auch der Respekt vor der Gewalt des Flusses verband. Wie absurd Flüsse als Grenzen sind, zeigt die Geschichte der DDR-Grenze an der Elbe zwischen Schnackenburg und Lauenburg. Vierzig Jahre stritten sich die DDR und die Bundesrepublik darum, ob die Grenze nun in der Flussmitte oder an der Nordseite verlaufen würde, derweil immer wieder Kühe und Schafe – die einzigen DDR-Einwohner, die sich vor dem Zaun auf den Elbwiesen aufhalten durften – kurzerhand durch die Elbe schwammen und in Hitzacker Asyl beantragten. Die Störche haben diese vierzig Jahre Grenz-Irrsinn auf ihren Flügen von Norden nach Süden und umgekehrt nicht mal registriert.
Aber sind Grenzen nicht auch ein Schutz gegen Fremde? Wir haben ja schließlich auch einen Gartenzaun gegen Strolche, die auf unser Grundstück wollen, ist es da nicht nur natürlich, dass auch die Nation ihr Grundstück einfriedet mit Zäunen und Mauern gegen Einbrecher und anderes Gesindel? Gegen Feinde? Zum Beispiel gegen die Barbaren auf der anderen Seite der Berge, die uns überfallen wollen? Natürlich haben Herrscher immer probiert und probieren noch heute, ihren Machtbereich auszudehnen und andere Länder zu überfallen. Deshalb können den dortigen Bewohnern Grenzen auch als Schutz erscheinen gegen Eindringlinge. Doch primär markieren sie einen Machtbereich. Zunächst den eines adligen Herrschers, eines Grafen, Herzogs, Großherzogs, Königs oder anderen Verbrechers, die den Menschen Schutz vor Gewalt boten, wenn diese bereit waren, ihre Herrschaft anzuerkennen. Taten sie es nicht, waren sie es selbst, die diesen aufmüpfigen Untertanen den Kopf abschlugen, damit allen klar war, von welcher Gewalt hier eigentlich die Rede war.
Der Herrscher konnte auf seinem begrenzten Territorium nicht nur die eigenen Untertanen ausnehmen, sondern auch die, die sein Machtgebiet durchqueren wollten, zum Beispiel mit Salz im Gepäck. Die Warenströme waren vor tausend Jahren noch gering, man fraß, was vor der Haustür wuchs, wie die Schafe von Schnackenburg. Salz jedoch musste gekauft werden. Im deutschen Mittelalter war der Handel mit Salz so prägend, dass zahlreiche Straßen als Salzstraßen bezeichnet wurden. In manchen Regionen wurde es abgebaut, an Händler verkauft, die es über weite Strecken transportierten. Ein Teil des Preises wurde aber nicht durch die aufgerufen, die das Salz herstellten oder es transportierten und verkauften, sondern durch die ehemaligen Raubritter, die sich inzwischen eigene Zöllner zugelegt hatten. Deren einzige Leistung bei dieser Wertschöpfungskette bestand darin, sich den Händlern in den Weg zu stellen und zu sagen: »Passt auf, wenn ihr hier rein wollt mit eurem Salz und ihr das Zeug an unsere Leute verkaufen wollt, müsst ihr uns Geld geben.« Da half auch ein »Nee, sorry, ich will euer Land nur durchqueren und das Salz in Dänemark verkaufen« nichts, denn neben dem Einfuhrzoll und dem Ausfuhrzoll, war auch der Transit-Zoll schnell erfunden.
Das Geld bekamen und bekommen bis heute Leute, die nichts tun, außer einen Schlagbaum zu bauen und ihn vor Kutschen oder Lkws abzusenken. Warum können sie das? Weil sie die Gewalt dazu haben. So wie ein junger Schläger, der Samstagnacht auf uns zukommt und sagt: »Gib mir eine Zigarette, dein Handy und deine Jacke, sonst hau ich dir auf die Fresse.« Was unterscheidet heutige Zöllner von diesem Schläger, von den Raubrittern des frühen Mittelalters und von Piraten im heutigen Somalia? Nichts. Man muss nur das Wort Salz durch Stahl oder Automobile ersetzen, um in der Gegenwart zu landen. Hier drei seit mehr als tausend Jahren bekannte Zollregeln, die bis heute durch nichts zu rechtfertigen sind:
Ihr wollt eure Waren bei uns verkaufen? Das kostet extra.
Ihr habt hier Waren hergestellt und wollt sie woanders verkaufen? Das kostet extra.
Ihr wollt hier mit euren Waren einfach nur durchfahren? Das kostet extra.
Die Vorstellung von Grenzen als Narben der Geschichte ist deshalb so treffend, weil die meisten aufgrund von gewaltsamen Auseinandersetzungen entstanden sind, also als Ergebnis eines Krieges. Aber dieses Bild lässt auch eine Hoffnung zu. Narben könnten auch wieder verheilen und fast unsichtbar werden. Doch im Moment sind die Schlagzeilen voller Forderungen nach neuen Grenzen. Donald Trump hat die US-Wahl nicht zuletzt mit der Forderung nach einer Mauer als Grenze zu Mexiko gewonnen. Sogleich brachte sich der deutsche Baukonzern Hochtief als Partner ins Gespräch. Gerade waren sie mit der Elbphilharmonie fertig geworden. Da kommt einem sofort der alte Spruch in den Sinn: »Beton, es kommt drauf an, was man draus macht.« Nach öffentlicher Empörung zog Hochtief die »Erwägung zur Bewerbung« schnell wieder zurück. Dabei wäre es für die Mexikaner ein Grund zum Durchatmen gewesen. Wenn eine Firma, die ewig braucht, um ein einziges Gebäude zu errichten, den Job für die Errichtung einer viele Tausend Meilen langen Grenze bekommt, dann können sie der Schließung der Grenze gelassen entgegensehen.
Seit es Grenzen gibt und solange Grenzen bestehen, werden Menschen versuchen, diese zu überwinden, versuchen hineinzukommen oder herauszukommen. Leute, die anderen einen illegalen Grenzübertritt ermöglichen, nennt man bei uns Schlepper. Und Schlepper sind böse und kriminell, das haben wir beim Zeitungslesen gelernt, denn sie verdienen Geld mit der Not der Menschen. Ich wusste gar nicht, dass es verboten ist, mit der Not der Menschen Geld zu verdienen. Mein Nachbar ist Apotheker, der macht das jeden Tag.
Und Profis seien die Schlepper, heißt es. Na so was! Es ist ein irrer logistischer Aufwand, Schlauchboote aus China an die lybische Küste zu bekommen. Dann Flüchtlinge in Minibussen nachts durch kontrollierte Grenzgebiete zu schmuggeln, in denen man jederzeit der Polizei oder den Grenztruppen begegnen kann. Da ist es doch recht erfreulich, wenn das Profis machen. Stellen wir uns mal die Schlepper als Familienbetrieb vor, der das schon seit vier Generationen macht, dann sehen wir, dass das Wort Schlepper noch nicht sehr alt ist. Gestern noch Fluchthelfer, heute Schlepper.
Sie würden die Menschen in Schlauchboote zwingen, wird ihnen vorgeworfen. Dabei ist das Gegenteil der Fall, niemand darf in die Schlauchboote steigen, wenn er nicht viel dafür bezahlt hat. Da drängt sich doch die Frage auf, ob es vielleicht nicht der Schlepper ist, der die Menschen ins Schlauchboot zwingt, sondern die EU-Gesetze?
Selbst Familien aus Syrien, denen in Aleppo die eigene Wohnung weggebombt wurde, durften nicht in der Türkei einen Flug nach Deutschland buchen, nein, auch sie mussten sich an der türkischen Küste zu den Schlauchbooten vorkämpfen. Als in unserem fiktiven Familienunternehmen noch der Vater aktiv war, war der Renner der Grenzübertritt von der DDR in den Westen. Dafür gab es noch das Bundesverdienstkreuz. Der Opa war sogar noch in den Pyrenäen aktiv. Gerade Künstler wie Heinrich Mann, völlig unsportlich, musste man erst mal über die Pässe bekommen, ein schweißtreibender Job, der natürlich bezahlt werden muss. Was wäre gewesen, wenn es in Amsterdam 1943 schon so gut organisierte Schlepper gegeben hätte wie heute in Libyen oder der Türkei? Hätte dann Anne Frank mit ihrer Familie in ein Schlauchboot steigen und nachts auf eine britische Kanalinsel übersetzen können?
Was oft untergeht, heute, wo wir wieder so viel über Grenzen reden: Selbst den Überlebenden des Holocaust war es in Europa nicht gestattet, Grenzen zu überschreiten. Viele Juden, die dieses Grauen überlebt hatten, wollten nach Palästina, wo gerade der Staat Israel gegründet wurde. Doch jeder Grenzübertritt war illegal. Trotzdem schafften es 4515 jüdische Flüchtlinge, darunter mindestens 655 Kinder bis nach Marseille und dort an Bord eines Schiffes namens Exodus. Nach gelungener Fahrt bis Haifa setzte die dortige britische Verwaltung durch, dass die Menschen gegen ihren Willen auf anderen Schiffen nach Hamburg gebracht wurden. Dort kamen die jüdischen Flüchtlinge am 8. September 1947 an und wurden bei Lübeck in einem Lager hinter Stacheldraht interniert – über zwei Jahre nach Ende des Faschismus in Deutschland.