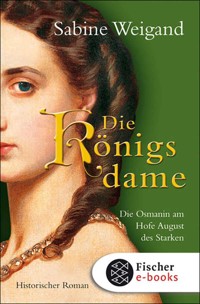Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erbin, Mutter, Rebellin: der große Roman um Königin Konstanze, die heimliche Schlüsselfigur der Stauferdynastie Es ist die berühmteste Geburtsszene des Mittelalters: Konstanze, Frau des deutschen Kaisers Heinrich VI., vierzigjährig, als unfruchtbar verschrieen, hochschwanger. Um jeden Preis muß sie die Legitimität ihres Kindes sicherstellen. Und so bringt sie ihren Sohn öffentlich, auf dem Marktplatz von Jesi, zur Welt. Die Nachwelt kennt sie als Mutter des Stauferkaisers Friedrich II. Aber welcher Weg liegt wirklich hinter Konstanze von Sizilien? Wem gehört ihre Treue: ihrer Heimat Sizilien oder ihrem Mann, dessen Grausamkeit sie entsetzt? Sabine Weigand erzählt das Leben einer Frau, deren Träume ganze Königreiche umfassen…
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sabine Weigand
Das Buch der Königin
Historischer Roman
Über dieses Buch
Palermo, 1184: Eigentlich ist Konstanze de Hauteville längst zu alt, um noch zu heiraten. Aber der Tod ihres Onkels macht sie mit einem Schlag zur einzigen Erbin des prachtvollen, exotischen Königreichs Sizilien. Und damit ist sie plötzlich eine brillante Partie für den jungen Stauferkönig Heinrich VI. Doch schon rebellieren Siziliens Barone: sie wollen keine Frau auf dem Thron. Konstanze kämpft um die Krone – und um ihre Position an der Seite Heinrichs, der Sizilien wie das Reich allein regieren will. Wem schuldet sie wirklich Treue: ihrem Land oder ihrem ungeliebten Mann? Wie soll sie, die als unfruchtbar Verschrieene, einen Staufererben gebären? Der junge Chronist Gottfried ist von Konstanze fasziniert – und er zeichnet heimlich ihre Taten auf. Noch kann er nicht ahnen, welche gefährliche Wendung Konstanze bevorsteht – und sie auf immer berühmt machen wird…
»Weigand mausert sich langsam aber sicher zur ›Päpstin‹ des historischen Genres.«
Arno Udo Pfeiffer, MDR, über die Autorin
www.sabine-weigand.de
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Sabine Weigand stammt aus Franken. Sie ist Historikerin und arbeitet als Ausstellungsplanerin für Museen. Dokumente aus Nürnberg waren der Ausgangspunkt ihres Romans ›Das Perlenmedaillon‹, das wahre Schicksal einer Osmanin am Hof August des Starken liegt dem Roman ›Die Königsdame‹ zugrunde. In ›Die Seelen im Feuer‹ bilden die Hexenakten von Bamberg die historische Romanvorlage, bei ihrem ersten Roman ›Die Markgräfin‹ war es die reale Geschichte der Plassenburg bei Kulmbach, bei ›Die silberne Burg‹ die Bestallungsurkunde einer jüdischen Ärztin, in ›Die Tore des Himmels‹ das Leben der Hl. Elisabeth.
Impressum
Umschlaggestaltung: bürosüd°, München
Umschlagabbildungen: Bridgeman Art Library, Berlin
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Landkarte: Thomas Vogelmann, Mannheim
Die Abbildungen vor den vier Büchern stammen aus dem ›Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis‹ von Petrus von Eboli (Burgerbibliothek Bern)
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402683-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Erstes Buch
Prolog: Kathedrale von Palermo, Pfingstsonntag, 17. Mai 1198
1 Konstanze, 1160er Jahre
2 Palermo, Frühjahr 1169 und 1172
3 Palermo, Pfingsten 1175 Konstanze
4 Burg Streitberg, Winter 1175
5 Bamberg 1177
6 Kloster Reichenau 1179
7 Bamberg 1181
8 Mainz, Pfingsten 1184
9 Bamberg, zur selben Zeit
10 Erfurt, 25. Juli 1184
11 Nachricht Gottfrieds an den Bischof zu Bamberg
12 Palermo, Juli 1184
13 Streitberg, Juli 1184
14 Von Palermo nach Pavia, Sommer/Herbst 1186 Konstanze
Zweites Buch
15 Brief Gottfrieds an Hemma ins Kloster St. Katharina und St. Theodor
16 Mailand, Januar 1186
17 Mailand, am Tag nach der Hochzeit, 28.1.1187 Konstanze
18 Norditalien, Frühjahr bis Herbst 1187
19 Streitberg, Frühjahr 1188
20 Mainz, Hoftag, 26. März 1188
21 Streitberg, Sommer 1188
22 Kaiserpfalz Ingelheim, Februar 1189 Konstanze
23 Regensburg, Mai 1189
24 Streitberg, Herbst 1189
25 Goslar, Oktober 1189 Konstanze
26 Eger, Weihnachten 1190
27 Auf dem Weg ins Heilige Land, Herbst 1189 bis Juni 1190
28 Lucca, Winter 1191
29 Rom, April 1191
30 Geheimbefehl des Königs an den Kommandanten der deutschen Besatzung in Tusculum vom 14. April 1191
31 Rom, Ostermontag, 15. April 1191
32 Montecassino, Ende April 1191
33 Vor Neapel, Mitte Mai 1191 Konstanze
34 Akkon, Juni/Juli 1191
35 Salerno, Kastell Terracina, Anfang August 1191
36 Salerno, Ende August 1191 Konstanze
37 Messina, Anfang September 1191
38 Montecassino, Mitte September 1191
39 Messina, Dezember 1191 Konstanze
40 Palermo, Frühling 1192
41 Irgendwo zwischen Neapel und Montecassino, Juni 1192
42 Ingelheim, September 1192
Drittes Buch
43 Irgendwo an der Adriaküste vor Aquileja, Oktober 1192
44 Kaiserpfalz Eger, Januar 1193
45 Reichsburg Trifels, März 1193 Konstanze
46 Bamberg, Juni 1193
47 Bamberg, eine Woche später
48 Mainz, Februar 1194 Konstanze
49 Trifels, 11./12. Mai 1194
50 Streitberg, Ende Mai 1194
51 Roncaglia, Juni 1194
52 Pisa, August/September 1194
53 Streitberg, Oktober 1194
54 Ancona, Oktober 1194 Konstanze
55 Sizilien, Oktober/November 1194
56 Palermo, November/Dezember 1194
57 Jesi, 25. Dezember 1194
58 Palermo, 28. Dezember 1194
59 Jesi und Foligno, Februar 1195 Konstanze
60 Bari, Ostern 1195
61 Palermo, Mai 1195
62 Palermo, die Gewölbe unter dem Palazzo Reale, Juni 1195
63 Schreiben der Kaiserin Konstanze an König Richard Löwenherz von England, 19. Juli 1195
64 Streitberg, September 1195
65 Streitberg, Freitag nach Allerseelen 1195
66 Streitberg, Mai 1196
Viertes Buch
67 Palermo, März/April 1197
68 Palermo, Ostermontag 1197
69 Castrogiovanni, Ende April 1197
70 Palermo, Favara, zwei Tage später
71 Palermo, tags darauf
72 Im Forst von Patti, Anfang Mai 1197
73 Palermo, Palazzo Reale, Mitte Mai 1197
74 Palermo, drei Wochen später
75 Palermo, Ende Juni 1197 Konstanze
76 Palermo, am selben Abend
77 Palermo, Mitte Juli 1197
78 Palermo, später am selben Tag
79 Palermo, keine Stunde später
80 Rom, Ende Juli 1197
81 Messina, September 1197 Konstanze
82 Messina, eine Woche später
83 Messina, Ende September 1197 Konstanze
Nachwort
Die Königin
Das Buch
Die Personen
Literatur
Das fränkische Ambiente
Personenverzeichnis
Glossar
[Kapitel]
Erstes Buch
Prolog: Kathedrale von Palermo, Pfingstsonntag, 17. Mai 1198
Tausend kostbare Bienenwachskerzen, armdick und zwei Fuß hoch, tauchen den mächtigen Dom der Hauptstadt in goldglühendes Licht. Die Schwere der Mauern scheint sich im zuckenden Spiel der Flammen aufzulösen, ihre Konturen zerfließen zu sanften Wellen, als seien die Steine zu Wasser geworden. Die Figuren auf den bunten Mosaiken bewegen sich, taumeln und tanzen; das Flackern hat sie zum Leben erweckt. Da ist ein Leuchten, ein strahlender Glanz, der einen beinahe schwindeln macht. So unglaublich hell ist es im Inneren der riesigen Kirche! Die Edelsteine auf dem Bild der Einsiedlerin Rosalia funkeln wie ein Sternenhimmel im Sommer. La Santuzza, wie die Palermitaner ihre Beschützerin liebevoll nennen, wacht mit mildem Lächeln über das Geschehen in ihrer Kirche.
Das Kind, das nun unter den feierlichen Gesängen der Mönche die Kirche betritt, blinzelt und bleibt stehen. Schwer lastet das Gewicht des goldbestickten Mantels auf seinen Schultern; Löwenkrallen aus gelber Seide schlagen sich in seinen Rücken. Allein die silberne Schließe des Tasselbands vor der kindlichen Brust mag bald ein halbes Pfund wiegen. Der Junge zögert, wankt leicht, da stupst ihn der Erbzischof von Salerno aufmunternd von hinten an, flüstert ihm etwas ins Ohr und zeigt zum Altar. Es sieht so aus, als ob der Junge aufseufzt, dann setzt er gehorsam einen Fuß vor den anderen. Mit energischen Trippelschritten durchmisst er die Gasse, die sich vor ihm öffnet. Die Menschenmenge im Dom weicht ehrfürchtig zurück, lässt ihn durch, den zukünftigen König, der einmal – noch ahnt es niemand – das Staunen der Welt sein wird. Doch im Augenblick verspürt der Kleine Lust am Spiel, er tritt absichtlich nur auf die weißen Steine des bunten Cosmatenfußbodens, dazu muss er ein bisschen im Zickzack gehen wie das Häschen, das ihm seine Mutter zum Willkomm geschenkt hat. Wieder erinnert ihn der Erzbischof von Salerno sanft an seine Pflichten. Er rückt ihm die blausamtene Mütze zurecht und stupst ihn dann wieder geradeaus. Links und rechts von ihm fallen die Leute auf die Knie, wie eine Welle geht es durch das Kirchenschiff. Vorne, hoch über dem Altar, entdeckt er den riesigen, goldglänzenden Christos Pantokrator. Mahnend hebt der Herr der Welt die linke Hand, neigt sich ihm mit ernstem Blick entgegen. Der Junge lächelt. Er hat keine Angst.
Konstanze sitzt auf ihrem Thron links vor der Mittelapsis, auf ihrem Haupt die Krone Siziliens. Auf diesen Tag, diesen Augenblick, hat sie ihr Leben lang gewartet. Es ist der Tag des vollkommenen Triumphs. Alles, was sie sich je gewünscht hat, ist Wirklichkeit geworden. Da kommt ihr Sohn, ihr einziger Sohn, an dessen Geburt vor dreieinhalb Jahren sie längst selber nicht mehr geglaubt hatte. Ihr Schatz, ihr Sieg, ihr Glück. Ein kleines Wesen in Blau und Gold, dessen viel zu großer Umhang auf dem Boden schleift und duftende Rosenblätter mit sich fegt. Ein schmächtiger Junge mit großen blauen Augen unter hellen Brauen und Wimpern. Er kommt nach seinem Großvater, denkt sie. Genau wie Barbarossa hat der Kleine rotblonde Locken und Haut von einer Blässe, die keine Sonne verträgt. Stauferhaut. Und dennoch ist er genauso ein Hauteville, sagt sich Konstanze trotzig. Er trägt die Namen seiner beiden Großväter: Friedrich und Roger. Sie aber nennt ihn, wenn sie allein sind, Konstantin. Nach sich selbst. Denn sie ist es, die ihn geboren hat, die um ihn gekämpft hat, die ihn dahin gebracht hat, wo er jetzt steht: vor den Altar des Doms von Palermo. Noch vor Ablauf einer Stunde wird er König von Sizilien sein.
Der kleine Friedrich hat sie jetzt entdeckt, zieht eine fröhliche Grimasse, als sie ihm zuwinkt. Ein Sonnenstrahl bricht durch eines der Seitenfenster und kitzelt ihn an der Nase. Er niest ganz unköniglich, und Konstanze muss schmunzeln. Dann bringt ihm ein Diener einen gepolsterten Hocker, von dem aus er die Messe verfolgen soll. So langes Stillestehen hält ein Kind nicht aus, das wissen selbst die alten Kirchenoberen. Ungeschickt versucht der kleine Friedrich, seine Kleider zu raffen, dreht sich, stolpert fast über sein langes Untergewand, bis er schließlich mit des Erzbischofs Hilfe auf dem Hocker zu sitzen kommt.
Das Tedeum klingt durch die Kirche, gesungen von hunderten Mönchen aus ganz Sizilien.
Ihr Blick wandert über Gesichter. Da sind die hohen Geistlichen: die Erzbischöfe von Palermo, Messina, Syrakus, der Abt von San Giovanni degli Eremiti … Alle sind sie ihr untertänig, obwohl nicht jeder von ihnen auf ihrer Seite war, damals, als es um ihr Leben ging und die Zukunft des Landes. Vorbei. Die alten Feindschaften ruhen, es ist gut. Ah, dort neben der Säule steht der Legat des Papstes. Luca Valdini, den sie »il Grugno« nennen. Nicht einmal die fehlende Nase kann ihn richtig hässlich machen. Sein Blick ist unruhig, wie immer, er weiß nicht, ob dieser Tag seiner Sache zum Guten oder zum Schlechten gereichen wird. Dabei immerhin hat sie doch den Papst zum Vormund ihres Sohnes bestimmt und seinen Anspruch auf das Reich zurückgezogen, Valdini sollte zufrieden sein. Neben ihm steht ganz in Schwarz der Kanzler, Walter von Pagliara, ein Mann, dem sie zwar nicht traut, der aber zu klug ist, um seine Fähigkeiten nicht für Sizilien zu nutzen. Endlich, an der Spitze der Palastgarde, das Gesicht, nach dem sie die ganze Zeit gesucht hat. Ein samtdunkles Augenpaar, olivfarbene Haut mit einem Schimmer von dichtem Bartwuchs. Aziz. Ihre Blicke treffen sich für einen winzigen Moment, dann schließt sie die Augen. Er weiß, was sie fühlt, er als Einziger unter all diesen Menschen in der Kathedrale. Eine Liebe im Licht der Welt ist ihnen nicht vergönnt, aber die im Dunkeln ist immer noch stark und tief und lebendig wie je. Ein Geschenk Gottes, des seinen und des ihren, das sie nur im Geheimen annehmen dürfen.
Sie öffnet die Augen, und ihr Blick fällt auf den großen Doppelaltar, dann gleitet er die Reihe der antiken Granitsäulen entlang, dorthin, wo die Toten liegen. Ihr Vater, den sie nie kennengelernt hat. Sein Blut, königliches Normannenblut, fließt in ihren Adern. Endlich habe ich dein Erbe angetreten, denkt sie, und strafft den Rücken. Sie spürt den leichten Druck der Krone, die auf ihrem Haupt sitzt, das Kitzeln der smaragdbesetzten Pendilien an ihrem Hals, wenn sie den Kopf dreht. Wie jetzt, da sie zum nächsten Grab hinübersieht. Heinrich. Der Kaiser, in Porphyr gebettet, über sich einen von sechs schlanken Säulen getragenen Baldachin. Sie schaudert. Dieser Mann hat sie berührt, mit Händen, so tot wie diejenigen, die jetzt knochig unter dem Sargdeckel liegen. Er hat sie erhöht und erniedrigt, untrennbar waren ihre Leben verwoben. Sein Tod hat den Weg frei gemacht. Die Krone, die er trug, wird jetzt gerade seinem Sohn aufgesetzt. Der Erzbischof von Palermo rückt das funkelnde Diadem zurecht, das innen einen Stoffring hat, damit es dem kleinen Friedrich passt. Ihr Sohn wackelt unwillig mit dem Kopf, als sei ihm das goldene Ding zu schwer. Er wird sich an das Gewicht gewöhnen, denkt sie. Und plötzlich ist da unter der Krone ein anderes Gesicht, verzerrt vor unerträglichem Schmerz, den Mund weit offen in lautlosem Schrei. Der sterbende Jordanus, auf seinen Schädel genagelt die glühende Eisenkrone des Verräters.
Sie schließt die Augen. Wer außer Jordanus fehlt noch unter den Gästen? Statt der lebenden Gesichter sieht sie nun die toten. Es gibt so viele. Da, ihr Bruder, wie er die Stirn runzelt, sein schwarzer Bart beginnt schon grau zu werden. Er musste um die Macht kämpfen, Sizilien hat ihn nicht geliebt. Vorbei. Dort sein Sohn Wilhelm, ihr Neffe, die blonden Locken fallen ihm offen auf die Schultern, er war für seine Schönheit berühmt. Sie versucht, ihre Gedanken zusammenzuhalten, doch da kommt noch jemand: Tankred, der Bastard. Sein Tod war gerechtes Schicksal, aber was heißt das schon. Der Papst hat ihn nicht schützen können oder wollen. Sie hat gelernt, dass auch der Glaube Teil der Politik ist.
Die Chöre werden wieder lauter, als sich der kleine Friedrich, nunmehr König von Sizilien, von den Knien erhebt. Nun hat sie ihre Rolle zu spielen. Sie geht gemessenen Schritts zu ihrem Söhnchen, nimmt seine kleine Hand in ihre. Einträchtig schreiten sie zusammen aus der Kirche. Ihr Herz weitet sich, als sie auf den kleinen Friedrich hinunterblickt, der unverdrossen neben ihr hertrabt, die Krone ein bisschen schief auf der Stirn.
In ihr jubelt es stumm. Sizilien ist gerettet. Die Zukunft wird glänzend sein. Mein einziger Sohn wird mein Erbe antreten, das Erbe der Hauteville. Hier bin ich und habe alles erreicht, was ich mir je gewünscht habe. Oh, ich weiß, ich bin nicht mehr jung. Und ja, ich habe für mein Glück bezahlt. Wer ist noch da von denen, die mir teuer waren? War es dies alles wert?
Sie schaut in das blendende Sonnenlicht, als sie aus der Kirche tritt. Ein letztes Gesicht taucht vor ihr auf, ihr eigenes. Das eines kleinen Mädchens, lachend, ohne Arg, als hätte es das Glück mit der Muttermilch eingesogen. Der Dom, die vielen Menschen, die Herrschaft über Sizilien – weit weg.
1 Konstanze, 1160er Jahre
Meine ersten Erinnerungen sind umweht vom Duft der Mandelblüten. Der Wind trägt die unsichtbare Süße aus den Baumgärten in die Innenhöfe der Paläste. Das Wasser im Brunnen plätschert, und ich tauche meine Hände in das kühle Nass. Tröpfchen sprühen auf mein gelbes Kleid und meine dünnen Samtpantoffeln. Safirah schimpft, aber sie meint es nicht ernst. Sie ist meine Amme, Sarazenin und die Frau eines kleinen Beamten des Diwans. Auf ihrem Schoß sitzt Aziz, mein Milchbruder, widerwillig lässt er sich den Kaftan richten. Und zu ihren Füßen kauert Wilhelm, mein Neffe, er ärgert mit seinem Stöckchen einen schwarzen Skarabäuskäfer. Damals kam es mir nicht merkwürdig vor, dass ein Neffe und seine Tante, nämlich ich, im gleichen Alter waren. Unsere Familie war nun einmal anders, die Familie des Königs. Für sie galten keine gewöhnlichen Gesetze. So fand ich es auch nie verwunderlich, dass ich meinen Vater nie kennengelernt habe. Den berühmten, den großen Roger! Ich bin erst nach seinem Tod geboren, er war schon alt, als er meine Mutter zur dritten Frau nahm. Für mich war mein ältester Halbbruder mein Vater: Wilhelm. Er sah schon ein wenig furchterregend aus, groß und massig, mit kohlschwarzem, ungebändigtem Haar und dichtem Bart. Dazu kam seine dunkle, heisere Stimme, die tief aus seinem Bauch aufzusteigen schien. Die Leute nannten ihn hinter vorgehaltener Hand »Löwenkopf« und hatten Angst vor ihm. Aber mit uns Kindern war er stets gutgelaunt, er ließ uns auf seinem Rücken reiten und warf mich oft hoch in die Luft. Er hatte auch andere Kinder an den Hof geholt, die zeitweise mit uns lebten, Söhne aus dem Adel wie den stillen Richard von Acerra, den wilden Jordanus oder den verwachsenen Tankred, von dem es hieß, er sei ein Bastard, was immer das bedeuten mochte. Die drei hielten sich weniger an uns jüngere Kinder, sondern eher an meinen ein paar Jahre älteren zweiten Neffen, Roger, der einmal den Thron erben sollte. Meine Mutter – was kann ich sagen? Sie hat sich gleich nach meiner Geburt ins Kloster zurückgezogen. Wenn ich sie sehe, und das ist selten genug, ist sie eine stumme Gestalt hinter einem grauen Schleier. Ich weiß nicht, ob sie mich überhaupt wahrnimmt. Es heißt, die schwarze Milch sei ihr zu Kopf gestiegen. Was das Wort Mutter bedeutet, habe ich erst gelernt, als mein Sohn auf die Welt kam.
Die Stadt meiner Kindheit ist Palermo. Sie liegt inmitten der sattgrünen Conca d’Oro, einer weiten Ebene, die von Bergen eingeschlossen ist wie das Innere einer Hand. Im Norden ragt der mächtige Monte Pellegrino auf, dort wohnt der großartige, schützende Hausgott der Stadt, den ich mir immer mit grimmig-grauem Wolkenkopf und grollend wie ein Gewitter vorgestellt habe. Im Osten bildet der Monte Catalfano den Abschluss der langgeschwungenen Bucht.
Palermo hat ein arabisches Gesicht. Kuppeln von zweihundert Moscheen spiegeln die Sonne wie Gold vor dem Hintergrund des grünblauen Ozeans, es ist, als habe der Zauberstab des Orients die Stadt berührt. Vor der Eroberung durch die Normannen regierten die Emire von ihrem Palast aus, unten am Meer im Viertel Al-Khalesa. Sie besaßen auch eine sichere Burg, am höchsten Punkt der Altstadt und ein Stück weiter westlich gelegen. Dort ist es kühler und ruhiger als in der Nähe des Hafens. Deshalb und weil der Ort leichter zu verteidigen war, wählten meine Vorfahren die alte Sarazenenfestung zu ihrem Wohnsitz. Es gibt dort vier mächtige Türme, gekrönt von sarazenischen Zwiebelkuppeln. Wir Kinder sind allerdings nur im Palazzo Reale, wenn Gefahr droht. Es gibt angenehmere Orte als die alte Festung: die Zisa, die Favara, den Parco und die Cuba. Alles Paläste des Königs, aufgereiht auf den Hügeln um die Stadt wie Perlen an einer Kette. Die Zisa ist mein Lieblingsort, erbaut vor der Porta Nuova im Nordwesten der Stadt. Sie ist umgeben von einem Meer von Olivenbäumen, deren schmale, silbrige Blätter wie tanzende Lichter im Wind zittern. Obsthaine und Gärten werden durchzogen von künstlichen Wasserläufen, die eine Vielzahl von Fischteichen speisen. Rund um den Eingangsbogen verläuft eine schnörkelige arabische Inschrift, die Safirah mir übersetzt hat: »Hier sollst du, so oft du es wünschst, das schönste Besitztum dieses Königreiches sehen, das Glanzstück der Welt und des Meeres. Dies ist das irdische Paradies, dieser König ist der Musta’iz, der Ruhmreiche, dieser Palast der Aziz.« Aziz heißt auf Arabisch schön, und mit dem »Ruhmreichen« ist natürlich mein Bruder Wilhelm gemeint, der die Zisa erbauen ließ.
Ich bin gerne in der großen Mittelhalle. Hier gibt es Nischen, die aussehen wie Höhlen mit hängenden Steinzapfen. Und Bilder, die ich jeden Tag bewundere: Medaillons, auf denen zwei Jäger mit dem Bogen nach Vögeln auf einem Baum schießen. Auf denen Pfauen gierig Datteln von Palmen picken. Wo beleidigte Hirsche einander kampfbereit gegenüberstehen. Aus der hinteren Wand entspringt eine Quelle, das Wasser ergießt sich in dickem Strahl in treppenartig gestufte Becken, bis es schließlich nach draußen in den Fischteich fließt. Drinnen ist es immer angenehm kühl, und das unerbittlich gleißende Sonnenlicht des sizilianischen Sommers dringt nur gedämpft herein. Vom Mitteleingang führt ein Brücklein zu einer Pavilloninsel in einem großen Teich. Von hier bin ich eines Winters einmal ins Wasser gefallen, es gab eine ungeheure Aufregung, man zog mich tropfnass heraus, und ich musste zwei Tage im Bett bleiben, weil ich Schüttelfrost bekam.
Die unbeschwerten Zeiten sind selten von Dauer. Immer wieder werden sie unterbrochen von geheimnisvoller Aufregung, wilder Betriebsamkeit, kaum verhüllter Panik. Dann kommen Männer mit Waffen, wir müssen hastig in einen anderen Palast umziehen, die Diener tuscheln ängstlich auf den Treppen, und wir dürfen unsere Zimmer im Harim nicht verlassen. Anfangs ist uns Kindern nicht klar, was geschieht, aber mit der Zeit lernen wir, die Ohren zu spitzen, wenn die Diener reden. Wir wissen nun: Es sind die Barone! Sie führen aufrührerische Reden, zetteln Verschwörungen an, ja, sie versuchen sogar, meinen Bruder mit Gewalt zu stürzen und die Hauteville-Dynastie, unsere Familie, zu vernichten. »Sie sind wie Skorpione«, höre ich einmal meinen Bruder sagen, »man weiß nie, wann sie zustechen.« Ich erinnere mich noch genau, wie ich eines Nachts wieder einmal geweckt und Hals über Kopf in den sicheren Palazzo Reale gebracht wurde, bei Regen und Nebel. Da plötzlich sprang ein Mann auf meine Kutsche zu, sein Dolch blitzte auf, und ich sah sein hassverzerrtes Gesicht. Dann eine schwarze Gestalt auf einem Pferd, ein erhobener Arm, ein Schlag, und der Angreifer war verschwunden. Ich merkte erst, dass ich schrie, als mich meine Amme fest in die Arme nahm und an sich drückte. Von diesem Augenblick an wusste ich, dass mein Leben nicht sicher war. Diese Angst hat mich meine ganze Kindheit hindurch begleitet. Ich hatte gelernt, wie brüchig der Frieden im Land war. Es gab tödliche Schlangen im Paradies.
Zwischendurch, wenn alles sicher ist, durchstreife ich mit Safirah, dem Eunuchen Calogero und den Jungen die Gassen von Palermo. Das sind unsere schönsten Stunden, wenn wir im Hafen mit den anderen Kindern Murmeln spielen und unsere Amme ärgern können, indem wir uns hinter den Fischständen verstecken. Jeder Ausflug in die Stadt ist ein großes Abenteuer. Allein die Düfte: Gewürze, Salz, Weihrauch, Gebratenes, Gesottenes, Süßigkeiten, Balsamöle. Und Fisch, immer wieder Fisch. Das Geschrei der Möwen, das Stimmengesumm der Leute. So viele Menschen! Sarazenen mit bunten Turbanen, langbärtige Juden, Normannen, die man an ihren Lederstiefeln und dem blonden Haar erkennt, Griechen mit Ohrringen und dicken Schriftrollen in der Hand. Man hört ein Gemisch aus Arabisch, Latein, Griechisch und Volgare, und weil wir Kinder alle Sprachen des Königreichs lernen, jede mit einem anderen Lehrer, verstehen wir so manches. Eine ganze Menge Schimpfwörter schnappen wir auf bei diesen Ausflügen, die wir natürlich bei nächster Gelegenheit anwenden, so lange, bis man uns droht, uns nicht mehr in die Stadt zu lassen.
Ich bin sechs Jahre alt. Wieder einmal wütet ein Adelsaufstand, und diesmal ist es noch ernster als sonst. Die ganze Familie hat sich in den Palazzo Reale geflüchtet, tagelang halten wir uns im großen Saal im Pisanischen Turm auf, dem sichersten Ort in ganz Palermo. Da brechen die Feinde durch die Tür, bis an die Zähne bewaffnet, die Palastgarde hat sie nicht aufhalten können. Zwei der Verschwörer stürzen sich mit dem Schwert auf den König, aber jemand wirft sich dazwischen und rettet ihm das Leben. Ich bin schreckensstarr, sehe, wie unsere Eunuchen getötet werden, der Harim gestürmt, die Dienerschaft zusammengetrieben. Schwerter blitzen, Pfeile sirren. Und dann ist da ein schriller, entsetzlicher Schrei, der mir durch Mark und Bein fährt. Es ist die Königin. Ich folge ihrem Blick: Da kniet Roger. Seine Hände umklammern einen verirrten Pfeil, der tief in sein linkes Auge gefahren ist. Blut quillt ihm durch die Finger. Wir laufen zu ihm und halten ihn, er zuckt und röchelt, und dann ist er tot.
Heute noch sehe ich meines Bruders Gesicht, als er seinem ältesten Sohn die Augen schloss, das Gesicht eines uralten Mannes. Er hat die Krone am Ende behalten, aber seinen Erstgeborenen verloren. Und mir ist zum ersten Mal im Leben der Tod begegnet. Es dauert lange, bis meine bösen Träume wieder verschwinden, aber schließlich hilft der dickflüssige Mohnsaft, den mich Safirah abends schlucken lässt. Wir Kinder vermissen Roger schmerzlich. Statt seiner ist nun Wilhelm unser Anführer – und der neue Thronfolger. Sein Leben ändert sich dadurch, und gleichzeitig auch das von mir und Aziz. Wilhelm muss nun viel mehr lernen, muss sich auf die Regierung vorbereiten. Wir anderen beiden teilen sein neues Leben, denn er braucht uns. Auch er hat seit dem Überfall auf den Palazzo Reale Angstträume, noch viel schlimmer als ich. Er ist traurig und still geworden. Die Geschichten über Kaiser und Papst, die unser Lehrer Petrus von Blois erzählt, können ihn nur wenig ablenken. Magister Petrus ist ein großer Gelehrter. Er kann wunderbar die Welt erklären, und ich sauge jedes einzelne seiner Worte in mich auf. Ich lerne, dass die Kunst der Glasherstellung auf die Phönizier zurückgeht. Dass die Araber die Zitronen gebracht haben, die Bitterorangen, den Maulbeerbaum, die Datteln, das Zuckerrohr! Dass Palermo von den Phöniziern gegründet wurde. Nach ihnen kamen die Römer, dann die Byzantiner, schließlich die Sarazenen und dann wir Normannen, die wir ja unsere Wurzeln in Frankreich haben. Dass die Insel viele Völker und Kulturen beherbergt und wir, die Dynastie der Hauteville, alles zusammenhalten müssen. Ich bin stolz darauf, dass mein Großvater Roger sich ganz Sizilien unterworfen hat und mein glorreicher Vater als erster Herrscher die Königskrone trug. Wir haben das Land zum Königreich erhöht, und ganz Europa beneidet uns seither um unsere Macht und unseren Reichtum!
Das alles macht mich stolz, aber Wilhelm jagt es eher Angst ein. Er vermisst Safirah, die nur noch selten bei uns ist – wir sind inzwischen zu alt für eine Amme. Er tut mir leid. Und die bösen Erlebnisse reißen nicht ab. Diesmal ist es kein Aufstand der Barone, sondern ein Aufbäumen der Natur. Ich weiß es noch wie heute: Wir sind in Messina im Königspalast, es gibt ein großes Festgelage für Gäste aus dem dortigen Adel und die Geistlichkeit. Die Tafeln biegen sich, Zimbeln, Trommeln und Flöten erklingen zur Unterhaltung. Junge Mädchen in blutroten Schleiergewändern lassen ihre Hüften kreisen, die goldenen Schellen an ihren Fußknöcheln bimmeln fröhlich. Wilhelm und ich sitzen unter dem riesigen Süßspeisentisch, verborgen vom bodenlangen Tischtuch. Gierig stopfen wir uns mit Blancomangiare und klebrigem Dattelkonfekt voll und grinsen uns verschwörerisch an. Eigentlich müssten wir längst im Bett sein, aber wir haben uns einfach versteckt. Da plötzlich erzittert der Boden unter uns. Voller Angst kriechen wir unter dem Tisch hervor – doch auch hier ist der Boden nicht fest. Alles läuft durcheinander, die Wände scheinen zu wanken. Wir rennen irgendwohin, »Aiutamicristo!«, schreit jemand, ein anderer »Ya salam!«. Eine Säule stürzt ein, zusammen mit einem Teil der Decke, Mauersteine prasseln auf uns herab. Plötzlich ist Wilhelm nicht mehr da! Ich fahre herum – da liegt er, Brocken von der Säule sind auf ihn heruntergestürzt. Seine Augen sind geschlossen, da ist Blut an seinem Kopf und überall. Ich laufe zu ihm hin und rüttle ihn. Ich muss weinen. Jetzt ist auch er tot wie Roger! Da greifen zwei Hände nach mir – eine Frau aus der Stadt, die ich nicht kenne, hebt mich einfach hoch und trägt mich fort. Ich wehre mich, aber sie sagt nur: »Schscht. Tommasina bringt dich weg, picciridda, keine Angst.«
An diesem Tag hat das Erdbeben Sizilien schwer geprüft. Es hat einen Teil von Messina ins Meer stürzen lassen. Der königliche Palast, der sich »wie eine weiße Taube am Rand des Wassers erhob«, wie der große Ibn Jubair einst schrieb, steht nicht mehr. Catania wurde völlig zerstört. Es gab unzählige Tote und noch mehr Verletzte. Lange war ich davon überzeugt, dass Wilhelm auch tot sei. Safirah sagte, das stimme nicht, aber ich dachte, sie lügt, weil sie mich wochenlang nicht zu ihm ließen. Dann endlich kam er wieder zum Unterricht, bleich und dünn. Als ich ihn sah, glaubte ich an einen Geist und bekam vor lauter Schreck selbst hohes Fieber. Und dann war Tommasina wieder da. Ich hatte im Fieber immer wieder nach ihr gerufen, und man hatte sie geholt. Ich weiß nicht, warum, aber ich fühlte mich bei ihr einfach sicher und geborgen. Sie hatte mich aus dem Chaos errettet! Ich wünschte, dass sie als meine Dienerin bei mir blieb, und der König, glücklich, dass wir Kinder noch am Leben waren, erlaubte es.
Drei Jahre später, am zweiten Samstag nach Ostern, herrscht Totenstille im Palazzo Reale. Räucherwerk erfüllt die Luft, es ist zum Ersticken. Die Hitze ist unerträglich, man könnte glauben, es sei schon August, so schwül ist es. Niemand spricht ein Wort; die Dienerschaft verrichtet ihre Arbeit stumm und bedrückt. Denn alle wissen: Der König, mein Bruder, liegt im Sterben. Die Ruhr und das Fieber haben seinen Körper geschwächt, nichts mehr kann er bei sich behalten. Die Augäpfel eingetrocknet, die Haut gelb und dünn wie Pergament, das schwarze Haar strähnig und schweißnass, so liegt er da, als uns Erzbischof Romuald von Salerno zum Abschiednehmen in die Schlafkammer holt. Der Atem des Königs geht schwer. Er sieht geschrumpft aus und greisenhaft, ein Fremder. Ich bin ganz zittrig, als man mich an sein Lager schiebt. Er kann nichts sagen, aber er versucht ein Lächeln und macht eine segnende Handbewegung. Dann bin ich weg, und Wilhelm ist an der Reihe. Mit einem Aufschrei wirft er sich über seinen Vater. »Du sollst nicht sterben«, schluchzt er. Der König legt seinem Sohn die kraftlose Hand auf den Kopf. »Du … wirst … mir … Ehre … machen«, röchelt er. Jemand zieht Wilhelm fort, und wir müssen aus dem Zimmer. Noch hat sich die Türe nicht hinter uns geschlossen, als ein Aufseufzen wie ein Windstoß durch den Raum geht. Am Nachmittag des 7. Mai 1166, um drei Uhr, ist der König von Sizilien tot.
»Jetzt bist du König«, flüstere ich Wilhelm zu.
Er ist blass. »Das will ich gar nicht sein«, sagt er und reibt sich dabei die Augen mit beiden Fäusten. »Und was ist, wenn ich auch sterbe? So wie Roger?«
Ich stehe da und überlege. Ja, was ist dann? Und auf einmal trifft es mich wie ein Schlag. Kein einziges Mal habe ich ernsthaft daran gedacht, aber: »Dann werde ich Königin«, sage ich und lausche voller Staunen dem Nachklang meiner eigenen Worte. Plötzlich bekomme ich Angst. Dann schüttele ich den Gedanken unwillig ab. Das wird nicht geschehen, sage ich mir. Nie.
2 Palermo, Frühjahr 1169 und 1172
»Ich lasse den Kerl vierteilen!« Wilhelm wirft den geätzten Silberpokal, aus dem er gerade trinken wollte, gegen die Wand. Roter Wein spritzt über die glasierten Kacheln und läuft in Rinnsalen zu Boden. »Behim! Halluf! Schakat!«
Konstanze hebt den Pokal auf. »Du sollst nicht auf Arabisch fluchen. Das versteht die ganze Dienerschaft.«
»Je m’en fiche!« Der junge König wechselt wieder zum Französischen. Gerade hat er erfahren, dass der Kanzler Stephan de Perche den Umsturz plant. Er selbst, Wilhelm, soll umgebracht werden, dann will de Perche seine Mutter, die Königinwitwe, heiraten und die Herrschaft übernehmen.
Wilhelm ist außer sich. Er packt Konstanze an beiden Schultern. »Du reitest mit zwanzig Mann von der Palastwache sofort zu Jordanus nach Castrogiovanni, und da bleibst du, bis es wieder sicher ist.«
»Und du?« Sie hat es jetzt mit der Angst bekommen.
»Ich werde mir diesen Schweinekerl vorknöpfen!« Er klingt nicht mehr wie ein Vierzehnjähriger. Seit er die Krone trägt, ist er erwachsen geworden. Bei der Krönung hat er noch ausgesehen wie ein blonder Engel, jetzt haben seine Züge nichts Kindliches mehr.
Auch Konstanze ist reifer als ihre Jahre. Sie verliert keine Worte mehr, sie weiß, dass es jetzt auf jede Sekunde ankommt. Mit wehenden Gewändern läuft sie in die Frauengemächer. »Tommá! Schnell, pack das Wichtigste ein, wir müssen weg! Tommá? Tommasina?«
Ein Mann verstellt ihr den Weg, ihr verschlägt es den Atem. Sie dreht sich um, rennt los – geradewegs in die Arme des nächsten Bewaffneten. Er hebt sie hoch, sie kreischt, schlägt um sich, strampelt. Umsonst. Der Mann wirft ihr eine Decke über den Kopf und trägt sie einfach fort.
Man steckt sie in eine Kiste. Sie hat Angst, zu ersticken. Verzweifelt ringt sie nach Luft, aber dann merkt sie, dass sie genug bekommt, wenn sie ruhig liegenbleibt und gleichmäßig atmet. Ich will nicht sterben, denkt sie, Gott, lass mich nicht sterben. Die Zeit scheint endlos lang, es holpert und schüttelt. Dann wird die Kiste getragen, schräg, wohl eine Treppe hinauf. Jemand öffnet den Deckel, und sie müht sich heraus. Alle Glieder tun ihr weh.
Da steht Stephan de Perche. Sie kennt ihn gut, den Günstling ihrer Schwägerin, der Königinwitwe. Er ist jung für sein Amt, aber die Machtgier macht seine mangelnde Lebenserfahrung wett. »Gott sei Dank, Princesse Constance, Ihr seid in Sicherheit«, sagt er jetzt.
Sie richtet sich auf, funkelt ihn an. »Ich war in Sicherheit, Monsieur! Ihr habt mich entführen lassen!«
»Oh, nicht doch, ma chère. Ich ließ Euch wegbringen, damit Ihr nicht das Schicksal Eures Neffen und Königs teilt. Er dürfte inzwischen tot sein.«
Sie schließt die Augen, schwankt. Assassino, denkt sie, Mörderschwein. Du wirst mich nicht weinen sehen. »Und warum wollt Ihr ausgerechnet mich verschonen?«, fragt sie.
De Perche breitet die Arme aus. »Ich bin kein Schlächter, Constance. Ich lasse Euch die Wahl: In Kürze wird mein Bruder aus Frankreich hier ankommen. Er ist ein angenehmer Junge, nicht besonders hübsch vielleicht, aber seine Herkunft und sein Ruf sind tadellos. Heiratet ihn, und Ihr werdet von mir keinen Ärger mehr bekommen.«
»Und Ihr nehmt die Königinwitwe.« Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. »Aber das genügt nicht. Sie ist keine Hauteville. Ihr braucht jemanden aus der Blutlinie der sizilianischen Könige, der sich mit Euch und Eurer Familie verbindet.«
»Touché!« De Perche schiebt die Unterlippe vor und nickt anerkennend. »Ihr seid ein kluges Mädchen. Dann wisst Ihr ja auch, was gut für Euch ist.«
»Nein.«
»Wie?«
»Nein. Ich werde niemanden heiraten, schon gar nicht Euren Bruder. Ich mache mich nicht gemein mit Thronräubern.« Sie zittert, vor Angst oder vor Wut?
De Perche zuckt mit den Schultern. »Nun, dann dürft Ihr gerne noch ein wenig meine Gastfreundschaft genießen, Princesse. Lasst es mich wissen, wenn Ihr Eure Meinung geändert habt.« Er wendet sich zum Gehen. »Und lasst Euch nicht zu lange Zeit. Ihr solltet Euren Wert nicht überschätzen.«
Dann ist er fort. Zwei Männer ergreifen sie und bringen sie in einen fensterlosen Raum. Die Tür fällt hinter ihr ins Schloss. Es ist dunkel. Sie ist allein.
Daran denkt sie jetzt, vier Jahre später, als sie mit Wilhelm unter den Arkaden der Favara spazierengeht. Ihr Neffe hat die Verschwörung überlebt, damals. Das Volk und die Barone haben sich auf seine Seite gestellt und Stephan de Perche mitsamt seiner Mörderbande vertrieben. De Perche ist inzwischen tot, die Königinwitwe in allen Ehren kaltgestellt. Sie hat den Verräter geliebt, das war ihre einzige Entschuldigung. Als ob Liebe genug sei, um ein Land zu regieren. Wilhelm hat es nicht übers Herz gebracht, seine Mutter zu bestrafen. Er ist ein guter Mensch. Schließlich hätte sie seinen Tod in Kauf genommen.
Jetzt schmiedet er selber seit einiger Zeit Heiratspläne. Es gab verschiedene Verhandlungen, unter anderem mit dem englischen Königshof, die allerdings zu keinem Ergebnis führten. Danach hat er um die Hand einer byzantinischen Prinzessin angehalten, und Kaiser Manuel Komnenos hat sie ihm zugesagt. Vor zwei Wochen ist die Braut in See gestochen, und heute wird ihre Ankunft mit Freude erwartet. Alles ist herrlich herausgeputzt, die Paläste sind geschmückt, die Häuser von Palermo mit Blumen bekränzt.
»Bist du aufgeregt?«, fragt sie Wilhelm, der sichtlich blass ist.
Er nickt. »Es wird ein großer Augenblick sein. Mit dieser Hochzeit steigt unsere Familie endgültig in die Reihe der gekrönten Häupter Europas auf. Wir sind keine Herrscher zweiter Klasse mehr, keine dahergelaufenen Emporkömmlinge aus dem Cotentin. Jetzt kommt die Anerkennung durch die alten Dynastien, die unser Vater sich immer gewünscht hat. Sizilien ist als Königreich endgültig angenommen.«
»Ich wäre eher aufgeregt, weil ich gleich meine Ehefrau zum ersten Mal sehen würde«, meint Konstanze.
»Maria?« Er zuckt die Schultern, aber sie spürt, wie sich sein Körper verkrampft. »Es wird schon gehen mit ihr.«
Man weiß, dass die byzantinische Braut unglücklich ist. Angeblich ist sie in einen anderen Mann verliebt. Sie soll damit gedroht haben, sich umzubringen.
»Du musst sehr freundlich zu ihr sein«, bittet sie. »Sie kommt ganz allein hierher in die Fremde. Bestimmt fürchtet sie sich vor dir und allem anderen.«
»Vor mir?« Wilhelm lacht gezwungen. »Vor mir muss sie keine Angst haben.«
Konstanze runzelt die Stirn. Er ist so merkwürdig heute. Was hat dieses seltsame Gerede zu bedeuten? »Willst du mir nicht sagen, was dich bedrückt?«, fragt sie.
Er atmet tief durch. »Weißt du, Constance – eigentlich will ich gar nicht heiraten. Vor allem nicht ein Mädchen, das ich noch nie gesehen habe und das mir womöglich überhaupt nicht gefällt. Ich tue das nur für mein Land.«
Sie streicht ihm liebevoll übers Haar. »Sie ist bestimmt hübsch und verliebt sich sofort in dich. Wie sollte sie nicht? Alle lieben dich!«
In diesem Augenblick kommt ein Bote, zitternd vor Aufregung. Er wirft sich vor Wilhelm auf die Knie. »Mon roi, verzeiht. Das Schiff aus Byzanz hat eben im Hafen angelegt, aber die Prinzessin ist nicht an Bord.«
Der junge König zuckt zusammen. »Bist du sicher, Omar?«
»Ja, Vergebung. Der Kanzler wird bald nachkommen und Euch die Nachricht bestätigen.«
»Geh.« Wilhelm winkt den Mann fort.
Sie sind beide wie vor den Kopf geschlagen. Konstanze folgt ihrem Neffen in die oberen Räume, wo etliche Diwane und Sitzgelegenheiten zum Verweilen einladen. Wilhelm wirft sich auf eines der Sofas, wütend. »Das ist eine Beleidigung!«, zischt er. »Wie kann dieser aufgeblasene Pfau von Komnenos mir das antun!« Er heult fast vor Zorn und Enttäuschung. »Das wird ihm noch leid tun!«
Konstanze weiß nicht, wie sie ihn trösten soll. Es ist ein Fluch mit diesen Ehen. Jeder Bauer kann heiraten, wen er will. Aber wir, denkt sie, wir sind Spielbälle für höhere Ziele von Macht und Ehre. »Für Menschen wie uns ist es schwer, eine glückliche Verbindung zu finden«, beginnt sie leise und setzt sich zu Wilhelm. »Du kannst dir keine Frau suchen, die du liebst, und ich kann auch nicht über mein Leben bestimmen. Damals, als man mich in den Kerker geworfen hat, tagelang, um meine Zustimmung zu dieser Perche-Heirat zu erzwingen, damals habe ich mir eins geschworen: Ich werde keinen Mann nehmen, den ich nicht will. Ich bin kein Mittel zum Zweck, kein Ding, das man hin- und herschiebt wie eine Dame beim Schachspiel. Über mich soll sich niemand Ansehen verschaffen oder Einfluss. Ich will selber über mich bestimmen.« Sie beugt sich ganz nah zu Wilhelm hin. »Kannst du das verstehen?«
Er wischt sich die Tränen der Wut aus den Augen. »Warum gehst du dann nicht in ein Kloster?«
Sie schüttelt so wild den Kopf, dass der Schleier fliegt. »Weil ich kein Gespenst werden will, so wie meine Mutter. Ich will leben.«
Wilhelm steht auf und geht zum Fenster. Drunten im Hof, vor den Arkaden, stehen zwei Zehnerreihen schwerbewaffneter Männer. Sie haben orientalische Kampfhelme auf, tragen Krummsäbel, auf ihren Rücken hängen Köcher mit Pfeil und Bogen. Die Palastgarde, die seit jeher aus Sarazenen besteht. Einer davon ist ihm und Konstanze vertraut wie ein Bruder. Wilhelm deutet hinunter. »Und du meinst nicht, dass es eher an ihm hier liegt?«
Sie kommt zum Fenster, wendet aber sofort den Blick ab wie ein ertappter Dieb. Aziz. Ihr Herz klopft. Sie hätte nicht geglaubt, dass Wilhelm sie so gut kennt – oder dass sie sich irgendwie verraten hat. Aber er hat recht. Nie hat sie einen anderen geliebt. Vielleicht ist es wirklich so, wie die alten Weiber munkeln – wer dieselbe Milch trinkt, wird einst Tränen schlucken. Als er vor Jahren die Kinderstube verlassen musste, weil seine Mutter als Amme nicht mehr gebraucht wurde und es sich für einen Jungen seines Standes nicht mehr schickte, zusammen mit dem König erzogen zu werden, ist sie wochenlang krank gewesen. Aber es war unumgänglich, dass ihre Wege sich trennten, sie hat das begriffen. Ihrer führte sie immer tiefer in den Prunk der herrschaftlichen Gemächer, seiner zog ihn zur Palastgarde. Er wollte ein Kämpfer werden, einer dieser gut ausgebildeten Elitesoldaten, die Verantwortung für das Leben der königlichen Familie trugen. Vielleicht war das seine Art, weiter für sie da zu sein, wenn auch nur von fern.
Sie verlor ihn nie aus den Augen. Oft sah sie ihn vom Fenster aus, wenn er auf dem Turnierplatz seine Pfeile zielgenau in das Herz einer Strohpuppe schoss. Oder sie beobachtete ihn, während er in seinem gepanzerten Wams wie versteinert Wache stand, den spitzen Sarazenenhelm auf dem Kopf, das Krummschwert an der Seite. Sie bemerkte, wie sein Körper sich veränderte, wie seine Muskeln sich durch die täglichen Übungen strafften, seine Züge härter wurden. Und manchmal, nur manchmal, trafen sich ihre Blicke.
»Ja«, sagt sie leise, »es liegt auch an ihm. Seit wann weißt du es?«
»Aziz, der Schöne«, lächelt er. »Er war schon immer dein Liebling. Seit wir klein waren, hast du nie einen anderen angesehen. Aber du kennst auch deinen Platz. Da geht es dir so wie mir. Du bist die Tochter des großen Roger, und ich bin sein Enkel. Für uns kommen nur Königskinder infrage. Ich und eine Prinzessin aus England, Spanien oder Byzanz – Letzteres ist nun wohl hinfällig. Und du, du wirst einmal Braut eines gekrönten Hauptes sein, Frankreich, England … wer weiß, vielleicht fragt sogar einmal der Kaiser an, es wäre im Interesse des Reichs.«
Schroff wendet sie sich ab. »Lieber bleibe ich allein.«
Er legt ihr versöhnlich den Arm um die Schultern. »Keine Angst, Constance, noch ist es ja nicht so weit. Auch bei mir nicht, wie du siehst. Aber irgendwann werde ich mir eine fremde Braut nehmen müssen, auch wenn mir vielleicht eine kleine Seidenspinnerin aus dem Tiraz lieber wäre. Schau, du hast wenigstens jemanden, den du liebst.«
»Amuri é amaru – die Liebe ist ein bitterer Trank, sagt Tommasina.« Konstanze wendet sich um. »Wilhelm, du warst mir immer wie ein Bruder, ich vertraue dir, und ich liebe dich. Und wenn du mich auch liebst, dann versprich mir, dass du mich nicht verschachern wirst wie ein Stück Vieh. Bevor ich einen Fremden nehme, den ich vorher nie gesehen habe und für den ich keine Gefühle hege, bleibe ich lieber allein. Ich bitte dich, Wilhelm, zwing mich später einmal zu nichts!« Sie hat seine Hand genommen und hält sie.
Warum verschließt sich sein Gesicht? Sein Kiefer verspannt sich, und er sieht ihr nicht in die Augen. »Ich will deine Wünsche so gut es geht berücksichtigen«, sagt er lau. »Aber du weißt, dass auch ich nicht immer nach freiem Willen entscheiden kann. Manchmal gibt es keine Wahl, und man muss tun, was nötig ist. Aber sei versichert: Das Letzte, was ich will, ist dein Unglück.«
Sie lässt seine Hand fallen. Warum ist er so kühl?
»Ich weiß«, sagt sie und geht.
Er hat ihr sein Wort nicht gegeben.
3 Palermo, Pfingsten 1175 Konstanze
Ich versuche, Aziz zu vergessen. Ich zwinge mich, nicht aus dem Fenster zu sehen, wenn die Garde im Hof exerziert. Ich lenke mich ab, so gut es geht, und meist gelingt es mir auch. Seit längerem schon sitze ich mit dem König im Staatsrat und beschäftige mich mit Steuereinkünften, Rechtstiteln, Privilegien und Schenkungen. Der Kronrat ist nicht besonders erfreut über meine Gegenwart, aber Wilhelm findet sie angenehm. »Du warst schon immer die Klügere von uns beiden«, sagt er, »und ich bin froh über deine Ratschläge und deine Hilfe. Den Familiaren kann ich nicht immer trauen, dir jedoch bedingungslos.« Also teile ich mit ihm die Sorgen und Geschäfte der Krone.
Dafür hat Wilhelm meine Bitte erfüllt: Er hat mich bisher zu keiner Ehe gezwungen. Obwohl in den letzten Jahren aus aller Herren Länder Anträge für mich eingegangen sind. Man ist auf mich als Heiratskandidatin aufmerksam geworden. Doch alle Anfragen hat der König für mich abgelehnt. Daraufhin glaubten die sizilianischen Barone, er würde mich lieber einem von ihnen geben. Richard von Acerra hat um meine Hand angehalten, der Gute. Dann der Graf von Andria. Viele haben um mich geworben. Sogar Tankred von Lecce, der Bastard, glaubte, gut genug für mich zu sein. Keinen von ihnen habe ich gewollt.
Jetzt bin ich einundzwanzig, und alle Welt fragt sich, warum ich immer noch nicht verheiratet bin. Schließlich bin ich eine der besten Partien Europas. Was hält den König nur davon ab, mich zu vergeben? Gerüchte schießen aus dem Boden wie Pilze. Dass ich so hässlich sei, dass man mich verstecken müsse. Dass ich seit meiner Kindheit an einer abstoßenden Krankheit der weiblichen Organe litte. In Spanien heißt es, ich habe längst den Schleier genommen, um bei meiner Mutter im Kloster zu leben. Die Deutschen mutmaßen, ich sei der Schande erlegen, und man könne mich nicht verheiraten, weil dies in der Hochzeitsnacht entdeckt würde und man mich dann zurückschicken müsste. Frankreich glaubt, ich sei die Konkubine des Königs und er wolle mich aus lauter Liebe nicht hergeben. In Byzanz dagegen munkelt man, ich sei ein Hermaphrodit, und dieses Geheimnis würde ich wohl mit ins Grab nehmen. Manchmal sitze ich mit Wilhelm zusammen, und wir müssen darüber lachen!
Warum kommen sie alle nicht auf den ganz einfachen Grund: Ich will nicht heiraten.
Eigentlich ist mein Leben doch glücklich so, denke ich. Ich regiere Sizilien und lerne mein Land jeden Tag besser kennen und lieben. Es ist unter meinem Vater und Großvater für ganz Europa ein Vorbild geworden. Unsere Regierung ist gerecht, friedlich und gesetzestreu. Wir sind ein Reich mit vielen Völkern, und keines fühlt sich benachteiligt. Die Finanzverwaltung liegt in arabischen Händen. Die Seestreitkräfte werden von griechischen Admirälen befehligt. Arabische Kaufleute bringen wirtschaftliche Blüte, Juden Gelehrsamkeit. Die heimischen Sizilianer lassen Handwerk und Landwirtschaft gedeihen. Und das Lehnswesen, eingeführt von meinen normannischen Vorfahren, hält alles zusammen. So wächst der Ruhm Siziliens von Tag zu Tag, und allenthalben beneidet man uns um unser Glück. »Das Reich in der Sonne«, so nennt man meine Insel. Und ich habe daran teil, dass dieses Reich wächst und blüht. Ja, ich bin stolz auf Sizilien, und ich liebe seine Menschen.
Aber ich liebe auch Aziz.
Es ist schwül. Der Garten der Zisa steht in seiner größten Pracht. Die Rosen sind in voller Blüte, die Bäume tragen schwer. Duftend blüht der weiße Jasmin in den Kübeln, die mit dem Schiff aus Ifriqia gekommen sind. Talwärts, unterhalb der Terrasse, wachsen an windgeschützter Stelle Johannisbrotbäume. Ich liege auf einem Diwan unter dem seidenen Sonnensegel und kann mich kaum ruhig halten. Ich habe es gewagt. Heute morgen, als der Wachwechsel der Garde vorüber war und Aziz in sein Quartier ging, bin ich ihm zufällig begegnet. Ich weiß nicht, was mir den Mut dazu gab, aber ich streifte im Vorbeigehen seinen Arm. Er drehte sich um und sah mich an, in seinen Augen stand ungläubige Hoffnung, und ich murmelte: »Heute Nacht vor der alten Steinfrau.«
Natürlich hat er sofort gewusst, welchen Platz ich meine. Als Kinder haben wir oft zu Füßen der marmorgeäderten griechischen Venus bunte Steine gesammelt. Ob er kommen wird? Ich trinke mir Mut an, mit dem schweren, süßen Wein von den Hängen des Feuerbergs. Eines der Tiraz-Mädchen bemalt mir die Hände mit Henna, hübsche Blumenranken und Sternchen lassen meine Finger schmaler erscheinen. Der Saft von Purpurschnecken auf meinen Lippen, Ambratropfen auf meinem Hals. Ich habe meine gute Tommasina als Wächterin bestellt. »Donna senza amuri é rosa senza oduri«, hat sie gelächelt. Eine Frau ohne Liebe ist wie eine Rose ohne Duft. Und dann endlich kommt die Stunde des Sonnenuntergangs. Lange Schatten zeichnen sich auf der Terrasse ab, der Himmel ist azurblau. Die Sonne hat sich zu einem glühenden Feuerball aufgebläht, so wie mein Herz, lautlos versinkt sie in einem purpurnen Schimmer, der sich am Firmament ausdehnt. Die ersten Lichter der Sterne blitzen auf. Die Luft ist erfüllt vom Duft der Wunderblumen. Er kommt nicht. Er kommt doch. Er kommt.
Mit drei Schritten ist er bei mir. Presst mich mit dem Rücken an die Steinvenus. Hält mich. Küsst mich. Einen winzigen Augenblick lang denke ich: Wie kann er es wagen? Dann spüre ich seine Lippen, seine Hände, und ich bin selig, dass er keine Angst hatte. Er duftet nach Salz und Sandel. Ich schlinge meine Arme um ihn, mein Schleier fällt zu Boden, geht es noch näher? Meine Hände fahren durch sein schwarzes, lockiges Haar, erkunden zum ersten Mal seine Schultern, tasten sich über seinen Rücken. So fühlt sich also ein Mann an, so gut, so fest, so warm. Allah, flüstert er, habibi, wo warst du so lange? Immer bei dir, sage ich.
Ein Zischen von Tommasina. Drüben beim Pavillon flackern Lichter. Aziz nimmt mich bei der Hand, und wir laufen atemlos ins Gebüsch, dorthin, wo uns niemand sehen kann.
»Hier gibt es Taranteln«, raune ich.
»Wenn sie uns beißen, müssen wir tanzen bis in den Tod«, antwortet er.
»Oder bis das Gift aus unseren Körpern geschwitzt ist.« Ich lasse mich ins Gras sinken und ziehe ihn zu mir herunter.
»Du bist mein schlimmstes Gift«, flüstert er. »Und ohne Gegenmittel.«
Ich streichle im Dunkeln sein Gesicht, ertaste den Flaum über seiner Oberlippe. »Erinnerst du dich? Einmal haben wir hier Eidechsen gefangen, und du hast ihnen die Schwänze abgerissen … ich war dir so böse. Bis mir deine Mutter erklärt hat, dass sie wieder nachwachsen.«
Er küsst meine Hände. »Ich habe nichts vergessen, Costanza. Und ich habe die ganze Zeit über gehofft, dass es dir genauso geht.«
»Mein Löwe, mein Soldat, wie konntest du zweifeln?«
»Es war nicht an mir, auf dich zuzugehen.«
Ich lege den Kopf an seine Brust. »Du hast recht«, seufze ich, »ich musste es tun.«
»Warum jetzt? Warum hast du so lange gewartet?«
Mir wird das Herz schwer. »Weil … du und ich … es geht nicht. Ich habe lange gehofft, ich würde mich daran gewöhnen.«
Himmel, ich fühle mich so geborgen in seinen Armen. Ich will nicht mehr reden. Aber er, er hört nicht auf. »Du und ich«, sagt er, »das ist keine Laune des Schicksals. Wir gehören zusammen.«
Aber ich weiß besser als er, dass es hoffnungslos ist. Wir werden niemals mehr haben als diese gestohlene Nacht. Ich will ihn nicht belügen. »Wir sind Kinder zweier Welten, Liebster. Gott ist mein Zeuge, ich würde alles dafür geben, wenn es anders wäre.«
Er küsst mich atemlos, wild, ungestüm. »Und wenn ich einen Weg finde?«, flüstert er heiser.
»Wie soll das gehen?« Meine Brust hebt und senkt sich. O Gott, denke ich, ich will ihn spüren, will ganz nah bei ihm sein, nur dies eine Mal. Nur jetzt nicht nachdenken.
»Wir könnten Wilhelm um Hilfe bitten.«
Ich schüttle den Kopf. »Ich kenne Wilhelm wie mich selbst. Er liebt uns beide, aber eine Verbindung würde er nie erlauben.«
»Dann müssen wir eben fortgehen, du und ich.« Er nestelt an meinem Kleid. »Nach Byzanz oder nach Ifriqia. Ich habe Geld geerbt von meinem Vater. Es würde für das Nötigste reichen. Ich könnte mich als Offizier verdingen.« Er beißt mich zärtlich in die Halsbeuge, knabbert an meinem Ohrläppchen. »Willst du nicht?«
Er kommt mir vor wie ein trotziges Kind. Ernüchterung packt mich. »Aziz, das ist unmöglich. Das würde Wilhelm uns nie verzeihen. Er würde uns verfolgen lassen. Es wäre vielleicht dein Tod. Vergiss nicht, ich bin eine Hauteville. Und du …«
»… der Sohn eines sarazenischen Palastbeamten, ich weiß.« Seine Finger gleiten unter mein Gewand, er streichelt mich, bedeckt mein Gesicht mit Küssen.
Ich schmiege mich an seine Brust. »Und das ist es nicht allein.«
Er hört auf, mich zu liebkosen, schweigt, eine ganze Zeit. Ich will nicht, dass es zu Ende ist, kaum dass es begonnen hat. Ich will nicht, dass der Zauber dieser Nacht vergeht. Ich will ihn lieben, will bei ihm sein. Es muss doch einen Weg geben. Vielleicht …
»Du müsstest zum Christentum übertreten«, denke ich laut. »Das wäre die Grundbedingung dafür, dass Wilhelm uns beisteht.«
Er richtet sich auf. »Ich soll meinen Glauben aufgeben? Aber … das kann ich nicht.«
Enttäuschung krallt sich in meinen Magen. »Wenn du mich wirklich liebst, warum denn nicht? Allah, Gott, welchen Unterschied macht das schon?«
»Für dich vielleicht keinen, Costanza.« Er grollt jetzt.
»Du willst, dass ich alles für dich aufgebe und mit dir fortgehe. Ich soll meine Ehre vergessen und meine Stellung. Du verlangst von der Tochter Rogers, Sizilien zu verlassen. Aber du willst nichts aufgeben?« Auch ich bin jetzt zornig.
Er lässt mich los. »Ich will, dass du auf Dinge der Welt verzichtest – du aber verlangst von mir, dass ich meine Seele verleugne! Das ist ein gewaltiger Unterschied.«
Ich möchte weinen. Alles ist verdorben. Und doch ist da immer noch mein Stolz. Ich bin die Tochter des großen Roger! Und er ein Niemand. Wer gibt denn für wen mehr auf? Und wer gewinnt mehr?
Auf einmal schäme ich mich für meinen Hochmut. Und ich spüre, dass es doch unmöglich ist. »Lass uns nicht streiten, Aziz«, bitte ich ihn und schlucke die Tränen hinunter. »Wir haben es wenigstens versucht. Aber manchmal hilft träumen und wünschen nicht.«
»Nein«, sagt er, und mir zerreißt es das Herz. »Das ist es nicht. Du willst nur nicht.«
»Aziz …«
Er schüttelt meine Hand ab und steht auf. »Ich weiß jetzt, wo mein Platz ist, Costanza.« Seine Stimme klingt kalt. »Allah schenke dir Schatten auf deinen Wegen.«
»Aziz, nicht so …« Ich will ihn umarmen, aber er stößt mich zurück.
Und dann ist er fort.
Eine Woche später steckt mir ein kleiner Mohrenknabe einen Zettel zu. Darauf steht in arabischer Schrift: »Morgen bei Sonnenaufgang legt das Schiff ab, das mich nach al Andaluz bringt. Wenn du deine Meinung geändert hast, dann komm mit mir.«
Ich packe Sachen zusammen. Packe sie wieder aus. Schreibe Briefe und werfe sie ins Feuer. Der Tag vergeht. Ich weiß gar nichts mehr. Die Nacht kommt, ich kann nicht schlafen, stehe am Fenster. Gleich wird der Tag anbrechen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Die Sonne steigt als roter Ball über den Monte Catalfano. Ein Schiff setzt Segel und gleitet langsam durch die schimmernde Bucht von Palermo.
Ich habe meine Wahl getroffen.
4 Burg Streitberg, Winter 1175
Schläfrig döst die kleine Burg im Winternebel hoch über dem Tal der Wiesent. Unterhalb, dort, wo der Fels aufhört, liegt der befestigte Fronhof, dazu ein kleines steinernes Kirchlein. Ein paar Bauernhäuser ducken sich am Hang in die Rodung, ihre Strohdächer sind reifbedeckt, aus Löchern im First quillt schwarzgrau der Rauch der Herdfeuer. Die Hofreiten sind von Palisaden und Flechtzäunen umgeben, bis hierhin kommen die Wölfe, wenn die Winter hart sind.
Es ist frühmorgens, die Hunde bellen, und die Menschen beginnen ihr Tagwerk. Eine Fronfuhre rollt über den Weg, sie hat vermutlich einen Teil des Kraut- und Rübenzehnts geladen, der nun auf die Burg soll. Die Ladung ist unter einer Plane verborgen. Hinter der Karre reiten gemächlich drei Bauern in dicken Umhängen. Die Rösser sehen ungewöhnlich gut aus, denkt sich der Wächter, das ist seltsam. Er öffnet das Burgtor weit, um die Fuhre einzulassen. Das Letzte, was er spürt, ist ein Schwerthieb, der ihm den Rücken spaltet.
Die Hölle bricht los. Unter der Plane springen Bewaffnete hervor, die Reiter haben ihre Umhänge abgeworfen und blankgezogen. Die kampffähige Besatzung der Burg besteht nur aus dem Torwart, einem Türmer und zwei Reisigen, dazu der Burgherr, der Schmied und sein jüngerer Bruder. Man war arglos; in Friedenszeiten sind nie mehr als ein paar Verteidiger in dem kleinen Felsennest. Jetzt stürmt der Edelfreie Konrad von Streitberg die Treppe zum Bergfried hinunter, das Schwert in der Hand. Er hat sich nicht die Zeit genommen, das Kettenhemd anzulegen, außerdem hätte es ihm wohl nicht mehr gepasst, er hat es seit fünfzehn Jahren nicht mehr getragen. »Albrecht von Neideck«, brüllt er, »du elender Schweinearsch, meine Burg kriegst du nicht!«
Ein mächtig gerüsteter Ritter stellt sich ihm in den Weg, breit und vierschrötig, er schwingt seinen schweren Bihänder mit erschreckender Leichtigkeit. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt.
Da: zwei helle Stimmen aus dem Fenster hoch über den Kämpfern. Es sind die Kinder des Burgherrn, der elfjährige Gottfried und die fünfjährige Hemma. Sie schreien vor Angst. Konrad von Streitberg zuckt zusammen, ist kurz unsicher geworden. In diesem Augenblick rauscht die zweischneidige Klinge mit Wucht heran und trennt ihm den Kopf vom Rumpf. Während der Körper erst auf die Knie und dann wie ein Sack in sich zusammenfällt, trudelt der blutige Schädel über den Burghof und bleibt schließlich in einer Pfütze liegen, die Zähne gebleckt.
Dann ist alles schnell vorbei. Die Burgmannen sind tot bis auf den alten Pferdeknecht, der sich im Heu versteckt hat, und die Dienstmägde. Und bis auf die Kinder.
»Du wirst mein geliebter kleiner Schwiegersohn werden«, sagt Albrecht von Neideck. Spritzer vom Blut des Vaters sprenkeln immer noch sein Gesicht. Eilig hat er es, der gierige Lump, sich das Territorium seines Nachbarn endgültig zu sichern. Gottfried versteht, worum es geht. Wenn der Neidecker einfach die Herrschaft an sich reißt, erklärt ihm womöglich der Bischof von Bamberg als Streitberger Lehnsherr die Fehde. Wenn aber der Sohn des rechtmäßigen Herrn die Tochter des Neideckers heiratet, ist es eine ganz einfache Sache der Familienpolitik. Und er, Gottfried, wird sich nicht gegen den übermächtigen Schwiegervater wehren können. Er ist ja schon froh, wenn er sich das Weinen verbeißen kann.
Er sieht zu Cuniza hinüber, seiner erklärten Braut. Sie ist ein paar Jahre älter und anderthalb Kopf größer als er, eigentlich ganz hübsch. Lange rotbraune Zöpfe fallen ihr bis auf die Hüften. Er will keine Frau. Er will seinen Vater zurück. Und seine kleine Schwester, die verschwunden ist, bestimmt auch tot. Aber da ist schon Vater Udalrich von der Dorfkirche. Die Spitze eines langen Spießes bohrt sich spürbar durch die Kutte in seinen Rücken. Der Neidecker legt seine Finger wie ein Schraubstock um Gottfrieds Nacken und zwingt ihn, sich neben Cuniza zu stellen. Dann geht alles ganz schnell. Der Priester vermählt das Paar, die anwesenden Ritter, alles Gefolgsleute des Neideckers, fungieren als Zeugen. Man rafft Brot, Geräuchertes, Sülzen und Würste aus der Küche zusammen, holt das einzige Fass Wein aus dem Keller, und dann feiern die Eroberer ihren Sieg, bis der Neidecker schließlich besoffen von der Bank kippt. Gottfried hat keinen Bissen hinuntergebracht, er hat die ganze Zeit über zu Vater Udalrich hinübergeschaut, der mit angewiderten Blicken das Gelage verfolgt hat. Schließlich geleitet man die Brautleute über die Wendeltreppe in eines der herrschaftlichen Schlafgemächer im ersten Stock.
Das Zimmer ist schon lange nicht mehr benutzt worden, allerlei Krempel steht herum, Kisten, lederne Eimer, ein Nachtscherben. Gottfried wird schmerzlich bewusst, dass es die Kemenate seiner Mutter ist. Niemand hat hier mehr geschlafen, seit die junge Burgherrin bei der Geburt ihrer kleinen Tochter gestorben ist. Der Junge fühlt sich nur noch sterbenselend. Er sieht seine Mutter weiß und kalt auf dem Totenlager liegen, zu ihren Häupten brennen zwei riesige Kerzen, drei Ellen hoch und dick wie Männerarme. Auf dem Fußboden stehen noch die aus Lindenholz gedrechselten Ständer mit den langen Eisendornen. Die Kerzen sind fort, stattdessen brennen Kienspäne an den Wänden, und das Bett ist leer. Gottfried wehrt sich nicht, als sie ihn ausziehen. Seine Nacktheit ist ihm peinlich, er flüchtet unter die kalten Laken, ein magerer, blasser Bub mit dünnen Armen und Beinen. Cuniza legt ihre Kleider hinter einem pergamentenen Wandschirm ab, wirft ein langes Hemd über und begibt sich ebenfalls zu Bett. Die Zeugen grölen besoffen und lassen das Paar hochleben. Dann fällt hinter ihnen die Tür ins Schloss. Ein Schlüssel dreht sich zweimal.