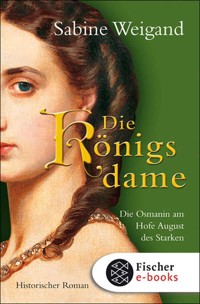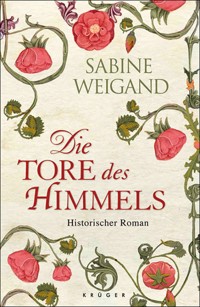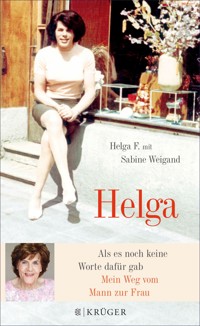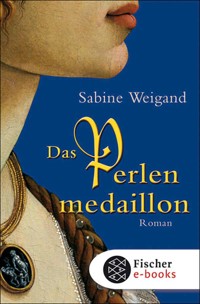
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe, Schmuggel und andere Abenteuer: Dieses Buch ist das Schmuckstück unter den Historienromanen. Für Sie Helena ist die beste Partie in der mächtigen Reichsstadt Nürnberg, aber eine verbotene Liebe verbindet sie mit dem Goldschmied Niklas. Doch der wird nach Venedig davongejagt, und Helena muss den Patrizier Heller heiraten. Anna ist die begehrteste "Hübschlerin" im Nürnberger Frauenhaus. Ihr Weg kreuzt den der stolzen Bürgerin Helena und sie hilft ihr, gegen ihren Mann den Nürnberger Rat anzurufen. Wird sie ihr Schicksal besiegen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 932
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Sabine Weigand
Das Perlenmedaillon
Roman
Roman
Über dieses Buch
Gegen ihren Willen muss Helena den Patrizier Konrad Heller heiraten. Doch eine verbotene Liebe verbindet sie mit dem Goldschmied Niklas. Nur die Briefe, die Niklas ihr über den jungen Maler Albrecht Dürer aus Venedig schickt, geben ihr noch Hoffnung – und das Perlenmedaillon, das sie zu Anna, der »Hübschlerin«, führt.
Mit Annas Hilfe wagt Helena das Unerhörte: Sie begehrt gegen ihren Mann auf, ruft den Nürnberger Rat an. Und Niklas, der in Venedig das Geheimnis des Diamantschleifens entdeckt hat, macht sich auf den Weg zu ihr. Kann sie ihr Schicksal besiegen?
Ein großer historischer Roman zwischen venezianischen Edelsteinschmugglern, Badstuben, Frauenwirten und prachtvollen Ratsfesten des späten Mittelalters.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: bürosüd°, München
Coverabbildung: Sandro Botticelli, »Weibliches Idealbildnis«
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2007
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400081-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Unsere Adresse im Internet: [...]
Schwabach, August 2004
ERSTES BUCH
Katzwang bei Nürnberg, Mai 1490
Reichsstadt Nürnberg, August, die Woche nach Laurentii anno 1494
Reichsstadt Nürnberg, Bartholomei und die Zeit danach, August 1494
Von Nürnberg über Schwabach nach Weißenburg, September 1494
Von Matrei über den Brenner nach Trient, Mitte Oktober bis Anfang November 1494
Reichsstadt Nürnberg, Februar 1495
Reichsstadt Nürnberg, Anfang November 1497
ZWEITES BUCH
Reichsstadt Nürnberg, Mai 1498
Venedig, Sommer 1498
Nürnberg, Dezember 1498
Reichsstadt Nürnberg, Freitag vor Palmarum 1499
Nürnberg, Ende April 1499
Venedig, Juni 1499
Reichsstadt Nürnberg, Tag des Fests der Heiligen Lanze, 1.Mai 1500
Venedig, September 1501
Nürnberg, Januar 1502
Nürnberg, April 1502
Nürnberg, Mai 1502
DRITTES BUCH
Nürnberg, Juni 1502
Venedig, September 1502
Reichsstadt Nürnberg, März 1503
Reichsstadt Nürnberg, März 1503
Nürnberg, Juni 1503
Venedig, 20.April 1504
Nürnberg und Oberwolkersdorf, September 1504
Venedig, 21.April 1504
Nürnberg, Mai 1505
Venedig, Ende September 1505
Nürnberg, Februar 1506
VIERTES BUCH
Nürnberg, März 1506
Venedig, Juni 1506
Reichsstadt Nürnberg, Juni 1506
Venedig, Juni 1506
Reichsstadt Nürnberg, Juni 1506
Venedig, Juni 1506
Nürnberg, Juni und Juli 1506
Venedig, Ende Juli 1506
Nürnberg, August 1506
Venedig, September 1506
Nürnberg, Ende Oktober 1506
Venedig, Anfang November 1506
Venedig, Freitag vor Lucie 1506
Venedig, Februar 1507
FÜNFTES BUCH
Oberwolkersdorf, August und September 1507
Nürnberg, März 1508
Nürnberg, April 1508
Nürnberg, Mai 1508
Nürnberg, Freitag vor Jubilate, 12.Mai 1508
Nürnberg, 17. und 18.Mai 1508
Nürnberg, die Nacht vom 18. auf den 19.Mai 1508
Nürnberg, 19.Mai 1508
Oberwolkersdorf, Mai 1513
Schwabach, August 2004
Nachwort
Unsere Adresse im Internet: www.fischerverlage.de
Schwabach, August 2004
Die segnende Hand Christi ragte aus den züngelnden Flammen. Zwei Finger wiesen anklagend nach oben auf die musizierenden Engelchen, die pausbackig an der Decke über dem Speisealtar schwebten. Es rauchte, knackte und zischte.
»Ey, holt noch mehr Gebetbücher!«
Der schlaksige Halbwüchsige mit dem Pickelgesicht und der knallrot gefärbten Igelfrisur kippte sich den Rest seiner Bierdose in den Mund, während er mit schwankenden Schritten das Feuerchen umrundete, das im Mittelgang zwischen den Bankreihen flackerte. Einer seiner Kumpane rüttelte am übrig gebliebenen Arm des hölzernen Heilands auf dem Palmesel, der trotz der Tatsache, dass das Kunstwerk aus der Zeit um 1500 stammte, nicht nachgab.
»Fuck!«
Ein wütender Tritt sorgte dafür, dass Grautier und Reiter krachend umfielen, wobei der Esel seine morschen Ohren und der Heiland fast alle Finger seiner rechten Hand verlor.
Der dritte Eindringling, ein dicklicher Baseballkappenträger mit Augenbrauenpiercing und einem Ninja-Tattoo auf der Schulter, schleppte einen Arm voller Gesangbücher und Kirchenprospekte durchs Langschiff, sichtlich behindert durch das bis in die Kniekehlen herunterschlabbernde Gesäß seiner Jeans. Unter beifälligem Gejohle der beiden anderen schmiss er alles in die Flammen, dass die Funken bis zur Decke stoben.
In einer Nische des Sakramentshäuschens stöberten die Jugendlichen zwei silberne Messpokale auf. Während zwei der Kids grölend durch die Stadtkirche turnten und mit den Pokalen Fangen spielten, holte ihr Anführer aus dem mitgebrachten Rucksack eine Spraydose. Auf der vordersten rechten Säule entstand ein grinsendes neongrünes Strichmännchen, auf der linken Säule ein umlaufendes Band mit dem beliebten Sponti-Spruch »Alle Bullen sind Schweine«. Danach fläzten sich die drei auf die Stufen vor dem spätgotischen Hochaltar – einem grandiosen Gemeinschaftswerk der weltberühmten Meister Wolgemut und Stoß –, rauchten selbst gedrehte Zigaretten und soffen billigen Wodka aus den inzwischen völlig verbeulten Silberkelchen. Schließlich, als die Glocken vom Kirchturm längst Mitternacht geläutet hatten, rafften sich die sturzbetrunkenen Halbstarken auf, kickten noch ein paar Blumenständer um und verließen die Kirche unbehelligt im Schutz der Nacht durch das Fornikantenpförtchen. Das aufgebrochene Schloss schepperte blechern, als die Holztür hinter ihnen zufiel.
Als der Messner am Morgen seinen Dienst antrat, traf ihn beinahe der Schlag.
Einen Tag später. Paul Möbius, Leiter des Schwabacher Stadtmuseums, lehnte sich in seinem Bürosessel zurück, blies mit dem Rauch seiner Zigarette Kringel in die Luft und beobachtete, wie diese gemächlich an seinen überfüllten Aktenregalen vorbeiwaberten. Möbius war Kunsthistoriker und begeisterter Sixties-Freak; tief in seinem Innern litt er unter der unabänderlichen Tatsache, dass er die wilden sechziger Jahre aufgrund zu später Geburt nicht hatte persönlich erleben dürfen. Er trug die Haare etwas zu lang und die Hosen etwas zu kurz; seine Hemden wiesen stets entweder das obligatorische Paisleymuster oder irgendwelche Op-Art-Dekors auf.
Den ganzen Vormittag hatte Möbius damit verbracht, ein Konzept für die nächste Sonderausstellung zu entwerfen. Jetzt hatte er sich einen Kaffee und die erste Zigarette des Tages verdient, bevor er sich daran machen wollte, die neuesten Auktionskataloge nach Schnäppchen durchzugehen. Möbius tat noch einen tiefen Zug. Gott sei Dank Freitag. Spätestens um halb zwei Uhr würde er im Museum alles erledigt haben und nach Hause fahren können. Dann hatte er noch Zeit für ein Schläfchen, sein obligatorisches freitägliches Entspannungsbad und ein schönes Glas Whisky, bevor er seine Freundin abholen und mit ihr in den Star Club gehen würde, das Mekka der fränkischen Sixties-Anhänger. Für heute Abend war eine englische Live-Band namens »The Psychedelic Bell-Bottoms« direkt aus London angekündigt, für Insider der Szene ein echter Leckerbissen.
Ein Klopfen riss Möbius aus seinen Gedanken. Monika Herbst, seine Halbtagssekretärin, steckte den Kopf zur Tür herein.
»’Tschuldigung, Chef, aber der Herr Dekan Müller hätte Sie gern gesprochen.«
Schon öffnete sich die Tür ganz, und der oberste Schwabacher Kirchenmann trat ins Zimmer, in der Hand eine unförmige neongelbe Sporttasche. Möbius nahm hastig die Füße vom Schreibtisch und drückte den Glimmstängel aus. Mit beiden Händen wedelte er den Rauch über dem Schreibtisch weg, während er den Dekan entschuldigend anlächelte und dabei verzweifelt überlegte, ob er diesen Termin heute wohl verschlafen hatte.
»Störe ich etwa Ihre Zigarettenpause, mein Lieber?«
Dekan Müller, dank einiger Jugendjahre als Amateurboxer ein außergewöhnlich athletischer Sechzigjähriger mit ergrautem Haarkranz, Brille und Kinnbart, stellte vorsichtig die Sporttasche ab und schüttelte Möbius über den Schreibtisch hinweg die Hand.
»Tut mir Leid, dass ich Sie so überfalle, aber es handelt sich um eine recht dringliche Sache.« Er nahm umständlich auf dem Besuchersessel Platz, rückte seinen Kragen zurecht und setzte eine düstere Miene auf. »Haben Sie heute schon Zeitung gelesen?«
Möbius schüttelte den Kopf. »Ist was passiert?«
»Das kann man wohl sagen.« Der Dekan raufte sich die spärlichen Löckchen auf seinem Hinterkopf. »Gestern Nacht waren Vandalen in der Stadtkirche! Haben mit Gesangbüchern ein Feuer gelegt, Wände beschmiert, Messgerät beschädigt, all so was. In der Kirche sieht’s aus wie auf einem Schlachtfeld. Stellen Sie sich vor, sogar dem Jesus auf dem Palmesel haben sie einen Arm abgerissen! Blasphemie ist das, reine Blasphemie!« Müller schnaubte grimmig durch die Nase, sein Doppelkinn bebte vor Empörung.
Möbius, der nicht besonders religiös war, nickte mitfühlend. »Ist ja unerhört, so was. Weiß man denn schon, wer’s war?«
»Die Polizei meint, es handelt sich um Jugendliche, die sich einen bösen Scherz erlaubt haben. Man hat einen Rucksack, etliche Bierdosen und eine kaputte Wodkaflasche gefunden. Wahrscheinlich haben die da drin eine kleine Orgie gefeiert. Scherz, pah! Mein Gott, ich darf gar nicht dran denken! Das ganze Dekanat ist in Aufruhr!«
Der Dekan zog ein Taschentuch und tupfte sich über die schweißfeuchte Stirn. »Ja, und deshalb bin ich hier«, fuhr er fort. »Wir haben ja noch Glück im Unglück gehabt. Denken Sie bloß – wenn diese Kirchenschänder auch noch die Tür zur Sakristei aufgebrochen hätten, wäre ihnen der gesamte Kirchenschatz in die Hände gefallen. Wissen Sie, das wertvolle antike Messgerät wird nämlich schon seit jeher dort in einem einfachen Holzschrank aufbewahrt. Kein Safe, keine Sicherheitsvorkehrungen – für so was ist nun mal kein Geld da, leider! Und wer hätte denn geglaubt, dass mal so was passieren würde? Heute Morgen haben wir nun im Kirchenvorstand beschlossen, alles Messgeschirr, das älter ist als hundert Jahre, als Dauerleihgabe ins Museum zu geben. Die Sachen werden ohnehin nicht mehr im Gottesdienst benutzt, und hier bei Ihnen sind sie wenigstens alarmgesichert. Schauen Sie nur, was für schöne Stücke dabei sind.«
Der Geistliche öffnete den Reißverschluss der Sporttasche, holte ein Teil nach dem anderen hervor und baute alles vor dem Museumsleiter auf. Goldene Kelche mit getriebenen Patenen, Silberpokale, Kerzenleuchter, Monstranzen und Hostienschalen verliehen Möbius’ Schreibtisch auf einmal einen nie gekannten Glanz.
Der Museumsleiter war sichtlich beeindruckt von so viel klerikaler Pracht. Er überschlug sofort mit Kennerblick den Versicherungswert der einzelnen Teile und besprach dann mit Müller noch einige Formalitäten wie Leihgabenbestätigung und eventuelle Ausstellungsmöglichkeiten. Nachdem sich der Dekan mit einem unangenehm kräftigen Händedruck verabschiedet hatte, machte sich Möbius sofort daran, die unverhofften Neuerwerbungen knapp zu inventarisieren und ins Eingangsbuch einzutragen.
»Inv. Nr. N 8742. Kelch, Silber vergoldet. Höhe 18,3 cm, Fußdurchmesser 14,8 cm. Mit Marke (Kleeblatt). Sechspassförmiger Fuß mit durchbrochenem Maßwerkrändchen. Ein aufgelegter Ring mit einem Engel hält zwei leere Wappentartschen. Am Buckelnodus sechs Einfassungen mit gepressten Glaspasten.
Inv. Nr. N 8743. Abendmahlskanne, Silber vergoldet. Höhe 22 cm, Fußdurchmesser 11,5 cm. Auf der Fußunterseite die Meistermarke I H im Queroval, daneben die Nürnberger Beschau mit Tremolierstich. Wappen an der Wandung der Kanne: in 1 der Löwe, in 2 und 3 Brandenburg, in 4 das Schwabacher Stadtwappen (Bierschöpfen). Überschrift SCHWOBACH, Unterschrift ANNO 1664.«
Möbius arbeitete konzentriert und zügig. Nach anderthalb Stunden hatte er fünf Kelche, drei dazugehörige Patenen, zwei Messkannen, eine Monstranz und eine Hostienbüchse inventarisiert. Als Nächstes folgte das kleinste Objekt des Konvoluts, ein unscheinbares braunes Ledersäckchen mit Inhalt. Möbius schnürte das abgewetzte Band auf, zog das Leder auseinander und ließ den Inhalt langsam auf seine Schreibtischunterlage gleiten. Dann besah er verblüfft, was er vor sich hatte: Es war ein silbernes Medaillon in Form eines bauchigen Fläschchens, das an einer dicken Gliederkette hing. Oben hatte das Gefäß einen Stöpsel, der offenbar früher mit einem Schmuckstein besetzt gewesen war, den man jedoch irgendwann einmal herausgebrochen hatte. Auch in der Mitte des Fläschchens befand sich eine Fassung, deren Stein fehlte. Möbius überlegte, was dieser Anhänger wohl mit dem Schwabacher Kirchenschatz zu tun haben könnte. Schmuckstück eines Geistlichen? Er verwarf den Gedanken wieder. Er klemmte sich seine Juwelierslupe ins rechte Auge und untersuchte das Stück näher. Die Gravuren waren von guter Qualität und zeigten vor allem florale Motive: Blumen, die von beinahe jugendstilähnlichem Rankengeflecht umgeben waren, dazwischen verdrehte Silberbänder mit aufgetropften Noppen und Kügelchen. An den Bändern und Seiten entlang zogen sich mehrere Reihen von winzigen Perlen, von denen ein Großteil schon ausgebrochen war. Das Schmuckstück musste einmal mit Perlen geradezu übersät gewesen sein. Zur Mitte des abgeflachten Fläschchens wies eine goldene Korona, deren Strahlen sich an der leeren Fassung trafen, die einmal einen Edelstein von beträchtlicher Größe gehalten haben musste. Links und rechts am Flaschenkörper befanden sich zwei kleeblattförmige Ösen, durch die die Kette lief. Unter einer der Ösen bemerkte Möbius ein kleines Silberscharnier. Vorsichtig schob er den Fingernagel seines Daumens auf der gegenüberliegenden Seite zwischen die Randwülste und drückte die Teile auseinander. Mit leichtem Klacken sprang das Medaillon auf – doch zu Möbius’ Enttäuschung war es innen leer.
Der Museumsleiter machte sich daran, die Ergebnisse seiner Untersuchung unter der Inventarnummer N 8753 und der Bezeichnung »Perlenmedaillon« ins Eingangsbuch einzutragen. Als er zum Schluss noch das Säckchen untersuchte und es dabei nach außen stülpte, fiel ihm ein Zettel entgegen. Es handelte sich um ein Stück graufleckiges Pergament, das sich beim Auseinanderfalten sofort in vier Teile auflöste. Die Schrift war durch die vielen Stockflecken so gut wie unleserlich. Möbius konnte zunächst nichts entziffern außer einer Jahreszahl am Anfang des kurzen Textes: »1687«. Mit Lupe und viel Kombinationsgabe identifizierte er noch die Wörter »Schloss Oberwolckersdorff« und »Seelgerät«. Das war alles.
»Hm. Das bringt nicht gerade viel«, brummte Möbius unzufrieden. Er stopfte alles zurück in den Lederbeutel. Mit einem Blick auf die Uhr stellte er gleichzeitig fest, dass es schon Viertel vor zwei war. Seufzend verstaute er den kompletten Kirchenschatz in dem alten Gründerzeit-Banktresor, der in einer Ecke seines Büros stand, schaltete die Alarmanlage scharf und machte sich auf den Heimweg.
Pfeifend fuhr Möbius mit seinem alten Golf Richtung Nürnberg, wo er in der Südstadt ein Zweizimmerappartement mit Balkon bewohnte. Es war ein angenehm warmer Tag, die Sonne schien aus einem makellos blauen Himmel, über den puffige kleine Wölkchen zogen. Möbius’ Stimmung hob sich mit jedem Kilometer, während er immer noch über das Perlenmedaillon sinnierte. Soviel war klar: Der auf dem Zettel erwähnte Ortsname Oberwolkersdorf bezog sich mit Sicherheit auf das heutige Wolkersdorf, eine 4000-Seelen-Gemeinde, die direkt auf Möbius’ Heimweg an der B 2 lag. Und er erinnerte sich, dass es in dem Ort tatsächlich ein Wasserschloss gab, in dessen Innenhof die Wolkersdorfer Laienspielgruppe manchmal Theaterstücke aufführte. Hatte nicht unlängst in der Zeitung gestanden, dass das alte Gemäuer nun schon seit längerem leer stand und per Zwangsversteigerung an die Sparkasse gefallen war?
Möbius war sich nicht sicher. Einer plötzlichen Eingebung folgend beschloss er, den kleinen Umweg zu machen und das Schlösschen in Augenschein zu nehmen. Mit quietschenden Reifen bog er von der Wolkersdorfer Hauptstraße in einen Nebenweg ab, der zunächst an der Kirche und einigen alten Bauernhöfen vorbeiführte. Schließlich entdeckte er etwas versteckt neben einem Ententeich eine alte Mauer mit hölzernem Doppeltor. Dahinter erhob sich ein kleines burgähnliches Gebäude mit Satteldach, fränkisch rot-weiß gestrichenen Fensterläden und drei niedrigen Türmchen an der Seite. Das musste es sein.
Neugierig stieg Möbius aus. Das Anwesen wirkte verlassen. Außer dem Gequake der Enten und fernem Pferdegewieher war kein Laut zu hören. Über den gepflasterten Weg, der zum Tor führte, kroch eine fette Weinbergschnecke und zog eine glitzernde Schleimspur hinter sich her. Möbius stieg über das Tierchen hinweg und besah sich den Eingang. Ein Namensschild, das neben dem Tor an der Mauer gehangen hatte, war offenbar erst kürzlich abmontiert worden. Der Museumsleiter fasste sich ein Herz und drückte probeweise die gusseiserne Klinke – ganz wider Erwarten ging das Tor auf.
Drinnen im Hof stieß er zunächst auf einen Haufen Gerümpel. Alte Matratzen gaben sich ein chaotisches Stelldichein mit kaputten Möbeln, Autoreifen, Brettern und sonstigem Hausrat. Eine bunte Katze sonnte sich auf einem zerfransten Abstreifer, schrak aber auf, buckelte und lief davon, als sich der Museumsleiter näherte. Eine Wildnis, die einmal ein Barockgarten gewesen sein musste, umgab das Gebäude. Das Schloss selber war auf der Ostseite überwuchert von Blauregen und Efeu. Bis zum Dach hangelten sich die Triebe und Ranken, sodass Möbius unwillkürlich an das Grimmsche Märchen vom Dornröschen denken musste, mit dem ihn seine Oma früher so oft in den Mittagsschlaf gezwungen hatte. Er ging die breite Außentreppe hoch und inspizierte das quadratische Gebäude, nicht ohne versuchsweise an den beiden Türen zu rütteln, die er fand. Diesmal hatte er weniger Glück. Nur ein Fenster, dessen Glas zu Bruch gegangen war, erlaubte einen kleinen Blick in einen der Innenräume. Alles war leer bis auf einen alten Ölofen und mehrere heruntergerissene Vorhangstangen. Ein Teil der hölzernen Bodendielen war durchgebrochen, und von der Wand, die ein aufgetünchtes grünes Rankenmuster zierte, blätterte großflächig der Putz.
Möbius ging weiter durch den sonnigen Schlosshof, in dem über buckligen alten Steinen Gras und Blumen wuchsen. In einer gemauerten Rinne gluckerte Wasser, in dem ruhig und gemessen eine einsame Forelle schwamm. Daneben, im Schatten eines alten Holunderbusches, glotzte ein fetter steinerner Karpfen von einer halbhohen Säule, auf dem ein zipfelbemütztes Männlein ritt und fröhlich grinsend eine Angel schwang. Möbius ließ sich von der verwunschenen Stimmung einfangen, die das Wasserschlösschen ausstrahlte. Er setzte sich ins Gras, lehnte den Rücken gegen die warme Rinde eines knorrigen Apfelbaums und genoss blinzelnd die Wärme des Nachmittags. Eine Biene summte um ihn herum, während vor seinen Füßen geschäftig eine Karawane rotbrauner Ameisen krabbelte. Vom Apfelbaum aus flog eine Amsel auf das ziegelgedeckte Türmchen neben dem Eingangstor, beobachtet von der bunt gefleckten Katze, die wieder aufgetaucht war, und Möbius hatte plötzlich das wohlige Gefühl, als sei die hektische Welt dort außerhalb der Mauern Meilen weit weg. Sein Körper entspannte sich. Mit einem Lächeln auf den Lippen schloss er die Augen und begann zu dösen …
ERSTES BUCH
Auszug aus dem Kirchenbuch der Pfarrei Schwabach
In pagis.
Item Geburten, Ehschließungen, Tauffen & Sterbefäll so vorkommen in der Familia des Bartholomeus Schwab, Bauer aufm Buckgütlein; villa Regelspach bei Schwobach.
Anno 1469, Sonntag Misericordia Domini. An dißem Tag sind erschinen vor mir der Bauersmann Bart. Swab von Regelsbach, im 29. Jar, mit der Barb Oetterin von Kammerstein, im 18. jar, die wollten umb Gots willen den Segen für iren Bundt. Dieweiln die Frau mit Leibs Frucht schwanger schon weit gediehn, hab ich die Eh gesloszen vorm Fornicantenpförtlein im Kirchhof. Iesus + Maria + Amen.
Anno 1469, Dienstag Jacobi. Item heut bin ich gerittten übern Pfaffensteig zu tauffen dasz Kindlein der Ehleut Schwabn zu Regelspach auf den Namen Bartel der Jünger. Got sei lob und Danck.
Anno 1470, Montag nach Exurge. Also sind heut gekomen die Ehleut Barth. Schwab mit irm todten Kindlein Bartele, das am Lungenfieber verstorben, es zu begraben in geweihtem Boden. Iesus + Maria + Amen
Anno 1471, Mittwoch nach Sanct Martinus episc. Geriten nach Regelzbach zum Buckgütlein, dorten die hl. Tauff volzogen an eim neugeborn Kindlein, genant Joannes Schwab. Gots lieb ist ewig und imerdar.
Anno 1471, Samstag nach Sanct Martinus. Den Säugling Joannes Swab, kaum vier Tag alt, zu seim Brüderlein beerdigt. Der Herr gibts & der Herr nimbts.
Anno 1474, sechster Sonntag nach Trinitatis. In villam Regelspach bei Sturm und Wetter geritten, zu tauffen das dritt Kind aufm Buckgut, ein Buben, auf den Namen Michel Antoni. Laus deo.
Anno 1476, Tag vor Epiphania dom. Item geriten durch den Schnee übern Pfaffensteig zum Buckguetlein bei Regelzbach, allda getauffet ein neugeborns Maidlein auff den Namen Anna Margretha. Kirie eleysson.
Anno 1480, Dienstag nach Egidi. Zu Regelzbach nott getaufet ein Kintlein mit eim ze grosz Kopf, dasz es nit leben kunnt. Bartolome und Bärbel Schwabin sowie dem Buben Michel und der klein Anna das Sacrament gespendt, dieweil die vier allsamt kranck vom Hunger undt mit der umlaufend Pestilenz geschlagen. Die Zeitläufte suchen das Lant derzeit schwer mit Kranckheit und Mißernte heim, Got schütz die Pauern. Das Kint Anna hat ein gar seltzsams Angesicht – ein Aug blau, das ander braun. Soll diße Merckwürdigkeit ein götlichs oder teuflisch Zeichen sein? Lebt wol eh nit mer lang, ist dürr und fiebert gar starck. Das todt misgestalt Kint hab ich mit nach Schwobach genommen, es dort zu seinen Geswistern zu versammeln. Gloria in exc. Dei.
Anno 1482, Samstag Urbani. Heut hab ich zu iren drei Kindtlein beerdiget Barbara, Ehwirtin des Buckbauern Bartel Schwap zu Regelspach, mit Todt abgangen in Gepurts wehn vor zwei Tagen, so es Gots Wille war. Dasz Kintlein, das sie getragen, ist in ir plieben und hab ichs auch mit ir begraben. Got erbarms.
Katzwang bei Nürnberg, Mai 1490
Da drüben ist die Mühle!«
Anna beschattete die Augen mit der Hand und spähte über die träge fließenden Wasser der Rednitz. Ein Stück weit weg am anderen Flussufer stand eine Ansammlung von Bäumen und kleineren Fachwerkgebäuden, die sich um ein stattliches Sandsteinhaus gruppierten. Dies musste sie sein, die Rennmühle von Katzwang, seit alters her genutzt als Mehl- und Walkmühle für den Ort selber und seine Nachbardörfer. Mühlen waren die Fabriken der damaligen Zeit; nur hier konnte man sich eine andere als die menschliche oder tierische Antriebskraft nutzbar machen. Große Wasserräder trieben komplizierte, ganz aus Holz konstruierte Mahl- und Hammerwerke an, mit denen nicht nur Getreide zerkleinert, sondern auch Tuche gewalkt oder Metallprodukte wie Messer oder Nadeln geschliffen und poliert werden konnten.
Die Katzwanger Mühle besaß zwei Mühlräder; eines davon drehte sich schnell, als das kleine Grüppchen sich dem Fluss näherte, und man konnte das Klopfen des Walkhammers weit über den Wiesengrund hören. Die Rennmüller waren schon immer wohlhabende Leute gewesen. Ihnen gehörten neben der Mühle mit dem Wasserrecht noch Wiesen, Weiher, Obstgärten und Wälder, und wie fast alle Mitglieder ihres Berufsstandes betrieben sie als Nebenerwerb noch eine lukrative Schweinezucht.
Anna, ihr Vater und ihr älterer Bruder Michel überquerten den Fluss auf einem Holzsteg nahe beim Wehr. Michel war ein hoch aufgeschossener, dunkelhaariger Sechzehnjähriger mit dem ersten Flaum auf Oberlippe und Wangen. Er zog einen wackeligen Karren hinter sich her, der die gesamte Habe der Familie barg: Zwei irdene Töpfe, eine Eisenpfanne, Decken und Leintücher, drei rupfene Säcke, ein paar Lederstiefel und eine Kiste mit sonstigem Hausrat. Obenauf war ein Stall aus Korbgeflecht gebunden, in dem zwei magere Hühner aufgeregt gackerten. Hinter dem Jungen lief sein Vater, ein hagerer, ältlicher Mann mit schütterem grauem Haar, gelblicher Gesichtsfarbe und eingefallenen Zügen. Dass er nicht gesund war, konnte jeder sehen. Sein Gang war unsicher, und er blieb oft stehen, um zu verschnaufen. Die vierzehnjährige Anna, ein schlankes, dunkelhaariges Kind, folgte den beiden über das Brücklein. Sie trug ein Bündel auf dem Rücken, das all ihre Schätze enthielt: einen schwarzen Sonntagsgoller, eine zweite Schürze, ein Zopfband, eine billige Ansteckfibel, die einmal ihrer Mutter gehört hatte, und einen Satz alter Haarnadeln aus Messingdraht.
Zögernd betraten die drei Neuankömmlinge den Mühlenhof. Unter der großen Linde, die einer gemütlichen Bank Schatten spendete, hielten sie inne. Es war Mittag, und der Duft von Kraut und gebratenen Zwiebeln ließ ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Seit Wochen hatten sie nichts anderes mehr gegessen als trocken Brot und Grünzeug.
Die Tür des Hauptgebäudes öffnete sich, und ein vierschrötiger Mann mittleren Alters trat in den Hof. Das konnte nur der Rennmüller sein. Anna hatte noch nie eine Achtung gebietendere Erscheinung gesehen: Der selbstbewusst vorgeschobene Bauch, das mit zinnernen Knöpfen besetzte Leibchen, das blütenreine Hemd aus feinem Leinen – alles wies Endres Preißler als reichen Mann aus. Nach seinem Großvater und Vater war er der dritte Preißler auf der Rennmühle, die er nun schon seit über zehn Jahren bewirtschaftete. Dabei war ihm seine Frau Maria in den ersten Jahren eine große Stütze gewesen, ein kräftiges, gesundes Weib, das anpacken konnte wie ein Mann. Dann hatte der liebe Gott sie mit Krankheit geschlagen – heute war sie trübsinnig und mager, sprach nicht mehr, aß kaum und brütete meist dumpf vor sich hin. Weder gutes Zureden noch Prügel, ja nicht einmal der aus der Stadt zugezogene teure Arzt hatten geholfen. Stattdessen hatte der Müller notgedrungen zu seinem ersten noch einen zweiten Knecht anstellen müssen, und der war ihm vor einem Monat auf und davon gegangen. Da kam es gerade recht, dass der junge Michel Schwab um Arbeit nachgefragt hatte. Der Bub war für sein Alter groß, und er machte einen willigen Eindruck. Außerdem brachte er seinen Vater mit, der zwar nicht recht gesund, aber bereit war, nur für Speis und Trank Hilfsarbeiten zu verrichten. Und die Kleine konnte der dicken Lisbeth, die immer mehr mit der Pflege der kranken Müllerin zu tun hatte, in Haus und Küche helfen.
Der Müller baute sich vor den drei ärmlich gekleideten, schüchternen Gestalten auf, verschränkte die Arme vor der Brust und musterte das Grüppchen mit zusammengekniffenen Augen.
»Seid ihr endlich da? Zeit wird’s!«, brummte er. Mit seiner fleischigen Hand deutete er auf den armseligen Karren und grunzte. »Ist das alles, was ihr dabei habt?«
Plötzlich wurde sein Blick von einer Bewegung bei der Linde abgelenkt. Er kniff die Augen zusammen, um sicherzugehen, dass er sich mit dem, was er da gesehen hatte, nicht täuschte. Nein, Teufel noch eins, das war ein leibhaftiger Wolfshund, der sich da unter der Bank duckte und ihn aufmerksam fixierte. Preißler fluchte.
»Gehört das Vieh da zu euch? Himmelherrgott, ihr traut euch was! Damit eins klar ist, der Hund kommt mir nicht auf den Hof.«
Anna nahm all ihren Mut zusammen und trat einen Schritt vor. »Ich bitt recht schön, Herr, Grimm gehört mir. Ich hab sie als verlassnes Junges im Wald gefunden, vor drei Jahren, und mit Ziegenmilch aufgezogen. Sie ist bräver als der brävste Hund, ich schwör’s bei der heiligen Muttergottes.«
Der Müller glaubte, nicht recht gehört zu haben. Er riss die Augen weit auf und deutete mit spitzem Zeigefinger auf das Mädchen. »Du willst mir doch nicht etwa sagen, dass das gar kein Wolfshund ist, sondern ein echter Wolf?«
Annas Stimme zitterte. »Doch«, flüsterte sie fast unhörbar. Dann straffte sich ihr Rücken. Sie hing mit jeder Faser ihres Herzens an der Wölfin und war bereit, um das Tier zu kämpfen. »Aber, Herr, schaut doch, wie zahm sie ist! Grimm, komm her, komm!«
Das Tier kroch unter der Bank vor, trabte schwanzwedelnd zu ihr hin und setzte sich erwartungsvoll auf die Hinterpfoten. Jetzt war es unverkennbar: Graues Fell, kleine Ohren, der schnürende Gang, die gelblichen Augen! Anna streichelte die Wölfin über den Kopf und sah den Müller flehentlich an. »Grimm fängt mehr Ratten und Mäuse als zwei Katzen zusammen. Und sie ist die beste Wach- und Hütehündin, die Ihr je gesehen habt, Herr. Sie kann’s Euch beweisen.«
Und bevor der Müller abwehren konnte, hatte sie schon das Kommando gegeben und in die Hände geklatscht. »Bring die Petzen, Grimm, los, bring!«
Auf der anderen Seite des Wegs grasten einige Schafe friedlich auf einer blühenden Wiese. Der Wolf lief tatsächlich hinüber, kreiste die erschrockenen Tiere ein und trieb sie unter Kläffen und Zwicken eng zusammen. Innerhalb kürzester Zeit drängten sich die Schafe aufgeregt blökend im Hof, und der Wolf sprang hechelnd an seiner Besitzerin hoch.
»Braveliebegute.« Anna lachte übers ganze Gesicht.
Der Müller hatte die Vierzehnjährige die ganze Zeit über beobachtet. Sie war schlank, ein bisschen zu mager für seinen Geschmack. Aber unter ihrem gegürteten Kittel zeichneten sich schon frauliche Formen ab, kleine spitze Brüste und runde Hüften. Sie hatte langes, glattes, in der Mitte gescheiteltes Haar von der Farbe dunkler Kastanien, und ihre Züge waren ebenmäßig, mit einer hübschen Stupsnase über erdbeerroten Lippen, die beim Lachen zwei Reihen makellos blitzender Zähne freigaben. Als Anna den Blick des Müllers spürte und zu ihm aufsah, bemerkte er zum ersten Mal ihre Augen und zuckte überrascht zurück: Ein Auge des Mädchens war leuchtend blau, das andere hingegen braun – eine Laune der Natur, die ihrem Gesicht einen eigenartigen Reiz verlieh.
Die meisten Leute, denen Anna bisher begegnet war, hielten ihre verschiedenfarbigen Augen für ein unglückbringendes Zeichen. Das Mädchen hatte deshalb ein freudloses Dasein als Außenseiterin geführt, vor allem seit dem Tod der Mutter, den irgendwelche böse Zungen ihrem Blick anlasteten. Die Nachbarn mieden sie seitdem und kreuzten heimlich die Finger hinter dem Rücken, wenn sie ihr doch über den Weg liefen. Manche raunten gar von Teufelswerk und Hexerei. Doch der Müller war nicht abergläubisch. Zumindest nicht so sehr, als dass sich beim Anblick des Mädchens nicht ein gewisser, seit Marias Siechtum stets unterbeschäftigter Körperteil geregt hätte, was all seine Bedenken hinwegfegte. Zum Kuckuck! Blau oder braun, braun oder blau – das hier war ein Happen, den er sich nicht entgehen lassen würde. Die Sache mit dem Wolf konnte man zunächst einmal abwarten – schließlich gab’s Mäuse und Ratten grad genug in der Mühle.
»Alsdann.« Preißler wies mit dem Kinn in Richtung eines Schuppens am Flussufer. »Ihr zwei Männer könnt euch drüben im Stadel einrichten. Lisbeth!«
Eine alte Magd in Schürze und Kopftuch erschien in der Haustür.
»Führ die da ins Haus und zeig ihr ihren Schlafplatz in der Kammer unterm Dach. Sie wird dir von heut an in der Küche helfen.«
»Hast Hunger?«
Anna nickte heftig. Die Magd schöpfte Kraut aus einem großen Kessel, der über dem Feuer hing, und schnitt einen Kanten Brot ab. »Da. Setz dich und iss.«
Das Mädchen ließ sich auf einem dreibeinigen Schemel am Tisch nieder und schlang gierig. Die alte Lisbeth werkelte derweil in der Küche herum.
»Bist ja ganz mager«, versetzte sie, »ihr habt wohl in letzter Zeit nicht viel zum Beißen gehabt, wie?«
Anna wischte mit dem letzten Stückchen Brot die Schüssel aus. »Mein Vater war lang und oft krank, und der Michel und ich haben den Hof nicht allein geschafft. Die letzte Ernte hat’s uns verhagelt, und dann ist auch noch die Kuh gestorben. Wer soll da noch den Zehnten und die Pacht bezahlen? An Ostern hat uns der Grundherr gesagt, dass wir gehen müssen.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Na, brauchst nicht gleich greinen.« Die Alte tätschelte Annas Rücken. »Hier habt ihr’s nicht schlecht, wirst schon sehen. Mit Essen will ich euch schon aufpäppeln, und wenn du brav arbeitest, kommen wir gut miteinander aus.«
Anna schniefte und putzte sich mit einem Rockzipfel die Nase. »Wenigstens darf ich Grimm behalten.«
»Den Wolf?« Lisbeth verzog das Gesicht. »So was hab ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Folgt aufs Wort wie ein Hund! Aber geheuer ist mir das Vieh nicht, ich will’s nicht in meiner Küche haben, hörst du?«
Anna lächelte. »Schon recht. Sie bleibt draußen, wenn ich’s sage. Der Müller ist ein guter Mensch, dass er sie mir lässt.«
Die alte Magd zuckte die Schultern, knurrte etwas Unverständliches und begann, mit Hingabe einen kupfernen Tiegel zu scheuern.
»Nimm dich bloß vor dem Müller in Acht«, brummte sie nach einiger Zeit warnend über die Schulter. »Der Endres lässt keinen Weiberrock ungeschoren, und so junge Dinger wie dich hat er besonders gern.«
Anna trat neben die Alte, griff sich einen irdenen Rührkübel und fing an, ihn mit Sand sauber zu schrubben. »Aber er hat doch eine Frau, der Michel hat’s erzählt.«
Lisbeth ließ ihren Tiegel sinken und seufzte. »Ach ja, das ist ein Kreuz mit der Maria. Ein Trumm Weibsbild war das – früher, als er sie geheiratet hat. Die hat hinlangen können! Geschafft hat die für zwei, und dabei immer ein freundliches Wort auf den Lippen. Aber dann ist ihr erstes Kind nach zwei Monaten am Friesel gestorben, und seitdem war sie nie mehr die Alte.« Die Magd brachte ihren Mund ganz nah an Annas Ohr. »Die schwarze Milch ist ihr zu Kopf gestiegen«, raunte sie. »Und es wird immer schlimmer mit ihr. Liegt nur noch im Bett und sagt zu niemandem ein Wort. Drum sucht sich der Müller seine Unterhaltung woanders«, schloss sie, »und du halt dich von ihm fern, wo’s geht … wenn du gescheit bist!«
Den ganzen Nachmittag dachte Anna über Lisbeths Warnung nach. Ihre anfängliche Freude über die neue Bleibe war einem unangenehmen Gefühl der Verwirrung gewichen. Sie war auf dem Land aufgewachsen und wusste recht gut, worauf Lisbeth mit ihrer Warnung angespielt hatte. Aber bisher hatte sie sich immer als Kind gefühlt – dass ein Mann in ihr etwas anderes sehen könnte, war ihr noch nie in den Sinn gekommen. Verstohlen tastete sie nach ihren sprießenden Jungmädchenbrüsten und fand, dass da nicht viel war, was einem Mann gefallen könnte. Außerdem war sie doch überhaupt nicht hübsch, viel zu dünn und knochig. Und das Schlimmste – ihre Augen! So wie sie war, würde sie sowieso nie einer nehmen, das hatte sogar der Pfarrer gesagt. Anna beschloss trotzdem, Endres Preißler möglichst aus dem Weg zu gehen. Und beim Abendvesper, als sich das ganze Gesinde mit dem Müller um den großen Tisch versammelte und Milchsuppe mit eingebrocktem Brot aß, sah das Mädchen die Erleichterung in den Augen ihres Vaters und war zum ersten Mal seit langer Zeit wieder glücklich.
Die ersten Wochen auf der Rennmühle vergingen wie im Flug, und die Familie lebte sich allmählich ein. Michel ging dem Müller und seinem Knecht beim Mahlen und Säckeschleppen zur Hand und stellte sich dabei ganz gut an, vor allem weil er durch das regelmäßige Essen immer besser zu Kräften kam. Man hörte den stets gut gelaunten Jungen schon in aller Frühe singen und pfeifen, wenn er das Mahlwerk in Gang setzte und die Getreidekörner in die großen Trichter schüttete. Bartel Schwab hingegen blieb schweigsam und verschlossen. Seit dem Tod seiner Frau vor acht Jahren war er vor der Zeit gealtert, und eine Krankheit nach der anderen hatte ihn aufs Siechenlager geworfen. Dennoch mühte er sich nach Kräften. An guten Tagen hackte er Holz, kümmerte sich um die Schweine, reparierte hier einen Zaun und dort ein Werkzeug und machte sich auch sonst nützlich, wo er konnte. Doch zuweilen hatten der Müller und sein Gesinde den Eindruck, der alte Bartel sei irgendwie nicht ganz richtig im Kopf – manchmal hörte man ihn seltsames Zeug murmeln, sah ihn vor sich hin gestikulierend oder fand ihn, wie er mitten im Weg stand und nicht mehr wusste, wo er hin wollte. Aber auch wenn der Bartel ein komischer Kauz war, für das bisschen, was er aß und trank, war’s gut genug.
Anna arbeitete wie ihr Bruder fleißig und mit Freude. Zum ersten Mal seit dem frühen Tod ihrer Mutter lastete nicht mehr die gesamte Verantwortung des Haushalts auf ihr, und es tat ihr sichtlich gut, nicht jeden Tag rätseln zu müssen, wie sie ihre kleine Familie mit dem Wenigen, was sie hatte, satt bekommen sollte. In der Lisbeth hatte sie eine gutmütige Lehrmeisterin und immer redselige Gesellschaft. Zu des Mädchens großer Erleichterung hatte sich die Wölfin Grimm tatsächlich als unermüdliche Ratten- und Mäusefängerin bewiesen und durfte seitdem sogar nachts im Haus bleiben, auch wenn ihr Anblick den anderen immer noch Unbehagen einjagte. Das schönste Geschenk für die Vierzehnjährige war jedoch die winzige Kammer unter der Treppe zum Dach – ein eigenes Reich, in das sie sich jeden Abend zurückziehen konnte.
Dennoch war Annas Dasein in der Mühle nicht ungetrübt, denn Lisbeths Prophezeihung hatte sich bestätigt. Erst hatte das Mädchen gedacht, die Berührungen des Müllers seien zufällig, unabsichtlich. Aber irgendwann war es nicht mehr zu übersehen, dass Preißlers Hände ganz vorsätzlich ihren Weg zu Annas Körper fanden. Am Anfang war es nur ein leichtes Streifen am Rücken oder an der Schulter, wenn der Müller eng an ihr vorbeiging. Dann eine Berührung an den Schenkeln, als Anna gerade auf einem Schemel stand, um Schmalz aus dem Regal zu holen. Und einmal glitten die Finger des Müllers wie zufällig über ihre Brust, als er ihr ein schweres Wasserschaff abnahm. Bei jeder Gelegenheit fasste er sie an, und dabei war er freundlich und tat so, als ob gar nichts gewesen sei. Anna versuchte, ihm auszuweichen, aber es gelang ihr selten. Manchmal hatte sie das Gefühl, als ob er ihr regelrecht auflauerte. Sie wusste sich nicht zu helfen und sagte deshalb lieber gar nichts. Dabei wurde es immer schlimmer. Ihr graute schon beim Aufstehen vor dem feisten, grinsenden Gesicht des Müllers und seinen tastenden Händen.
Schließlich kam die Mittsommernacht. Der uralte Brauch aus heidnischen Zeiten, in dieser Nacht mit dem Tanz um das Feuer um Fruchtbarkeit und den Segen der Götter zu bitten, war auch in christlicher Zeit nicht verloren gegangen. So versammelten sich die Bewohner der kleinen Ortschaft Katzwang, zu der nur wenige Höfe gehörten, bei Sonnenuntergang um den großen Holzstoß auf der gemähten Allmende. Auch die Mühlenbewohner gesellten sich zu der abendlichen Festgesellschaft. Die Leute waren ausgelassen, denn der Frühsommer war gut gewesen und die nächsten Monate versprachen reiche Ernte. Der Katzwanger Wirt hatte auf einem Karren ein großes Fass Bier an den Rand der Wiese kutschiert, die Bäuerinnen stapelten in flachen Körben die traditionellen, mit Sauerrahm, Zwiebeln und Speck gebackenen Roggenfladen, und der Müller hatte aus seiner kleinen Forellenzucht beim Wehr die fettesten Fische geräuchert und mitgebracht. Als das von der Dorfjugend entzündete Johannisfeuer hell aufloderte, waren alle in Hochstimmung. Das hochprozentig gebraute Bier tat seine Wirkung, und schon packte jemand eine Flöte aus und spielte lustige Melodien. Die ersten jungen Leute sprangen auf, und kurze Zeit später tanzte das ganze Dorf. Auch Anna, ihr Bruder und ihr Vater reihten sich in den fröhlichen Reigen ein, der die züngelnden Flammen umkreiste. Hie und da stob ein Funkenregen über die Tanzenden, deren Gestalten sich als schwarze Schatten vom Feuerschein abhoben.
Plötzlich stolperte Annas Vater, von zu viel Bier aus dem Gleichgewicht gebracht, über seine eigenen Füße und stürzte heftig gegen seinen Vordermann, den Katzwanger Schmied. Der, ebenfalls nicht mehr nüchtern, drehte sich um und ging sofort in Kampfstellung. Der Reigen kam ins Stocken, als der verdutzte Bartel Schwab einen ersten Haken in die Magengegend kassierte. Er versuchte, den Angreifer abzuwehren, doch der packte ihn und begann, mit ihm zu ringen. Die Flöte verstummte, und um die beiden Streithähne bildete sich ein Kreis.
»Los, Anna, schnapp dir den Vater und dann verschwinden wir!« Michel versuchte, die beiden Betrunkenen zu trennen; er hielt den Schmied zurück, während Anna ihren Vater wegzog. Doch Bartel riss sich von Anna los, taumelte wieder auf seinen Kontrahenten zu und steckte erneut einen Schlag ein. Michel kämpfte verzweifelt, um die beiden Männer auseinander zu halten, als plötzlich etwas völlig Unvorhergesehenes passierte: Bartel Schwab brach wie vom Blitz gefällt zusammen und wälzte sich zuckend auf dem Boden. Vor Mund und Nase bildete sich weißlich blasiger Schaum. Die Wölfin, die sich bisher vom Feuer fern gehalten hatte, lief aufgeregt herbei und stimmte ein lang gezogenes, klagendes Geheul an.
Anna war sofort bei ihrem Vater, riss sich das Tuch von den Schultern und schob ihm ein zusammengeknülltes Stück davon zwischen die Zähne. »So helft mir doch«, schrie sie die Gaffer an, »haltet ihn fest, damit er sich nichts tut. Es geht bald vorbei.«
Zupackende Hände hielten den Tobenden fest, bis der Anfall vorüber war und Bartel erschöpft und halb bewusstlos dalag. Anna richtete sich auf und strich sich schwer atmend eine Strähne aus der schweißnassen Stirn. Sie war plötzlich todmüde und froh, dass es vorüber war. Auf einmal hörte sie hinter sich die zornige Stimme des Müllers, der sich einen Weg durch die Menge gebahnt hatte. Mit wutverzerrtem Gesicht stand er da und fluchte, was das Zeug hielt.
»Der hat ja die Fraiß! Das habt ihr mir verschwiegen, ihr zwei Hinterfotze! Darum kann er kein ordentliches Tagwerk leisten und benimmt sich manchmal so merkwürdig, dass ich schon gedacht hab, er ist nicht ganz richtig im Kopf.«
»Der hat den Teufel im Leib«, raunte einer. Die Umstehenden schlugen angstvoll das Kreuz.
»Das wird mit jedem Hinfallen schlimmer, ich kenn das von meinem Vetter«, mischte sich ein Nachbar ein. »Der war am End ganz blöd, wie ein kleines Kind, und zu nichts mehr zu gebrauchen.«
»Ich hab gehört, man soll die mit Weihwasser besprengen! Die Fraiß ist eine Strafe des Herrgotts für irgendwas Schlimmes, was die verbrochen haben, ganz bestimmt!«, mutmaßte ein altes Weib, zog ihre Rise fest um den Kopf und schaute mit einem Ausdruck, in dem sich Angst und Verachtung paarten, auf die zusammengekrümmte Gestalt auf dem Boden.
Anna richtete sich hoch auf. »Mein Vater hat nichts verbrochen. Er kann nichts dafür, dass er die hinfallenden Siechtage hat. Vor drei Jahren ist er beim Beschneiden vom Apfelbaum gefallen und mit dem Kopf gegen einen Stein geschlagen. Zwei Tage haben wir gebetet, bis er wieder aufgewacht ist. Seitdem steht’s so um ihn.«
Die Leute redeten aufgeregt durcheinander, während Anna mit blitzenden Augen dastand, bereit ihren Vater weiter zu verteidigen.
»Sakramentkruzifix!«, murmelte der Müller halblaut vor sich hin. Anders als seine Nachbarn glaubte er zwar nicht an Teufelswerk, aber einen Hausknecht mit einem Anfallsleiden konnte er weiß Gott auch nicht brauchen. Er griff sich seinen Großknecht und Michel und schubste die beiden zu dem immer noch reglos daliegenden Bartel. »Haltet keine Maulaffen feil, ihr zwei! Packt an und tragt ihn heim. Heut ist Schluss mit Feiern!«
Stumm und betreten gingen die Mühlenbewohner nach Hause.
Von diesem Vorfall an wurde Annas Leben in der Rennmühle immer unerträglicher. Gleich am nächsten Tag, als sie im Waschhaus beim Fluss schmutzige Laken und Tücher in Seifenwasser einweichte, hatte sie wieder einmal das Gefühl, beobachtet zu werden. Sie richtete sich auf und sah den Müller mit verschränkten Armen im Türrahmen lehnen. Sein mehlbestäubtes Hemd hing ihm aus der Hose, und er hatte den abgebrochenen Stiel einer Axt unter der Achsel klemmen. Er musste ihr schon eine ganze Zeit zugesehen haben. Jetzt grinste er, trat ganz in den Schuppen und stellte sich dicht vor sie hin.
»Na, bist schon wieder fleißig?«
Seine Stimme klang harmlos und freundlich, und er zog spielerisch an einer feuchten Haarsträhne, die unter Annas Kopftuch hervorlugte. Anna begann, vor ihm zurückzuweichen, aber er drängte nach, bis sie mit dem Rücken an den steinernen Waschtisch stieß.
»Ich … ich hab viel Arbeit heut, Müller«, wehrte sie ab. »Die ganze Wäsche … «
»Wirst doch wohl ein bisschen Zeit für deinen Herrn übrig haben?« Sein bemehlter Zeigefinger glitt an ihrem Hals entlang bis an die Spitze ihres Hemdausschnitts.
»Bitte«, flüsterte Anna und drehte den Kopf zur Seite, »lasst mich doch … «
Panisch überlegte sie, was sie tun könnte, um ihn wieder loszuwerden. Der Müller kam ihr immer näher, und sie roch seinen ranzigen, säuerlichen Schweiß.
»Warum so spröd, Mädelchen? Wirst sehen, dir gefällt’s auch.« Er versuchte, mit seinen dicken, feuchten Lippen ihr Gesicht zu erreichen, doch Anna beugte den Oberkörper so weit zurück, wie es ging. Sie schob seine Hand fort, die sich zu ihrem Busen vorgetastet hatte.
Preißler gab nicht nach. »Könntest ruhig ein bisschen lieb zu mir sein, du kleines Unschuldslämmchen. Vielleicht, aber nur vielleicht, lass ich dann deinen Vater dableiben.« Er nahm ihre Hand und presste sie auf sein hartes Geschlecht.
In diesem Moment stand die alte Lisbeth mit einem Korb voll Wäsche in der Tür. Preißler ließ Anna los und trat einen Schritt zurück. Er atmete schwer.
»Lass doch in Gotts Namen das Kind in Ruhe, Müller.« Die Magd erkannte sofort die Situation. »Schämst dich gar nicht, Endres Preißler, wo drüben dein krankes Weib liegt?«
»Kümmer du dich um deinen eigenen Kram, alte Krähe! Und pass auf, dass du dir nicht eine Schelln einfängst!« Preißler drehte sich um und stapfte wütend aus dem Schuppen.
Lisbeth setzte ihren Korb ab und schüttelte traurig den Kopf. »Es ist eine rechte Plag mit den Mannsbildern. Haben immer nur eins im Schädel. Ach, wenn bloß die Maria noch alle sieben Sinne beieinander hätte … «
Anna ließ sich auf einen wackligen Dreifuß sinken und versuchte, das Zittern ihrer Hände unter Kontrolle zu bringen.
»Ich kann nichts dafür, Lisbeth, wirklich nicht!«, beteuerte sie. »Er lässt mich einfach nicht in Frieden. Dauernd fasst er mich an, dabei graus ich mich so vor ihm!«
Die alte Magd überlegte. »Vielleicht wär’s das Beste, wenn du dir woanders was suchen würdest. Drüben in Reichelsdorf oder in Limbach gibt’s ein paar größere Höfe, die bestimmt eine Hilfe brauchen könnten. Oder gar in Nürnberg – da gehen viele hin und finden Arbeit bei reichen Leuten. Geh, schau halt nicht so unglücklich!« Sie nahm das Mädchen in den Arm und streichelte ihr beruhigend den Rücken.
»Aber der Vater … « Vor Wut und Verzweiflung begann Anna zu weinen. »Er hat gesagt, er schickt den Vater weg … «
»Scht, scht. Hör auf zu heulen, Kind, das hilft nichts. Weißt du was? Du überlegst dir das mit dem Weggehen in Ruhe und besprichst dich mit deinem Bruder. Ich frag am Sonntag den Pfarrer, ob er irgendwo eine Stelle für dich weiß. Und in der nächsten Zeit bleibst du den ganzen Tag bei mir und rührst dich nicht vom Fleck. Dann sehen wir weiter.«
In den nächsten Wochen wich Anna nicht von Lisbeths Seite, wodurch der Müller keine rechte Gelegenheit für Annäherungsversuche hatte und die Dinge etwas erträglicher wurden. Nachts nahm sie die Wölfin mit zu sich in die Kammer – wenn Grimm bei ihr schlief, fühlte sie sich sicher. Der Vater hatte sich überraschend schnell von dem schweren Anfall erholt, und dieses Mal sah es nicht so aus, als ob sich sein geistiger Zustand durch die Attacke verschlechtert hätte. Er nahm seine Arbeit nach zwei Tagen Ruhe wieder auf, und der Müller war’s offenbar zufrieden. Anna schob die Entscheidung, sich anderswo Arbeit zu suchen, erleichtert auf. Vielleicht würde sich alles von selbst finden und der Müller sich mit der Zeit an sie gewöhnen und sie in Ruhe lassen. Jeden Abend betete sie mit Inbrunst zur Mutter Maria. Lass alles gut werden, flüsterte sie dann, hilf mir und dem Vater und dem Michel wie du schon so vielen geholfen hast, Gloria Amen.
So kam der August, genau wie der Juli trocken und heiß. Die Rednitz führte Niedrigwasser, gerade noch genug, um die Mühle nicht stillstehen zu lassen. Roggen, Hirse und Hafer auf den Feldern ließen die Ähren hängen, das Gras verdorrte auf den Wiesen. Die Sonne brannte unerbittlich aus dem flimmernden Himmel, und die tägliche Hitze wurde den Menschen immer unerträglicher. Sogar nachts kühlte es nicht mehr ab. Der Pfarrer ließ die Katzwanger Gemeinde in der kleinen Wehrkirche jeden Sonntag eine Stunde länger dableiben und um Regen beten. Und endlich, am Abend nach Decollatio Johannis türmten sich hohe schwarze Wolken am Horizont und schoben sich von Westen her über den Rednitzgrund. Von fern war Donnergrollen zu hören, erste Windstöße fuhren in das trockene Laub der Bäume und fernes Wetterleuchten erhellte den Himmel. Anna war mit Grimm nach dem gemeinsamen Abendvesper in den kleinen Schuppen gelaufen, um noch eine kleine Weile mit ihrem Vater und Michel zusammenzusitzen. Als das Gewitter immer näher kam und die Windböen schon bedrohlich an den Wipfeln der alten Föhren drüben am Kappelberg zerrten, beeilte sie sich, noch vor dem einsetzenden Regen zum Haus zurückzulaufen. Sie legte sich das Schultertuch über den Kopf und hielt es mit beiden Händen fest, während sie gegen den Wind ankämpfte. Es war beinahe schon nachtfinster. Ein zuckender Blitz tauchte das Waschhaus und den alten Heuschober daneben in geisterhaft helles Licht. Die ersten schweren Tropfen begannen zu fallen. Anna senkte den Kopf und rannte. Ihr Lauf wurde jäh von einem festen Widerstand gestoppt, als sie um die Ecke der Scheune bog. Eine Hand packte sie, und ein massiger Körper drängte sie durch das offene Scheunentor: Endres Preißler war noch einmal herumgegangen, um zu kontrollieren, ob alles sturmsicher war.
»Diese Verabredung war von Anfang an fällig, Liebchen.« Seine Stimme war ein heiseres Flüstern.
Der Müller ließ Anna los und stellte seine Laterne auf die hölzerne Werkbank. Dann verschloss er mit bedächtigen Bewegungen das Doppeltor von innen mit dem langen Querbalken. Langsamen Schritts kam er auf das Mädchen zu, das mit angstgeweiteten Augen bis in die Ecke des Schobers vor ihm zurückwich. Grinsend hob er die Hand, griff in den Halsausschnitt ihres flächsernen Hemds und riss es mit einem Ruck in Fetzen. Anna schrie.
»Das Schreien kannst dir sparen, dummes Ding. Bei dem Regen und dem Donner hört dich sowieso keiner. Komm, sei nicht so störrisch.«
Preißlers gierige Blicke saugten sich an Annas kindlichen Brüsten fest, die im Schein der Lampe rötlich schimmerten. Er drängte das Mädchen mit seinem Körper gegen die Wand. Die groben Hände wanderten überallhin, und sein Schnaufen klang in ihren Ohren. Er roch ekelhaft, nach einer Mischung aus Mehl und Schweiß und Bier, und Anna musste würgen. Ich will nicht, dachte sie, ich will nicht ich will nicht ich will nicht. Sie wehrte sich verzweifelt und versuchte, unter ihm durchzuschlüpfen. Aber er zwang sie zu Boden und warf sich auf sie. Sie spürte, wie sich seine Hände um ihre Hinterbacken legten, seine Lippen auf ihre pressten und seine glitschige, widerliche Zunge in ihren Mund drang. Panik stieg in ihr auf. Angst und Ekel trieben ihr die Tränen in die Augen, und sie weinte, weil er ihr mit seinem Gewicht wehtat. Trotzdem gelang es ihr, zur Seite zu rollen und von ihm wegzukriechen, aber der Müller erwischte sie am Knöchel und zog sie mit einem Ruck wieder zu sich her. Sie wehrte sich blind, kratzte und versuchte, ihn mit ihren kleinen Fäusten zu treffen.
Schließlich versetzte er ihr eine kräftige Ohrfeige und schlug ihren Kopf zweimal hart und schmerzhaft auf den Boden, bis es ihr wie Sterne vor den Augen flimmerte. Er bringt mich um, schoss es ihr durch den Kopf, heilige Muttergottes hilf.
»Bitte«, flehte Anna, »bitte … «
Dann bekam er beide Hände des Mädchens in seiner Linken zu fassen. Er hielt sie in eisernem Griff, während er versuchte, mit der Rechten ihren Rock hochzustreifen. Lieber Gott, wo bist du? Anna strampelte, weinte und schrie. Sie hatte keine Kraft mehr, konnte nicht mehr denken, war nur noch ein hilfloses Bündel Verzweiflung. Er zwang ihre Beine auseinander. Dann kniete er sich dazwischen und machte sich mit einer Hand an seinem Hosenlatz zu schaffen.
»Halt endlich still, du Biest!«
Der Müller drückte sie keuchend mit seinem ganzen Gewicht nach unten. Etwas Hartes drängte sich gegen ihren Unterleib, stieß und drückte, jedoch ohne in die enge Öffnung zwischen ihren Beinen eindringen zu können. Anna gab auf, hörte auf, sich zu wehren und weinte nur noch lautlos, als sie jäh einen erstickten, überraschten Schrei aus Preißlers Kehle hörte und die schwere Last von ihr wich.
Die Wölfin hatte mit gefletschtem Gebiss knurrend und fauchend den Müller angesprungen. Sie hatte draußen gespürt, dass ihr Mensch in Gefahr war, und wie wild den lockeren Boden zwischen zwei weit auseinander stehenden Brettern aufgegraben, bis sie sich durch das enge Loch hindurchzwängen konnte. Preißler ließ sofort von Anna ab, und begann nach einem Moment der Überraschung mit Händen und Füßen gegen die Wölfin zu kämpfen. Doch Grimm hatte sich fest in seinen Unterarm verbissen, aus dem das Blut tropfte, und ließ nicht locker, bis ihr Gegner nachgab. Der Müller lag schließlich mit Kopf und Rücken auf einem Häckselhaufen, die Wölfin zähnefletschend über sich. Er wagte nicht mehr, sich zu bewegen, und schrie stattdessen das Mädchen an, das zitternd, die Arme wie zum Schutz fest um sich geschlungen, in der Ecke saß und einfach nur mit stumpfen Augen zusah.
»Ruf das Vieh zurück, du Miststück, wird’s bald! Die bringt einen ja um!«
Die Wölfin grollte aus tiefer Kehle und bewegte sich keinen Millimeter.
»Los, mach schon, ruf den Wolf zurück. Verdammt, ich tu dir nichts mehr.« Der Müller wand sich, aber sofort waren die Fänge des Tieres an seiner Kehle.
Anna erwachte wie aus einem Traum und hob den Kopf. In ihren Ohren rauschte es. Sie erkannte die Wölfin, sah ihren Peiniger daliegen. Auf einmal stieg Hass in ihr auf, grenzenloser, unbändiger Hass, ein Gefühl, das sie mit Wucht erfasste. Sie fühlte sich unendlich beschmutzt, gedemütigt und missbraucht. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Dann kam wieder Leben in Annas Blick. Sie straffte den Rücken und sah dem Müller in die Augen. Dann flüsterte sie mit heiserer Stimme nur ein einziges Wort:
»Beiß!«
Die Wölfin schlug ihre Fänge in das weiche Fleisch an der Halsbeuge des Mannes. Ihre Zähne zerfetzten Muskeln, Sehnen und Adern. Preißler gab einen ungläubigen, angstvollen, tierischen Laut aus tiefster Kehle von sich, seine Augäpfel quollen aus den Höhlen. Dann schrie er, und sein Schrei erstarb in einem glucksenden Gurgeln. Hellrotes Blut spritzte rhythmisch und in hohem Bogen auf die Sägespäne am Boden.
Noch zweimal setzte die Wölfin den Todesbiss, zermalmte Kehlkopf, Stimmbänder und Luftröhre; dann zog sie sich mit bluttriefender Schnauze zurück und legte sich dicht neben Anna.
Der Müller lag da und röchelte dumpf; sein Hals war nur noch eine zerfetzte Masse, aus der immer mehr Blut quoll. Endlich begannen seine Arme und Beine zu zucken, und sein massiger Körper bäumte sich schwerfällig ein letztes Mal auf. Dann war er tot.
Nach einer Ewigkeit war Anna fähig, aufzustehen. Alles tat ihr weh, ihr eines Auge war zugeschwollen, ein Knöchel war dick, und im Mund schmeckte sie metallenes Blut. Draußen prasselte noch immer der Regen, aber das Gewitter war inzwischen vorbei.
»Komm, Grimm.«
Mit der Wölfin dicht neben sich verließ sie die Scheune und humpelte durch den Regen zum Waschhaus. In dem großen Weidenkorb mit schmutzigen Sachen fand sie eine Bluse, die sie statt des zerrissenen Hemds anzog. Danach ging sie zum Stadel, wo ihr Vater mit Michel schlief. Von drinnen ertönte gleichmäßiges Schnarchen, als sie die Hand auf den Türgriff legte. Doch dann hielt sie inne. Sie schämte sich so sehr. Und Grimm hatte den Müller totgebissen. Anna wurde klar, dass sie nicht hier bleiben konnte. Spätestens morgen früh würde man nach dem Müller suchen. Und selbst wenn Anna hätte erklären können, dass die Wölfin sie nur verteidigt hatte – die Katzwanger würden Grimm nicht am Leben lassen. Und ob sie ihr überhaupt glauben würden? Schließlich war Preißler ein angesehener Mann … Das Mädchen beugte sich zu dem Tier hinunter und umhalste es stürmisch.
»Ich lass nicht zu, dass sie dich erschlagen«, raunte sie, und ein verzweifelter Trotz stieg in ihr hoch. »Keiner darf dir was tun. Wir zwei gehen einfach fort, dahin, wo uns niemand kennt.«
Sie erinnerte sich daran, was die alte Lisbeth über Nürnberg gesagt hatte. Viele suchten sich dort ein Auskommen. In den anderen Dörfern würde sie mit der Wölfin auffallen, aber die Stadt war groß. Und sie lag nur zwei Tagesmärsche weit weg. Wenn sie aufpasste und die breite Landstraße mied, konnte sie es schaffen. Es war der einzige Ausweg.
Die beiden wanderten die ganze Nacht durch, die Rednitz entlang in Richtung Norden. Anna fühlte sich zerschunden und grenzenlos niedergedrückt, und ihr Knöchel schmerzte noch immer. Innerhalb kürzester Zeit hatte sie alles verloren: ihre Heimat, ihr Auskommen und ihre Familie. Sie war zum ersten Mal in ihrem Leben völlig auf sich allein gestellt; nur die Wölfin war ihr geblieben. In den ersten Stunden ihres Marsches weinte sie, bis keine Tränen mehr kamen. Die Wölfin, die ihre Verzweiflung spürte, hielt sich dicht bei ihr. Als der Morgen graute und sich der weiße Nebel über den Kopfweiden am Fluss lichtete, versteckten sie sich in einem Birkenwäldchen, und Anna fiel vor Erschöpfung in einen tiefen Schlaf bis zum Mittag. Im Traum begegnete sie immer wieder dem Müller, der gierig die Hände nach ihr ausstreckte. Jedes Mal, wenn er bei ihr war und sie packte, fuhr sie schweißgebadet hoch. Dann war die Wölfin bei ihr, stupfte sie mit der Pfote an oder fuhr ihr mit rauer Zunge über Gesicht und Hals.
Nach dem Erwachen fühlte sich Anna wie gerädert, aber immerhin forderte ihr Körper sein Recht – ihr Magen knurrte laut und vernehmlich. Sie sammelte beinahe reifes Korn, auf dem sie kaute, suchte sich Beeren und aß ein paar rohe Pilze, während Grimm ihren Hunger an einem jungen Feldhasen stillte. In der Nacht gingen sie weiter, der Fluss wies ihnen immer noch den Weg. Mehr als einmal fiel Anna hin, stolperte über Wurzeln oder trat in ein Rattenloch. Aber sie blieb nicht stehen, angetrieben von dem Gedanken, dass man inzwischen vielleicht schon nach ihr und der Wölfin suchte. Am zweiten Morgen schliefen sie vor lauter Erschöpfung am Rande eines Rübenackers ein. Diesmal war Annas Schlaf tief und traumlos, und sie erwachte erst, als die Sonne schon hoch am Nachmittagshimmel stand. Sie blieben an einer unzugänglichen Stelle am Fluss, bis der Abend heraufdämmerte, und wanderten dann auf direktem Weg weiter nach Norden.
Und endlich, in aller Frühe, sah Anna das Ziel ihrer Flucht im Morgenrot vor sich auftauchen: Dort drüben, mitten in der Ebene, lag die eindrucksvolle Silhouette der mächtigen alten Reichsstadt mit ihren spitzen Kirchtürmen und der hoch oben thronenden Kaiserburg. Anna war überwältigt. Nie hatte sie etwas so Großartiges gesehen. Eine hohe, turmbewehrte Mauer umschloss ein Meer aus Stein, riesig, uneinnehmbar. Dach grenzte an Dach, Haus an Haus. Wie unglaublich viele Menschen mochten hier leben? Majestätisch über allem erhob sich der steile Burgberg mit der Festungsanlage, wo Kaiser und Könige sich ein Stelldichein gaben, Fürsten und Bischöfe! Einen Augenblick schwankte Anna, wurde unsicher vor dem Anblick der Stadt. Sie war doch nur ein einfaches Bauernmädchen, wie sollte sie sich da jemals zurechtfinden? Aber dann straffte sich ihr Rücken.
»Da geh’n wir hin, Grimm!«
Anna vergaß ihren nagenden Hunger und schritt zügig aus.
Reichsstadt Nürnberg, August, die Woche nach Laurentii anno 1494
Heinrich Brandauer, Goldschmied, Schmelzherr, Kaufmann und Bergbauunternehmer und einer der reichsten Männer der Stadt, saß in seinem Privatkontor im ersten Stock des großen Brandauerschen Hauses am Obstmarkt. Es war ein warmer Sommernachmittag, durch ein geöffnetes Fenster wehten die verlockenden Essensdüfte aus der nahen Garküche, und die Stimmen der Menschen, die drunten auf dem Obstmarkt ihren Geschäften und Einkäufen nachgingen, klangen herein. Sonnenstrahlen drangen durch das grünliche Glas der Butzenscheiben und ließen Staubkörnchen durchs Zimmer tanzen. Das Gesinde werkelte geschäftig in den Wirtschaftsräumen, das Küchenpersonal kochte und briet und bereitete alles für den abendlichen Empfang vor, während Brandauer beschlossen hatte, heute sei der rechte Tag, um endlich einmal Ordnung unter seinen alten Papieren zu schaffen. Er holte stapelweise Briefe, Verträge und Rechnungen aus Kisten und Truhen und warf den ganzen Wust auf den geschnitzten Arbeitstisch, der die rechteckige Ausbuchtung des Chörleins ausfüllte – eines ganz aus Holz gebauten großen Erkers, der wie ein geschlossener Balkon aus der Fassade ragte und dessen Fenster von drei Seiten das Licht einließen. Dann stellte er Tintenfass, Feder und Sandbüchse dazu und ließ sich schwer auf den dick gepolsterten Lehnstuhl vor dem Tisch fallen.
Der Kaufmann sortierte ruhig und konzentriert, trennte Altes von Neuem, legte Rechnungen auf den einen, Urkunden und Geschäftsbriefe auf den anderen Stapel. Manchmal, dachte er, war es fast beängstigend, wie gut die Dinge liefen. Brandauer entfaltete ein vergilbtes Blatt, an dem ein riesiges hellbraunes Siegel hing, und strich es beinahe liebevoll glatt: Der erste kaiserliche Auftrag, eine Bestellung über einen Zwölfersatz silberner Tafelbecher vom Jahr 1480. Nein, den würde er nicht wegwerfen. Genauso wenig wie den Handelsvertrag mit der Bürgerschaft von Brügge, der dort drüben lag, oder das Dankschreiben des spanischen Kardinals, wie hieß er doch noch gleich ...
Das Brandauersche Imperium spannte sich über ganz Europa. Was Heinrichs Vater und Großvater begonnen hatten, setzte er mit glänzendem Erfolg fort. Mit jedem Schreiben, das er entfaltete und durchlas, wuchs sein Stolz auf das, was er geleistet hatte. Zufrieden schaute er aus dem Mittelfenster des Chörleins. Da draußen lag Nürnberg, eine der wenigen echten Weltstädte nördlich der Alpen und die bedeutendste deutsche Handelsstadt. Über achttausend Haushalte gab es in der Reichsstadt an der Pegnitz, mit insgesamt dreißig- bis vierzigtausend Menschen, wer wusste das schon so genau. Hier pulsierte das Leben, wurde Handel mit der ganzen Welt getrieben von einer modernen Kaufmannschaft, die sich weder von Kaiser noch Papst Vorschriften machen ließ.