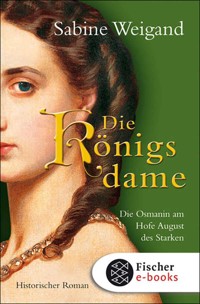8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sie ist eine der allerersten, die das Wagnis einging, durch eine Operation zum richtigen Körper zu kommen. Helga F. erzählt in diesem bewegenden Memoir ihren Weg vom Mann zur Frau, in einer Zeit, die dafür noch keine Worte hatte. Aufgezeichnet von Erfolgsautorin Sabine Weigand, zeigt Helga F.s Autobiographie einen außergewöhnlichen Menschen von großer innerer Kraft, der aus tiefstem Elend ein gelingendes Leben macht. »Als ich so mutterseelenallein zum Flugzeug ging, dacht ich: ›Nürnberg, ade! Entweder komme ich als Frau wieder, oder ich bleib am Operationstisch.« Hermann ist 40, Familienvater in der fränkischen Provinz, als er 1970 erfährt, dass in Casablanca die OP angeboten wird, die ihn vom Mann zur Frau machen kann. Als einer der allerersten geht er das damals noch kaum vorstellbare Wagnis ein. Schon der 5jährige, mitten in Nazi-Deutschland, in ärmsten Verhältnissen, weiß, dass sein Geschlecht nicht zu ihm passt. »Da war einfach was in mir drin, das war übermächtig.« Aber für das, was er fühlt, gibt es noch keine Worte wie Transsexualität. Also heiratet er, gründet eine Familie, steigt auf im Wirtschaftswunderland. Doch nur nachts, heimlich, in Frauenkleidern, fühlt er sich richtig. Nach der OP beginnt Helgas zweites Leben. Sie erfährt, wie es ist, eine Frau zu sein. Und dass die Wirrnisse damit nicht aufhören. »Ohne die Operation hätt ich nie erfahren, wie das ist, wenn man weiß, jetzt bin ich der Mensch, der ich immer sein wollt.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Sabine Weigand
Helga
Als es noch keine Worte dafür gab Mein Weg vom Mann zur Frau
Über dieses Buch
Hermann ist 40, Familienvater in der fränkischen Provinz, als er 1969 erfährt, dass in Casablanca eine Operation angeboten wird, die ihn vom Mann zur Frau machen kann. Er ist einer der allerersten, der das Wagnis eingeht, das zu dieser Zeit noch kaum vorstellbar war.
Schon der 5jährige, mitten in Nazi-Deutschland, in ärmsten Verhältnissen, weiß, dass sein Geschlecht nicht zu ihm passt. »Da war einfach was in mir drin, das war übermächtig.« Aber es gibt keine Worte für das, was er fühlt. Also heiratet er, gründet eine Familie, steigt auf im Wirtschaftswunderland. Doch nur nachts, heimlich, in Frauenkleidern, fühlt er sich richtig. Nach der OP beginnt Helgas zweites Leben. Sie erfährt, wie es ist, eine Frau zu sein. Und dass die Wirrnisse damit nicht aufhören.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverfoto: privat
Bildnachweis: Alle Fotos privat, außer: »Immer noch gern am Steuer«, »Auf der Eckbank mit dem Foto der Ehemänner«, »Gemeinsam, Frühjahr 2016«, »Helga, Frühjahr 2016«. Für diese Fotos gilt: © Gaby Gerster.
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403788-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Prolog
Ich bin unehelich geboren, [...]
Ja, so lustig ist [...]
Glossar fränkischer Dialektausdrücke
Prolog
Es ist Sommer 1936 in Nürnberg. Ein Arbeiter-Wohnviertel in der Südstadt. Durch die Haslerstraße marschiert in kurzen dunklen Hosen und braunen Hemden ein Trüppchen Hitlerjungen, angeführt von einem strammen blonden Kerl mit Schiffchenmütze. Eine alte Dame sieht aus ihrem Fenster und winkt lachend hinunter. Die Pimpfe stimmen ein Lied an, hell klingt die Melodie: »Ich hab mich ergeben – mit Herz und mit Hand – dir Land voll Lieb und Leben – mein deutsches Vaterland.«
Droben im zweiten Stock, im Schlafzimmer einer kleinen Dreizimmerwohnung, steht ein fünfjähriger, schmächtiger Bub nackt vor dem Spiegel. In der Hand hält er eine Rasierklinge, die er am Morgen aus dem Küchenschränkchen gestohlen hat.
Liedfetzen dringen an seine Ohren, aber er hört gar nicht hin. Ganz versunken ist er in sein eigenes Spiegelbild. Er sieht einen hübschen Jungen mit blassem Gesicht, dunklem, über den Ohren gestutztem Haar, dünnen Armen und Beinen. Und zwischen den Beinen, da sieht er das, was nicht zu ihm gehört. Was falsch ist an ihm, ganz falsch.
Er schluckt. Er nimmt seinen kleinen, schlaffen Penis in die linke Hand, zieht daran, bis die Haut glatt und stramm ist. Dann setzt er die Rasierklinge an. Eine klitzekleine Bewegung – und er zuckt zurück. Schreit überrascht auf. Da, wo die Klinge die Haut geritzt hat, läuft hellrotes Blut heraus, rinnt ihm über den Schenkel. Es tut so weh. Der Junge fängt an zu weinen, wirft die Rasierklinge weg und hockt sich auf den Boden, ein Häuflein Elend.
Dies ist die Geschichte eines ganz besonderen Lebens.
Die Geschichte eines außergewöhnlichen Menschen.
Eines Menschen, der im falschen Körper geboren wurde, in einer Zeit, die für solche wie ihn noch nicht einmal einen Namen hatte.
Der schließlich den Mut aufbrachte zu einem damals noch kaum vorstellbaren Wagnis: zur Operation, die ihn vom Mann zur Frau machte.
Von Hermann zu Helga.
Ich bin unehelich geboren, zu Nürnberg, am 22. Mai 1931. Ein lediges Kind, so hat man damals gesagt. Meine Mutter hat sich mit einem Schausteller eingelassen, und der hat sie sitzenlassen mit mir im Bauch. Da hat sie mich auch nicht mehr haben wollen. Jemand vom Amt ist gekommen und hat die Vaterschaft eingetragen und ihren Familienstand ledig, und dann hat sie mich mit vier Wochen hergegeben. So eine Mutter war das. Ich hab mir oft gesagt, sie war halt noch jung und dumm, sonst wär sie doch nicht mit einem von der Kirchweih mitgegangen, jeder hat doch gewusst, was das für Lumpen waren. Auch später hab ich sie nie gefragt, warum sie mich nicht behalten hat, aber da hab ich’s mir schon denken können.
Meine ersten Pflegeeltern waren die Weidingers in der Linnéstraße, das waren freundliche Leut. Viel Erinnerung hab ich nicht an sie, ich war ja noch ganz klein, aber die Weidingers-Mutter ist eine gute Frau gewesen. Einmal hat sie Papiersterne aus alten Tüten ausgeschnitten, die hat sie dann vom Fenster in den Hof runtergeschmissen. »Schau, Hermännle, da sind Sternle vom Himmel gefallen«, hat sie zu mir gesagt, »such nur schön, wo die hin sind.« Ja, da hab ich’s gut gehabt.
Aber die Weidingers-Mutter war bald zu alt, vielleicht ist sie auch krank gewesen. Jedenfalls hat sie mich nicht mehr recht versorgen können. Da bin ich dann zu anderen Leuten gekommen. Ich war vier Jahre alt.
Die anderen Leute, das waren die Schmidts. Er war gelernter Kürschner, und seine Frau, die Schmidti, war eine geborene Hupfer und kam von Hessen drüben. Mormonen waren die, das hab ich damals gar nicht verstanden. Es war ja das »Dritte Reich«, wie man es genannt hat, und die Nazis hatten die Macht. Die haben ja schon das Christentum nicht gewollt, und die Mormonen bestimmt erst recht nicht. Zu uns sind dann immer Leute gekommen, heimlich. Die haben sich nämlich gegenseitig in ihren Wohnungen besucht, damit ihnen keiner draufkommt. »Bruder soundso« und »Schwester soundso« hat’s dann geheißen. Aber was die geredet haben, davon hab ich nichts mitbekommen. Des ist ganz geheimnisvoll gegangen bei denen. Ich bin ja auch kein Mormone geworden, dazu haben die mich nicht erzogen. Aber wenn ich das Wort Mormonen höre, dann schüttelt’s mich heut noch.
Die Schmidts haben damals auch meinen Bruder Erwin genommen. Ich hab ihn da überhaupt erst kennengelernt, vorher hab ich nichts von ihm gewusst. Der Erwin ist zwei Jahre nach mir geboren und ist von einem anderen Vater. Unsere Mutter hat ihn auch gleich weggegeben, er war ihr genauso im Weg wie ich, so seh ich des heut. Eine Matz war das, hat sich mit jedem eingelassen, und die Kinder waren ihr ganz egal. Ein billiges Leben hat sie führen wollen.
Bei den Schmidts, des war die Hölle. Wenn der Erwin nicht gewesen wär, ich weiß nicht, ob ich das alles überstanden hätt. Die haben uns behandelt wie die Tiere. Wenn wir was falsch gemacht haben, hat die Schmidti uns in den Schwitzkasten gezwungen, ein Messer verkehrt herum in die Hand genommen und uns dann mit dem Knauf ein paarmal auf den Kopf geschlagen. Auf uns rumgehaut hat die wie auf einer Trommel. Des hat immer richtige Hörner gegeben. Unsere Köpf waren voll davon. Einmal waren wir beim Friseur, der hat sich recht gewundert über unsere »Nüss«. Von da an hat uns die Schmidti immer selber die Haare geschnitten.
Er, der Karl, hat überhaupt nichts zu sagen gehabt. Sie war eine böse Frau. Margaret hat die geheißen, und wir haben Mutter zu ihr sagen müssen. Arbeiten hat die uns lassen, von früh bis spät. Des war eine schwere Zeit. Schon mit fünf Jahren bin ich im Waschhaus gestanden und hab bei der Wäsche mitgeholfen, wir Buben haben Kohlen geschleppt zum Schüren, da mussten wir immer in den Keller, Allmächt, dabei haben wir uns so gefürchtet. Finster war’s da, und es hat Ratten gegeben, die haben uns eine Heidenangst eingejagt. Einmal haben alle Frauen im Mietshaus eine Ratzenjagd im Hof veranstaltet. Da standen sie alle in ihren Arbeitsschürzen, Kopftüchle umgebunden und alle möglichen Geräte in der Hand: Besen, Schaufeln, Schrubber. Der Ratz ist in wilder Flucht im Hof umeinandergerannt und konnte doch nicht hinaus, weil drumrum ja die Mauer war. Alle Weiber sind gerannt und haben geschrien und das Viech gescheucht, und am Schluss hat ihn dann die Schmidti mit einer Art Heugabel aufgespießt. Der hat vielleicht geschrien! Wie ein kleines Kind, so hat des geklungen. Ich hab dann jahrelang geträumt, dass die mich jagen und dass die Schmidti mir mit dem Dreizack in den Bauch sticht. Überhaupt hab ich viel Albträum gehabt, meine ganze Kindheit durch. Manchmal hat’s mich so gegraust davor, ins Bett zu gehen, und dann hab ich versucht, mich ganz lang wach zu halten, dass der grauslige Traum von der letzten Nacht nicht wiederkommt.
Der Erwin hat noch viel mehr Angst gehabt vor der Mutter als ich, na ja, er war ja auch zwei Jahre jünger. Ach, mein Erwin, der hat halt immer gleich gepflietscht, sogar wenn amal bloß geschimpft worden ist. Es hat ja ständig Schläge für uns gegeben, wegen nix und wieder nix. Wenn der Erwin ins Bett gemacht hat, hat sie ihm des nasse Laken aufs Gesicht gedrückt, bis er keine Luft mehr bekommen hat. Spielen haben wir überhaupt nicht dürfen. »Was wollt ihr?«, hat’s da geheißen. »Die Hausordnung ist noch net gemacht. Geht Treppen putzen, ihr faulen Säu!« Dann sind wir halt ins Treppenhaus, haben erst mit dem Rasch die Holzstufen gescheuert, dann nachgekehrt und dann gewischt. Wachsen haben wir auch müssen, damit’s am Schluss schön ausschaut. Der Erwin hat mit einem alten Fetzen das Wachs verteilt, und ich bin dann mit dem Blocker hinterher, bis alles geglänzt hat. Ich hab dabei immer geschwitzt wie ein Aff, das Raschen mit dem Fuß war g’scheit anstrengend, und so ein Blocker war ja auch schwer. Aber danach hat alles gut gerochen. Einmal ist dann die Nachbarin auf der frisch geblockerten Treppe ausgerutscht, da hat mich die Schmidti mit einem Stecken grün und blau geprügelt, weil ich das Schild »Vorsicht, frisch gewachst« vergessen hatte.
Wenn die Pflegeeltern fortgingen, haben sie uns Kinder nie mitgenommen. Und damit wir nichts anstellen konnten, haben sie mich und den Erwin immer in der Küche an zwei Stühle gefesselt. Erst die Hände zusammengebunden und dann uns an die Stühle. Stundenlang haben wir so sitzen müssen und uns nicht rühren können, bis die halt wieder da waren. Mein Lieber, da juckt’s dich irgendwann überall, und du kannst doch net kratzen! Und wehe, einer hat pieseln müssen und es net so lang ausgehalten. Dann ist wieder der Stecken geschwungen worden, und wir haben beide kein Abendessen gekriegt. Das war eine Tyrannin, kann man sagen, eine Hex. Einmal haben wir aus lauter Langweil mit den Stühlen vor und zurück gewippt, und ich bin dabei umgefallen, mit dem Kopf auf den Kartoffelkorb. Der ist umgekippt, und so hab ich dann die ganze Zeit daliegen müssen, mit dem Kopf mitten zwischen den Kartoffeln. Eine Angst hab ich gehabt, dass die Margaret mich so findet. Gott sei Dank ist der Karl eher heimgekommen, und als der mich gesehen hat, da hat er was zum Lachen gehabt. Aber wenigstens hat’s keine Prügel gesetzt.
Ja, heut würden sich die Kinder so was nicht mehr gefallen lassen. Die würden ihre Eltern anzeigen! Da gibt’s ja Gesetze. Aber damals, ach Gott, da hätten wir uns niemals getraut, aufzumucken. Des waren halt andere Zeiten.
Mit dem Essen war des auch so eine Sache. Wir Buben haben immer extra gekriegt, nie zusammen mit den Pflegeeltern. Da war dann Schmalhans Küchenmeister. Früh eine Scheibe Schwarzbrot mit so dünn Marmelade oder Honig drauf, dass man’s kaum gesehen hat, dazu eine Tasse Milch oder einen verdünnten Zichoriekaffee. Mittags eine Suppe ohne Fleisch, das haben sie danach selber gegessen. Und abends wieder ein Stück Brot, wenn wir Glück gehabt haben mit Margarine und Zucker oder, wenn die Schmidti gut gelaunt war, mit Butter und Senf drauf. Ja, das hat uns damals geschmeckt, wir haben doch immer einen Hunger gehabt, der Erwin und ich. Nur am Sonntag, des war ein Fest, da hat’s für uns Kloß mit Soß gegeben, und der Karl hat uns manchmal, wenn die Hex net hingeschaut hat, ein Bröckle Schweinefleisch unterm Sauerkraut versteckt. Der Karl wär ja vielleicht gar net so verkehrt gewesen, aber sie hat ihn unter der Fuchtel gehabt. Hörig war der seiner Frau, des sagt man doch so. Und er hat’s mit den Nerven gehabt. Der war so aufgeregt, dass er im Sitzen die Beine aneinandergerieben hat, andauernd. An der Stelle haben seine Hosenbeine richtig geglänzt, so hat der gerieben. Manchmal, wenn er ein paar Bier intus gehabt hat, hat er Lieder gesungen, dann ist er rührselig geworden. Und wehe, wenn er was gesungen hat, das der Schmidti net gepasst hat! Da ist die auf ihn losgegangen und hat zugeschlagen. Uns hat der Karl nie was getan, aber geholfen hat er uns auch net.
Wenn die zwei gegessen haben, mussten der Erwin und ich uns immer mit dem Rücken zum Tisch vor die Balkontür stellen. Und damit wir im Fensterglas net wie in einem Spiegel sehen konnten, was sie essen, hat uns die Schmidti schwarze Tücher über den Kopf geworfen. So mussten wir dann stehen, bis sie fertig waren. Meineherren, ist uns da manchmal vom Geruch das Wasser im Mund zusammengelaufen, und unsere Mägen haben geknurrt wie Nachbars Struppi. Wir haben hören können, wie die zwei gekaut und geschmatzt haben, und haben uns vorgestellt, was des alles Gutes ist. Manchmal, aber des war net oft, haben wir dann die Reste gekriegt, hei, da ging’s uns gut! Einen Batzen Kartoffelstopfer, ein Stück Schweinsrüssele oder einen Schnerpfel Krakauer, da haben wir bald gestritten, der Erwin und ich, dass jeder gerecht sein Teil bekommen hat.
Ich weiß auch noch gut, dass die Schmidti oft beim Essen am Tisch gesessen hat, und ich hab zugeschaut, in der Hoffnung, dass für mich auch was abfällt. Da hat sie immer gegrinst: »Jetzt ess ich, und du schaust zu – und dann schaust du zu, und ich ess!« Ich hab dann nur gesagt: »Ja, Mutter!« Wenn ich heut dran denke, muss ich fast heulen. So was vergisst man nicht.
Ab und zu ist unsere leibliche Mutter zu Besuch gekommen. Else-Mama haben wir zu ihr gesagt. Manchmal hat sie uns mitgenommen und ist mit uns a weng spazieren gegangen, meistens in die Anlage an der Landgrabenstraße, da war ein Sandkasten und eine Rutschbahn. Sie hat sich dann auf ein Bänkle gesetzt und Zigaretten geraucht, und wir haben spielen dürfen. Einmal sind wir sogar mit der Straßenbahn an den Dutzendteich gefahren zum Entenfüttern. Und zum Geburtstag vom Erwin waren wir im Tiergarten und haben die Elefanten angeschaut. Schön war des, und die zwei steinernen Löwen am Eingang zum Tiergarten, Mensch, die haben uns schwer imponiert.
Na ja, des war schon komisch, dass da auf einmal noch eine zweite Mama war, aber wir haben’s ja net anders gekannt und auch net weiter darüber nachgedacht. Was haben wir denn verstanden? Wir haben uns einfach gefreut, wenn sie vorbeigeschaut hat. Sie hat uns beim Gehen oft noch ein Zehnerle geschenkt, aber wehe, die Schmidti hat’s gesehen. Dann hat die uns das Geld gleich abgenommen.
Die vom Jugendamt sind auch vorbeigekommen, zum Nachschauen. Das hat die Schmidti natürlich vorher gewusst, und dann hat sie den Erwin und mich immer schön hergerichtet. Da ist im Zinnzuber gebadet worden, Fingernägel geschnitten und Haare mit der parfümierten »Wichs« glattgekämmt, die der Karl immer benutzt hat. Wir haben uns dann brav hinsetzen müssen und ruhig sein. Einmal hat der Erwin vom Hauen mit dem Stecken blaue Flecke auf den Oberarmen gehabt, da musste er mitten im Sommer eine dicke Strickweste anziehen, damit keiner was merkt. Hinterher, wenn die Frau vom Amt wieder fort war, da hat’s geheißen: »Ausziehen, ja, was glaubt ihr Bankerten denn, wie ihr rumlaufen könnt, wie die feinen Herren?« Und wir haben wieder unsere alten, gestopften Hosen mit dem Gummizug um die Knöchel angezogen und die Hemden mit den abgewetzten Krägen.
Ja, das Geld haben sie genommen, das sie vom Amt für uns gekriegt haben, da haben sie die Händ aufgehalten. Ich kann nicht sagen, wie viel das war, aber gebraucht haben sie’s wohl zum Leben, ich denk, weil der Karl schon alt war und nimmer gearbeitet hat. Sonst hätten die uns bestimmt nicht aufgezogen. Aber Gutes getan haben sie dafür an uns nicht viel.
Dass es Mädchen und Buben gibt und dass die unterschiedlich sind, hab ich freilich gewusst, wie alle Kinder des halt so wissen. Und dass die Mädchen kein Zipfelchen haben, des war mir schon auch klar. Die anderen Buben in der Haslerstraße haben immer die Ida von der Wirtschaft am Eck aufgezogen. »Ich hab dei’ Unterhosn g’sehn«, haben sie gesungen, wenn die sich beim Wäscheaufhängen gebückt hat. Dann haben wir alle gekichert, und die Ida ist uns mit dem Teppichklopfer nach.
Hermann und Erwin mit der Else-Mama 1939
Dass der Erwin einen Zipfel hat, daran hab ich mich nie gestört, das war halt so und hat seine Ordnung gehabt. Bei mir selber war das anders. Zu mir hat des irgendwie nicht gehört. Ich wollt des blöde Zipfelchen net haben, des war falsch, wie des da an mir dranhing. Ich weiß net, warum, aber ich wollt halt immer rund sein, untenrum. Einfach rund. Es war damals noch nicht so, dass ich direkt ein Mädchen hätt sein wollen. Bloß rund, des war mein Gedanke. Und je mehr ich drüber überlegt und je öfter ich an mir heruntergeschaut hab, desto mehr hat mich des garstige Ding gestört. Einen immer stärkeren Widerwillen hab ich gekriegt, richtig geekelt hab ich mich. Na ja, irgendwann hab ich dann gedacht, man kann’s vielleicht wegmachen. Abschneiden, so wie man ein Würstle abschneidet. Also bin ich in der Früh, wie der Karl aus dem Haus und die Mutter beim Bettenmachen war, in die Küche. Ich hab gewusst, wo die Rasierklingen sind, in dem kleinen Hängeschränkle beim Guß, und hab eine davon genommen. Die hab ich dann versteckt, ganz hinten in meinem Nachtkästchen. Und als die Mutter dann einmal mit dem Erwin bei der Nachbarin war, da hab ich mich ins Schlafzimmer geschlichen. Da hat es immer ganz komisch gerochen, irgendwie muffig und süßlich, und wir durften nie hinein, das war streng verboten. Ich hab mich ausgezogen und vor das niedrige Schränkchen mit dem großen Spiegel hingestellt. Des werden wir gleich haben, hab ich gedacht, gleich bin ich das Ding los. Eine Freud hab ich gehabt. Ich hab das Zipfelchen mit der einen Hand genommen und stramm gezogen, und mit der anderen Hand hab ich die Rasierklinge angesetzt. Die war sauscharf, und bevor ich noch richtig geschnitten hab, hat’s schon höllisch weh getan. Und geblutet hat’s auch. Ich bin so erschrocken, da hab ich angefangen zu greinen. Auerlauerlau! Die Klinge hab ich weggeschmissen und mich auf den Linoleumboden gehockt. Ich hab das Schnupftuch vom Karl genommen, das ich schon hingerichtet hatte, damit ich mein abgeschnittenes Schnerpfelchen drin einwickeln kann, und hab mir damit das Blut weggetupft. Der Schmerz ist dann Gott sei Dank auch vergangen. Bis die Schmidti und der Erwin wieder zurückgekommen sind, war ich schon wieder angezogen. Angesehen hat man mir nichts, aber ich war furchtbar enttäuscht, dass mein Plan net geklappt hat. Die Rasierklinge hab ich abgewaschen und zurückgelegt und das blutige Taschentuch am nächsten Tag, als ich den Abfall auf die Straße getragen hab, mit weggeworfen. Die Kehrichtbauern haben alles mitgenommen, und die Schmidti hat nie gemerkt, dass eins vom Karl seinen Rotzfahnen fehlt.
Ja, das war mein erster Versuch. Damals war ich fünf Jahre alt und hab überhaupt noch von nix was gewusst.
Dann bin ich in die Schule gekommen. Jeden Früh bin ich ins Melanchthonschulhaus marschiert, das war nicht weit, vielleicht fünf Minuten. Ich kam in eine reine Bubenklasse, da war oft was los! Mein erster Lehrer hat Nachtmann geheißen, der war ein richtiger SA-Mann. Wenn einer zu viel gezappelt hat oder aufgestanden und rumgerannt ist, hat ihn der Nachtmann einfach mit den Hosenträgern an den Stuhl geschnallt, da war’s dann aus mit den Faxen. »Pfötchen« haben wir auch gekriegt, mit dem »spanischen Röhrchen« auf die Finger, wenn wir die Hausaufgaben nicht gemacht haben. Wer schwätzte, musste sich in die Eselsecke stellen. Jeden Morgen zu Unterrichtsbeginn mussten wir uns alle aufstellen und sagen: »Heil Hitler, Herr Lehrer«, und am Schluss wieder. Wer dieser Heil Hitler war, des haben wir schon so ungefähr gewusst, aber als Kinder haben wir darüber nicht viel nachgedacht. Unser Führer halt. Wie er aussieht, hat man an dem Bild erkennen können, das hinter dem Lehrertisch an der Wand hing. Er hat dem Kohlenfahrer ähnlich gesehen, der bei uns einmal im Monat die Kohlen geliefert und zum Kellerfenster hineingeschippt hat und der immer so schön schwarz im Gesicht war. Daheim haben wir über den Hitler nie geredet, für mich war der so weit weg wie der liebe Gott.
Wenn ich es mir recht überleg, war ich in der Schule eher ein Ruhiger, der sich immer am Rand gehalten hat. Nicht weil ich dümmer gewesen wär als die anderen, ich hab schon ganz gute Noten gehabt, und manchmal hat mich der Lehrer sogar gelobt. Meine Noten lagen meistens so zwischen einem Zweier und einem Dreier, bloß in Religion, da hatte ich immer eine Eins. Aber so ein Hansdampf in allen Gassen, des war ich nie. Die anderen, die haben schon ab und zu miteinander gerauft, aber ich war immer eher einer vom Zuschauen, ich hab mich rausgehalten. In der Pause, da mussten wir immer raus in den Schulhof, ob Sommer oder Winter, und da ist immer Fußball gespielt worden. Der Schneiders-Gerch hat einen alten Lederball von seinem Vater mitgebracht, damit war er der König, und alle haben sich darum gerissen, sein Freund zu sein. Ich war net besonders gut beim Fußballen. Bei der Spielerwahl sind immer die zwei besten Stürmer aufeinander zugegangen und haben Fuß vor Fuß gesetzt. Wer den letzten Fuß vollständig hineingebracht hatte, durfte mit der Wahl anfangen. Ich war halt immer der Letzte, den sie genommen haben, weil ich kein guter Spieler war. So richtig Spaß hat’s mir net gemacht, und da hab ich mich einfach net ordentlich angestrengt. Höchstens Torwart, das ist noch gegangen, da hat man net so viel rempeln müssen. Eigentlich wäre ich viel lieber hinüber zu den Mädchen gegangen und hätt bei denen mitgemacht. Die haben so Klatsch-Spiele mit den Händen gemacht oder Gummihupfen oder Schleuderfigur gespielt. Oder sie haben mit einem Ziegelscherben auf den Boden Felder gemalt und dann drauf Himmel und Hölle gehüpft. Aber da konnt ich natürlich net hin, da hätten mich ja alle ausgelacht. Ich fand auch damals schon die Haare von den Mädchen viel schöner. Die hatten meistens Zöpfe, und auf dem Kopf oben einen »Gockel«. Mir hat die Schmidti einen Topf aufgesetzt und dann alles abgeschnippelt, was drunter vorstand. Mitte Hinterkopf haben die Haare aufgehört, Militärschnitt. Ja, damals war des modern. Eigentlich hätt ich mir gern Zöpfe wachsen lassen, aber des hab ich niemandem verraten.
Nach der Schule rannten wir Buben erst einmal in die Anlage zum Melanchthon-Brunnen. Da sind wir dann auf die »steinernen Männer« geklettert, das waren riesige Statuen. Denen haben wir uns auf den Schoß gehockt und allen möglichen Unsinn mit denen getrieben, bis uns einer heruntergescheucht hat. Danach sind wir heimgegangen, da hat schon das Mittagessen gewartet. Einen Hunger hab ich immer gehabt, weil ich meistens kein richtiges Vesper mitgekriegt hab, sondern bloß einen kalten Kartoffel oder ein Knerzle Brot. Oft hab ich dann das Verdorbene von den Tagen vorher essen müssen. Eine angeschimmelte Kartoffelsuppe, wo vorher schnell der Schimmel weggekratzt wurde, oder sauer gewordene Milch mit einem eingebrockten Weckle, das war mein »Mittagsmenü«. Na ja, der Hunger hat’s reingetrieben. Dann schnell Hausaufgaben gemacht und der Schmidti bei der Arbeit geholfen, was halt so angefallen ist, abstauben und kehren und so. Jeden zweiten Tag hab ich den Abort saubermachen müssen, der war sogar mit Wasserspülung. Andere haben damals meistens bloß ein stinkiges Plumpsklo auf dem Zwischenstockwerk gehabt, zur Gemeinschaftsbenutzung. Klopapier hat’s auch net gegeben, da hat man immer eine Zeitung kleingeschnitten und die Papierstückle im Abort auf einen Nagel an der Wand gespießt. Und neben dem Klo stand ein Eimer Wasser, mit dem hat man dann nachgeschwenkt.
Wenn hinterher, nach der Hausarbeit, noch Zeit war, durfte ich mit dem Erwin vor dem Abendessen noch zum Spielen gehen. Wir sind dann meistens zum Melanchthonplatz gelaufen, der war ja gleich schräg gegenüber. Dort haben sich alle Buben aus der Nachbarschaft getroffen, zum Räuber-und-Schander-Spielen. Oder Wäppeln. Dabei haben wir Pfennigstücke so ähnlich wie beim Schussern gegen eine Hauswand geschossen. Den nötigen Pfennig zum Mitmachen hab ich verdient, wenn ich ab und zu für den Karl im Bergbräu-Stüberl an der Gassenschänke abends ein Bier geholt hab. Des hat aber die Schmidti nicht wissen dürfen. Wenn ich gewonnen hab, bin ich mit dem Erwin zur Ida ins Stüberl, und wir haben dafür einen Brocken Bärendreck gekriegt oder einen Lutscher. Des haben wir dann gerecht miteinander geteilt, am Lutscher haben wir abwechselnd geschleckt. Wir haben uns immer eins a verstanden, mein Bruder und ich. Aber ich hab auch Freunde unter meinen Schulkameraden gehabt. Die hab ich immer beneidet, weil die ein richtiges Elternhaus hatten und ich nicht. Am besten hab ich mich mit dem Wollenschlägers-Herbert aus der Charlottenstraße verstanden, den hab ich manchmal vor der Schule die Hausaufgabe abschreiben lassen. Der Herbert und sein Vater haben mich einmal nach Zabo mitgenommen, zum Club-Training. Das war ja damals die berühmteste Fußballmannschaft in ganz Deutschland! Nicht so wie heut, wo der FCN in der zweiten Liga rumplempelt und net merkt, dass der Ball rund ist und wo der überhaupt nei muss. Jedenfalls damals, während wir zwei Buben beim Trainieren zugeschaut haben, ist der Wollenschlägers-Vater weggegangen und mit zwei Bratwurstweckle zurückgekommen, die hat er uns hingehalten. »Da!«, hat er gesagt, »Haut euch o!« Ich hab’s mich erst gar net nehmen trauen. Dass mir einer so was Gutes tut! Bis heut hab ich des net vergessen. Wenn man so einen Vater hat, hab ich mir gedacht, jeden Tag, des muss doch sein wie im Himmel.
Jeden Sonntag sind ich und der Erwin zum Kindergottesdienst in die Christuskirche geschickt worden. Da hat es mir gut gefallen, das war eine schöne Kirche, und der Pfarrer war freundlich zu uns. Ich hab dort immer zum lieben Gott gebetet, dass er uns doch liebe Eltern schenken soll und wir von der bösen Schmidts-Mutter wegkommen. Aber genutzt hat’s nix.
Einmal, ich kann mich noch genau erinnern, da haben wir Weihnachten gefeiert. Das war schon im Krieg. Da hat’s vom Winterhilfswerk Geschenke für arme Kinder gegeben, und die Schmidti hat für mich eine Mundharmonika gekriegt. Am Heiligen Abend haben dann die Schmidti und ihr Karl im Wohnzimmer gesessen, zusammen mit ihrer erwachsenen Tochter, dem Schwiegersohn und der Enkelin, Hilde hat die geheißen und war ein Jahr jünger als ich. Bei denen drin in der Stube war’s warm, aber ich, ich hab in der kalten Küche auf einem Schemel sitzen müssen, ohne Licht. Da hab ich im Finstern auf der Mundharmonika herumgeblasen, ganz allein, und die anderen haben sich drüben die Bäuche vollgestopft und gefeiert. Irgendwann ist dann die Schmidti gekommen und hat gesagt: »Hopp jetzt, Schluss mit der Katzenmusik, jetzt wird ins Bett gegangen!« Wo der Erwin an dem Abend war, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass wir im Bett oft einen furchtbaren Durst hatten. Wir haben nämlich abends nichts mehr trinken dürfen. »Damit ihr Saubären net ins Bett brunzt«, hat die Schmidti immer gesagt. Vor lauter Durst haben wir uns dann heimlich nachts aus unserem Zimmer geschlichen und haben das Wasser aus der Abortschüssel getrunken. Na ja, manchmal haben wir auch was anderes als Wasser erwischt, wenn einer nicht nachgeschwenkt hat. Da hat’s uns dann geschüttelt, so grauslig hat des Brunzi geschmeckt, pfui Teufel! So was vergisst man im ganzen Leben nicht.
Die erste Lederbox’n hab ich zu meinem achten Geburtstag bekommen, da war ich schon stolz! Und Kniestrümpfe dazu. Bis dahin hab ich immer lange Strickstrümpfe anziehen müssen, im Winter unter der langen Hose und im Sommer zur kurzen. Bis Mitte Oberschenkel sind die gegangen. Damit die oben geblieben sind, hat man dazu ein Leible getragen, das hat kurz unter der Brust geendet. Daran waren Strapsbänder befestigt, an die wurden dann die Strümpfe hingeknöpft. Das war so ähnlich wie später beim Hüfthalter für die Frauen. Na, heut möcht ich einen Buben sehen, der noch mit so was rumlaufen würde! Mir war das einerlei. Am liebsten hätt ich sowieso ein Schürzle angehabt wie die Mädchen.
Irgendwann haben der Erwin und ich uns dann doch gewundert, warum wir mit Nachnamen F. heißen und nicht Schmidt, wie es auf dem Klingelschild stand. Weil, bei den anderen Kindern war des nicht so. Ich hab nachgefragt, der Erwin hat sich nicht getraut. »Wieso kommt des, dass ich zwei Mütter hab und bloß einen Vater?«, wollte ich wissen. Und: »Warum heiß ich F.?« Da hat’s nie eine Antwort drauf gegeben, bloß Ausreden. Wir wussten überhaupt keine Zusammenhänge, niemand hat uns was erzählt. An eine Antwort kann ich mich noch erinnern: Als ich gefragt hab, wie ich auf die Welt gekommen bin, hat die Else-Mama gesagt: »Du bist vom Himmeleinsbrunnen herausgezogen worden.« Am nächsten Tag bin ich dann losgezogen und hab den Brunnen gesucht. Ich hab die Leute auf der Straße danach gefragt, aber alle schauten mich bloß mitleidig an und haben geseufzt, ach Gott, der Bub! Unverrichteter Dinge bin ich dann wieder heimgegangen. Erst viel später hab ich die Wahrheit erfahren über meine uneheliche Geburt, und dass ich ein weggegebenes Kind war. Da hab ich dann gedacht, vielleicht bin ich deshalb innerlich so. Schau her, des ist doch ganz falsch, wenn man einem Kind so was net sagt. Des will doch auch wissen, wo es herkommt. Da hat doch jeder Mensch ein Recht drauf. Aber der Schmidti und meiner Mutter war des wurscht, die haben mir lieber Märchen erzählt. Hauptsache, sie haben ihre Ruh gehabt.
Dass wir im Krieg waren, hab ich in der Schule erfahren. Viel Gedanken haben wir Kinder uns nicht gemacht, aber gewinnen wollten wir schon. Ab da haben wir meistens Soldat gespielt, mit einem Holzstecken als Gewehr. Der Sohn von unserer Nachbarin, der Ludwig, der kam dann als erstes an die Front, und plötzlich waren ganz viele Männer aus der Haslerstraße nicht mehr da. Wir Buben haben uns wenig Gedanken über die Gefahr gemacht. Zugeschaut haben wir, der Erwin und ich, als sie den großen Hochbunker in der Landgrabenstraße gebaut haben, des war interessant für uns. Dann kamen die Bombenangriffe. Die Nürnberger Südstadt war auch ein Ziel, weil da gab es ja Industrie. MAN, Siemens-Schuckert, das waren ja Rüstungsbetriebe. Immer öfter haben wir die Nacht im Luftschutzkeller verbracht, der lag unter unserem Haus. Unter dem Bett hatten wir Buben immer unser gepacktes Köfferle mit Unterhosen drin und Socken und Waschzeug. Wenn dann die Sirenen geheult haben, haben wir uns des Köfferle geschnappt und sind mit in den Keller gerannt. Da hockte dann die ganze Hausgemeinschaft beisammen und hat gewartet bis zur Entwarnung. Die einen haben gebetet, die andern gegrienen, und manchmal hat man die nahen Einschläge gehört. Da hat dann der ganze Boden gezittert, und von der Decke ist der Staub gerieselt. Der Erwin und ich waren meistens nicht direkt im Keller drin, sondern in dem Gang davor, der hatte ein Gewölbe, und der war auch sicher. Für den Erwin und mich war das jedes Mal ein angstvolles Erlebnis, wir hatten Herzklopfen, und unsere Knie zitterten. »Lieber Gott, beschütze uns«, haben wir gebetet. Wir sind später auch in die Häuser und die Keller rein, die Treffer abgekriegt haben, das war natürlich verboten, aber grad deswegen war’s ja spannend. Dass des alles über uns hätt einstürzen können, daran haben wir nicht gedacht. So sind halt Kinder.
1942, ich war gerade in der fünften Klasse, sind wir dann evakuiert worden. Wir haben unsere wichtigsten Habseligkeiten gepackt und sind mit dem Leiterwagen aus der Stadt. Die Schmidts hatten entfernte Verwandtschaft in Pyras, das ist ein kleines Dorf vielleicht 50 km im Süden von Nürnberg, und bei denen auf dem Bauernhof sind wir untergekommen. Des waren selber arme Leut, geben konnten die uns nicht viel außer einem Dach über dem Kopf. Zwei Zimmer haben wir im Haus bewohnt. Aber wir waren ja froh, dass wir überhaupt eine Bleibe hatten und noch am Leben waren. »Seid froh, dass wir überhaupt noch beieinander sind«, hat der Kurt gesagt, »die, wo Pech gehabt haben, die liegen jetzt unter den Trümmern.«
In Pyras, da ging es anfangs noch ganz gut, da haben unsere Pflegeeltern anscheinend noch ein bissle Geld gehabt. Wir Buben waren begeistert vom Landleben, da gab es Enten und Hühner und Katzen, einen Hofhund, zwei Rindviecher und eine Sau. Da waren auch noch zwei Mädchen, die Gunda und die Frieda, aber die waren schon viel älter als wir und haben sich nicht viel mit uns abgegeben. Der Kurt hat in der Landwirtschaft mitgeholfen, weil der Bauer an der Front war, und wir haben auch geholfen, beim Misten und auf dem Feld, Kartoffelklauben und Tabakblätter zupfen und alles. Damals ist in der Gegend noch viel Tabakanbau gewesen und Hopfen fürs Bier. Oft sind wir auch mit einer Karre in den Wald gefahren zum Holzsammeln. Lustig war’s, wenn wir zur Kirschenernte auf den Baum haben klettern dürfen. Und im Herbst sind wir barfuß über die Stoppelfelder um die Wette gerannt, mein Bruder und ich. Aber am allerschönsten war im Sommer das Baden im Karpfenweiher, der war am Schegel, drei bis vier Meter tief. Da hab ich dem Erwin das Schwimmen beigebracht, im grünen Wasser sind wir herumgestrampelt, und die fetten Karpfen haben mit ihren Rückenflossen unten unsere Bäuche gestreift.
Eines Tages hat mich die Schmidti in der Früh mitgenommen, wir sind nach Thalmässing zum Einkaufen. Da gab’s ein schönes Modegeschäft, wo alle Bauern ihre Sachen gekauft haben. Aber sie hat gar nicht mir was kaufen wollen, sondern ihrer Enkeltochter, der Hilde. Die hat neue Sommersachen gebraucht, weil sie aus den alten herausgewachsen war. Ich sollte die ganzen Sachen anziehen, weil das Mädle so groß war wie ich und die Schmidti sehen wollte, wie alles angezogen aussieht. So hab ich halt die Kleidle anprobiert. Da hab ich mich so wohl gefühlt, des kann ich gar net sagen. Ich wollt mich gar nimmer ausziehen. Zum ersten Mal hab ich mich schön gefunden. Drehen hab ich mich sollen, vor dem Spiegel, das hat die Schmidti mir nicht zweimal sagen müssen. Wie eine Prinzessin hab ich mich gefühlt. Aber am End hab ich natürlich alles wieder ausziehen und in meine Hosen schlupfen müssen. Bald geheult hab ich. Ich hätt wer weiß was dafür hergegeben, wenn ich wenigstens ein Schürzle hätt behalten dürfen. Aber gesagt hab ich natürlich nix. Die hätten ja gemeint, ich spinn. Also bin ich recht traurig wieder mit der Schmidti heimgelaufen. Wenigstens hab ich das Paket mit den Mädchensachen unterm Arm tragen dürfen. Ja, des ist ein ganz besonderer Tag für mich gewesen. Ab da hab ich immer daran denken müssen, wie schön des war in den Kleidchen und Schürzchen.
Da draußen in Pyras haben wir Kinder gar nicht mitgekriegt, dass mit der Zeit ganz Nürnberg in Schutt und Asche versunken ist. Bloß dass immer wieder die Bomber gekommen sind, das haben wir gesehen, manchmal sind über uns am Himmel ganze Staffeln geflogen, Lancaster-Bomber und Moskitos. Die Bauersleut haben dann jedes Mal gebetet. Und dann, am Abend des 2. Januar 45, da gab es den schlimmsten Angriff auf die Stadt. Wir sind alle miteinander auf einen Hügel gestiegen und haben den Himmel angeschaut. Der war feuerrot vom großen Brand, gespenstisch hat das ausgesehen. Am Tag darauf bin ich mit dem Kurt nach Nürnberg gefahren, um nach unserem Haus zu schauen. Die verbrannten Leichen sind auf der Straße gelegen und haben noch geleuchtet vom Phosphor. Wo die Melanchthonschule gestanden hatte, war bloß noch ein Trümmerhaufen, von der schönen Christuskirche stand nur noch der Turm, und unser Haus war auch weg.
Von da an hat die Schmidti den Erwin und mich alle zwei Wochen in die Stadt geschickt. Wir sollten nach brauchbaren Sachen in den Trümmern schauen. Da sind wir dann in der zerstörten Südstadt herumgegogert und haben irgendwelches Zeug auf unseren Leiterwagen geladen, Blecheimer, Lampenschirme, eine Schachtel mit Sicherheitsnadeln, was halt noch gut war. Sogar eine Armbanduhr haben wir in einer zerbombten Wohnung gefunden, die hat noch funktioniert. Und einen Fuchspelz für Damen zum Um-den-Hals-Legen, mit Kopf und Glasaugen, alles noch dran.
Einmal kamen wir auf das Gelände einer Süßwarenfabrik. Das war lustig: Überall zwischen den Trümmern lagen viele, viele bunte Bonbonpapierchen und Stanniolpapierfetzen. Das hat so schön geglitzert! Die Fetzchen haben wir dann aus lauter Gaudi gesammelt, der Erwin und ich, da kam auf einmal die Polizei. Die haben uns beschimpft und aufs Revier mitgenommen, du heiliger Strohsack! Wir hatten so furchtbaren Schiss, dass sie uns einsperren, uns ist das Herz in die Hosen gerutscht. Der oberste Schutzmann dort hat uns dann belehrt, dass die Papierle Volkseigentum wären und wir uns des Diebstahls schuldig gemacht hätten. Er wollte aber noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen, hat er gesagt, weil wir halt noch Kinder sind. Wir haben dann die Taschen ausleeren und die Papierle dalassen müssen. Dann sind wir heimgeschlichen wie die begossenen Pudel.
Eines Tages hat der Kurt gesagt, dass der Krieg verloren ist. Angst haben wir alle gekriegt, dass der Russe kommt. Es sind dann auch immer mehr Städter zu uns aufs Land zum Hamstern. Alles Mögliche wollten die gegen Lebensmittel tauschen, Bilder oder Porzellan oder auch richtig wertvolle Sachen wie Pelzmäntel oder Schmuck. Da haben wir Kinder die Augen aufgesperrt! Die Bäuerin hat schon oft was hergegeben, des war eine brave Frau, aber irgendwann war dann halt auch Schluss. Und später, als der Krieg vorbei war, ist es erst richtig schlimm geworden. Auch wir haben dann genug damit zu tun gehabt, dass wir was zwischen die Zähne gekriegt haben. Unsere Pflegeeltern hatten kaum das tägliche Brot, und davon haben wir Buben noch das Allerwenigste abbekommen. Sogar die Gunda, die sich sonst nie um uns geschert hat, hat Mitleid mit uns gekriegt. Ab und zu hat sie den Erwin und mich in die Küche gewunken und jedem ein Scheible Brot gegeben mit Milchhaut drauf vom Milchabkochen. Da haben wir geschleckt! Es gibt ja viele Leut, die graust’s vor der Milchhaut, aber für mich ist des bis heut eine Delikatesse. Einmal, da hat die Schmidti den Erwin erwischt, wie er die Gunda um eine Birne angebettelt hat. Da hat sie seine Hände genommen und ihm die Finger bis ganz nach hinten umgebogen. Das hat sie oft gemacht. Der Erwin hat dabei jedes Mal vor Schmerzen geschrien, des hör ich heut noch. Gefoltert hat die ihn richtiggehend. Hat ihm immer mit Gewalt die Goschen auseinandergezogen bis zu den Ohren, bis das Blut gekommen ist. Des hab ich alles mitanschauen müssen und hab dem Kleinen nicht helfen können. Aber was hätt ich denn machen sollen? Ich war doch selber noch ein Kind!
Am End hat uns die Schmidti dann immer öfter zum Hamstern zu den Bauern geschickt, weil Kinder leichter was geschenkt kriegen als Erwachsene. Da sind wir dann herumgegangen und haben gesagt: »Gelobt sei Jesus Christus. Könnten wir vielleicht ein Ei haben oder ein Stückle Brot?« Oft sind wir weggejagt worden, aber manchmal waren wir auch erfolgreich und haben was heimbringen können. Wenn zufällig irgendwo Kirchweih war oder gar eine Hochzeit, des war für uns das Höchste. Wir haben dann mittags um einen Teller Suppe gefragt, weil wenn’s was zu feiern gibt, sind die Leut spendabler. Mein Lieber, da haben wir uns angefressen, der Erwin und ich, so viel, wie in unsere Bäuche hineingegangen ist.