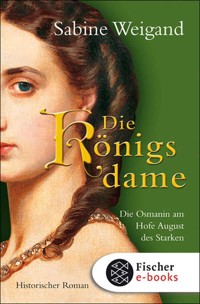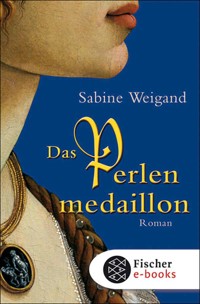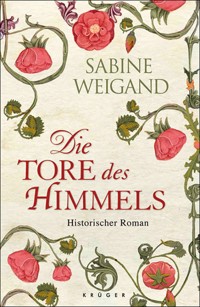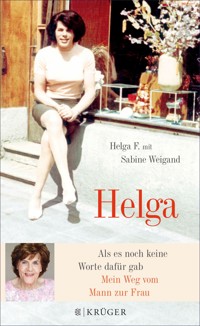8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ist die Königin des Mittelalters: Eleonore von Aquitanien, bewundert, verleumdet, legendenumwoben. 1137 heiratet Eleonore, die schönste Frau ihrer Zeit, den König von Frankreich. Doch die Ehe scheitert. Eleonore tut das Unerhörte: sie lässt sich scheiden. Während ihr Name überall in den Schmutz gezogen wird, heiratet sie erneut: Henry Plantagenet, den König von England. Mit ihm regiert sie, steht im Zenit ihrer Macht. Doch wie soll sie handeln, als Henry sie betrügt? Wird sie aus Rache ihre Söhne zur Rebellion anstacheln und alles aufs Spiel setzen – auch ihr eigenes Leben? Erfolgsautorin Sabine Weigand lässt Eleonore selbst ihr Leben erzählen, das größer ist als jeder Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 944
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Sabine Weigand
Ich, Eleonore, Königin zweier Reiche
Historischer Roman
Über dieses Buch
Eleonore (Aliénor) von Aquitanien: bewundert, verleumdet, legendenumwoben. Als schöne Erbin von Aquitanien heiratet sie König Ludwig VII. von Frankreich, bringt Kunst und Musik an den kargen Pariser Hof. Schon dass sie Ludwig auf den Kreuzzug begleitet, ist ein Skandal. Aber dann tut Alienor das Unerhörte: sie verlangt die Scheidung. Während sie überall als Hure verleumdet wird, heiratet sie erneut: Henry Plantagenet macht sie zur Königin von England. Ihm schenkt sie acht Kinder, regiert mit ihm. Doch als er sie betrügt, kennt ihr Zorn keine Grenzen. Dass sie ihre Söhne zur Rebellion gegen Henry aufstachelt, bezahlt sie fast mit dem Leben. Gedemütigt und eingesperrt kämpft sie selbst im Verlies noch um das Lösegeld für ihren gefangenen Sohn Richard Löwenherz. Unbeugsam träumt sie weiter davon, mit ihrem Einfluss die Geschicke der europäischen Reiche
www.sabine-weigand.de
Sabine Weigand stammt aus Franken. Sie ist Historikerin und arbeitete als Ausstellungsplanerin für Museen. Dokumente aus Nürnberg waren der Ausgangspunkt ihres Romans ›Das Perlenmedaillon‹, das wahre Schicksal einer Osmanin am Hof August des Starken liegt dem Roman ›Die Königsdame‹ zugrunde. In ›Die Seelen im Feuer‹ bilden die Hexenakten von Bamberg die historische Romanvorlage, bei ihrem ersten Roman ›Die Markgräfin‹ war es die reale Geschichte der Plassenburg bei Kulmbach, bei ›Die silberne Burg‹ die Bestallungsurkunde einer jüdischen Ärztin. In ›Die Tore des Himmels‹ erzählte sie das Leben der Hl. Elisabeth, in ›Das Buch der Königin‹ das Schicksal der deutschen Kaiserin Konstanze von Sizilien.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: akg images
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403219-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Dieser Roman erzählt die [...]
[Kapitel]
Prolog Irgendwo auf dem Weg zwischen Poitiers und Tours, Herbst 1173
Erstes Buch
Königreich Kastilien, Januar 1200
Von Burgos nach San Juan de Ortega Ende Februar 1200
Talmont, Sommer 1130
Von San Juan de Ortega nach Belorado Ende Februar 1200
Troyes, am selben Tag
Poitiers, Ende Mai 1137
Paris, eine Woche später
Bordeaux, Juli 1137
Ludwig
Von Belorado nach Santo Domingo de la Calzada Ende Februar 1200
Brief der Gräfin Blanca von der Champagne an ihren Bruder, König Sancho von Navarra, vom 23. Februar 1200
Paris, September 1137
Santo Domingo de la Calzada Ende Februar 1200
Ludwig
Santo Domingo de la Calzada Ende Februar 1200
Paris, Sommer bis Herbst 1141
Santo Domingo de la Calzada Ende Februar 1200
Ludwig
Ermahnung Bernhards von Clairvaux an König Ludwig VII., Frühjahr 1143
Saint Denis, 10. und 11. Juni 1144
Ein namenloser Weiler Ende Februar 1200
Bericht des Bernhard von Clairvaux an Papst Eugenius III. nach der Kreuzzugspredigt von Vézelay
Von Saint Denis nach Metz, Juni 1147
Vom namenlosen Weiler nach Najera Ende Februar 1200
Ludwig
Lied der französischen Kreuzritter
Von Byzanz nach Attalya, Oktober 1147 bis Januar 1148
Von Najera nach Navarrete März 1200
Navarrete März 1200
Aus der Chronik des Odo von Deuil
Antiochia, März 1148
Johann von Salisbury, Historia pontificalis
Odo von Deuil, De Ludovici VII Francorum Regis, Profectione in Orientem
Antiochia, März 1148, einen Tag später
Cercamon, Lied
Gervasius von Canterbury, Otia Imperialia
Von Navarrete nach Logroño März 1200
Ludwig
Logroño März 1200
Späterer Vorwurf des englischen Papstes Hadrian (1154–1159) an Ludwig von Frankreich
Von Logroño nach Viana März 1200
Pamplona, März 1200
Potenza, Montecassino und Tusculum, September und Oktober 1149
Von Viana nach Torres del Rio März 1200
Ludwig
Zweites Buch
Von Torres del Rio nach Irache März 1200
Paris, August 1151
Von Irache nach Estella März 1200
Brief König Ludwigs von Frankreich an Abt Bernhard von Clairvaux vom 17. September 1151
Antwort Bernhards von Clairvaux auf Ludwigs Ansuchen vom 28. September 1151
Estella März 1200
Schreiben der Herzogin Aliénor von Aquitanien an Henry Plantagenet vom 1. April 1152
Henry
Aus der Chronik des Hélinand de Froidmont
Aus der Historia Rerum Anglicarum des William von Newburgh
Aus den Historischen Werken des Gervase von Canterbury
Von Estella nach Puente la Reina März 1200
Puente la Reina März 1200
Pamplona, am selben Tag
Eilbotschaft des Erzbischofs Theobald von Canterbury an König Henry Plantagenet von England und Irland vom 25. Oktober 1153
Barfleur, englische Küste, Winchester und London November/Dezember 1153
Puente la Reina März 1200
Henry
Aus den Carmina Burana 145a Lied eines deutschen fahrenden Scholaren
Von Puente la Reina bis zum Alto del Perdòn März 1200
Wallingford Castle, Mai 1156
Brief Aliénors an Henry vom 3. Juni 1156
Vom Alto del Perdòn bis Cizur Menor März 1200
Pamplona März 1200
Aus den Epistolae des Archidiakons Peter von Blois
Pamplona März 1200
Henry
Falaise, Dezember 1159, und London, April 1160
Pamplona März 1200
Von Pamplona nach Larrasoaña März 1200
Falaise und Cherbourg, Mai 1162
Henry
Von Larrasoaña nach Bizkarreta März 1200
Von Bizkarreta nach Roncesvalles März 1200
Henry
Roncesvalles März 1200
Aus einem Brief der Hildegard von Bingen an Eleonore von Aquitanien vor 1170
Henry
Drittes Buch
Roncesvalles März 1200
Bur-le-roi, Weihnachten 1170
Nachricht an Erzbischof Thomas Becket nach Canterbury Weihnachten 1170
Die Kathedrale von Canterbury, 29. Dezember 1170
Augenzeugenbericht des Bischofs Arnulf von Lisieux über das Eintreffen der Nachricht von Beckets Tod am Königshof in Argentan, 1. Januar 1171
Aus einem Schreiben König Ludwigs von Frankreich an den Papst Januar 1171
Henry
Der Pass von Roncesvalles März 1200
Von Biakorri nach St. Jean-Pied-de-Port März 1200
Merlins Prophezeiung nach Roger of Hoveden
Limoges, Ende Februar 1173
Henry
Jung-Henry
Richard
Geoffrey
John
Brief des Peter von Blois an die Königin von England und Herzogin von Aquitanien, Sommer 1173
Von Biakorri nach St. Jean-Pied-de-Port März 1200
St. Jean-Pied-de-Port März 1200
Klage des Troubadours Richard le Poitevin über Aliénors Gefangenschaft, geschrieben im Herbst 1174
St. Jean-Pied-de-Port März 1200
Ein Schlachtfeld am Ufer der Charente, irgendwo in der Nähe von Saintes, Frühjahr 1174
Aus der Autobiographie des walisischen Chronisten Giraldus Cambrensis
Sarum, irgendwann, es ist ohnehin ganz gleich
St. Jean-Pied-de-Port März 1200
Henry
Von St. Jean-Pied-de-Port nach St. Palais März 1200
Winchester, August 1176
Von St. Palais nach Sorde-l’Abbaye März 1200
Henry
Jung-Henry
Rocamadour, Juni 1183
Aus der Totenklage des Bertrand de Born für den jungen König
Henry
Von Sorde-l’Abbaye nach Dax März 1200
Dax März 1200
John
Henry
Ballan und Chinon, Juni/Juli 1189
Epitaph des Königs Henry II. von England nach einer Transkription des Ralph von Diceto
Richard
John
Von Dax nach Lesperon April 1200
London, September 1189
Von Lesperon nach Labouheyre April 1200
Schreiben der Königin von England an Papst Coelestin III.
Von Labouheyre nach Belin April 1200
Chalus, März/April 1199
Totenklage des Troubadours Gaucelm Faidit für König Richard
Belin April 1200
Belin April 1200
Bordeaux, April 1200
Nachwort
Personen
Glossar
ahi
Die Illustrationen
Dieser Roman erzählt die Geschichte
einer der berühmtesten Frauen des Mittelalters:
die Geschichte von Eleonore,
Gräfin von Poitou,
Herzogin von Aquitanien,
Königin von Frankreich
und Königin von England.
Ihr Name wurde schon zu ihren Lebzeiten
in alle Sprachen Europas übersetzt.
Sie selbst nannte sich
in ihrer Muttersprache,
der Langue d’Oc des französischen Südens,
ALIÉNOR
Prolog Irgendwo auf dem Weg zwischen Poitiers und Tours, Herbst 1173
Ein Blitz zerreißt zuckend die Nacht und taucht die schwarze Ebene in gleißendes Licht. Donner grollt über dem Land. Mit mörderischer Wucht setzt der Regen ein, vom brüllenden Wind gepeitscht, eiskalt. Es ist, als hätten sich die Tore der Hölle geöffnet.
Die Reiter galoppieren durch die Finsternis, als wäre der Teufel persönlich hinter ihnen her. Sie sind bis auf die Knochen durchnässt, aber sie halten nicht an, um Schutz vor dem Unwetter zu suchen. Die Hufe ihrer Pferde schleudern Steine und Erdklumpen hoch, trotz der Nässe sprühen Funken unter den Eisen. Dreizehn zu allem entschlossene Männer sind es, die bei diesem nächtlichen Ritt ihr Leben riskieren und ihre Rösser unerbittlich vorwärtshetzen. Irgendwann, nachdem das Gewitter nachgelassen hat, fallen die Tiere in einen erschöpften Schritt, sie können nicht mehr. Der Boden ist zu schwer und zu schlammig geworden.
Die einzige Frau unter den Reitern nimmt mit einem leisen Aufstöhnen die Füße aus den Steigbügeln und streckt die Beine durch. Das Reiten im Männersitz ist sie nicht gewohnt, ihre Knie schmerzen. Aber im Damensattel hätte sie diesen Galopp nicht überstanden. Und sie haben keine Zeit zu verlieren auf dieser Flucht.
Der Anführer, ein junger Ritter, kaum dem Kindesalter entwachsen, lenkt sein Pferd an ihre Seite. Er ist triefend nass, das Wasser tropft ihm vom Kinn. »Es kann nicht mehr weit sein bis Saint-Cyr«, ruft er gegen den Wind an. »Schafft Ihr es noch weiter, Domna?«
Sie nickt. »Nur voran, Thibaut, solange die Pferde noch laufen können. Mir geht es gut.«
Sein Blick ruht bewundernd auf ihrer schlanken Gestalt. Der regenschwere Mantel hängt ihr um die Schultern, die Lederkappe auf ihrem Kopf ist verrutscht und enthüllt einen dichten Schopf langer dunkler Haare. Sogar jetzt noch, todmüde, nass und als Mann verkleidet, ist sie schön. »Keine Frau kommt Euch gleich, Herrin!«
Dann treiben sie die Rösser wieder an. Im Nieselregen passieren sie das Wegkreuz vor Saint-Cyr, über den Hügeln im Osten graut schon der Morgen. Sie versucht abzuschätzen, wie viele Stunden sie schon unterwegs sind. Acht? Zehn? Ganz gleich. Dorthin, wo es hell wird, führt ihr Weg. Nach Paris. Sie muss die Hauptstadt erreichen, koste es, was es wolle. Nur beim König ist sie sicher. Denn sie hat den Aufstand geplant, hat die große Rebellion angezettelt, es war ihr Werk allein. Und nun ist alles verloren. Ich kann nicht auf Gnade hoffen, denkt sie. Sie würde im umgekehrten Fall auch niemanden schonen, weiß Gott. Seit sie von Poitiers losgeritten ist, hockt die Angst mit ihr im Sattel und hält ihren Körper umklammert wie eine Spinne mit hundert Armen.
Die dunkle Silhouette eines Bauernhofs taucht vor ihnen auf.
»Lasst uns hier kurz haltmachen, Herrin«, ruft der junge Thibaut über die Schulter zurück. »Die Pferde brauchen eine Rast und Futter.«
Sie hat ein ungutes Gefühl, aber sie sagt nichts. Schließlich ist sie kein ängstliches altes Weib. Und niemand kann wissen, wohin sie geflohen sind. Sie hätten genauso gut nach Süden in Richtung Bordeaux reiten können. Also lassen sie ihre Pferde im Schritt auf das kleine Gehöft zugehen und passieren das niedrige Mäuerchen aus Bruchsteinen durch ein offenes Gatter.
Und dann bricht die Hölle los. Von zwei Seiten gleichzeitig greifen berittene Kämpfer an. »Ein Hinterhalt!«, brüllt der junge Thibaut. »Schützt die Königin!« Ihre Männer bilden einen Ring um sie, ziehen die Schwerter. »Ergebt Euch!«, ruft einer der Angreifer. »Niemals!«, tönt es zurück. Dann beginnt der Kampf.
Klingen klirren, Schilde prallen donnernd aufeinander, Pferde wiehern schrill vor Panik, trampeln und steigen. Zu ihrer Männerverkleidung gehört kein Schwert, sie könnte auch gar nicht damit umgehen. Nur der Hirschfänger bleibt ihr zur Verteidigung; verzweifelt versucht sie, ihn am Gürtel zu ertasten und mit den nassen Handschuhen aus der Scheide zu zerren. Ein grauenvoller Schrei ertönt links von ihr, hallt gurgelnd über den Hof. Einer ihrer Beschützer kippt rückwärts vom Pferd, ein Schwert steckt bis zum Heft in seiner Seite. Sie kann gerade noch ausweichen, als eine Lanze an ihrem Kopf vorbeizischt. Die Gegner hacken und schlagen auf ihre Getreuen ein, scharfe Schneiden durchtrennen Fleisch und Muskeln und Sehnen, metallene Spitzen lassen Knochen zersplittern und reißen Löcher in Eingeweide. Der Geruch von Blut und Kot erfüllt die Luft, Sterbende röcheln, wer getötet hat, schreit seinen Triumph hinaus, es ist der Rausch des Kampfes, den sie nicht zum ersten Mal erlebt. Sie versucht nach Kräften, ihre Stute ruhig zu halten, die vor Schreck durchzugehen droht. Links von sich sieht sie, wie die Spitze einer Schwertklinge einem ihrer Männer in den offenen Mund fährt, er scheint sie im Todeskampf verschlucken zu wollen. Blut sprudelt, er fällt. Die anderen sind in der Übermacht. Sie kann nichts tun außer beten, und darin war sie noch nie gut. Ein dritter ihrer Verteidiger geht mitsamt seinem Pferd zu Boden. Und die anderen brüllen. Sie brüllen ihre Lust am Töten hinaus, die Gewissheit des Sieges lässt sie jetzt schon jubeln. Endlich hat sie den Dolch gefunden, der am Gürtel nach hinten gerutscht ist; sie packt ihn fest und hält ihn zum Stoß bereit. Ihr Pferd gleitet auf dem vielen Blut aus, das inzwischen den Boden tränkt, aber sie kann es wieder hochreißen. Hinter ihr eine schnelle Bewegung – ein Angreifer hat dem tapferen Quentin de Blaye mit der Axt den Unterarm abgetrennt. Hellrotes Blut spritzt auf ihre Schulter. Fest umklammert sie ihren Dolch. Plötzlich ist da ein Reiter neben ihr, will ihr in die Zügel greifen. Er hat sie erkannt! Doch da drängt sich schon der junge Thibaut dazwischen, die Klinge zum Schlag erhoben. »Verliert nicht den Mut, Domna!«, ruft er. Er schützt sie mit seinem Leben, dieser unerfahrene Knabe, der erst im Sommer seinen Ritterschlag erhalten hat. Sie sieht, wie sein Gegner ausholt, will ihn warnen, doch ihr Ruf geht im Kampfgetümmel unter. Die Klinge fährt ihm unterhalb des Lederkollers in den Bauch. Er lässt die Waffe fallen, rudert mit den Armen. Sie bekommt seine blutige Hand zu fassen, hält sie einen Wimpernschlag lang fest in ihrer. Seine hellen Augen suchen ihren Blick, er lächelt sie an, als seien sie nicht mitten in einem tödlichen Kampfgetümmel, sondern beim Reigen im Palast von Poitiers. Dann erschlaffen seine Finger, entgleiten ihrem Griff. Sie möchte weinen. Sein Mörder ist inzwischen neben ihr vom Pferd geglitten; er greift nach ihr, will sie aus dem Sattel ziehen. Da rammt sie ihm mit aller Kraft von oben den Dolch in den Nacken, dort, wo der Helm endet und das Kettenhemd noch nicht schützt. Er bricht zusammen. Vor ihr ist mit einem Mal freie Bahn, und sie gibt ihrem Pferd die Sporen. Es prescht, verrückt vor Panik, blindlings auf das Mäuerchen zu, gerade noch rechtzeitig presst sie die Schenkel zusammen, duckt sich und setzt im Sprung über das Hindernis. Hinter sich hört sie einen Reiter, einer der Angreifer hat ihre Flucht bemerkt. Es ist inzwischen hell genug, dass er sie verfolgen kann. Über ein Stoppelfeld lenkt sie auf ein kleines Wäldchen zu, vielleicht kann sie dort den Mann abschütteln. Sie schreit, feuert ihr Pferd an, und betet stumm, dass es nicht in ein Mäuseloch oder einen Kaninchenbau tritt. Der Reiter kommt immer näher. Da sind schon die ersten Birken! Sie kann es schaffen! Dann ein Ruck, ein Wiehern. Ihre Stute ist auf einer Wurzel ausgerutscht. Sie verliert die Steigbügel, schwankt im Sattel hin und her. Und dann spürt sie einen Schlag an der Schulter. Ein Zweig hat sie getroffen, fegt sie vom Pferd. Sie landet auf dem harten Boden, aber sie spürt keinen Schmerz. Alles ist vorbei, denkt sie. Den Dolch hat sie nicht mehr. Neben ihr springt ihr Verfolger ab. Sie rappelt sich benommen auf, knickt in den Knien ein. In ihr wühlt elende, würgende, panische Angst. Eine schwere Hand packt sie mit eisernem Griff am Genick, zerrt sie an den Haaren hoch, reißt sie herum …
Die alte Frau schreckt hoch. In ihren Augen steht die Angst. Wo in Herrgotts Namen ist sie? Ach ja. Im Wagen. Sie muss eingeschlafen sein, trotz des ständigen Holperns der eisenbeschlagenen Räder auf dem steinigen Weg. Die Anspannung weicht aus ihrem Körper, sie öffnet die geballten Fäuste. Ihre Finger schmerzen. Dieser Traum – wie oft hat sie ihn schon geträumt! Er will sie einfach nicht loslassen, auch nicht nach all den Jahren. Sie atmet tief durch, fährt sich müde mit dem Handrücken über die Augen. Draußen hört sie Stimmen. Sie schlägt die Lederklappe zurück und späht hinaus ins Freie. Vor ihr erhebt sich ein mächtiges Doppeltor, flankiert von zwei trutzigen Wehrtürmen. Einer ihrer berittenen Waffenknechte unterhält sich gestenreich mit den beiden Wächtern. Langsam lehnt sie sich zurück und bekreuzigt sich. Sie ist am Ziel.
Erstes Buch
Königreich Kastilien, Januar 1200
Burgos.
Der Winterwind fegt Schneekristalle in glitzernden Wolken von den Dächern der Stadt. Schwarzer Rauch von Holzfeuern liegt in der Luft. Die Sonnenscheibe steht im Mittag, vergeblich schickt sie ihre kraftlosen Strahlen durch den azurblauen Himmel. Es ist so kalt, dass die Schweine sich beim Wühlen in den gefrorenen Misthaufen blutige Rüssel holen.
Über die Brücke, die den Rio Arlanzon überspannt, bewegt sich ein langsamer Zug. Voran reiten grimmig aussehende Waffenknechte, Eis in den Bärten, ihre Rösser dampfen. Der Mann an der Spitze hält eine Fahne hoch. Es folgen Wagen auf eisenbeschlagenen Rädern, danach zwölf Maultiere, schwer bepackt mit allerlei Tand. Zwei Reiterinnen im Damensattel auf kleinen, rehbraunen Zeltern. Schließlich ein Reisekarren, ein vornehmes Gefährt, gezogen von zwei Rotschimmeln. Die ledernen Vorhänge sind geschlossen, um den oder die Insassen vor den Widrigkeiten des Wetters zu schützen. Den Abschluss der Reisegesellschaft bilden wieder Bewaffnete in Zweierreihen. Ohne zu wissen, wer da kommt, verneigen sich die Menschen und ziehen die Hüte, sobald der Zug in die Stadt einreitet. Das muss wohl ein bedeutender Gast in wichtiger Mission sein, der sich mitten im Winter die Strapazen einer Reise antut, und sicherlich ist sein Ziel das mächtige Kastell, in dem nun schon seit einigen Wochen die königliche Familie residiert.
Tatsächlich nimmt der Zug den Weg über den holprigen, beinhart gefrorenen Schlamm der Calle de las Calzadas auf die Burg zu, deren Tor sich nun knarrend öffnet, um die Einreitenden wie ein gefräßiges Tier zu verschlucken.
Drinnen im Hof springen die Reiter steifbeinig ab; einer von ihnen öffnet die Tür des Reisekarrens. Mit grün behandschuhter Hand greift jemand fest nach seinem ausgestreckten Unterarm. Eine schlanke Gestalt in schwarzem Umhang steigt vorsichtig aus, die feinen Stiefel finden nach einigem Suchen festen Halt auf den eisglatten Kopfsteinen. Die Gestalt richtet sich auf, zupft den verrutschten dunklen Schleier zurecht und sieht sich eine ganze Weile suchend um. Ein missbilligendes Schnalzen. Keiner steht bereit, sie zu begrüßen.
Da öffnet sich die Doppeltür zum Wohntrakt der Burg, eine Dame mittleren Alters eilt in fliegender Hast die Treppe zum Hof hinunter. Sie hat sich nicht einmal die Zeit genommen, einen Mantel umzulegen. Schwer atmend bleibt die Frau – es ist die Königin von Kastilien – vor der Gestalt im schwarzen Umhang stehen. Die beiden sehen sich an, wortlos. Endlich streckt Leonor von Kastilien beide Hände aus und sagt: »Mutter! Wie lange ist es her?«
Die Gestalt antwortet: »Neunzehn Jahre und vier Monate. Und du kommst immer noch zu allem zu spät.«
Dann fallen sie sich in die Arme.
In der großen Halle brennt ein Feuer, dessen Wärme nicht einmal ausreicht, die gefrorenen Eiskristalle an der Nordwand wegzutauen. In den Fenstern sind lederbespannte Holzrahmen verkeilt, die mit dem Wind auch das Tageslicht draußen halten. Die Diener haben Kienspäne an den Wänden entzündet und vielarmige Kandelaber mit dicken Bienenwachskerzen aufgestellt; es ist trotzdem düster, die Luft rauchgeschwängert. Auf den kalten Steinfliesen liegen noch vom Weihnachtshoftag her maurische Teppiche; inzwischen sind sie fleckig und stinken, weil die Hofhunde auf ihnen gern ihr Geschäft verrichten.
Der König von Kastilien niest. Geräuschvoll schnäuzt er sich durch zwei Finger auf den Boden. Mit seinem schwarzen Haarbusch und dem verwegenen, dichten Bart sieht er fast aus wie ein muselmanischer Sultan. Alle seine Kinder kommen nach ihm, haben sein dunkles Haar und die üppigen Lippen, ganz anders als ihre rotlockige, hellhäutige Mutter. Die ganze königliche Familie sitzt vor dem großen Feuer, die kleineren Kinder rutschen unruhig auf ihren Hockern hin und her. Alle blicken gespannt auf die Saaltür, die sich jetzt öffnet und ihren Gast einlässt.
Die Frau stützt sich auf einen silberbeschlagenen Gehstock, als sie mit langsamen, würdevollen Schritten auf die königliche Familie zukommt. Staunend reißen die Kinder die Augen auf: Noch nie haben sie jemanden gesehen, der so alt ist! Ein Gesicht, durchzogen von unzähligen feinknittrigen Fältchen, die Haut so blass und durchscheinend wie vielfach geschabtes Pergament. Eine leicht gebogene Adlernase, ein schmaler Mund, der nicht lächelt. Augen im strahlendsten Meerblaugrün, ein wenig milchig geworden durch das Alter, unter hohen, mit Kohle nachgezeichneten Brauen. Eine Schönheit, der die Jahre kaum etwas genommen haben. Eine Miene, die beinahe Angst einjagt.
Die Greisin bleibt ein paar Schritte vor der Familie stehen. Königin Leonor erhebt sich. »Kinder«, sagt sie, »begrüßt eure Großmutter.«
Und jetzt lächelt die Frau. Breitet die Arme aus. »Ich freue mich, euch zu sehen«, sagt sie auf Französisch mit einem weichen okzitanischen Akzent. »Und natürlich auch dich, Alfonso, lieber Schwieger.«
Eines nach dem anderen treten die Kinder vor, um die Großmutter zu küssen. Den Anfang macht die vierjährige Costanza, dann Enrique, auf ihn folgt Mafalda. Der elfjährige Fernando verbeugt sich schon recht elegant. Dann kommt Blanca, sie wagt sogar ein Lächeln. Am Schluss die schüchterne Urraca, der noch niemand gesagt hat, dass dieser Besuch allein ihr gilt. Auch sie drückt einen Kuss auf die trockene Wange ihrer Großmutter und wundert sich, dass der Blick der Greisin länger auf ihr ruht als auf den anderen.
Als sich nun auch noch Alfonso erhebt und seine Schwiegermutter umarmen will, kommt er gerade noch rechtzeitig, um ihren zusammensackenden Körper aufzufangen. »Den Arzt!«, ruft er, während er die Alte vorsichtig auf den Teppich bettet. Leonor kniet sich neben ihre Mutter und fächelt ihr Luft zu. »Ich wusste es«, murmelt sie sorgenvoll. »Die Reise war doch viel zu anstrengend für sie.«
Der Arzt eilt herbei, untersucht die still daliegende Greisin, die flach und stoßweise atmet. »Liebe Jungfrau im Himmel, stirbt sie?«, fragt die Königin.
Noch bevor der Medicus eine Antwort geben kann, öffnet die alte Frau die Augen. »Ich bin in England nicht gestorben, in Frankreich nicht und nicht im Heiligen Land«, sagt sie mit schwacher Stimme. »Wenn ich diese Welt verlasse, dann tue ich das in meinem Aquitanien.« Sie lächelt mühsam. »Das habe ich mit dem lieben Gott so ausgemacht.«
»Es ist eine Erschöpfung. Sie braucht nur Ruhe und eine stärkende Diät.« Der junge Arzt erhebt sich und sieht zu, wie ein paar Diener die Kranke hinaustragen. Und jetzt wird es ihm erst klar: Er hat soeben der berühmtesten und gleichzeitig berüchtigtsten Frau seiner Zeit das Mieder geöffnet. Der Frau, deren Ruf weit über alle Grenzen gedrungen ist, über deren Abenteuer seit Jahrzehnten ganz Europa spricht. Deren Schönheit Legende geworden ist, genauso wie ihre angebliche Schlechtigkeit. Der Königin von Frankreich und England, Gräfin von Poitiers, Herrscherin über Saintonge, La Marche und Touraine, Herrin über die Gascogne, die Auvergne und das Limousin. Der hochedlen Herzogin Aliénor von Aquitanien.
Eine Woche lang bekommt sie Kalbssuppen, Würzwein mit Eigelb und Honig, weißes Schonbrot mit zerdrücktem Ochsenmark. Ihre Tochter bringt ihr Blutwurst mit Reis und Fett, die man hier Morcilla nennt und die angeblich noch mehr Kraft geben soll als gebratene Stierhoden und Schlangenpulver. Der Arzt schnäppert sie zwei Mal zur Ader – jeweils nur die Menge eines Wachteleis, bei alten Menschen muss man vorsichtig sein. Schließlich geht es ihr besser, der liebe Gott hat sich an seine Abmachung gehalten. Sie lässt täglich ihre Enkelkinder kommen, unterhält sich mit der Königin und ihren Damen, macht kleine Spaziergänge durch die Burg.
Einer ihrer Rundgänge führt sie am Sonntag Exsurge an der Kapelle vorbei, als sie von drinnen leises Schluchzen hört. Sie späht durch die halbgeöffnete Tür. Drinnen ist es dunkel bis auf das gelblich flackernde Licht zweier Altarkerzen. Auf einer Seitenbank sitzt Urraca, ein Häuflein Elend, ihre Schultern zucken im Rhythmus der Flammen. Langsam kommt Aliénor näher und legt ihrer Enkelin die Hand auf den gesenkten Kopf. »Warum weinst du, mi cors?«
Jetzt fließen die Tränen nur umso schlimmer. Aliénor setzt sich neben Urraca auf das Bänkchen und wiegt das Mädchen in ihren Armen. Sie ahnt, was gleich kommen wird.
»Mutter hat mir erzählt«, stößt Urraca zwischen zwei Schluchzern hervor, »dass Ihr mich mitnehmen wollt.«
»Ja, das stimmt«, antwortet Aliénor. »Deshalb bin ich gekommen.«
Urraca hebt flehend die Hände. »Aber ich will nicht fort, Großmutter. Ich will hierbleiben. Ich hab solche Angst. Ich kann das nicht. Bitte, im Namen der Muttergottes, bitte lasst mich hier.«
Aliénor seufzt aus tiefster Brust. Sie hat das Mädchen in den letzten Tagen beobachtet, und ihr erster Eindruck hat sich nun bestätigt. Urraca ist ein liebenswertes Ding, fromm und gut erzogen. Sie kann lesen, die Harfe zupfen und handarbeiten. Aber ihr fehlt es an Mut und Selbstvertrauen, und sie denkt zu wenig. Nicht, dass sie einfältig wäre, aber sie hat keinen Sinn für Zusammenhänge, kann nicht zwischen wichtig und unwichtig trennen. Zudem ist sie langsam bis hin zur Trägheit, kennt weder Schwung noch Leidenschaft.
»Du willst also nicht mit mir nach Frankreich reisen?«, fragt sie.
Urraca schüttelt voller Verzweiflung den Kopf.
Sie tätschelt dem Mädchen die Hand und erhebt sich mit einem Seufzer. »Nun gut. Ich werde darüber nachdenken und mit deiner Mutter reden.«
Noch am selben Nachmittag, nachdem sie stundenlang auf dem Bett gelegen und gegrübelt hat, öffnet sich lautlos ihre Kammertür. Ein dunkles Augenpaar lugt herein. Ein Flüstern. »Großmutter, schläfst du?«
Es ist Blanca, die Zweitälteste, ein mageres Ding mit rabenschwarzen Locken, milchblasser Haut und den Mandelaugen Kastiliens.
»Komm nur herein, Liebes«, sagt sie und setzt sich auf. »Was hast du auf dem Herzen?«
Blanca läuft zu ihr und hockt sich wie ein kleines Kind zu ihren Füßen. »Ich … ja, weißt du …«
Aliénor lächelt. »Nur freiheraus damit, sag, was du sagen willst.«
Blanca schaut zu ihr auf. »Nimm mich mit nach Paris, Großmutter. Nicht Urraca.«
Aliénors gemalte Augenbrauen schnellen in die Höhe. »Und warum sollte ich das tun?«
Blanca springt auf. »Weil ich Königin von Frankreich werden will«, ruft sie beinahe trotzig.
»Aha«, sagt Aliénor trocken. »Und deine Schwester?«
»Die sitzt seit heute Morgen in der Kapelle und heult sich die Augen aus. Sie sagt, sie kann das nicht.«
»Und glaubst du denn, du kannst es?«
»Ja!« Das Mädchen hat vor Aufregung rote Wangen bekommen. »Ich will den König von Frankreich heiraten. Ich will mit ihm über ein großes, reiches Land herrschen. Ich will mit ihm ins Heilige Land ziehen, so wie du! Die Welt sehen! Ich will Dinge entscheiden. Ich will, dass man über mich Lieder singt. Ich will …«
Aliénors Gesicht hat sich verfinstert. »Das sind Träume«, sagt sie rau. Die ihren Preis haben, denkt sie bei sich. Das weißt du noch nicht.
»Aber du hast doch auch …«, beginnt Blanca.
Aliénor tut einen tiefen Atemzug. Ihre Miene entspannt sich wieder, sie lächelt. »Ja, das habe ich. Bei Gott. Komm, hilf mir auf.«
Sie lässt sich von ihrer Enkeltochter hochziehen und den Stock reichen. »Wie alt bist du?«
»Ich werde bald fünfzehn. Im Sommer.«
»Und du hast dich stets fromm und züchtig gehalten?«
Das Mädchen blitzt sie an. »Ich habe noch nie Umgang mit einem Mann gehabt, wenn du das meinst.«
Ei, denkt Aliénor, die Kleine redet freiheraus. Das ist gut. »Und bist auch sonst gesund?«
Blanca lacht voller Zuversicht. »Mir hat einmal eine Zigeunerfrau geweissagt. Ich werde uralt. Und ich werde viele Kinder haben.«
»Pah! Das sagen sie immer.« Aliénor winkt ab. Aber sie sieht, was sie sieht. Ein junges Mädchen in voller Blüte, ein bisschen zu dünn vielleicht, aber mit ganz ordentlichen Brüsten und nicht zu schmalem Becken. Eine Rose, die nur darauf wartet, gepflückt zu werden. Sie nickt zufrieden. Warum nicht? Prinzessin ist Prinzessin. »Nun geh und tröste deine Schwester«, sagt sie. »Ich will sehen, was ich tun kann.«
»Gib mir die Jüngere mit!«
Leonor von Kastilien, die mit ihrem Lieblingsäffchen auf der Schulter in der Fensternische sitzt, runzelt die Stirn. »Aber Mutter, wir hatten doch vereinbart …«
»Das hatten wir«, fällt Aliénor ihrer Tochter ins Wort. »Trotzdem. Urraca ist zu schwach. Sie hat weder den Willen noch die nötige Stärke. Und es geht schließlich um einen dauerhaften Frieden zwischen uns und der französischen Krone.«
»Aber Blanca ist schon nach Portugal versprochen.«
»Ei nun. Das lässt sich regeln. Gib mir die Jüngere mit. Du weißt, dass ich recht habe.«
»Du kannst das nicht einfach so alleine entscheiden, Mutter. Was wird der Bräutigam sagen? Er wollte unsere Älteste.«
»Papperlapapp. Der Knabe ist Ludwigs Enkel, und es heißt, er käme in allen Dingen nach ihm. Er wird keine Schwierigkeiten machen.«
Leonor seufzt. So hat sie ihre Mutter in Erinnerung. Stur wie ein Ziegenbock. »Und warum meinst du, dass Blanca die bessere Wahl ist?«
»Weil sie Ehrgeiz hat. Und Leidenschaft. Weil sie klug ist und weiß, was sie will. Weil sie Stolz und Haltung hat und freiheraus ihre Meinung sagen kann.«
»Kurzum: Weil sie so ist wie du!«
Aliénor wirft den Kopf zurück und bricht in herzhaftes Lachen aus. »Bei den Augen Gottes, das stimmt!« Himmel, hat sie eben wirklich den Lieblingsspruch ihres toten Gatten benutzt? Den sie mehr gehasst hat als jeden anderen Menschen auf der Welt? Die Zeit kann so manches bewirken, denkt sie. Wohl auch den Hass vergessen machen, wie man sieht. »Also, was sagst du?«
Leonor scheucht ihr Äffchen davon und erhebt sich. »Ich schätze dein Urteil, Mutter. Aber ich muss vorher mit Alfonso reden.«
Aliénor sieht ihre Tochter spöttisch an. »Dein Gatte wird nichts tun, was du nicht willst, meine Liebe. Er erinnert mich an meinen Ludwig, Gott hab ihn selig. Man muss sie nur zu nehmen wissen, dann fressen sie einem aus der Hand.«
»So?«, lacht Leonor.
Aliénor zuckt mit den Schultern. »Nun ja, nicht alle. Nicht dein Satansbraten von Vater.«
»Und genau deshalb hast du ihn geliebt!«
»Ach!« Aliénor schiebt trotzig das Kinn vor. »Hab ich das?«
In diesem Augenblick sieht sie wieder aus wie ein junges Mädchen.
Von Burgos nach San Juan de Ortega Ende Februar 1200
»Blanche?«
Das Mädchen schaut aus dem Fenster des Reisewagens, lässt ihren Blick über die weiten Felder schweifen, auf denen im Sommer der Weizen wogt und die jetzt mit Schneeflecken übersät sind.
»Blanche?« Jetzt erst sieht die junge Prinzessin auf.
»Besser, du gewöhnst dich gleich an den Namen«, sagt Aliénor. »Denn so werden sie dich nennen, in Paris.«
»Wie haben sie dich genannt, damals?«
Aliénor schließt kurz die Augen. »Oh, für mich hatten sie viele Namen. Herrin. Hoheit. Hure. Teufelsweib. Was nicht alles.«
»Sie haben dich also nicht geliebt?«
»Geliebt und gehasst. Das wirst du noch lernen, meine Kleine. Königin sein ist ein elendes Geschäft.«
Das Mädchen lacht unsicher. »Es gibt bestimmt schlimmere Schicksale!«
»Was weißt du dummes kleines Ding schon?« Aliénor droht ihrer Enkelin mit dem Finger. »Wenn du in Paris so vorlaut bist, werden sie sich über dich genauso das Maul zerreißen wie über mich damals. Und du wirst viele Feinde haben.«
»Aber du warst doch die Königin!«
»Wenn Ludwig damals nicht gegen alle anderen zu mir gehalten hätte, hätten sie mich schon in den ersten Monaten zerfleischt«, lächelt Aliénor. »Allen voran meine Schwiegermutter. Weißt du, ein Königshof kann erschrecklicher sein als ein Wald voller Räuber.«
Blanca spielt nachdenklich mit ihren Zöpfen, während der Wagen über den gefrorenen Weg holpert. Draußen in der Ferne erhebt sich grau und nebelumwölkt der Matagrande, den sie heute noch überqueren müssen. Zum ersten Mal wird ihr ein bisschen mulmig bei der Vorstellung, in der Fremde zu leben. Mit einem Unbekannten, der ihr Ehemann werden soll. Sie kommt sich plötzlich klein vor und schwach. Ein Kind.
»Grand-mère«, fragt sie schließlich, »wie alt warst du, als du den König von Frankreich geheiratet hast.
»Ungefähr so alt wie du.«
»Und warst du denn nicht froh und glücklich, Königin zu werden?«
Aliénor zieht die Decke höher über ihre Knie. »Ei, natürlich war ich das.«
»Und wolltest du nicht fort von daheim, eine verheiratete Frau sein? Die Welt sehen?«
Die alte Dame lächelt. »Ach weißt du, mich hat damals keiner gefragt. Uns Frauen fragt ja ohnehin nie einer. Und ich musste schnell verheiratet werden, mein Vater war gestorben, und es ging um das Herzogtum. Ob ich die Welt sehen wollte? Eigentlich war ich glücklich in Aquitanien …«
Ihre Gedanken schweifen ab, weit zurück in eine Zeit, die sie längst vergessen hatte. An einen Ort, der immer ihr Zuhause war. Poitiers. Die Sonnenstrahlen fallen senkrecht aus einem blau gleißenden Himmel und tanzen auf den Helmen der Wächter, die auf den Mauern patrouillieren. Sie und Petronilla spielen im Garten, kriechen kichernd unter Büsche, flechten Haarschmuck aus bunten Blütenköpfen. Die dichtbelaubten Äste der Obstbäume tragen schwer an ihrer Last aus Birnen, Pfirsichen, Pomeranzen und Quitten. Rote Feuerkäfer krabbeln im unruhigen Zickzack über den Kiesweg und suchen Schutz im angrenzenden Grün, Eidechsen sonnen sich reglos auf den Mäuerchen und blinzeln genüsslich ins gleißende Licht. Wenn die Mädchen müde sind, legen sie sich ins warme Gras und hören den Zikaden zu, wie sie in den Kräuterbeeten ihre Lieder sägen. Die Luft ist schwer vom Duft wilder Myrrhe.
»Grand-mère?«
Aliénor schreckt hoch.
»Erzähl mir, wie es bei dir war.«
Sie schließt kurz die Augen. Erzählen? Noch niemandem hat sie ihr Leben preisgegeben. Nicht einmal ihren eigenen Kindern. Nicht einmal Richard, ihrem Liebling, ihrem Augenstern. Der jetzt tot und kalt liegt neben seinem Vater. Dort, wo sie auch hingehen wird. Ja, denkt sie, das Erzählen habe ich versäumt, wie so vieles. »Hast du denn noch keine Geschichten über mich gehört?«, fragt sie.
Blanca beugt sich vor. »Doch. Aber Mutter sagt, die sind gemein. Und ich soll nicht alles glauben, was man über dich sagt.«
Aliénor runzelt die Stirn. Es war ihr immer egal, was die anderen über sie redeten. Böse Zungen kann man selten ganz zum Schweigen bringen. Ihr fällt ein, dass dieser junge Dichter sie einmal gefragt hat, damals, als ihn noch kaum einer kannte. Chrétien de Troyes. »Wollt Ihr nicht mit meiner Hilfe Eure eigene Legende schreiben?«, hatte er gesagt. Sie wollte nicht. Trotzdem hat er sie in seiner Artussage verewigt, in Gestalt der Königin Guinevere. Aliénor ärgert sich über sich selbst. Vielleicht war es ein Fehler, ihn abzuweisen. Immerhin ist sein Werk inzwischen berühmt und wird an allen Höfen Europas vorgetragen. Und plötzlich will sie nicht, dass ihre kleine Enkelin, die ihr so ähnlich ist, von ihr denkt, was alle denken. Dass sie auf die Lügen hereinfällt, die man sich erzählt. Auf die Bösartigkeiten, die Missgunst, den Hass all der Kirchenmänner, die über sie in den Chroniken und Hofberichten ihr Gift ausgeschüttet haben. Nein. Das Mädchen soll die Wahrheit wissen.
»Nun«, sagt sie ein bisschen zu fröhlich, »wir haben eine lange Reise vor uns. Und es soll dir schließlich nicht langweilig werden mit deiner Großmutter. Wenn du also wirklich hören willst, was ich zu erzählen habe …«
Blanca nickt eifrig.
Aliénor räuspert sich. »Dann werde ich mich wohl erinnern müssen!«
Der Wagen macht halt. In dem Örtchen Cardenuela dürfen die Pferde saufen und bekommen eine Übermaß Hafer, bevor sie den Aufstieg zum Matagrande bewältigen müssen. Aliénor und Blanca steigen aus, dehnen und strecken sich. In einer flohverseuchten Herberge serviert man ihnen und ihren beiden Dienerinnen ein einfaches Mahl aus Oliven, hartem Käse und spelzigem Brot. Dazu sauren Wein, den sie mit Wasser verdünnen, um ihn trinkbar zu machen. Die Rast dauert nicht lange; sie sind spät dran. Sie wollen an diesem Tag unbedingt noch San Juan de Ortega erreichen, um im dortigen Kloster ein warmes und trockenes Nachtquartier zu beziehen.
Als sie wieder im Wagen sitzen, die dicken Decken aus zusammengenähtem Hasenfell bis zum Kinn gezogen, beginnt Aliénor zu erzählen. »Womit soll ich anfangen?«, fragt sie. Ja, womit? Mit ihrer Geburt vielleicht? Ihren Eltern, der Familie, den Vorfahren? Und dann weiß sie es. Sie wird beginnen mit dem, was ihr mehr als alles andere im Leben wichtig war: Aquitanien. Ihr Land. Ihre Seele. Sie lehnt sich in die Polster, zupft den Pelzring an ihrem Gebende zurecht, atmet tief die eisige Winterluft in die Lungen und findet dann endlich die ersten Worte.
»Was weißt du über Aquitanien, Blanche? Nicht viel, meinst du? Dann höre: Aquitanien ist ein großes, fruchtbares Land. Es erstreckt sich vom Fluss Loire im Norden bis zum Pyrenäengebirge im Süden, von der Küste des Meeres im Westen bis zu den himmelhohen Bergen in der Mitte Frankreichs. Das Reich war seit jeher so bedeutend, dass seine Herrscher eher für Könige als für Herzöge gehalten wurden. Es ist ein Land der Weinberge und der Kornfelder, der Seefahrer, Händler und Salzgärtner. Ein Land der Wälder, Felder und Wiesen, der Flüsse und reinen Quellen. Den Namen gaben ihm in alter Zeit die Römer wegen seines Wasserreichtums: Land der Wasser. Ihnen galt es damals als die reichste Provinz Galliens. Mein alter Bekannter Ralph von Diceto, Gott gönne ihm den angenehmsten Winkel der Hölle, hat es einmal so aufgeschrieben: ›Aquitanien fließt über von Reichtümern aller Art, so dass es von alters her alle anderen Gegenden der westlichen Welt übertrifft.‹ Nun, zumindest in diesem Fall kann man ihm nicht widersprechen.«
»Und dort bist du geboren? Wohl im größten Palast, in der Hauptstadt?«, mutmaßt Blanche.
»Nein, nicht in Poitiers«, entgegnet Aliénor. »Ich kam in Belin zur Welt, einer halbwegs gemütlichen Burg in der Nähe von Bordeaux, als Tochter Wilhelms X., des Herzogs von Aquitanien, und seiner Ehefrau Aénor von Chatellerault …«
»Von ihr habe ich gehört«, unterbricht Blanche aufgeregt. »Ihre Mutter soll ein ganz liederliches Frauenzimmer gewesen sein, sagt man, und dass ihre Hochzeit mit dem Herzog damals Anlass zu üblem Gerede gab …« Sie beißt sich auf die Lippen.
»Vorsicht, Fräulein Vorlaut!« Aliénor wirft ihrer Enkelin einen scharfen Blick zu. »Wer hat dir das erzählt?«
»Mutter«, gibt Blanche kleinlaut zur Antwort. »Stimmt es denn nicht?«
Aliénor gibt einen kleinen ungnädigen Knurrlaut von sich. »Deine Mutter sollte ihre eigenen Vorfahren nicht schlechter machen, als sie waren.« Dann sieht sie das zerknirschte Gesicht ihrer Enkelin und seufzt. Ganz so unrecht hat die Kleine schließlich nicht. »Nun gut, es war wohl eine ziemlich anrüchige Ehe, das muss ich zugeben, aber davon später. Erst einmal das Grundsätzliche, damit alles seine Ordnung hat. Also. Es gibt viele Geschichten über die Dynastie der Herzöge von Aquitanien, die musst du nicht alle kennen. Nur so viel: Bei uns genossen die Frauen gemäß der alten römischen Tradition mehr Freiheiten als anderswo. Adelige Damen hatten es in Aquitanien nie schwer, Einfluss zu gewinnen und sich in öffentliche Angelegenheiten einzumischen. Töchter konnten erben, über Ländereien verfügen und regieren. Ich – und damit du, meine Kleine – habe Ahnfrauen, die in Rang und Stellung jedem Mann gleichkamen. Herzogin Emma oder Herzogin Agnes beispielsweise, die beide mit unfähigen oder treulosen Ehemännern fertigwurden oder diese verlassen haben, die an Stelle ihrer schwachen Gatten oder Kinder regiert und auf ihre Herrscherwürde gepocht haben. Das sollen deine Vorbilder sein, Blanche, so wie sie immer meine waren. Ihr Blut fließt in deinen Adern.«
»Aber von denen habe ich nie gehört, Grand-mère!« Blanche wirkt richtig empört.
»Siehst du! Das hätte dir deine Mutter erzählen sollen, nicht den ganzen anderen Unsinn.« Aliénor ist wütend auf ihre Tochter. Hat sie Leonor nicht eine ordentliche Erziehung angedeihen lassen, besser, als sie damals andere Mädchen von Adel bekamen? Und sie hat nicht einmal das Wissen über ihre Ahnfrauen weitergegeben? Ahi, da wird die kleine Blanche wohl noch manches nachholen müssen! Die alte Königin schnaubt kopfschüttelnd und erzählt dann weiter.
»Als ich geboren wurde, regierte noch mein Großvater, Wilhelm IX., den sie schon damals den Troubadour nannten. Sein Hof war der herrlichste, vornehmste und bedeutendste in ganz Frankreich. Ei, du denkst jetzt sicherlich, der Königshof zu Paris muss doch den in Poitiers übertroffen haben, aber das stimmt nicht. Aquitanien hatte zwar nach altem Herkommen der französischen Krone den Lehnseid zu leisten, aber das war nie mehr als eine Formalie. Man hat sich arrangiert. Der König war weit, und er tat gut daran, in Paris mit seinem Hintern den Thron schön warmzuhalten und sich ansonsten nicht einzumischen. Wer von den mächtigen Herzögen im Land nahm damals schon diese kleine Dynastie von Emporkömmlingen ernst, deren Söhne zu französischen Königen gewählt wurden? Aus dem einfachen Grund, weil sie wegen ihres spärlichen Eigenbesitzes und ihrer begrenzten Mittel für den Adel keinerlei Gefahr darstellten. Capet! Dass ich nicht lache, pflegte mein Großvater zu sagen. Denen gehört kein Tagwerk Acker außerhalb der Île de France, und wenn du die findest, dann pass auf, dass du nicht aus Versehen drübersteigst! Emporkömmlinge ohne ordentliche Ahnenreihe, keine Lebensart, kein Geld, kein Land. Gewählt – soll das ein Witz sein? Uns soll mal jemand versuchen zu wählen! Wir führen unseren erlauchten Stammbaum auf Karl den Großen zurück. Selbstverständlich regieren wir Aquitanien, wer auch sonst? Schließlich sind wir dafür geboren.«
Blanche ist beeindruckt. »Meine Mutter sagt, Herzog Wilhelm der Troubadour war berühmt in allen Landen!«
»Na immerhin! Da hat sie ausnahmsweise einmal recht«, brummt Aliénor. »Beim lieben Herrgott! Ich sehe meinen Großvater heute noch vor mir. Ein eindrucksvoller Mann, groß, wohlbeleibt und immer mit einem Scherz auf den Lippen. Sein Hof war das Herz Frankreichs, nicht die armselige Bleibe des Königs in Paris, die später zu meinem Heim werden sollte. Und während sich die Krone in allen Dingen der Kirche untergeordnet hatte, scherte sich mein Großvater nicht einen Mückenschiss um den Papst in Rom. Ha, vor allem nicht, wenn es um Frauen ging. Du musst wissen, dass die Heirat in früherer Zeit noch kein heiliges Sakrament war. Aber die Kirche hat damals versucht, sich die Hoheit über adelige Ehen zu erkämpfen, indem sie Ehen bis zum siebten Verwandtschaftsgrad untersagt hat und auch außereheliche Beziehungen, wie sie stets üblich waren, nicht anerkannte. Da hättest du deinen Ururgroßvater erleben sollen! Er war berühmt dafür, dass er tobte, bis er mit dem Kopf gegen die Wand rannte! Denn er und die Frauen, das war eine besondere Geschichte, weiß Gott! Und er war unfromm, schlug die Lehren der Bibel in den Wind. Du musst gar nicht so erschrocken dreinschauen, Kind, du wirst als Königin noch deine eigenen Kämpfe mit der Kirche bestreiten. Jedenfalls waren die Vergnügungen der Liebe das Einzige, was ihn im Leben wirklich angefochten hat. Unermüdlich war er auf der Jagd nach Abenteuern. Natürlich hatten es ihm auch das ritterliche Leben und der Krieg angetan, aber hauptsächlich waren es die Frauen, hinter denen er her war. Er war in zweiter Ehe verheiratet mit Philippa von Toulouse – über seine erste Frau weiß ich kaum etwas –, die ihm als Erbe Toulouse einbringen sollte. Allerdings wurde sie von ihrer Verwandtschaft um dieses Erbe betrogen, aber davon später. Philippa nun, obwohl sie ihm viele Kinder schenkte, wurde meinem Großvater bald zur Last, und er wandte sich einer Frau zu, die bereits einem anderen gehörte. Dangerosa nannten sie die Leute – die Gefährliche. In der Tat war sie so gefährlich, dass mein Großvater völlig den Kopf verlor und sie mir nichts dir nichts ihrem Gatten entführte. Was sie sich nur zu gerne gefallen ließ. Er hatte die Stirn, sie im neuerbauten Wohnturm der Burg von Poitiers einzuquartieren, genau vor den Augen seiner Frau. Ab diesem Zeitpunkt hieß sie La Maubergeonne, nach dem Namen des Turms.«
Blanche richtet sich triumphierend auf. »Also war sie doch ein liederliches Weib, wie meine Mutter gesagt hat.«
»Pah! Darüber steht deiner Mutter gar kein Urteil zu, und dir schon gar nicht, du naseweises Ding! Sie haben sich eben leidenschaftlich geliebt, die beiden!« Aliénor hebt beschwichtigend die Hände. »Natürlich war die ganze Sache zutiefst unanständig und gegen die guten Sitten. Und für Großmutter Philippa war es ein großes Unglück. Nachdem sie dem Treiben lange Zeit hilflos zugesehen hatte, flüchtete sie sich schließlich, weil weder Weinen noch Wüten etwas geholfen hatten, in den Schoß der Kirche. Sie ging ins Kloster, denn gegen einen liebestollen Ehemann ist nun einmal kein Kraut gewachsen, davon kann auch ich ein Liedchen singen, bei Gott! Sie war eine würdevolle Dame. Ich weiß noch, dass ihr Haar silbergrau war, und ihr Gang gebeugt. Sie litt still und stumm, denn sie liebte meinen Großvater sehr. Als Kind machte ich mir darüber keine Gedanken. Dangerosa mochte ich gern, sie war lebhaft, lachte und spielte mit mir und brachte mir vieles bei. Ich war gleich in zwiefacher Hinsicht ihre Enkelin: Mein Vater war der Sohn ihres Geliebten, des Herzogs, mit seiner rechtmäßigen Gattin Philippa, und meine Mutter war ihre eigene Tochter aus der immer noch bestehenden Ehe mit dem Grafen von Chatellerault. Das habe ich gemeint, als ich vorhin sagte, die Ehe meiner Eltern sei anrüchig. Das ganze Land hat sich das Maul darüber zerrissen, und die Vertreter der Kirche sahen mit scheelem Blick auf die Verbindung.«
»Und dein Vater?«, will Blanche wissen.
Aliénor lacht auf. »Ei, der hat sich gegen diese Ehe gewehrt wie ein Löwe, aber als er meine Mutter zum ersten Mal sah, war er von ihr so hingerissen, dass er allen Widerstand aufgab.«
»Dann hast du also all deine Schönheit von ihr?«
»Was weißt du wohl von meiner Schönheit?«, raunzt Aliénor. »Schau mich an: eine alte, vertrocknete Rosine bin ich!« Sie zieht eine Grimasse, und Blanche kichert. »Aber du hättest mich sehen sollen, als ich in deinem Alter war!«
Der Karren ruckelt und holpert – die Passhöhe ist überwunden, jetzt geht es schneller bergabwärts. Schon kommt die Raststation Atapuerca in Sicht, wo ein Halt eingeplant ist. Danach geht es über Agès nach San Juan de Ortega. Inzwischen ist es Abend geworden. In der Pilgerherberge des Klosters haben es die Reisenden gemütlich warm, die Frauen sitzen beim Kamin und löffeln hungrig den dicken Eintopf aus Graupen und Speck, den man ihnen vorsetzt. Danach lassen sich Blanche und Aliénor von den beiden Zofen für die Nacht herrichten. Als vornehme Gäste hat man ihnen ein eigenes Zimmerchen mit einer einigermaßen sauberen Bettstatt zugewiesen, und sobald Aliénor neben ihrer Enkelin auf dem glattgeklopften Strohsack liegt, fällt sie in einen tiefen, erschöpften Schlaf.
Talmont, Sommer 1130
»Gib das her!« Aliénor reißt ihrer Schwester Petronilla das buntbemalte Tonpüppchen aus der Hand.
»Meins«, heult Petronilla.
Die Kinderfrau eilt herbei, um zu schlichten. »Pfui, schämt euch«, schilt sie, »nehmt euch ein Beispiel an Aigret, seht, wie lieb er mit seinen Pferdchen spielt!«
Die beiden Mädchen blicken hinüber zum Bach, wo ihr zweijähriger Bruder unter der Trauerweide seine geschnitzten Rösser durchs Gras galoppieren lässt. Neben ihm die Mutter auf weichen Kissen, umgeben von ihren adeligen Frauen und Dienerinnen. Die Damen vergnügen sich mit Ratespielen, während ihre Männer auf der Jagd sind. Talmont ist Herzog Wilhelms liebstes Jagdschlösschen, hier lässt er seine Falken halten und verbringt angenehme Tage ohne viele Gedanken an das leidige Regieren. Manchmal, so wie jetzt, lässt er die ganze Familie mitkommen, was für einen Fürsten nicht selbstverständlich ist. Aber Wilhelm liebt seine Frau und seine Kinder und hat sie gerne so oft wie möglich um sich.
Aliénor und Petronilla laufen zu ihrer Mutter, um dem Schelten der Kinderfrau zu entgehen. Aénor nimmt die beiden lachend in die Arme und steckt Petronilla zum Trost eine kandierte Kirsche in den Mund. Eine glückliche junge Frau, die mit ihren kaum zweiundzwanzig Jahren bereits drei Kinder geboren hat und schon wieder das nächste unter dem Herzen trägt. Sie stimmt ein Lied an, und einige der Frauen singen fröhlich mit. Wein und Ziegenkäse werden aufgetragen, honigtriefendes Gebäck und frisches Obst. Sofort umsummen die ersten Wespen die auf einem Tuch ausgebreiteten Leckereien, denn zu den Wirtschaftsgebäuden des Schlösschens gehört ein Schuppen, unter dessen Dach ein wildes Wespenvolk Heimat gefunden hat.
Aénor nimmt ihr Söhnchen auf den Schoß und gibt ihm ein Apfeltörtchen. Aigret stopft sich die Süßigkeit mit beiden Händen in den Mund und kaut mit vollen Backen, das Kinn verschmiert und triefend von Honig. Eine Wespe brummt heran und setzt sich auf seine Unterlippe. Aénor will sie gerade verscheuchen, da zuckt Aigret mit dem Kopf. Aénor schreit hell auf. Ein Stich am Ringfinger, man sieht die kleine Wunde und die Rötung drumherum. Eine Zofe taucht ihr Fazenettlein in die Weinkaraffe und wickelt es um den verletzten Finger. »Nicht so schlimm«, lacht Aénor. Doch das Lachen bleibt ihr schon im Halse stecken. Hand und Arm werden dick, auf der Haut bilden sich im Nu lauter kleine Quaddeln. »Es juckt überall«, krächzt die Herzogin, ja, krächzt, denn auch Hals und Gesicht schwellen auf, sie wird ganz blau. Schwindel erfasst sie, sie kippt hintüber, röchelt, ringt nach Luft. Die Hofdamen sind bestürzt, eine greift sich den kleinen Aigret, eine andere rennt mit wehenden Röcken zum Schloss, um den Leibarzt zu holen. Die Gräfin von Mauléon eilt zum nahen Teich, um Wasser zu holen. Die anderen öffnen Aénors Kleid, fächeln ihr Luft zu, tupfen ihr den kalten Schweiß von der Stirn. Stumm vor Entsetzen stehen Aliénor und ihre Schwester da und sehen zu, wie ihre Mutter zu einem unförmigen Ding anschwillt. Ihre Lippen sind zu Wülsten verformt, die Augenlider so dick, dass nur noch die Wimpernspitzen zu erkennen sind. Aigret piepst: »Warum ist Maman so dick?«, aber niemand gibt ihm Antwort, alle starren fassungslos die Herzogin an. Aénor ringt nach Luft, versucht verzweifelt, Atem zu holen. Es geht nicht. Ihre Arme und Beine zucken krampfartig, der Kopf ruckt hin und her. Und dann liegt sie still.
Als der Arzt kommt, ist die Herzogin von Aquitanien bereits tot.
Aus der fröhlichen Jagdpartie ist eine Trauergesellschaft geworden. Aigret hat noch nichts begriffen, aber die Mädchen wissen schon, was der Tod bedeutet. Und ohne die Herzogin gibt es keinen weiblichen Hofstaat mehr. Wo sollen da die Kinder hin?
Die Lösung ist Großmutter Philippa. Die andere, die Maubergeonne, hat sich gänzlich vom Hof zurückgezogen, damals, als Großvater Wilhelm gestorben ist. Philippa kommt also aus dem Kloster Fontevraud, das sie zu ihrem Witwensitz erkoren hatte, und bezieht mit den Kindern die Frauenkemenate der Festung Ombrière in Bordeaux.
Und hier geschieht das nächste Unglück. An einem Regentag im August entwischt der kleine Aigret aus der Kinderstube und begibt sich vorwitzig ganz alleine auf Erkundung. Er trabt über den Hof, wirft ein paar Steinchen in den mit Fliesen eingefassten Brunnen und huscht dann durch die Tür zum rechteckigen Bergfried, der aus der Südostecke der alten römischen Mauer herauswächst. Bis ganz nach oben steigt der Junge, ohne dass ihn jemand bemerkt. Im obersten Stock will er zum Fenster hinausschauen, aber es ist zu hoch. Da rückt er einen Scherenhocker unter das Sims und klettert hinauf. Ah, die Dächer von Bordeaux, so viele sind es! Und da, der Fluss, die Garonne! In weitem Bogen umfließt er die Stadt; kleine Wirbel an der Oberfläche zeigen an, dass die Flut von der Gironde her kommt, bis zu drei Ellen hoch macht sich der Unterschied der Gezeiten hier noch bemerkbar. Boote dümpeln an den Anlegestegen im Wasser, und zwei große Segler gleiten anmutig in Richtung Meer. Das Lachen der Möwen klingt so lustig, dass der Junge in die Hände klatscht, und siehe da, eine davon fliegt herbei und setzt sich über dem Fenster aufs Dach. Aigret lehnt sich weiter nach draußen, um den Vogel so besser sehen zu können, dreht den Kopf nach oben. Noch ein Stückchen schiebt sich der Junge nach vorne, und noch eins. Und dann verliert er das Gleichgewicht. Er schreit vor Schreck hell auf, rudert mit den Armen, aber seine Hände finden keinen Halt. Mit einem dumpfen Geräusch landet sein kleiner Körper auf dem steinigen Rasenstück zwischen Burgmauer und Wall. Erst am Abend, nach stundenlanger Suche, finden sie ihn.
Der junge Herzog, schon durch den Tod seiner jungen Frau gepeinigt, hat nun auch noch seinen einzigen Sohn und Erben verloren. Gott straft ihn. Die ganze Nacht hören ihn die Mädchen schluchzen und heulen. Und die beiden weinen aus tiefstem Herzen mit um das tote Brüderchen.
Von San Juan de Ortega nach Belorado Ende Februar 1200
»Der Tod meines kleinen Bruders veränderte mein Leben«, erinnert sich Aliénor. »Jetzt war ich, mit meinen sechs Jahren, die Erbin der Herzogswürde. Mein Vater bemühte sich zwar bald um eine neue Ehe, aber sie kam dann doch nicht zustande, warum er letztendlich alleine blieb, weiß ich nicht. Vielleicht glaubte er, er habe noch viel Zeit. Vielleicht konnte er auch meine Mutter nicht vergessen, die er so sehr geliebt hat. Oder es lag an seiner Trägheit. Er hatte nicht viel von meinem Großvater. Der, ja der war ein Herzog, wie es keinen zweiten gab! Er focht und stritt, brüllte und tobte, lachte und soff, feierte prächtige Feste, sang und dichtete. Und er hatte so viele Liebschaften wie Spatzen auf den Dächern von Poitiers sitzen. Ich hing sehr an ihm, er trieb seine Späße mit mir, warf mich hoch in die Luft, ließ mich auf seinen Schultern reiten. Kurz bevor er starb, schenkte er mir einen wunderschönen, glitzernden Becher aus Bergkristall, den er im maurischen Spanien einem riesigen, furchteinflößenden Sarazenen abgejagt hatte, so erzählte er mir. Du weißt ja, Bergkristall ist steingewordenes Eis, nichts funkelt schöner im Sonnenlicht.« Aliénor lächelt. »In Wirklichkeit war der Becher ein Geschenk des Emirs von Saragossa. Ganz gleich, er war lange Zeit mein kostbarster Schatz.«
Blanche sitzt stumm da, in Gedanken versunken. Sie überlegt, dass auch sie ein Brüderchen verloren hat, Enrico. Er ist am Leibgrimmen gestorben, an mehr erinnert sie sich nicht, weiß nicht einmal mehr, wie er ausgesehen hat. Die Prinzessinnen wurden nicht zusammen mit den Prinzen erzogen, sie waren die meiste Zeit unter sich am Hof in Palencia. Sie hat auch kaum mitbekommen, als vor zehn Jahren ihr ältester Bruder Sancho tödlich verunglückt ist. Merkwürdig, denkt sie. Da hat man Brüder und kennt sie kaum. Dann wendet sie sich wieder Aliénor und ihrer Erzählung zu.
»Dein Vater, der Sohn des Troubadours – was war er für ein Mensch?« Sie kratzt sich am Hals, es waren doch Wanzen im Bett, letzte Nacht.
Aliénor überlegt. »Mein Vater hatte selten Zeit für mich, und wenn, dann war er meist traurig, sobald er mich anschaute. Es hieß damals, ich sähe meiner Mutter so ähnlich wie ein Ei dem anderen, und je älter ich wurde, desto größer wurde diese Ähnlichkeit. Weißt du, wir hatten beide dieses dichte, sanftgewellte Haar, dunkel und glänzend wie ein Rabenflügel. Heute sind meine Haare grau, jaja, du kannst es also nicht mehr sehen. Aber meine Augen, die siehst du: irgendetwas zwischen Blau und Grün. Es sind die Augen meiner Mutter. Aigret und Petronilla hingegen waren die Ebenbilder unseres Vaters, rotblond und braunäugig.«
Der Weg führt nun wieder aufwärts, hinein in die Montes de Oca. Die Gänseberge sind dicht bewaldet, und in der Finsternis dieser Wälder hausen Räuberbanden, die nur auf durchziehende Pilger oder Händler lauern. Aliénor lässt kurz halten und erteilt Anweisungen für den Ernstfall; sie ist zu Burgos schon vorgewarnt worden. Außerdem lässt sie sich zwei lange, spitze Dolche in den Karren reichen und gibt Blanche einen davon. »Gebrauche ihn, wenn es nötig wird«, sagt sie.
Blanche blickt unsicher drein. »Hast du schon einmal …?«, fragt sie.
Aliénor lacht trocken. »Einmal?« Sie merkt, dass das Mädchen Angst hat und winkt ab. »Wir haben doppelte Bewachung, Kind. Wenn diese Schnapphähne gescheit sind, halten sie sich von uns fern.«
Blanche ist beeindruckt. Dass sie sich im Notfall verteidigen soll wie ein Mann, das hat ihr noch nie jemand gesagt. Ihre Achtung vor Aliénor steigt ins Unermessliche. Wer weiß, wie viele Angreifer die Großmutter schon zur Strecke gebracht hat! Sie dreht den Dolch nachdenklich in ihrer Hand und überlegt dabei, ob sie wohl jemals eine ebenso streitbare Frau werden kann wie die alte Königin.
Der Wagen rollt voran, es beginnt, sachte zu nieseln. Im Wald ist es finster, dichte Baumkronen schirmen das Tageslicht ab. Nur das Schnobern der Pferde, das Rumpeln der Wagenräder und das Tropfen des stärker werdenden Regens sind zu hören. Die Waffenknechte reiten mit gespannter Aufmerksamkeit.
»Also, wo waren wir stehengeblieben?«, fragt Aliénor leichthin, um Blanche abzulenken. »Ah ja, mein Vater. Anders als mein Großvater war er nie ein Weiberheld. Er lebte ganz im Diesseits – die Kirche war ihm stets ein Dorn im Auge. Das liegt in der Familie, pah, ich kann die Pfaffen genauso wenig leiden. Mein Vater stritt sich mit seinen Bischöfen und unterstützte sogar damals diesen Antipapst, wie hieß er noch gleich? Ahi, man wird vergesslich. Nun ja, ich selber war in dieser Zeit mit anderen Dingen beschäftigt. Als zukünftige Herzogin von Aquitanien musste ich lernen, viel lernen. Der Erzbischof von Bordeaux wurde damit betraut, sich um meine Schulbildung zu kümmern, und das tat er denn auch mit großem Eifer. Er ordnete an, dass die Hofkapläne mir Lateinunterricht gaben. Hatte man mir vorher nur die üblichen Fertigkeiten einer adeligen Dame beigebracht – Nähen, Sticken, Spinnen, Weben –, so lernte ich nun auf bischöflichen Befehl alles, was man nötigenfalls zum Regieren brauchte. Ich ging zusammen mit einigen Jungen vom Adel in den Unterricht, was meine Großmutter sehr missbilligte. ›Sie wird ein Mannweib werden, wenn du das weiterhin zulässt!‹, fauchte sie meinen Vater einmal wütend an. Aber der grinste nur. ›Schau doch nur, das hübsche Ding‹, erwiderte er, ›ich wette, die wird später ganz bestimmt niemand für einen Kerl halten.‹ So lernte ich also alles über die Geschichte Aquitaniens und über ferne Länder, ich lernte wichtige Dinge über die Kriegskunst und die Staatskunst, über Handel und Gewerbe, Verwaltung und Steuern. Besonders gut gefiel mir die Wissenschaft der Astronomie; schnell konnte ich die wunderbaren Sternbilder benennen, die nachts so herrlich am Himmel funkelten. In Glaubensdingen bildete mich der Erzbischof selber aus, er war ein sanfter, geduldiger und kluger Mann, ein ehemaliger Eremit. Ich mochte ihn gern, aber wie mein Vater und Großvater blieb auch ich der Kirche gegenüber stets vorsichtig und nahm nicht alles an. Denn mehr als um den Glauben geht es der Kirche um Macht, auch das wirst du noch lernen.«
»Ich wollte, ich hätte auch so guten Unterricht bekommen wie du!« Blanche macht einen Schmollmund. »Dann wüsste ich viel mehr, und du würdest mich nicht für so dumm halten.«
»Papperlapapp! Du bist nicht dumm, Schätzchen. Du musst nur noch manches lernen. Und dazu hast du ja noch Zeit!« Aliénor tätschelt ihrer Enkelin die Hand.
»Mutter hat gemeint, Petronilla war dumm«, sagt Blanche vorsichtig.