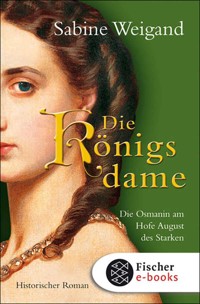8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anno 1415: Hätte der Medicus eine Frau sein dürfen? Sie ist Ärztin, sie ist Jüdin, und sie ist auf der Flucht vor ihrem brutalen Ehemann: Sara hat viele Geheimnisse, die sie vor den Gauklern verbirgt, mit denen sie 1415 den Rhein entlang zieht. Auch der junge Ritter Ezzo schweigt über den Auftrag der ungarischen Königin, der ihn zu den Gauklern geführt hat. Und der irische Mönch Ciaran bewahrt in seiner Harfe das Vermächtnis des Ketzers John Wyclif, das die Kirche unbedingt vernichten will. Alle drei geraten auf dem Konzil von Konstanz in Machtintrigen, die sie in große Gefahr stürzen. Denn sie hüten ein Geheimnis, das die Welt von Kaiser und Papst erschüttern kann. Der spannende Mittelalterroman um die historisch verbürgte jüdische Ärztin Sara – von Erfolgsautorin Sabine Weigand
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 920
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Sabine Weigand
Die silberne Burg
Historischer Roman
Über dieses Buch
Sie ist Ärztin, sie ist Jüdin, und sie ist auf der Flucht vor ihrem brutalen Ehemann: Sara muss viele Geheimnisse vor den Gauklern verbergen, mit denen sie 1415 den Rhein entlang zieht: ihren Glauben, ihre Herkunft, anfangs sogar ihre Fähigkeiten als Medica. Auch der junge Ritter Ezzo schweigt über den Auftrag der ungarischen Königin, der ihn zu den Gauklern geführt hat. Und der irische Mönch Ciaran bewahrt in seiner Harfe das Vermächtnis des englischen Ketzers John Wyclif, das die Kirche unbedingt vernichten will.Alle drei reisen zum großen Konzil von Konstanz. Dort geraten sie unversehens in Machtintrigen, die sie in Gefahr stürzen. Denn sie hüten ein Geheimnis, das die Welt von Kaiser und Papst erschüttern kann.Die jüdische Ärztin ist historisch dokumentiert. Sabine Weigand erzählt die spannende Geschichte einer außergewöhnlichen Frau im Mittelalter.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Coverabbildung: © HildenDesign unter Verwendung von Motiven von Bridgeman Art Library (Burg) und Interfoto (Frau)
Landkarte am Buchende: Kartengrafik Thomas Vogelmann, Mannheim
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2010
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-10-400885-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Erstes Buch
Siegburg, Oktober 1390
Irgendwo im Süden Englands, zur selben Zeit
Rittergut Riedern bei Lauda, Sommer 1394
Aus der Kölner Judenordnung
Köln, Frühjahr 1398
Irland, Kloster Clonmacnoise, Sommer 1398
Sara
Rittergut Riedern bei Lauda, Winter 1398
Testament des Grafen Heinrich von Riedern, ausgestellt vor Zeugen am 10.Oktober 1395 und nach seinem Ableben nicht mehr auffindbar.
Köln, Winter 1403
Rittergut Riedern, Winter 1404
Papst Innozenz III. über die Juden, 1205
Sara
Brief des Salomon ben Hirsch an Sara, Frühling 1405, geschrieben auf Deutsch mit hebräischen Buchstaben
Kloster Clonmacnoise, Sommer 1405
Buda, Frühjahr 1406
Kloster Clonmacnoise, zwei Monate später
Köln, Frühjahr 1408
Sara
Kloster Clonmacnoise, Winter 1410
Buda, Sommer 1410
Sara
Zweites Buch
München, Winter 1411
Sara
Irland, Midlands, Sommer 1412
Augsburger Arztbestallung aus dem Jahr 1362
München, Herbst 1412
Budapest, zur selben Zeit
München, Dezember 1412
London, zur selben Zeit
Würcksame Mittel gegen alle mögklichen Gebresten des Leybes
Sara
London, Februar 1413
Empfehlung eines christlichen Patienten, 15. Jhd.
Sara
Under der Linden Walther von der Vogelweide, Anfang 13. Jahrhundert
Eine Donauinsel nahe Budapest, Sommer 1413
Irgendwo zwischen Brügge und Lüttich, zur selben Zeit
Aus den Werken Abaelards über die Juden
München, Ostern 1414
Sara
Drittes Buch
Köln, Juni 1414
Musik und Tanz, 15. Jhd.
Siegburg, Juni 1414
Sara
Aus »Des sorgsamen Artztes heyl bringender Rosengartten«, geschrieben von Jehuda Mendel
Burg Drachenfels, Juli 1414
Aus »Des sorgsamen Artztes heyl bringender Rosengartten«, geschrieben von Jehuda Mendel
Maria Laach, August 1414
Würcksame Mittel gegen alle mögklichen Gebresten des Leybes,
Andernach, September 1414
Sara
St. Goar, Oktober 1414
Burg Pfalzgrafenstein, Anfang November 1414
Sara
Viertes Buch
Konstanz, Februar 1415
Gesamtübersicht über die Gäste und Teilnehmer am Konzil
Sara
Konstanz, Anfang März 1415
Klagelied über die Bosheit der Frau von Oswald von Wolkenstein
Konstanz, zur selben Zeit
Sara
Konstanz, Dominikanerkloster, 20.März 1415
Konstanz, zur selben Zeit
Konstanz, am selben Abend und am Tag danach
Sara
Kurze Nachricht des Ritters Oswald von Wolkenstein an die fahrende Ärztin zu Konstanz, 28.März 1415
Zweite Nachricht des Ritters Oswald von Wolkenstein an die fahrende Ärztin zu Konstanz, 24.April 1415
Schloss Gottlieben bei Konstanz, Ende April 1415
Ausspruch des Bischofs Hallum von Salisbury auf dem Konstanzer Konzil zur Frage, ob ein Ketzer sterben müsse
Konstanz, Hohes Haus, Ende Mai 1415
Schmähvers auf Jan Hus, geschrieben wohl 1415 zu Konstanz von Oswald von Wolkenstein
Konstanz, Refektorium des Franziskanerklosters, Juni 1415
Widerrufsformel für Jan Hus, aufgesetzt Ende Juni 1415 durch Kardinal Francesco Zabarella
Darauffolgende letzte Erklärung des Jan Hus vom 1.Juli 1415, ebenfalls übersetzt aus dem Lateinischen
Sara
Konstanz, ein paar Tage später
Botschaft der Barbara von Cilli an Ezzo vom 15.Juli 1415
Konstanz, Mitte Juli 1415
Sara
Fünftes Buch
Würzburg, Oktober 1415
Schreiben des Ritters Ezzo von Riedern an Ihre Majestät die Königin, Barbara von Cilli, Oktober 1415
Sara
Würzburg, am selben Abend
Sara
Gebet eines Arztes
Würzburg, Dezember 1415
Aus dem Bericht des Efrajim ben Jaquv
Aus dem Chronikon Ellenhardi
Aus der Bischofschronik des Lorenz Fries
Würzburg, April 1416
Eintrag in einem Würzburger Kopialbuch des 15. Jahrhunderts
Riedern und Würzburg, Sommer 1416
Würzburg, am selben Nachmittag
Sara
Mainz und Riedern, Anfang August 1417
Schreiben des Rabbi Malachi Süßlein an den Rabbi der jüdischen Gemeinde zu Köln, Anfang August 1417
Riedern, Mitte August 1417
Schreiben des Barnoss der Kölner Gemeinde an Rabbi Malachi Süßlein, Ende August 1417
Burg Lauda, Ende August 1417
Gedicht des einzigen bekannten jüdischen Minnesängers Süßkind von Trimberg, erste Hälfte des 13. Jahrhunderts
Würzburg, Anfang September 1417
Würzburg, Oktober 1417
Schreiben des Elkan Liebmann, Geldverleiher zu Miltenberg, an den edelfreien Herrn Friedrich von Riedern zu Lauda vom 9.Oktober 1417
Revers des Friedrich von Riedern an Elkan Liebmann vom 13.Oktober 1417
Revers des Elkan Liebmann an Friedrich von Riedern vom 18.Oktober 1417
Nachricht des Friedrich von Riedern an Elkan Liebmann vom 23.Oktober 1417
Revers des Elkan Liebmann an Friedrich von Riedern vom 1.November 1417
Nachricht des Friedrich von Riedern an Elkan Liebmann
Schreiben des Elkan Liebmann an Seine Eminenz Fürstbischof Johann II. von Mainz vom 6.November 1417
Schreiben des Elkan Liebmann an Friedrich von Riedern vom 19.November 1417
Revers des Friedrich von Riedern an Elkan Liebmann vom 29.November 1417
Vertrag zwischen Friedrich von Riedern und Sara, der Judenärztin zu Würzburg, die Übernahme aller Güter des Friedrich von Riedern betreffend, abgeschlossen und beglaubigt durch das Landgericht des Herzogtums Franken am 7.März 1418
Miltenberg, Anfang März 1418
Lied über den Tod von Oswald von Wolkenstein
Sara
Acht Jahre später, Riedern
Epilog
Anhang
Glossar
Die Illustrationen
Nachwort
Zur Geschichte des Judentums in Deutschland
Bestallungsurkunde der »Juden Ertzin« Sara
Europa um 1415
Erstes Buch
Drei Kinder
Siegburg, Oktober 1390
Die Schreie der Schwangeren zerrissen in regelmäßigen Abständen die Stille des Oktobermorgens. Das Städtchen erwachte. Friedlich lag es im Schönwetterdunst des Sonnenaufgangs; dünne Rauchschwaden der ersten Herdfeuer züngelten aus den Kaminen. Droben vom Kloster her erklangen leise wie Mückengesumm die Stimmen der Mönche.
In den Gassen war es noch ruhig, bis auf ein paar gackernde Hühner, träge sich reckende Hunde und die ersten Schweine, die in den Abfallhaufen nach Leckerbissen wühlten. Levi Lämmlein, der reiche Geldverleiher von Siegburg, ging mit unruhigen Schritten in der Stube auf und ab. Die halbe Nacht hatte er so verbracht, während seine Frau in endlosen Wehen lag. Zwei Nachbarinnen waren schon seit Stunden bei ihr und hatten ihn jedes Mal, wenn er zaghaft an der Schlafzimmertür klopfte, mit verkniffenen Mienen wieder weggescheucht. Levi wusste, es war schwer für seine Schönla, die eigentlich längst aus dem Alter für das erste Kind heraus war. Beide hatten sie die Hoffnung auf Nachwuchs fast aufgegeben, als ihre Gebete doch noch an die Ohren des Herrn gedrungen waren. Bald, so hoffte und freute sich Levi, würde ihr Glück auf dieser Welt vollkommen sein. Er trat ans Fenster, öffnete es und sah hinaus. Es würde ein schöner Tag werden. Die Sonne stieg höher und höher, und ihre Wärme ließ langsam die weißen Morgennebel zerfließen, die über dem Fluss lagen. Levi tat einen tiefen Atemzug, um gleich darauf zusammenzuzucken, als der nächste Schmerzensschrei seiner Frau ertönte. Er schwor sich, dass es diesem Kind in seinem Leben niemals an etwas fehlen sollte, sofern es nur endlich auf die Welt kam. Und er beschloss, dass es wohl gut sei, darüber Zwiesprache mit Gott zu halten.
Gerade als Levi den fransenbesetzten Gebetsmantel für die Morgenandacht umlegen wollte, klopfte es. Mordechai, der betagte Hausdiener, der bisher in der Küche gesessen und fromme Sprüche geleiert hatte, schlurfte kopfschüttelnd zur Tür. »Jetzt ist nicht die Stunde«, schimpfte er mit hoher Greisenstimme durch das Fensterchen hinaus, »die Hausfrau kommt nieder.«
»Ein Schreiben vom Rat«, erklang es zurück. Es war die Stimme des Stadtboten, der nun eine Schriftrolle durch die kleine Öffnung schob. »Da, nimm, Alter.«
Mordechai tippelte in die Stube zurück und reichte seinem Herrn mit einer entschuldigenden Geste den Brief.
»Schon gut«, murmelte Levi. Die städtische Obrigkeit konnte schließlich nicht wissen, dass er gerade Nachwuchs bekam. Vermutlich fragten sie wieder einmal nach einem Darlehen an, dabei hatten sie die letzten beiden noch nicht zurückgezahlt. Levi legte die Rolle erst ein wenig unentschlossen auf seinen Arbeitstisch, doch dann erbrach er, eigentlich ganz froh um die Ablenkung, das Siegel. Sorgsam rollte er das Pergament auf und begann mit gerunzelter Stirn zu lesen.
»Unsern Gruß zuvor dem Stadtjuden Löw Lämmlein, Kammer Knecht des güthigen und gerechthen Königs Wentzel, dem der allmechtige Gott möge noch vil Jahre und ein glückliche Regirung geben. Item so hat nun unßer König gerechther Maßen entschiden, zur Mehrung unßer aller Glück und Wohlstands die Schulden sämtlicher derjeniger, die bei der Judenheit im Reich Geldt entliehen haben, für nichtig zu erklärn. An die Juden ist nichts zurück zu zahlen, auch nit der Zinß. Ermelte Schulden fallen statt deßen an die Landesherrschafft, die davon ein Theill an die königliche Schatull zu zahlen hat. Dafür erbiethet unßer König seinen hoch geschetzten und gelibten Juden im Reich weitherhin sein Schutz und Schirm wie es seit alters her guther Brauch ist ...«
Levi Lämmlein verschwammen die Buchstaben vor den Augen. Ein neuer Judenschuldenerlass! Wie konnte das sein, nachdem Wenzel, der geldgierige Mensch, erst vor fünf Jahren genau dasselbe verfügt hatte? Schon damals hatten die Städte, die Obrigkeiten und der König selbst alles an sich gerissen, was die Juden in harter Arbeit erworben hatten. Niemand konnte damit rechnen, dass dies so schnell wieder geschehen würde, und so hatte Levi nicht vorgesorgt. In wilder, ohnmächtiger Wut ballte er die Fäuste. Natürlich, den Juden konnte man ja ungestraft alles nehmen! Es bedurfte nur eines Federstrichs! Seit jeher nämlich waren er und seinesgleichen als Kammerknechte direkte Untertanen der Krone, standen somit unter deren Schutz, aber auch unter deren Knute. Ihnen war nicht erlaubt, Waffen zu tragen, denn der König verteidigte sie ja – sofern er wollte. Sie durften kein Handwerk ausüben, denn das kontrollierten schließlich die Gilden und Zünfte. Und sie durften kein Land bebauen, das tat ja schon der Bauernstand. Allein weil den Christen verboten war, Zins zu nehmen, hatten die Juden überhaupt einen Lebensunterhalt, nämlich den, Geld zu verleihen. Allerdings nur, solange ihnen ihr Herr und König nicht in den Rücken fiel, so wie jetzt. Brauchte er Kapital, holte er es sich eben von »seinen« Juden. Wollte er den Städten oder dem Adel Geld zukommen lassen, waren dafür die Juden gut. Begehrte die Kirche etwas von ihm, nun, so durfte sie es sich von den Juden nehmen. Levi spürte, wie er zu zittern begann. Widerstand war nicht möglich, wie auch? Die Judengemeinden im Reich mussten ja froh sein, dass Wenzel sie vor Verfolgung schützte, und diesen Dienst ließ er sich wahrlich gut bezahlen. Ja, die Reichsjudenschaft war der Willkür ihres Herrn auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Auch wenn es den Bankrott bedeutete. Wen kümmerte schon das jämmerliche Leben eines Christusmörders? Aus, dachte Levi, aus und vorbei. Er brauchte gar nicht anfangen zu rechnen. In letzter Zeit hatte er ein paar risikoreiche Geschäfte getätigt. Er besaß derzeit keine Rücklagen, keine Sicherheiten, keinen Grundbesitz. Levi Lämmlein, der reiche Geldjude von Siegburg, hatte mit einem Schlag alles verloren.
Während also Schönla auf ihrem Geburtsstuhl in einer letzten furchtbaren Anstrengung das Kind aus sich herauspresste und erschöpft, aber glücklich in die gepolsterten Lehnen zurücksank, saß der Vater des Neugeborenen an seinem Schreibtisch und weinte.
So kam Sara auf die Welt als Tochter eines bettelarmen Mannes. Nie konnte ihr Vater sie ansehen, ohne daran zu denken, dass der Tag ihrer Geburt gleichzeitig die Erfüllung seines sehnlichsten Wunsches nach einem Kind, aber auch das jähe Ende seines Wohlstands mit sich gebracht hatte. Und als seine Tochter ihre winzigen Lungen zum ersten Mal mit der feuchten, kühlen Oktoberluft füllte, schien es Levi, als brülle sie ihren Protest gegen die Willkür des Königs mit durchdringender Lautstärke in die ungerechte Welt hinaus.
Kaum sechs Wochen später musste die Familie das Haus verlassen. Levi hatte den alten Mordechai und die beiden Mägde ausbezahlt und den meisten Hausrat verkauft; was ihnen noch übrig blieb, passte auf einen Eselskarren. Schönla wäre so gern in ihrer Heimatstadt geblieben, nur, wovon hätten sie leben sollen? Ihr Mann hatte kein Kapital mehr, um Geld zu verleihen, und die kleine jüdische Gemeinde, die aus gerade einmal fünf Familien bestand, konnte ihnen kein anderes Auskommen bieten. Also mussten sie woanders hin, am besten in eine Stadt mit zahlreicher Judenschaft, wo man ihnen helfen konnte, wieder auf die Füße zu kommen. Und, aber daran mochte Levi gar nicht denken, wo die Armen im schlimmsten Fall ein paar Pfennige aus der Gemeindekasse bekamen, um sich am Leben zu erhalten. Bitterste Gedanken gingen ihm durch den Kopf, während er den Karren mit dem Wenigen belud, was sie noch besaßen: Kleider, ein paar Möbel, Leintücher und Decken, der schwere, versilberte siebenarmige Leuchter, ein Erbstück seiner Frau, die wichtigsten Haushaltsgegenstände. Gott sei Dank hatte sich Schönla von der schwierigen Geburt erstaunlich schnell erholt, und die Kleine war gesund genug, um eine weite Fahrt zu überstehen. Levi zurrte die Seile fest, die seine Habe auf dem Gefährt hielten, und überprüfte das Zaumzeug des mageren, alten Maultiers, das ihm die Nachbarn geschenkt hatten. Schönla saß schon auf dem Karren, das Gesicht tränenüberströmt, die schlafende Sara im Arm. Ihm blieb nur noch, die Mesusa aus dem Türstock zu brechen, die kleine Metallkapsel, deren Inneres zwei handgeschriebene Thorasprüche und den Namen des Herrn barg. O Adonai, betete er dabei, lass uns ein neues Heim finden, an dessen Tür ich Deinen heiligen Namen wieder lesen darf.
Dann stieg er auf den Wagen und schnalzte mit der Zunge. Sie würden ihr altes Leben für immer hinter sich lassen und mit Gottes Hilfe ein neues beginnen.
Irgendwo im Süden Englands, zur selben Zeit
Es regnete, und der Wald war schwarz wie Pech. Die Männer ritten durch die Nacht als sei der Teufel persönlich hinter ihnen her, und vielleicht stimmte das auch. Nasse Zweige schlugen ihnen ins Gesicht, die Pferdehufe schleuderten Wurzelstücke und Erdklumpen hoch. Sie wagten nicht, in der Finsternis zu galoppieren; ein scharfer Kanter war gefährlich genug. Irgendwann fielen die Pferde in erschöpften Schritt, der Boden wurde zu tief und zu schlammig. Der Anführer, ein älterer Mann mit scharf geschnittenen Gesichtszügen, winkte einen seiner Begleiter zu sich.
»Ihr wisst Bescheid, Lovelace?«
»Aye, Mylord«, nickte der massige Kahlkopf. Das Wasser lief in kleinen Bächlein vom Rand der Kapuze über seine Wangen.
»Keiner der Ketzer darf überleben, hört Ihr?«
»Aye, Mylord.«
»Aber vorher müssen wir herausfinden, wo die Handschrift versteckt ist. Habt Ihr Eure Leute im Griff?«
Der Mann knurrte unwillig. »Natürlich. Ihr könnt Euch auf die Männer verlassen, Herr. Sie gehorchen mir aufs Wort. Außerdem – der Erzbischof bezahlt sie gut.«
Der Anführer atmete einmal tief durch. Ja, dachte er, Thomas Arundel, du liegst jetzt gerade in deinem Bett und schläfst den Schlaf der Gerechten. Und mich lässt du die Drecksarbeit machen. Meinen besten Freund verraten. Gott gebe, dass unsere Sache gerecht ist. Und dass ein paar Fetzen Papier dies alles wert sind …
Als könne der gedungene Mörder Gedanken lesen, fragte er: »Was ist das für eine Handschrift, die der Erzbischof so unbedingt haben will?«
Der Anführer fuhr herum. »Das wollt Ihr gar nicht wissen, Mann, wenn Euch Euer Leben lieb ist«, schnappte er. »Los, beeilen wir uns lieber. In ein paar Stunden wird es hell.«
Der Morgen graute über Tiltenham Manor. Es hatte aufgehört, zu regnen, Dampf stieg aus dem feuchten Laub im Garten. Sir Geoffrey Granville schlug das Federbett zur Seite und stand auf. Ein kurzer Blick sagte ihm, dass seine Frau noch schlief; ihr Atem ging ruhig und regelmäßig. Er hingegen hatte kein Auge zugetan. An John Wyclif hatte er gedacht, seinen Freund und Lehrmeister zu Oxford. Gebetet hatte er, inbrünstig und doch ohne Hoffnung. Er wusste, es würde bald vorbei sein. Sie waren ihm schon zu lange auf der Spur, es war immer nur eine Frage der Zeit gewesen. Hatte er richtig gehandelt? Damals, als er alles aufgegeben hatte, um Wyclif zu folgen? Oh, wie richtig, wie einfach und überzeugend hatte geklungen, was der große Religionsgelehrte gepredigt hatte: Die Kirche muss arm sein wie Jesus! Allein durch Gottes Gnade, nicht durch einen verderbten Klerus, ist Erlösung möglich! Das Wort Gottes muss allen zugänglich gemacht werden, dem kleinsten Mann, in seiner Muttersprache! Wie viel Wucht in dieser Lehre lag, Wucht, die Kirche zu zertrümmern, das war ihm erst jetzt wirklich klar, sieben Jahre nach Wyclifs Tod! Und dass sich die Kirche gegen die neue Lehre wehren würde mit allen Mitteln.
Granville zog seinen wollenen Morgenmantel an und setzte sich wieder aufs Bett. Seine junge Frau regte sich schlaftrunken und fasste nach seiner Hand. Elizabeth, dachte er, ich hätte dich nicht mit hineinziehen dürfen. Doch du hast bald mehr als ich an die neue Lehre geglaubt, mit mehr Inbrunst und mehr Hingabe. Kaum hatten die Verfolgungen angefangen, warst du eine von Wyclifs brennendsten Verfechterinnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Versionen der englischen Bibel, dieser mühsamen Übersetzung aus dem Lateinischen, durch deine Hilfe angefertigt wurden. Es müssen an die zwanzig gewesen sein. Als unsere Freunde in den Untergrund gezwungen wurden, hast du sie heimlich beherbergt, hast Versammlungen einberufen, hier in diesem Haus. Alle waren sie hier: Sir Thomas Latimer, Sir John Trussel, Sir Lewis Clifford, Sir John Peachey, Sir William Nevil, sogar Sir John Montagu, der Earl of Salisbury. Lollardenritter, so nannte man uns alle inzwischen. Ach Gott, wir wussten immer, dass wir mit dem Feuer spielten. Doch zu Anfang waren wir wenigstens nicht an Leib und Leben bedroht. Das hat sich längst geändert.
Gedankenverloren streichelte Granville die Hand seiner schlafenden Frau. Sie war stärker als er. Noch gestern Abend, als die böse Nachricht sie erreichte, hatte Elizabeth zu ihm gesagt: »Wenn sie kommen, ist es der Wille Gottes. Aber es ist auch sein Wille, das Vermächtnis unseres Lehrers zu bewahren. Wir werden nicht reden, Geoffrey, und wenn es unseren Tod bedeuten sollte.«
Niemand wusste von dem Geheimnis. Die Gefahr, das jemand unter der Folter das Versteck preisgeben würde, war zu groß. »Übergebt mein Vermächtnis demjenigen zu treuen Händen, der mir nachfolgt in der wahren Lehre«, hatte Wyclif zu ihnen gesagt. Das war kurz vor seinem Tod gewesen, als er gespürt hatte, dass das Leben aus ihm wich. »Einer wird kommen, der die Flamme weiterträgt. Er wird mein Werk fortführen, irgendwann. Bis dahin verbergt es gut.«
Das hatten sie getan. Nicht einmal die höchsten Lollardenführer kannten den Ort. Das Geheimnis war sicher in ihrer Obhut.
Draußen ertönte Hufgetrappel. Lady Granville fuhr hoch, die Augen schreckgeweitet. »Ist es so weit?«
Er nickte. »Lass uns beten.«
Drei Stunden später lebte auf Tiltenham Manor niemand mehr. Blut war überall. Es befleckte die Teppiche, die Mauern, die Möbel. Die Mörder hatten ganze Arbeit geleistet – aber sie hatten ihr Ziel nicht erreicht. Lord und Lady Granville waren gestorben, ohne ihr Geheimnis verraten zu haben. Ihre Körper sahen nicht mehr menschlich aus, als die Häscher sie verließen.
Der Anführer stürmte durchs Haus, auf der Suche nach Hinweisen über den Verbleib der Handschrift. Er ließ alles durchsuchen, doch ohne Erfolg. Irgendwann stießen seine Männer auf eine verborgene Tür hinter einem riesigen, schweren Truhenschrank und drangen in den dahinterliegenden Raum ein.
Das enge Gemach war nur von einigen Kerzen erhellt, deren Flackern die steinernen Mauern in rötliches Licht tauchte. In einer Ecke lag auf einem notdürftig eingerichteten Lager ein schlafendes Kind, davor, wie um einen Schatz zu verteidigen, stand mit ausgebreiteten Armen und kreidebleich eine schwerbrüstige Frau in Ammentracht. In ihrer Panik fing sie an, das Kreuzzeichen zu schlagen, immer wieder, und schließlich griff sie nach dem Kruzifix, das sie um den Hals trug und streckte es den Angreifern hin.
»Wenn ihr diesem Kind etwas antut, wird Gott sich an euch rächen, an euch und euren Nachkommen, bis ins siebte Glied! Der Herr beschützt die Kleinsten! Dieser Junge ist so rein und unschuldig wie frisch gefallener Schnee!«
Der Anführer drängte sich mit gezücktem Schwert in den Raum, und die Amme fiel vor ihm auf die Knie. Sie zitterte wie Espenlaub, konnte kaum die gefalteten Hände dem Mörder entgegenrecken. Der kleine Bub auf seinem Lager wachte auf und begann zu schreien.
»Wessen Kind ist das, Weib?«, knurrte der Anführer.
»Das Kind der Herrschaft«, jammerte die Kinderfrau und raufte sich die Haare. »Kaum ein halbes Jahr alt. O Herr, lasst meinen Liebling leben, habt Erbarmen, ich … «
Ein sirrendes Geräusch durchschnitt die Luft, dann klaffte im Hals der Frau ein roter Schnitt. Blut sprudelte, und die Amme kippte langsam zur Seite.
Der Anführer machte ein schnelles, unwilliges Zeichen mit der Hand. »Es ist genug«, zischte er. »Genug.«
Er ging an der Leiche vorbei und trat zu dem brüllenden Kleinkind. Dem Sohn seines besten Freundes, den er gerade zu Tode gefoltert hatte. Und dem Sohn der süßen Elizabeth, mit der er aufgewachsen war, und die er liebte wie eine Schwester. Geliebt hatte. Ein bitterer Geschmack wie Galle lag auf seiner Zunge.
Die Amme hatte recht. Der Junge war unschuldig. Er konnte von nichts etwas wissen, trug für nichts die Verantwortung. Wie Elizabeth hatte er pechschwarzes, lockiges Haar und helle Haut wie milchweißer Alabaster. Der Anführer griff nach dem kleinen Händchen, und der Junge hielt wütend seinen Daumen fest, mit einer Kraft, die erstaunlich für solch ein kleines Wesen war. Um seinen Hals hing ein Lederbändchen mit einem hellroten Korallenanhänger, wie man ihn kleinen Kindern gewöhnlich als Glücksbringer umband. Einer der Männer zog mit einer Hand seinen Dolch und griff mit der anderen dem Buben in den schwarzen Schopf. Von der Spitze der Waffe troff Blut.
Der Anführer schüttelte den Kopf. »Lovelace«, sagte er tonlos.
»Mylord?« Der stämmige Mann trat vor.
»Bringt das Kind irgendwohin. Es soll leben.« Der Anführer wandte sich brüsk ab und ging hinaus.
Lovelace hatte für solche Schwachheiten kein Verständnis, aber Befehl war Befehl. Er stand da, kratzte sich im fleischigen Nacken und grübelte eine Weile, bis er eine Lösung fand. Dann winkte er einen seiner Männer zu sich und deutete auf das immer noch schreiende Kind.
»Bring das Balg nach Irland, Dermot. Du stammst doch von der Insel, oder? Eine ganze Menge Klöster gibt es dort, so hört man … Die Ketzerbrut soll im rechten Glauben aufwachsen, weit weg von hier. Und kein Wort zu irgendjemandem, bei deinem Leben.«
Keine Stunde später brannte Tiltenham Manor. Die Mörder im Namen des rechten Glaubens hatten ihre Aufgabe erledigt; eilig ritten sie durch die Granvilleschen Ländereien in Richtung York. Am Kreuzweg vor Lutterworth löste sich ein Reiter aus der Gruppe, ein kleines, sich windendes Bündel Mensch fest an den Leib gepresst. Wie befohlen, galoppierte er nach Westen.
Rittergut Riedern bei Lauda, Sommer 1394
Und warum kommt der Falke immer wieder zurück?« Der kleine Junge mit dem dichten strohblonden Haar sah mit blitzenden Augen zu seinem Vater auf.
»Weil er gelernt hat, dass die Faust der beste Platz für ihn ist.« Heinrich von Riedern löste die Fußfessel des Gerfalken aus der Öse der hölzernen Sitzstange und nahm den Vogel mit dem Handschuh auf. Das Tier flatterte aufgeregt, ließ sich aber durch ein paar gemurmelte Worte beruhigen. »Schau, das ist mein Lieblingsfalke«, lächelte der grauhaarige Ritter und fütterte ein Stückchen rohes Fleisch, das der Vogel gierig verschlang. »Hat mich so viel gekostet wie ein gutes Streitross. Sie heißt Nimue.«
»Wie die Fee aus dem Teich«, rief Ezzo.
»Ah, du hast es dir gemerkt.« Heinrich von Riedern fuhr seinem kleinen Sohn liebevoll über den Kopf. Erst gestern hatte er ihm die Geschichte vom Zauberer Merlin und der unglückbringenden Herrin vom See erzählt. »Nimue liebt die Jagd über unseren Fischteichen. Heuer hat sie schon über siebzig Reiher erledigt. Sie ist pfeilschnell.«
Der Ritter strich dem Falken über die helle, gefleckte Brust und setzte ihn dann vorsichtig wieder zurück auf seinen Platz. »Das dort drüben ist Kolander, den hab ich noch nicht lange.« Er wies auf einen jungen grauen Sakerfalken, der reglos und schüchtern in einer Mauernische hockte.
»Warum hat er eine Mütze auf?«, wollte Ezzo wissen.
»Das ist eine Falkenhaube aus Leder, mit Federn und Silberstückchen verziert. Kolander ist noch neu, weißt du, und es beruhigt ihn, wenn er nichts sieht. Am Anfang musste ich ihm die Lider durchstechen und zunähen, so aufgeregt war er. Jetzt kann ich ihm die Haube schon für längere Zeit abnehmen, ohne dass er wie wild flattert. Ich schätze, in ein paar Monaten wird er so weit sein, dass ich mit ihm arbeiten kann.«
»Welche Vögel jagt er dann?«
»Mit Sakerfalken jagt man Reiher«, erklärte Heinrich von Riedern geduldig. »Gerfalken wie Nimue gehen am besten auf Kraniche, wenn sie auf dem Durchzug nach Süden sind, und Wanderfalken taugen gut als Jäger auf Wasservögel, also Enten oder Wildgänse. Jetzt komm, sonst regt sich Kolander auf.«
Ezzo folgte seinem Vater nach draußen in den Burghof. »Nimmst du mich einmal mit auf die Beiz? Bitte!«, drängelte er. »Ich bin auch ganz brav!«
Heinrich von Riedern lachte; die alte Kampfnarbe auf seiner linken Wange bildete dabei unregelmäßige Zacken. »Da musst du erst noch ein bisschen größer werden, Junge. Die Jagd ist nichts für kleine Burschen wie dich. Aber nur Geduld, die Zeit wird kommen. Nun lauf, deine Mutter wartet sicher schon auf dich.«
Er versetzte Ezzo einen leichten Klaps, und der trabte davon. Mit einem Lächeln auf den Lippen sah ihm der Ritter nach und tat einen zufriedenen kleinen Seufzer. Der Junge war sein Ein und Alles, ein hübscher Kerl, robust, aufgeweckt und klug. Wie sehr hatte er sich mit seiner Frau einen Sohn gewünscht, einen Erben für Riedern. Wie viele Ländereien hatte er der Kirche gestiftet, wie viele Kerzen entzündet. Wie inbrünstig hatten sie gebetet, und doch war alles vergebens gewesen. Alt waren sie miteinander geworden, seine Irmingard und er, glücklich waren sie gewesen, so gut es unter diesen Umständen möglich war, aber auf ihrem Bund hatte kein Segen gelegen. Natürlich, er hätte sie verstoßen können, eine zweite Frau nehmen, die Blutslinie fortzuführen. Doch das hatte er nicht übers Herz gebracht. Aus Liebe, und weil er ihr nicht die alleinige Schuld geben wollte. Jetzt war sie tot und begraben, und was er nicht mehr zu hoffen gewagt hatte, war eingetreten. Er hatte sich eine Küchenmagd ins einsame Bett genommen, und sie endlich hatte ihm das geschenkt, was sein Weib nie vermocht hatte. Einen gesunden, kräftigen Sohn. Heinrich von Riedern wischte sich verstohlen über die Augen.
Ezzo strolchte über den engen Burghof. Neugierig sah er eine Zeitlang zu, wie der Zeugmeister in einem Kessel frisch gekratzten Salpeter läuterte und wackelte dabei mit seinen schmutzigen Fingern an einem lockeren Milchzahn. Dann beobachtete er ein paar Knechte, wie sie Eimer um Eimer Wasser aus der Zisterne holten und ins Sudhaus trugen. Es duftete nach Malz und frischer Maische, der typische Geruch an Biertagen. Auch Ezzo bekam wie alle Kinder seinen Anteil Bier bei Tisch, ein halbes Mäßlein zu Mittag und ein halbes zu Abend. Das regelte die Hofordnung, genauso wie die Essenszeiten. Ob wohl bald der Turmwächter zur Abendmahlzeit blasen würde? Ezzo spürte schon den Hunger. Er ging weiter, scheuchte ein bisschen die Tauben, dann die Ziegen herum, guckte in den Fischkasten, ob heute ein besonders dicker Karpfen dabei war und stibitzte schließlich ein Ei aus dem Korb vor dem Kücheneingang. Gierig bohrte er mit dem Daumennagel ein Loch hinein und schlürfte das Innere, wobei ihn Rumpold, der Koch, entdeckte und wegscheuchte.
Atemlos rannte er durchs offene Burgtor in den schmalen Zwinger. Vor der Pferdeschwemme balgten sich ein paar Katzen, und er wollte sich gerade zu ihnen ins frisch gemähte Gras kauern, als er das Donnern von Hufen hörte. Aufgeregt rappelte er sich hoch und flitzte zum Burganger hin, einer schönen großen Wiese am Flussufer der Erf. Welch ein Anblick bot sich ihm da! Ein Ritter, das herrlichste Wesen auf der ganzen Welt! Der polierte Brustpanzer blitzte so hell im Sonnenlicht, dass Ezzo blinzeln musste. Auf dem topfartigen Helm mit den länglichen Augenschlitzen, der seinen Träger so gefährlich aussehen ließ, schwankte fröhlich ein schneeweißer Federbusch. Der Ritter hatte seine Lanze in der Halterung am Sattel aufgestellt und zügelte einhändig sein nervös tänzelndes Pferd. Und was für ein Ross! Rabenschwarz, riesig, die Mähne in Zöpfen herunterhängend, die Nüstern gebläht. Sein Schweif peitschte die staubige Luft, die Hufe stampften, die Augen rollten, dass man das Weiße sah. Der Reiter klemmte die Lanze ein, unter den rechten Arm, bis sie fast waagerecht stand, dann gab er seinem Rappen die Sporen. In gestrecktem Galopp sprengte er auf die Turnierpuppe zu, ein hölzernes Gestell mit einem Turban wie ein Sarazene. Ein gellender Kriegsschrei, dann hatte die Lanze den ausgestreckten Holzarm des Sarazenen getroffen, an dem ein runder Schild befestigt war. Die Figur drehte sich durch den Aufprall blitzschnell um die eigene Achse; am anderen Arm hing ein Seil mit einem schweren Sack, der nun herumschwenkte. War der Reiter nicht schnell genug, traf ihn der Sack in den Rücken und fegte ihn vom Pferd. Ezzo hatte schon den Mund zum Schrei geöffnet, aber sein Ritter war glücklich vorbei, der Sarazene rotierte ein paar Mal um die eigene Achse und blieb dann stehen. Der Ritter trabte gemächlich zurück und stieg vor Ezzo ab.
»Herr Friedrich«, schrie der Junge aufgeregt, »Herr Friedrich, das war ein herrlicher Treffer! Ihr seid der beste Ritter im ganzen Land, ich schwör’s!«
Friedrich von Riedern, der jüngere Bruder des Burgherrn, nahm den Helm vom Kopf und ließ sich von einem Knecht Harnisch und Lederarmschutz abschnallen. Er musterte den Knaben mit gerunzelten Brauen.
»Wenn ich groß bin, will ich auch solch ein Ritter werden wie Ihr«, plapperte Ezzo, ganz rot im Gesicht vor Begeisterung. »Dann will ich mit Euch in den Krieg ziehen, als Euer Knappe. Wann zieht Ihr denn in den Krieg?«
»Gar nicht!« Friedrich von Riedern spuckte die beiden Worte förmlich aus.
»Aber warum nicht?« Ezzos Augen wurden groß und rund. »Und wenn Ihr nicht in den Krieg zieht, darf ich dann wenigstens kämpfen und Ritter werden? Helft Ihr mir dabei?«
Friedrich von Riedern beugte sich langsam zum Sohn seines Bruders hinunter und lächelte freundlich. »Du kannst niemals Ritter werden«, sagte er mit zuckersüßer Stimme. »Das können nur Männer von Geblüt und hoher Geburt.«
»Aber ich bin doch von hoher Geburt!«, widersprach der Fünfjährige zaghaft. »Herr Heinrich ist mein Vater.«
»Und deine Mutter, hm? Wer ist die? Lieschen vom Gänsebrunnen, was?« Ezzos Onkel brach in ein scheinbar fröhliches Lachen aus. »Schau, Kleiner, du und ich, wir haben etwas gemeinsam: Wir können beide kein Ritter sein. Ich, weil meine Beine zu schwach sind, um mich zu tragen, und du, weil du ein Bastard bist. So ist das Leben.« Er zog eine schräge Grimasse und kniff Ezzo leicht in die Backe. Dann ergriff er die Krücken, die ihm der Knecht hinhielt, drehte sich um und schleppte sich zum Burgtor. Seine verkrüppelten Beine schlenkerten merkwürdig unter dem massigen Oberkörper, als gehörten sie nicht recht zu ihm.
Abends, als Ezzo mit seiner Mutter allein war, stellte er die Frage, die ihn den ganzen Tag beschäftigt hatte.
»Mutter? Was ist ein Bastard?«
Lies spürte einen Stich im Herzen. Bisher hatte sie ihrem Sohn nichts erklären müssen. Er war bei ihr in den Gesindekammern der Burg aufgewachsen, nicht in der Herrenkemenate, aber der Ritter von Riedern hatte ihn immer offen als seinen Sohn behandelt. Mehr noch, er zeigte deutlich, wie sehr er sein einziges Kind liebte. Sie hatte nie Forderungen stellen müssen, denn Heinrich hatte von Anfang an klargemacht, dass er für sie und den Jungen sorgen würde. Ezzo wusste, wer seine Eltern waren, auch wenn er sich bisher noch keine Gedanken darüber gemacht hatte, was das für ihn bedeutete. Doch jetzt war die Zeit gekommen, es ihm zu sagen. Sie glättete das Leintuch auf dem Strohsack, blies die Kerze aus und legte sich zu Ezzo in das schmale Spannbett. »Komm, kuschel dich her, dann erklär ich’s dir.«
Ezzo schmiegte sich an seine Mutter. »Arnulf und Konrad sagen, ein Bastard ist einer, der nicht weiß, wer sein Vater ist. Aber ich weiß das doch, es ist der Herr Heinrich. Warum sagt dann Onkel Friedrich, ich sei ein Bastard?«
Lies tat einen tiefen Atemzug und nahm ihren Sohn in die Arme. »Du bist ein Friedelkind, mein Liebster. Dein Vater ist von Adel, aber deine Mutter nicht. Ich bin bloß eine vom Gesinde, deshalb kann er mich nicht heiraten. Aber wir lieben dich beide, du bist unser gutes, braves Kind. Und jetzt träum schön, kleiner Herr Wackelzahn.« Sie strich Ezzo sanft über die Lider, um sie zu schließen, und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Dann summte sie ihm ein Lied vor, bis er eingeschlafen war.
Am nächsten Tag marschierte Ezzo zu seinem Vater in die Hofstube. »Ich will kein Friedelkind sein«, beschwerte er sich und stampfte trotzig mit dem Fuß auf. »Ich will ein Ritter werden, wie Ihr.«
Heinrich von Riedern starrte stumm und einigermaßen entgeistert auf seinen Sohn hinab, in dessen blauen Augen jetzt Tränen glitzerten. War es also so weit. Er würde wohl eine Entscheidung treffen müssen. »Aha, ein Ritter, wie?«, fragte er.
Ezzo nickte ernst. »Ja, das will ich werden«, antwortete er im Brustton der Überzeugung.
Heinrich von Riedern überlegte lange. »Na, wenn das so ist«, brummte er irgendwann bärbeißig, »wenn das so ist, dann müssen wir was dafür tun.«
Noch am selben Tag zog der Friedelsohn des Ritters von Riedern in die herrschaftlichen Gemächer um.
Aus der Kölner Judenordnung
Juden und Juden Weiber, jungk und alt, so zu Cöllen wohnen oder alß Frembde herein komen, sollen solche Kleidungk tragen, daß man sie alß Juden erkennen kan:
Wie allüberall guther Brauch, so solln die Männer an ihrn Kleidern ein gelben Ringk tragen und den spitzigen Juden Huth; die Weiber müßen am Schleyer zwei plaue Streiffen haben.
Item sie solln an ihren Über Röcken und Röcken Ärmel tragen, die nit weitter alß eine halbe Elle sindt. Die Kragen dürfen nit mehr alß einen Finger breitt sein. Pelzwerck darff an den Enden der Kleyder nit zu sehen sein. Auch müßen die Mänttel Franßen haben und so lang als biß zur Waden reichen.
Sie solln keyne Seiden Schuh, nit in ihren Häußern noch draußen, tragen.
Eine Judenjungkfer darff nur ein Haarband unther 6 Gulden Wertt und unther 2 Finger Breitte tragen.
An Werck Tagen ist den jüdischen Weibern nur erlaubt, Ring zu tragen, die nit mehr als 3 Gulden Wertt haben, unnd an einer jeden Handt bloß einen. Sie dürffen auch keyn vergoldet Gürttel anlegen.
In der Kar-Wochen unnd zu Oßtern sölln die Juden in ihrn Häusern pleiben, damit sie, deren Volck Christum gemordet hat, die gläubige Andacht nit störn.
Sind dann an Feyer Tagen Umbzüg oder Procession in der Stadt, so dürffen sich die Juden nit auf der Straßen sehn laßen.
An Sonntagen und Feiertagen ist den Juden nit verstattet, ihre Pfänder öffentlich vor ihren Thürn feil zu bieten.
Die Juden dürffen unter der Halle vor dem Rathauß nit gehen, stehen oder gar sitzen, es sey denn, der Rath hett sie geladen.
Die Juden dürffen auch auf dem Platz vorm Rathauß kein Versammlungk abhaltten, solang der Rat darinnen ist, doch dürffen sie zu zweyen oder dreyen auß irer Schul, der Synagoga, hinaus oder hinein gehen.
Ihren Kehrricht dürffen sie auß ihren Häusern nit auf den Platz noch vor ander Leutt Häuser tragen oder tragen laßen.
Sie dürfen auf keine gestohlnen Pfänder Geldt leyhen.
Dies ist der Wille des genedigen Herrn Ertz Bischoffs und der Freunde der hilligen Stadt Cöllen.
Köln, Frühjahr 1398
Mie ein Halbmond schmiegte sich die größte Stadt Deutschlands ans linke Rheinufer, umgeben von einem Mauerring, der nach dem Vorbild des himmlischen Jerusalem zwölf mächtige Tore besaß. Das hillige Cöllen, so wurde sie denn auch von ihren Bewohnern genannt, Ausdruck eines Selbstbewusstseins, das anderswo keine Selbstverständlichkeit war. In Köln herrschten der Erzbischof und die zunftähnlichen Gaffeln, die vornehmen Bürger und Kaufleute; Handel und Handwerk hatten die Stadt reich gemacht und zu einer europäischen Metropole heranwachsen lassen. Und bald würde sie einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte nördlich der Alpen sein, denn sie beherbergte eine der kostbarsten Reliquien des Christentums: die Gebeine der Heiligen Drei Könige, einst aus Italien geraubt. Ein großartiger Dom musste die würdige Kulisse für diesen unschätzbaren Besitz werden, sein Turm sollte einst alles überragen, was je von Menschenhand gebaut war. Seit hundertfünfzig Jahren arbeitete man schon an der monumentalen Konstruktion, inzwischen waren Chor, Mittelschiff und die halben Seitenschiffe fertig, der Südturm mit dem Petrusportal hatte das zweite Stockwerk erreicht. Die Baustelle mit dem riesigen Holzkran, der die schweren Trachytquader aus dem Siebengebirge an ihren Platz wuchtete, prägte das Bild der Stadt wie der mächtige Turm von Groß Sankt Martin und wie der Rhein, der ihre Lebensader war.
Das Judenviertel lag nahe beim Fluss mitten im Zentrum Kölns, begrenzt von der Portalgasse, der Judengasse, Unter Goldschmied und Obermarspforten. Seit über tausend Jahren war die älteste jüdische Gemeinde des Reichs fester Bestandteil der Stadt. Es gab eine Synagoge, die in direkter Nähe des Rathauses lag, ein Judenbad, eine Schächterei, ein Backhaus, ja sogar ein Tanz- und Hochzeitshaus. Und inzwischen ließ sich das Judenviertel sogar mit zwei Toren abschließen, ein Privileg, das die Kölner Juden nur noch mit denen von Trier teilten. Darauf waren sie stolz, denn diese Abtrennung bedeutete Schutz und Schirm und bewahrte sie vor nächtlichen Übergriffen.
Hier nun hatte Levi Lämmlein mit seiner kleinen Familie Zuflucht gesucht. Sofort nach seiner Ankunft hatte er die Gemeinde um Unterstützung angefleht, in der Hoffnung auf ein Darlehen. Doch wegen des Judenschuldenerlasses war keiner seiner Glaubensbrüder willens und in der Lage gewesen, ihm einen nennenswerten Grundstock an Kapital zu leihen, so dass ihm der Weg zurück ins Geldgeschäft versperrt blieb. Das einzige Angebot, das der Gemeindevorstand ihm schließlich machen konnte, war nicht das, was Levi erstrebt hatte: Das Amt des Synagogendieners und Schulklopfers war wegen eines Todesfalls gerade frei geworden. Es war gering bezahlt und eigentlich unter seiner Würde, aber es war verknüpft mit freier Wohnung in einem kleinen Häuschen nahe der Synagoge. Levi hatte keine Wahl, und so nahm er die Gabe schließlich dankbar an. Es bedeutete wenigstens eine Möglichkeit zum Überleben. Und was er anfangs nicht geglaubt hatte, war eingetreten: Der reiche Geldjude Lämmlein fand sich mit seinem neuen Leben ab, ja, er entwickelte mit der Zeit sogar eine gewisse Zufriedenheit. Er brauchte keinem Kredit mehr hinterherzubangen, keine Angst mehr vor dem Scheitern eines Geschäfts zu haben, keine schwierigen Entscheidungen mehr zu treffen, die ihn nachts nicht schlafen ließen. Täglich konnte er sich dem Studium der Thora widmen, die Synagoge besuchen, ein gottgefälliges Leben in Ruhe und Frieden führen. Die Familie hatte genug zum Leben, und er genoss jeden Tag mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter, die er vergötterte. Bald wurde er wegen seiner Bescheidenheit und seinem unerschütterlichen Glauben zu einem angesehenen Mitglied der Gemeinde. Er übte sein Amt mit ernster Gewissenhaftigkeit aus; jeden Freitagabend sah man ihn nach alter Vorschrift mit seinem gedrechselten Schulklopferstab durch die Gassen gehen und an die Türen der Judenhäuser klopfen, um den Beginn des Schabbat anzuzeigen. Er kümmerte sich um alles, was das Bethaus betraf, Sauberkeit, Lichter, Heizung, rechtzeitiges Auf- und Zusperren. Niemals, so pflegte der Rabbi zu betonen, war ein Synagogendiener fleißiger und zuverlässiger gewesen. So war der Rat der Gemeinde geneigt, seinem Ansuchen stattzugeben, als Levi sich nach Jahren erstmals mit einer etwas merkwürdigen Bitte an den Barnoss wandte.
»Im Namen Gottes«, sagte er in seiner heiteren, ruhigen Art, »ich würde gern meine Tochter Sara zur Schule schicken. Sie ist nun acht Jahre alt und recht gescheit und aufgeweckt. Es ist auch ihr Wunsch.«
Der Barnoss, Vorsteher des Ältestenrats, kraulte sich bedächtig den Bart, bevor er antwortete. »Nun, das ist außergewöhnlich, wenn auch nicht verboten. Glaubt Ihr denn, Levi, dass Eure Tochter – immerhin ist sie nur ein Mädchen, wenn auch vielleicht ein kluges – dem Unterricht im Kopf folgen kann?«
Levi warf sich in die Brust. »Davon bin ich überzeugt.«
»Es geht ja nicht nur um Lesen und Schreiben«, warf einer der Gemeindevorstände ein, »schließlich muss sie dabei Hebräisch lernen, eine fremde Sprache! Ich kann nicht glauben, dass ein Mädchen zu solch einer Leistung fähig ist … «
»Meine Großmutter konnte besser Hebräisch als jeder andere«, entgegnete Baruch, der Schächter, und Levi warf ihm einen dankbaren Blick zu. »Warum sollen wir es die Kleine nicht versuchen lassen, wenn sie es so gern will und kein Gesetz dagegensteht? Es kostet schließlich nichts und tut keinem weh.«
Der Barnoss wackelte unschlüssig mit dem Kopf. »Ich weiß nicht, Levi Lämmlein. Wenn nun alle Mädchen Lesen und Schreiben lernen wollten, wo kämen wir denn da hin?«, meinte er. »Am Ende wollen die Weiber gar am Schabbat Kiddusch machen!«
Alle lachten, und die meisten Teilnehmer der Versammlung pflichteten ihm bei. So einfach war die Sache nicht.
Levi ließ die Männer eine Weile reden. Dann blickte er mit einem kleinen, traurigen Lächeln in die Runde. »Seht, meine Brüder, ich habe keinen Sohn. Das Schicksal hat mich und mein Weib nicht begünstigt, und wir haben Trost im Glauben gefunden. Wenn wir einmal alt sind und unsere Augen schlecht, soll jemand in unserem Haus aus den heiligen Büchern lesen können … «
Die Männer des Gemeindevorstands, alles stolze Väter von Söhnen, nickten mitfühlend. Man beschloss, mit dem Rabbi zu reden.
Drei Tage später wurde Sara in aller Frühe sorgfältig gewaschen und in saubere neue Kleider gesteckt. Sie war glücklich und dabei schrecklich aufgeregt. Wie sehr hatte sie sich gewünscht, endlich die bunten Buchstaben der Haggada und des Buches Esther lesen zu können, die so wunderhübsch in Reih und Glied über die Seiten liefen. Monatelang hatte sie ihrem Vater in den Ohren gelegen mit ihrer verrückten Idee, zur Schule zu gehen, bis er es schließlich erlaubt und versprochen hatte, mit der Gemeinde zu reden. Und nun ging ihr größter Wunsch in Erfüllung. Sie konnte es kaum erwarten.
»Halt jetzt endlich still«, schimpfte Schönla, während sie den beinernen Kamm durch das widerspenstige Haar ihrer Tochter zog und versuchte, die langen bernsteinfarbenen Flechten zu entwirren. Sara trippelte von einem Fuß auf den anderen, bis die Zöpfe endlich fertig waren, dann stürmte sie voll Neugier und Vorfreude in die Wohnstube. Da lagen sie schon auf dem Tisch, die drei kleinen duftenden Laibe aus feinem Weizen und Honig, dazu drei Eier und drei rotwangige Äpfel. So verlangte es der Brauch. Auch ihr Vater stand schon bereit; gemeinsam mit der Mutter packte er die guten Sachen in ein mit Segenssprüchen besticktes Tuch. Er nahm seinen Tallit, den feinen Gebetsmantel mit den langen Fransen, und legte ihn Sara behutsam um Kopf und Schultern. »Bereit?«, fragte er schmunzelnd. Sie nickte, vor Aufregung brachte sie kein Wort heraus.
Dann trat sie hinter ihrem Vater durch die Haustür, eine Doppeltür aus zwei Rundbögen, die an die Gesetzestafeln des Moses erinnern sollte. Stolzgeschwellt führte Levi seine Tochter den kurzen Weg über den Rathausplatz zum Fraueneingang der Synagoge.
Drinnen warteten schon der Rabbi Meir Baruch und Feifl Isaak, einer der Gemeindevorstände. Nach einer ehrfürchtigen Begrüßung wurden die mitgebrachten Leckereien auf einem Tischchen ausgebreitet, und Sara durfte von allem ein Häppchen essen. Sie brachte kaum einen Brocken hinunter, spuckte den letzten Bissen, den sie so trocken gekaut hatte, dass sie ihn gar nicht mehr hinunterbrachte, verstohlen in die Hand und ließ ihn in ihrer Rocktasche verschwinden. Der Rabbi tat, als hätte er es nicht gesehen, verbiss sich ein Lachen und führte sie in den Schulraum.
Elf Köpfe fuhren herum, und elf Paar Augen blickten Sara mit unverhohlener Neugier an. Lauter Jungen, die meisten um etliches älter als sie, saßen da schon auf kleinen Bänken. Rabbi Meir führte seine neue Schülerin auf einen Platz, der ein Stück weit von den anderen entfernt war, und drückte ihr feierlich eine kleine Wachstafel in die Hand, auf der in wunderschönster Schönschrift schon das Alphabet geschrieben stand. Sara lächelte, während ihr Lehrer langsam und deutlich die einzelnen Buchstaben vorlas. Anschließend brachte ihm einer der Schüler, wie es der Brauch verlangte, ein Krüglein Honig. Der Rabbi goss etwas von dem dickflüssigen Zeug auf die Tafel, verschmierte es mit einem kleinen Spatel, und hielt die Tafel dann Sara hin. »Lieblich und süß wie der Honig ist das Lernen«, sagte er zu ihr und zwinkerte aufmunternd. Sara griff mit beiden Händen zu und schleckte den süßen, klebrigen Saft vom Wachs, bis kein Tröpfchen mehr übrig war. Zufrieden und erleichtert, mit honigverschmiertem Kinn und pappigen Händen, ließ sie sich danach von ihrem Vater wieder aus der Synagoge hinausführen, heim zu ihrer Mutter.
So verlief der erste Schultag.
In den folgenden Wochen lernte Sara schmerzhaft, was es bedeutete, anders als die anderen zu sein. Keiner der Jungen redete mit ihr. Keiner half ihr. Im Unterricht taten sie, als sei sie gar nicht da, in den Pausen warfen sie ihr nichts als abschätzige Blicke zu. Sie stand abseits und fühlte sich ganz klein und einsam. Irgendwann fing einer der größeren Schüler an, sie beim Verlassen der Synagoge zu schubsen und zu rempeln, Und die anderen taten es ihm bald nach, zogen an ihren Zöpfen, versteckten ihr Täfelchen, zischten ihr schlimme Worte nach. Sie wagte nicht, sich zu wehren, denn sie wusste ja, dass ihr Schulbesuch eine Ausnahme darstellte. Wenn jemand merkte, dass es Schwierigkeiten gab, würde sie vielleicht wieder zu Hause bleiben müssen. Und das wollte sie auf gar keinen Fall. Zu schön war es zu lernen, wie sich aus den schlangenartigen Buchstaben Wörter formen ließen, sie mit dem kleinen Holzstäbchen ins Wachs zu drücken. Geschichten zu lauschen aus alter Zeit und aus neuer. Die fremde Sprache zu hören mit ihrem seltsamen Klang. Dem Rabbi Fragen stellen zu können über alles, was sie nicht wusste. So marschierte Sara jeden Morgen mit trotzig vorgerecktem Kinn in die Synagoge, auch wenn sie sich in der Nacht davor in den Schlaf geweint hatte. Sie würde keine Schwäche zeigen!
Ihre Standhaftigkeit fand ein Ende, als zwei der Jungen, Herschel Enoch und Süßkind Männlein, sie an einem Regentag nach der Judenschule abpassten. Schon den ganzen Vormittag über hatten die beiden sie mit Wachskügelchen beschossen, immer dann, wenn der Rabbi nicht hinsah. Beim Hinausgehen kämpfte Sara wie so oft mit den Tränen, als Süßkind vor dem Fraueneingang begann, um sie herumzutanzen. Er stapfte dabei so wild in die Pfützen, dass die Wasserspritzer Saras Schulkleid trafen, ihr einziges, das wunderschöne neue aus hellem Leinen. Herschel riss dazu an ihren Haaren, während die anderen herbeirannten, um zuzusehen. »Nicht!«, rief Sara, »bitte nicht!«
»Dann bleib doch daheim, du Ziege!«, zischte Herschel. »Weiber haben bei uns nichts zu suchen.«
»Du bist hässlich und dumm«, plärrte Süßkind und streckt ihr die Zunge heraus. »Hau ab, wir wollen dich nicht.« Er schnappte sich den Riemen ihres Schulbeutels und zog sie daran herum, so dass sie sich immer schneller um ihre eigene Achse drehen musste. Sara kam ins Taumeln, als der Riemen riss, schrie auf und fiel hin, genau in die schlammigste Pfütze von allen. Die Jungen lachten hämisch und zeigten mit Fingern auf sie, einer nahm einen Dreckklumpen und warf ihn nach ihr. Da war es mit ihrer Beherrschung endgültig vorbei. Sie schlug die Hände vors Gesicht und begann zu weinen.
» Lasst sie!«, sagte da plötzlich eine helle Stimme, und eine Hand legte sich auf ihre Schulter. »Ihr seid gemein. Der Barnoss hat beschlossen, dass sie in die Schule darf. Ich will’s meinem Vater sagen, wenn ihr sie nicht in Ruhe lasst! Und dem Rabbi!«
Ungläubig blickte Sara auf. Es war Salomon Hirsch, der zehnjährige Sohn des Geldverleihers Hirsch Gideon, der ihr zu Hilfe gekommen war und ihr jetzt mit einem aufmunternden Lächeln die Hand hinstreckte. »Es stimmt gar nicht, dass du hässlich bist«, sagte er. »Und dumm auch nicht. Die sind bloß neidisch.« Sie ließ sich von ihm hochhelfen, immer noch schluchzend, und während er den klatschnassen Lederbeutel aufhob und ihr über die Schulter warf, verdrückten sich die anderen Jungen einer nach dem anderen. Der Spaß war vorbei.
»Komm, ich bring dich heim«, meinte Salomon mit der tiefsten Stimme, zu der er fähig war. Er fand langsam Gefallen an der Beschützerrolle. Sara nickte und schnäuzte sich geräuschvoll in den nassen Ärmel. Während sie so gingen, sah sie ihren Retter verstohlen von der Seite her an. Er war viel größer als sie, mit dunklem Teint und dunklen Augen, schwarze Locken ringelten sich um seine Stirn. Ihr fiel auf, dass er Wimpern wie ein Mädchen hatte, lang, dicht und gebogen, einen ziemlich großen Mund und große Ohren. Er guckte auf sie herab und schüttelte grinsend den Kopf. »O Adonai!«, sagte er, »du siehst aus wie eine Schlammratte.« In diesem Augenblick verliebte sich Sara unsterblich in ihn.
Irland, Kloster Clonmacnoise, Sommer 1398
Mie ein breites silbernes Band schlängelte sich der Fluss durch die weite Ebene. An seinen Ufern hatten sich schon seit frühester Zeit Menschen niedergelassen, Fischer und Ackerbauern, die der rauen Natur auf der Insel ihr täglich Brot abtrotzten. Und vor mehr als achthundert Jahren hatte ein junger Mönch namens Ciaran, Sohn eines einfachen Wagenknechts aus Roscommon, auf der Kuppe eines flachen Hügels an der Flussbiegung ein Kloster gegründet. Bald darauf war er an der Pest gestorben, und man begann, den vom Glauben Beseelten als Heiligen zu verehren. Das klösterliche Gemeinwesen am Shannon blühte von da an, und sein Ruf als Stätte der Kultur und christlichen Gelehrsamkeit drang weit über die Grenzen Irlands hinaus. Es wurde zur erwählten Grablege vieler irischer Könige. Und aus ganz Europa strömten junge Scholaren nach Clonmacnoise, um dort, im Zentrum der Grünen Insel, zu lernen und ein heiligmäßiges Leben zu führen. Jetzt, gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts, hatte die Klosteranlage ihre Blütezeit hinter sich. Sie bestand noch aus einer kleinen Kathedrale, etlichen verstreut liegenden Kapellen, den weitläufigen Wohnanlagen und Werkstätten der Mönche, einem Friedhof und einem hohen Rundturm, den man wegen der wiederholten Wikinger- und Normannenangriffe in früheren Zeiten als Fluchtmöglichkeit errichtet hatte. Clonmacnoise war zu einem Ort nahezu greifbarer Ruhe geworden, auf grünsamtenen Flusswiesen, nur erreichbar durch eine Bootsfahrt über den Shannon oder einen Weg durchs Moor.
Der dunkelhaarige Junge und der alte Mönch gingen zusammen auf einem Pfad in Richtung Fluss, vorbei an der hübschen kleinen Nonnenkirche, die außerhalb des niedrigen Mauerrings lag, der das Kloster begrenzte. Freundlich grüßten sie ein Grüppchen verschleierter Frauen, die gerade aus dem Portal traten, und hielten dann geradewegs auf die Stelle am Ufer zu, wo die schönsten Binsen wuchsen. Das strohige Mark der Halme gab gute Lampendochte; auch nutzten es die Mönche als weichen und wärmenden Bodenbelag für das Refektorium und die Zellen der Alten, die die nächtliche Kälte oft schwer ertrugen.
»Erzählt noch einmal, wie Ihr mich gefunden habt, Father Finnian«, bat der Junge und griff zutraulich nach der Hand des greisen Mönchs.
Der ehrwürdige Vater Finnian seufzte und wackelte in gespielter Verzweiflung mit dem fast kahlen Kopf. Sein kleiner Freund hörte die Geschichte aber auch gar zu gern. Gutmütig begann er zu erzählen. »Nun, wenn du es hören willst: Es war vor sieben Jahren, beinahe schon Winter. Wir hatten in jenem Jahr die schlimmsten Herbststürme, die man sich vorstellen kann, manchmal hättest du glauben können, das Jüngste Gericht sei gekommen. Ein fürchterliches Heulen und Tosen lag dann in der Luft, als ob der schwarzgraue Himmel sich selber verschlingen wollte. Der Wind war an diesen Tagen so gewaltig, dass die Wellen unseres braven alten Shannon bis an die Mauern der Finghin-Kapelle peitschten. Nicht einmal die Möwen wussten vor lauter Gischt und Regen mehr, wo oben und unten war, und die dunklen Wolken hingen so tief, dass man fürchtete, mit dem Kopf daran zu stoßen, wäre man ins Freie gegangen. Eines Abends, als der Sturm wieder einmal so heftig an den Dächern unserer Hütten zerrte, dass wir es mit der Angst vor dem Weltenende zu tun bekamen, versammelten wir uns alle im Refektorium, um dort das Nachtmahl zu halten. Wir beteten und sangen, damit wir nicht die Zuversicht verlören. Gestärkt durch ein warmes Essen und das gemeinsame Gebet begaben sich alle zurück in ihre Zellen, nur ich – damals war ich Pförtner – hatte wie immer die Aufgabe, das Tor für die Nacht zu schließen. Oh, wie kämpfte ich mich durch Regen und Sturm! Der Wind fegte die kalten Tropfen wie spitze Nadeln gegen mein Gesicht, und innerhalb kürzester Zeit war ich nasser als ein Fisch! Ohne hochzusehen stemmte ich mich gegen das hölzerne Portal, um es zu schließen. Es klemmte! Ich schob und stieß, aber die Tür ging nicht zu! Da bemerkte ich einen rechteckigen geflochtenen Deckelkorb, der verhinderte, dass der Türflügel ins Schloss fallen konnte. Jemand musste ihn unbemerkt hierhin gestellt haben. Na, du kannst dir vorstellen, dass ich beinahe angefangen hätte, zu fluchen! Ich zerrte an dem Korb, um ihn aus dem Weg zu bekommen, als ich einen Laut hörte, der aus dem Inneren drang. ›Beim heiligen Ciaran‹, dachte ich, ›was ist das?‹ Ich öffnete den Deckel, und, arrah!, was glaubst du, was darin war? Du! Ein winziges Kindlein, gewickelt in dicke Tücher, das auf einem Bett aus Stroh lag. Und du sahst mich mit großen Augen an, als ob du sagen wolltest: Hilf mir, Father Finnian, nimm mich mit! Ich hob den Korb hoch, drückte ihn fest an mich und lief so schnell ich konnte zur Wohnung des Abts. Du kennst ja Father Padraig! Er schlug erst einmal die Hände über dem Kopf zusammen und rief alle Heiligen an, dann schickte er den langen Liam – der war damals noch Küchenknecht – durch den Sturm zu den Nonnen. Und stell dir vor, Mutter Mairin kam selbst! So dick und schlecht zu Fuß sie damals schon war, sie kämpfte sich durch das Wetter, um dich zu sehen. ›Gute Jungfrau Maria‹, schnaufte sie, ›hier haben wir ja Moses und die Sintflut gleichzeitig beieinander!‹ Vorsichtig holte sie dich heraus und wickelte dich aus dem nassen Zeug. Du fingst an zu schreien und zu strampeln. ›Gesund scheinst du ja zu sein‹, sagte sie zu dir, nahm dich hoch und tätschelte dir den Rücken, ›aber du hast sicher großen Hunger. Na, wir werden dich schon durchbringen, kleiner Wicht. Willkommen in Clonmacnoise.‹«
Father Finnian lächelte auf den Buben herunter, der wie jedes Mal gespannt an seinen Lippen hing. Ciaran hatten sie das Findelkind genannt, nach dem heiligen Gründer ihres Klosters. Oh, so etwas kam schon einmal vor, dass ein namenloser Säugling zu den Gottesleuten gebracht wurde. Die Nonnen nahmen solche Kinder stets bei sich auf und zogen sie groß, bis sie irgendwo außerhalb bei christlichen Familien untergebracht werden konnten. So hatten sie es auch mit Ciaran vorgehabt, doch der Junge hatte sich so vielversprechend entwickelt, dass Mutter Mairin ihn im Alter von fünf Jahren zur weiteren Erziehung zu den Mönchen geschickt hatte.
»Wo bin ich denn aber nur hergekommen, Father?«, wollte Ciaran wissen.
»Och, mein Junge, das weiß nur der liebe Gott.« Vater Finnian kratzte sich an der Wange. »Von draußen eben.«
Draußen! Dieses Wort klang geheimnisvoll und rätselhaft. Natürlich wusste Ciaran noch nichts darüber, er konnt nur ahnen, dass dieses »draußen« eine ganze, riesengroße Welt umfasste. Er kannte bisher nichts als die steinernen Kirchlein und Kapellen innerhalb der engen Mauern, nichts als betende Mönche und Nonnen, Gottesdienste, Schulunterricht und Küchenarbeit. Aber irgendwo dort draußen, da waren seine Eltern.
»Jedenfalls«, sagte Finnian und seufzte leise, »gehörst du jetzt zu uns. Wir alle, die Brüder und Schwestern von Clonmacnoise, sind deine Familie.«
Inzwischen waren der hochgewachsene, greise Mönch und sein junger Begleiter am Ufer angekommen. Jetzt zogen sie kleine Sicheln aus ihren Gürteln und begannen, die schönsten und längsten Binsen abzuschneiden, immer eine Handbreit über dem Boden. Über ihnen trieb der Wind die Wolken über den weiten Himmel, immer wieder brach die Sonne durch und tauchte das Land in ein klares, strahlendes Licht. Das Grasland leuchtete in tausend Schattierungen von Grün, der Fluss glitzerte blausilbern, und selbst die grauen Steine der Klosterbauten schienen beinahe kristallen und gleißend weiß. Nach einiger Zeit bündelten Father Finnian und Ciaran die grünen Halme, schulterten ihre Last und gingen langsam zum Kloster zurück.
Ciaran war müde. Er war zusammen mit den Mönchen lange vor dem ersten Morgengrauen aufgestanden, hatte noch vor dem Frühstück das Skriptorium gefegt und dann bis mittags bei Father Dermot Unterricht gehabt. Mit gesenktem Kopf trabte er neben seinem Begleiter her; die beiden durchquerten den kleinen Friedhof mit den uralten Gräbern der Hochkönige, umgingen die Werkstätten der Gold- und Silberschmiede und erreichten schließlich die Hütten der Mönche. Und da drang plötzlich eine Melodie an Ciarans Ohren. Es waren Töne, fein wie Spinnweben, die in der Luft schwebten, sich verwoben, miteinander spielten, einander umschlangen und liebkosten, um dann auseinanderzutanzen und wieder zu verklingen. Der Junge sah auf. Vor einer der Hütten saß ein Novize mit feuerrotem Haarschopf, auf den Knien ein merkwürdiges hölzernes Gestell. Seine Finger hüpften über das Ding, zupften und streichelten und entlockten dem Instrument die wunderbarsten Klänge. Der Rotschopf schien ganz versunken, und dann plötzlich hob er mit heller Stimme an, zu singen. »Im ruhigen Wasserland, dem Land der Rosen, steht Ciarans heilige Stadt. Und die Krieger Erins liegen hier begraben und schlafen den ewigen Schlaf … «
Der Junge stand wie verzaubert. Die Choräle der Mönche, die kannte er, aber so etwas Schönes hatte er noch nie gehört. Er rührte sich nicht, wagte kaum, zu atmen, um den Sänger nicht zu stören. Der hatte schließlich sein Lied beendet und lächelte Ciaran freundlich an. »Gefällt’s dir?« Sein Irisch war schwer zu verstehen, denn er kam von den felsigen Inseln im Westen.
Ciaran nickte ehrfürchtig. »Es ist wie … Engelsmusik.«
Brendan, der Novize, lachte. Er hatte ein lustiges Gesicht mit Unmengen an braunen Sommersprossen und hellgraue Augen, die von rotblonden Wimpern umrahmt waren. »Willst du noch mehr hören?« Er begann wieder zu spielen und sang ein altes irisches Liebeslied. »Siubhail a ruin, siubhail a ruin, tabhair dam do lamh … « – komm, Liebchen, gib mir deine Hand …
»Was ist das für ein Instrument?«, fragte Ciaran am Ende des Lieds.
»Eine Clairseach, eine irische Harfe«, antwortete Brendan.
»Kann man das lernen?«
Der Novize nickte ernst. »Natürlich. Willst du’s mal versuchen?« Er nahm Ciaran, der sein Binsenbündel schon längst achtlos zu Boden geworfen hatte, auf den Schoß und zeigte ihm, wie er die Saiten mit den Fingern zupfen musste. Die Wangen des Jungen brannten vor Eifer, während Brendan ihm geduldig alles erklärte. »Es gab einmal in alter, alter Zeit einen Barden mit Namen Ossian, Sohn eines Sterblichen und einer Feenfrau, der so wunderbar sang und spielte, dass er in die Anderwelt aufgenommen wurde, ins Land der ewigen Jugend. Niemals ist sein Name auf unserer Insel vergessen worden«, endete er schließlich.