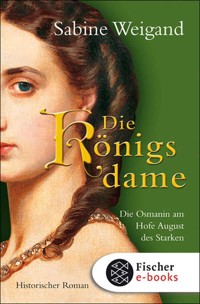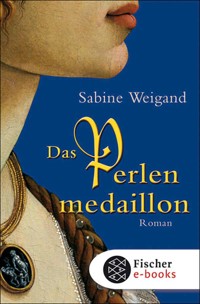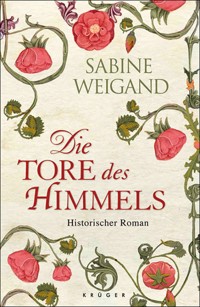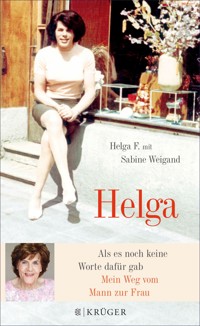4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit zehn ist sie verheiratet. Mit zwölf Witwe. Mit fünfzehn heiratet sie den König von Böhmen. So steht es in den Chroniken. Als sie endlich ihr eigenes Leben führen will, sperren ihre Brüder sie ein. Ihre Spur verliert sich 1542. Bis in unseren Tagen ein geheimnisvoller Fund die Geschichte der Markgräfin Barbara von Ansbach enthüllt. »Eine Geschichte von Machtgier, Intrigen, Liebe und Verrat - die Geschichte einer Frau, die tatsächlich gelebt hat: fesselnd bis zur letzten Seite.« Gong
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 730
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Sabine Weigand
Die Markgräfin
Roman
Über dieses Buch
Schon mit zehn Jahren wird die Markgräfin Barbara verheiratet. Rasch verwitwet und mit reichem Erbe, wird sie zum Unterpfand weiterer Heiratspläne ihrer ehrgeizigen Brüder. Aber als sie endlich ihr eigenes Leben führen will, sperren die Brüder sie ein. Ihre Spur verliert sich 1542.
2001, die Plassenburg in Franken: der Kastellan Haubold macht einen rätselhaften Fund. Ein kostbares Kästchen aus dem 16. Jahrhundert, darin die Knöchelchen eines Kindes. Haubolds Forscherdrang lässt ihm keine Ruhe, er muss herausfinden, was sich hinter diesem Fund verbirgt. Und er entdeckt eine ungeheure Geschichte von Macht und Verrat, von einer mutigen Frau und ihrer großen Liebe, die nicht sein durfte. Er entdeckt Barbara, die Markgräfin.
Eine spannende Detektivgeschichte, ein großes Historienepos – das Schicksal Barbaras entfaltet sich in der bewegten Zeit der Reformation in Deutschland. Die Markgräfin hat es wirklich gegeben. Dies ist ihre Geschichte.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Sabine Weigand stammt aus Franken. Sie ist Historikerin und arbeitet als Ausstellungsplanerin im Museum von Schwabach. Die Spur der Markgräfin entdeckte sie bei ihren Forschungen zur Geschichte der Plassenburg bei Kulmbach, einer der größten Festungsanlagen Nordeuropas - dem Schauplatz ihres Romans. "Die Markgräfin" ist ihr erster Roman.
Impressum
Covergestaltung: bürosüd, München – Abbildung: Piero di Cosimo, »Simonetta Vespucci«
© 2004 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400844-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Schon mit zehn Jahren [...]
Erstes Buch
Plassenburg, Dezember 2001
Ansbach, September 1525
Herzogtum Groß-Glogau-Crossen, Schlesien, Mai 1527
Universität Erlangen, Dezember 2001
Glogau, Mai 1527
Plassenburg, Januar 2002
Glogau, Dezember 1527
Bamberg, Januar 2002
Glogau, März 1529
Ansbach, September 1529
Bamberg, Februar 2002
Ansbach, September 1539
Plassenburg, März 1541
Plassenburg, März 2002
Neustadt an der Aisch, August 1541
Neustadt an der Aisch, Januar 1542
Plassenburg, April 2002
Neustadt an der Aisch, September 1542
Heilsbronn, Oktober 1542
Ansbach, Oktober 1542
Kulmbach, Mai 2002
Kulmbach, Oktober 1542
Zweites Buch
Plassenburg, April 1543
Schwabach, 29.August 1543, Häuptleinstag, decollatio Johannis
Kulmbach, Juni 2002
Feldlager vor der Festung Landrecies, Frankreich, Ende Juni 1544
Abenberg in Mittelfranken, Juni 2002
Kulmbach, Juli 2002
Vor der Festung Landrecies, Frankreich, Juli 1544
Plassenburg, April 1545
Kulmbach, Juni 1545
Plassenburg, Juni 1545
Kulmbach, August 2002
Heideck, Juli 1545
Plassenburg, August 2002
Plassenburg, Frühjahr 1548
Kulmbach, August 2002
Drittes Buch
Kulmbach, Frühjahr 1552
Plassenburg, August 2002
Kulmbach, August 2002
Plassenburg, August 1552
Kulmbach, September 2002
Plassenburg, November 1552
Kulmbach, September 2002
Plassenburg, November 1552
Himmelkron, September 2002
Plassenburg, Dezember 1552
Plassenburg, Dezember 1553
Plassenburg, Februar 1553
Kulmbach, Ende Oktober 2002
Plassenburg, März 1553
Plassenburg, 20.November 1553
Kulmbach, Anfang November 2002
Plassenburg, 21.November 1553
Plassenburg, 26.November 1553, Konraditag
Kulmbach, 26.November 2002
Trockau und Wirsberg, Ende Februar 1554
Bayreuth, Anfang Dezember 2002
Plassenburg, Ende Februar 1554
Plassenburg, 27.März 1554
Kulmbach, 26.Dezember 2002
Plassenburg, Ende Mai 1554
Plassenburg, Neujahrstag 2003
Plassenburg, 20.Juni 1554
Kulmbach, 1.Januar 2003
Plassenburg, 21.Juni 1554
Plassenburg, 21.Juni 1554
Schluss
Kulmbach, 6.Januar 2003
Wer war das Kind in der Mauer? – Forscherteam enthüllt Identität der Plassenburger Kinderleiche
Nachwort
Schon mit zehn Jahren wird die Markgräfin Barbara verheiratet. Rasch verwitwet und mit reichem Erbe, wird sie zum Unterpfand weiterer Heiratspläne ihrer ehrgeizigen Brüder. Aber als sie endlich ihr eigenes Leben führen will, sperren die Brüder sie ein. Ihre Spur verliert sich 1542.
2001, die Plassenburg in Franken: der Kastellan Haubold macht einen rätselhaften Fund. Ein kostbares Kästchen aus dem 16. Jahrhundert, darin die Knöchelchen eines Kindes. Haubolds Forscherdrang lässt ihm keine Ruhe, er muss herausfinden, was sich hinter diesem Fund verbirgt. Und er entdeckt eine ungeheure Geschichte von Macht und Verrat, von einer mutigen Frau und ihrer großen Liebe, die nicht sein durfte. Er entdeckt Barbara, die Markgräfin.
Das Schicksal Barbaras entfaltet sich in der bewegten Zeit der Reformation in Deutschland. Die Markgräfin hat es wirklich gegeben. Dies ist ihre Geschichte.
»Anhand dieses Frauenschicksals erzählt die promovierte Historikerin Sabine Weigand einen ungemein spannenden Kriminal- und Frauenroman, der gleichzeitig auf unterhaltsame Weise in die Sitten, Gebräuche und Denkstrukturen des Mittelalters einführt.« 3sat
Erstes Buch
Plassenburg, Dezember 2001
Missmutig stapfte der Kastellan durch den frisch gefallenen Schnee über den Schönen Hof. Die Aussicht auf morgendliche Schneeräumaktionen ließ seine Stimmung auf den Nullpunkt sinken, vor allem weil der Beamte von der Bayerischen Schlösserverwaltung ihm gerade eröffnet hatte, dass der beantragte Zuschuss für ein Spezialräumgerät heuer wieder nicht zu erwarten war. Jeden Winter das gleiche Spiel – Anträge, Formulare, Telefonate, und dann die Ablehnung.
Seit drei Jahren hatte Gregor Haubold nun das Amt des Kastellans auf der Plassenburg inne, und als leidenschaftlicher Heimathistoriker fühlte er sich auf der riesigen Festung wohl. Inzwischen kannte er jeden Gang und jedes verborgene Eckchen, wusste, wo der Putz bröckelte und wo bei starken Regenfällen das Wasser eindrang. Manchmal kam es ihm so vor, als ob er seit Jahrhunderten hier lebte und ein Teil des alten Gemäuers wäre. Dann stellte er sich vor, er sei herrschaftlicher Schlossvogt, und der Hof der Burg bevölkerte sich in seiner Phantasie mit geschäftig umherlaufender Dienerschaft, mit Bauern, die in Fronfuhren den Kraut- und Rübenzehnt ablieferten, mit Schweinen, Hühnern, Tauben und schwänzelnden Hunden.
Doch heute hatte Haubold keine Zeit für solche Gedanken. Vor der Tür an der Nordostecke des Schönen Hofes warteten bereits die zwei Handwerker. Der Kastellan kramte in seiner ausgebeulten Hosentasche nach dem Schlüsselbund und förderte ihn schließlich zusammen mit Bonbonpapierchen und einem Schokoriegel zutage. Haubold nickte den beiden zu und sperrte eine Zeit lang am rostigen Schloss herum, bis die alte Tür schließlich knarrend aufging.
»Da geht’s rein. Vorsicht bei dem Türstock, der ist ziemlich niedrig. Und dann bitte hinter mir bleiben – die Treppe ist schon recht beschädigt.«
Haubold, mit seiner Größe von knapp zwei Metern und über 125 Kilogramm Lebendgewicht eine imposante Erscheinung, bückte sich mit einer Behändigkeit, die ihm niemand zugetraut hätte, und ging sicheren Schrittes voraus in die Kellergewölbe. Die Beleuchtung stammte noch aus der Zeit, als die Plassenburg als Zuchthaus diente, und spendete mit ihren nackten Glühlampen nur spärliches Licht. Die beiden Handwerker folgten dem Kastellan zögernd hinunter in die klammen und kalten Kellerräume unter den Markgrafengemächern.
»Da oben!«
Der Kastellan ließ den Strahl seiner Taschenlampe über einen großen feuchten Fleck an Decke und Außenwand gleiten.
»Hier verläuft die Wasserleitung von den Besuchertoiletten neben den Markgrafenzimmern herunter und dann weiter an der Mauer entlang in den tieferen Vorhofbereich. Wahrscheinlich ist das Rohr schon länger aufgefroren – ich kontrolliere den Keller hier nicht so häufig. Na ja, jedenfalls muss das hier dringend repariert werden, bevor uns der halbe Keller zusammenstürzt und die Schlösserverwaltung Ärger macht. Der Stein ist hier überall brüchig.«
Der ältere der beiden Handwerker seufzte und begutachtete den Wasserfleck.
»Da hilft nichts, wir müssen die Wand aufschlagen.«
Mit einem schicksalsergebenen »Also dann!« machte sich sein Gehilfe ans Werk und begann zu klopfen und zu hämmern, bis die Rohrleitung nach einigen Minuten sichtbar wurde. Die ganze Bescherung lag nun offen zutage.
»Kein Rohrbruch, Meister«, stellte der Handwerker fest, »schauen Sie selber: Die Leitung ist von oben bis unten aufgerostet! Dazu brauchen wir länger!«
Haubold fluchte. Wenn die Leitung hier verrostet war, konnte man davon ausgehen, dass die zweite Wasserleitung, die von der Personaltoilette aus durch das Gewölbe führte, auch nicht viel besser aussah. Der Kastellan schnappte sich aus dem Werkzeugkasten Hammer und Meißel und machte sich ein Stück weiter an der Wand zu schaffen, um die zweite Leitung zu finden und zu kontrollieren. In Brusthöhe fing er zielstrebig an zu klopfen. Hier ungefähr musste die zweite Leitung verlaufen. Haubold schwante, dass er es nun nicht mehr bis zwölf Uhr in die Kastellanswohnung zum Mittagessen schaffen würde, was besonders ärgerlich war. Essenszeiten waren ihm heilig, und er versäumte nie ohne ernsthaften Grund eine Mahlzeit. Er schlug kräftiger zu und legte schnaufend einen Teil der zweiten Leitung frei. Dann kratzte er mit dem Meißel am Rohr entlang und leuchtete mit der Taschenlampe hin. Kein Rost. Gott sei Dank.
Sein Blick fiel auf die Schuttbrocken auf dem Boden. Mittendrin lag ein größeres Stück eines zerborstenen Mauersteins. Ohne recht zu wissen warum, bückte er sich mit einem angestrengten Quietscher, um den Stein aufzuheben. Er suchte nach der fehlenden Stelle in der Mauer und wollte den Stein in die Lücke hineindrücken, als ein weiteres kleines Stück aus der Mauer herausfiel. Haubold bemerkte, dass sich dahinter ein Hohlraum befand. Vergeblich versuchte er, mit der Taschenlampe hineinzuleuchten – das Loch war zu klein. Er schob mühsam eine Hand in den Hohlraum und fingerte vorsichtig darin herum. Was er fühlte, waren kleine Steinchen, etwas Glattes, Rundliches und diverse kleinere und größere Teilchen.
Das Erste, was Haubold dann herauszog, war ein flaches, eckiges Stückchen. Er blies es vom Staub frei und versuchte es notdürftig zu säubern. Beim Ankratzen mit dem Daumennagel erwies sich das Material als hart und irgendwie glatt, jedenfalls war es kein Holz, auch kein Stein, eher Metall. Vergessen waren das Mittagessen und der Wasserschaden – Haubolds Forschergeist war geweckt. Nachdem kein Pinsel für eine sachgemäße Reinigung des Teilchens zur Hand war, zog der Kastellan ein altväterliches Herrentaschentuch mit deutlichen Gebrauchsspuren aus der Gesäßtasche, spuckte auf das Metallteil (im Gegensatz zu führenden Wissenschaftlern sah er Speichel durchaus nicht als konservatorische Todsünde an) und putzte das Ding mit aller Sorgfalt.
Was er sah, ließ ihn innerlich frohlocken: ein winziges Metallscharnier! Und nicht etwa ein einfaches Scharnier, nein, er hielt da ein aufwendig gearbeitetes Teil in der Hand, das florale Muster in feinster Ziselierung aufwies. Haubold schob seine schon reichlich verkratzte Hand noch einmal in das Loch und ergriff ein paar undefinierbare Kleinteile. Er blies, reinigte und ordnete die Teilchen, überlegte und folgerte schließlich enttäuscht, dass es sich lediglich um die Knöchelchen einer Tierpfote handelte. Aber wie, so fragte sich Haubold, war das Tier in das Mauerloch gelangt? Ging ein größerer Riss durch die Außenwand, sodass ein Marder oder ein anderes Kleintier von draußen hereinkommen und hier wie in einer Höhle Unterschlupf finden konnte? Der Kastellan sah schon in düsteren Vorahnungen Restaurierungsmaßnahmen an der Außenmauer auf sich zukommen. Andererseits, was hatte ein antikes Metallscharnier in einer Tierhöhle zu suchen?
Er griff noch einmal zu Hammer und Meißel und erweiterte das Mauerloch. Vorsichtig setzte er die Werkzeuge ein, um nichts zu zerstören, und löste noch drei, vier Brocken aus der Wand. Nun konnte er in das Loch hineinleuchten. Im Licht der Taschenlampe sah er, dass es sich um einen engen Hohlraum handelte, mit irgendwelchem Abraum darin, alles staubig und grau. Außerdem lag da noch etwas Größeres, Kugeliges, das er vorhin schon gefühlt hatte. Er zog die Lampe zurück und griff wieder mit der Hand in das Loch. Seine Finger schlossen sich um das rundliche Ding. Es passte zusammen mit seiner Hand gerade noch durch die erweiterte Öffnung. Nachdenklich betrachtete der Kastellan das geborgene Teil, drehte und wendete es. Das musste eine kleine knöcherne Hirnschale sein. Haubold langte noch einmal in die Höhlung und tastete nach der Kinnlade des Tieres. Er versuchte, nach spitzen Zähnchen zu fühlen, fand aber nichts. Schließlich zog er ein Knochenstückchen mit heraus, bei dem er die Krümmung eines Kieferknochens zu spüren glaubte. Er öffnete die Hand, und tatsächlich, da war der kleine Unterkiefer. Der Kastellan schüttelte den Kopf. Der Kiefer lief nicht so spitz zu, wie er es bei einem Tier erwartet hätte. Und er war völlig zahnlos. Was war das bloß für ein komisches Vieh? Haubold fingerte unschlüssig an den Knochenteilen herum und besah sie sich noch einmal von allen Seiten. Er hielt die beiden Stücke aneinander. Und plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Dies war kein Tierschädel! Der Schreck fuhr ihm so in die Glieder, dass er beinahe alles fallen gelassen hätte. Es lief ihm kalt über den Rücken. Das hier war, nach allem, was er wusste, die verkleinerte Ausgabe eines menschlichen Schädels – Allmächtiger, er hatte gerade den Schädel und die winzige Hand eines Kindes entdeckt.
Der Kastellan wurde blass. Er stürmte los, lief keuchend an den verdutzten Klempnern vorbei die Treppe hoch und rannte, so schnell es seine zweieinhalb Zentner erlaubten, quer über den Schlosshof. Schwer atmend erreichte er den Kassenbereich des Zinnfigurenmuseums. Als er nach dem Telefonhörer greifen wollte, merkte er, dass er immer noch die beiden Teile des Kinderschädels in der Hand hatte. Er legte alles vorsichtig auf den Kassentisch und wählte die Nummer der Bayerischen Schlösserverwaltung.
Ansbach, September 1525
Hoch erhobenen Hauptes schritt die kleine Markgräfin über den mit Stroh bedeckten Boden des Saales. Es raschelte, als ihre Röcke über die Halme streiften. Man hatte sie für diesen besonderen Tag in Staatsgarderobe gekleidet – sie trug ein schweres perlenbesticktes Brokatkleid, das bis zum Boden reichte, und das zierliche Häubchen der unvermählten Jungfrauen, aus der das dunkle Haar vom Hinterkopf in dicken Flechten herabfiel. Das Gehen fiel ihr schwer, steckten ihre Füße doch heute zum ersten Mal in den modischen breiten Hornschuhen. Aber der Bedeutung des Tages bewusst, gab sich die Achtjährige größte Mühe, nicht zu stolpern.
Sie war keine Schönheit: Ihr Teint war zu dunkel, ihre Brauen zu dicht, ihr Mund zu groß, ihr Haar zu schwarz. Aber die Pocken hatten ihr Gesicht noch nicht entstellt wie das ihrer älteren Schwester, ihre Haut war glatt und weich wie Samt. Ihr schlanker Hals bog sich in sanftem Schwung und schien fast zu zart, um das schwere Haar zu tragen. Sie bewegte sich anmutig und leicht, in ihrer Gestik kündigte sich schon jetzt eine jungmädchenhafte Grazie an. Die eigenartig hellgrauen Augen blickten ernst, wie man es von der Tochter eines bedeutenden Reichsfürsten erwarten konnte. Für Kinderspiele war kein Platz in der Erziehung einer Markgrafentochter.
Am Ende des Raumes saßen der Markgraf Friedrich von Brandenburg-Ansbach und seine Frau Sophia auf zwei schweren, geschnitzten Stühlen, daneben ein älterer Mann in fremdartiger Tracht.
»Da wäre das Kind nun also«, sprach der Markgraf und bedeutete dem Mädchen, näher zu kommen. »Euer Liebden werden bemerken, dass sie ordentlich gewachsen und nicht hässlich ist, wie ich Eurem herzoglichen Vetter nach Schlesien geschrieben habe. Ein wohlerzogenes Kind, höflich und säuberlich. Sie kann lesen und schreiben, mit Nadel und Faden umgehen und ist im christlichen Glauben gut unterwiesen.«
Der Gesandte, ein weitläufiger Verwandter des letzten Herzogs von Groß-Glogau und Crossen, nickte zufrieden und antwortete: »Ein ansehnliches Mädchen fürwahr, Euer Gnaden – und ihre Gesundheit steht ja wohl außer Frage?«
»Wenn sie ihrer Frau Mutter nachschlägt«, und damit wandte sich der Markgraf verschmitzt an seine Ehefrau, die ihm bereits sechs Kinder geboren hatte, von denen allerdings zwei kurz nach der Geburt gestorben waren, »so dürfte der Nachwuchs des Herzogshauses zahlreich werden, so Gott will. Und natürlich sofern der Herzog will.« Der Markgraf lachte, dass sein Bauch bebte.
Die kleine Markgräfin stand stolz vor ihrem Begutachter. Sie war die erste der markgräflichen Töchter, für die man einen Antrag erhalten hatte, und sie wollte sich ihrer Familie wohl würdig erweisen. Also tat sie, wie man ihr eingeschärft hatte: Sie machte einen tiefen Knicks, hielt die Augen auf den Boden gerichtet und sagte gar nichts. Die Markgräfinmutter, eine ehemals ungarische Prinzessin, erhob sich von ihrem Polster, nahm das Kind bei der Hand und führte es zum herzoglich-glogauischen Gesandten.
»Gott zum Gruß zuvor, Euer kleine Liebden, von meinem Herrn und Anverwandten, dem Herzog von Groß-Glogau und Crossen. Solch ein Fräulein von Anmut und Schönheit wie Euch habe ich nicht erwartet«, schmeichelte der Gesandte.
Das Kind sprach mit erstaunlich dunkler Stimme und ernsten Augen.
»Dank für den Gruß, hoher Herr, und willkommen zu Ansbach auch von mir.«
»Ihr hört, sie spricht vernünftig, und ist auch kein Fehl an ihrer jungfräulichen Bildung – dafür bürgt mein Wort«, wandte sich der Markgraf an seinen Besucher. Gleichzeitig wedelte er mit der linken Hand und entließ damit seine Tochter, ohne sie noch eines Blickes zu würdigen. Das Mädchen drehte sich vorsichtig um, warf die Fülle des Kleides mit einer etwas ungeschickten Bewegung und einem Schlenker ihrer Hüfte hinter sich und schritt langsam, um nur ja nicht zu stolpern, wieder durch die Tür hinaus.
Damit war die Hochzeit zwischen Barbara, Markgräfin von Brandenburg-Ansbach, und Heinrich, dem letzten Herzog von Groß-Glogau, beschlossene Sache.
Kaum hatte sich die Saaltür hinter Barbara geschlossen, raffte sie die Röcke, entledigte sich mit zwei schwungvollen Tritten der unbequemen Schuhe und rannte wieselgeschwind ins Frauenzimmer.
»Dicke Martsch, dicke Martsch, ich glaub, er nimmt mich!«, schrie sie ihrer Amme zu und warf sich in deren ausgestreckte Arme. »Ich gehe bald fort und werde Herzogin!«
»Ach du mein Gott, Bärbelchen«, lachte die Martschin, die ins Wanken geraten war, »wo hast du deine Schuhe gelassen? Na, freu dich nur und vergiss deine alte Martsch nicht, wenn du erst einmal bei deinem schlesischen Herzog bist!«
Barbaras Augen weiteten sich.
»Du kommst nicht mit? Aber ich will nicht allein dahin! Dann geh ich nicht!«
»Das können Euer Liebden gar nicht entscheiden.« Die Markgräfin war in die Stube getreten. »Dein Vater und ich sorgen schon für alles. Du wirst herzogliche Gemahlin in Schlesien, das ist besser, als wir es je für dich erwartet haben, Barbara. Eine mehr als standesgemäße Verbindung, die auch noch politisch für das Haus Zollern bedeutsam ist.«
Die Markgräfin sah ihre Tochter zufrieden an.
»Dein Vater, der Markgraf, ist hocherfreut. Du hast dich recht gut gehalten vorhin.«
Zum ersten Mal wurde Barbara klar, dass die Hochzeit ihren Abschied aus Ansbach bedeutete, den Abschied von allem, was ihr lieb und vertraut war. Die Ungewissheit darüber, was ihr in der neuen Hofhaltung in Schlesien begegnen könnte, ließ sie nachdenklich werden. Würde man dort freundlich zu ihr sein? Welche Dienerinnen würde man ihr zuordnen? Und der Herzog, ihr zukünftiger Ehemann, würde er sie gut behandeln? Überhaupt, sie hatte gehört, man sprach in diesem Schlesien ganz anders!
Ihr Leben hatte sich bisher im ansbachischen Frauenzimmer abgespielt, zusammen mit ihren beiden Schwestern, den Hofdamen, dem kleinen Bruder Albrecht und natürlich der dicken Martsch, die das Kind wie eine Mutter liebte. Außer dem Beichtvater, dem Stubenheizer, den Schneidern und einem Kammerknecht hatten Männer hier keinen Zutritt. Es war eine abgeschirmte, heile kleine Welt, in der Barbara aufgewachsen war, und die Tage vergingen mit Handarbeiten, Geschichtenerzählen, Spaziergängen, Gebeten und Unterricht. Aus diesem ausschließlich den Frauen vorbehaltenen, streng geordneten Dasein sollte sie jetzt plötzlich ins Unbekannte hinaus. Dabei war sie bisher ohne die Aufsicht ihrer Kinderfrau nicht einmal bis in den Hofgarten gekommen. Barbara spürte, wie sich ein Kloß in ihrem Hals bildete. Sie schaute ihrer Mutter nach, wie diese wortlos das Zimmer wieder verließ. Die Freude war ihr vergangen.
Herzogtum Groß-Glogau-Crossen, Schlesien, Mai 1527
Es war Frühling, das erste Grün schimmerte an den Bäumen, und es regnete. Die sechs Einrosser, allesamt aus fränkischem Adel, die für den Schutz der Markgräfin abgestellt waren, ritten mit eingezogenen Köpfen triefend und frierend voraus durch den Hohlweg. Hinter ihnen rollte langsam der Wagen mit dem markgräflich-ansbachischen Wappen. Der Kutscher auf dem Bock hatte eine schwere Decke umgeschlagen und lenkte die beiden Kaltblüter mit straffen Zügeln. Danach folgte die berittene Dienerschaft. Den Schluss des Zuges bildete ein einfacher Karren, der mit Truhen, Fässern und allerlei Tand beladen war.
Neun Tage waren sie nun unterwegs. Die Grenzen des Herzogtums Ansbach hatten sie am dritten Tag erreicht und überschritten; jetzt ging es auf Glogau zu.
Im Wagen saß die nunmehr zehnjährige Barbara von Brandenburg-Ansbach, die jetzt, nach fast zweijährigen Verhandlungen um Mitgift und Heiratskonditionen, ihrem Bräutigam zugeführt wurde. Während sie nun 5000 Gulden mit in die Ehe brachte, wurden ihr im Gegenzug dafür Schloss und Stadt Glogau als Leibgeding und ihren Nachkommen die Nachfolge des Herzogs in der Regentschaft des Landes garantiert.
Das Kind schlug den Lederlappen zurück, der vor dem Fensterloch hing, und steckte die Nase in den Regen hinaus. »Ich glaube, der Wald hört gar nicht mehr auf«, seufzte es und ließ das Leder wieder fallen.
»Ob es in Glogau wohl auch Wiesen gibt und Felder wie daheim?«
»Bestimmt, Euer Liebden«, erwiderte eine der beiden Frauen, die der kleinen Markgräfin in der Kutsche gegenübersaßen. »Am besten, Ihr schlaft ein bisschen, dann vergeht die Zeit schneller.«
Gehorsam lehnte sich Barbara in eine Ecke und schloss die Augen, aber trotz der Dunkelheit im Wagen war es gar nicht so einfach einzuschlafen, denn die Kutsche holperte und rüttelte, dass es ihren Rücken heftig gegen die hölzerne Hinterwand schlug. Und ihr gingen so viele Gedanken durch den Kopf. Die anfängliche Schwermut und der Trennungsschmerz von allem, was ihr in Ansbach lieb gewesen war, hatten inzwischen nachgelassen, aber geblieben waren Angst und Unsicherheit. Was war der Herzog wohl für ein Mann? Wie sah er aus? Würde er gut zu ihr sein? Ein ganz fremder Hofstaat wartete auf sie, neue Aufgaben, die sie nicht kannte. Ob man sie wohl froh als neue Herrin begrüßen würde? Sie jedenfalls wollte sich Mühe geben, alles richtig zu machen. Wenn nur die Martsch mit dabei wäre – die könnte helfen und raten. Aber sie war ganz allein, und sie fühlte sich immer einsamer, je näher Glogau rückte. Über all diesen Überlegungen schlief sie endlich ein, ein verlorenes Vögelchen, das man aus dem Nest geworfen hatte.
Die beiden Frauen, die Barbara gegenüber auf der Bank saßen, unterhielten sich leise. Sie waren beide Hofdamen der markgräflichen Mutter und sollten das Kind bis Glogau begleiten.
»Also, mir tut die Kleine Leid«, flüsterte die Jüngere, ein Fräulein von Flachslanden, und zog ihren Umhang fester.
»Sie hätten ihr wenigstens die Martsch mitgeben sollen. Das arme Ding hat ja die ersten zwei Tage nur gegreint.«
Die ältere Hofdame, Anna von Beulwitz, nickte nachdenklich.
»Sie wird wohl auch nicht glücklicher sein, wenn sie den Herzog sieht – es heißt, er sei schon alt und ohne Haare und Zähne.«
Die Beulwitzin kratzte sich am Kopf, suchte mit den Fingern und zerdrückte einen Floh.
»Auf der Reise gibt’s immer weniger Geziefer als daheim. Ich weiß schon, warum ich so gern auf Fahrt gehe.«
Die Ärmste zog das Ungeziefer an wie der Honig die Fliegen. Unter allen Hofdamen hatte sie die meisten Bisse zu verzeichnen. Wer bei ihr im Zimmer oder im gleichen Bett schlief, blieb meistens verschont von Flöhen, Läusen und Wanzen, weshalb sie eine beliebte Schlafgenossin war und oft das Privileg genoss, im Markgräfinnenbett zu nächtigen.
»Gestern im Kloster, wo wir übernachtet haben, gab’s fast gar keines von diesen Höllenviechern. Ich möchte wissen, wie die das machen.«
Doch bevor die Beulwitzin noch tiefere Betrachtungen über das allgegenwärtige Ungeziefer anstellen konnte, blieb die Kutsche stehen. Draußen ertönten Stimmen.
Es war ein Trupp herzoglich-glogauischer Reiter, die der zukünftigen Landesherrin entgegengeschickt worden waren. Die Ritter vom Adel grüßten sich. Ihr Anführer, bei dem es sich um den gleichen Gesandten handelte, der schon Barbaras Verheiratung eingefädelt hatte, öffnete den Schlag der Damenkutsche.
»Gottes Gruß und den meines Herrn, Euer Liebden.«
Während er sprach, tropfte ihm das Regenwasser von Kinn und Nase.
»Wir sind glücklich, dass Ihr gesund im Land angekommen seid. Bis Glogau sind es nur noch vier Stunden, und wenn wir gut vorwärts kommen, sind wir vor der Nacht da.«
»Lieber Vetter, ich danke Euch für die Begleitung. Ich bin froh, bald in Glogau zu sein. Nach so vielen Tagen Fahrt tut mir der Hintern schon recht weh«, antwortete Barbara artig.
Der Gesandte grinste und gab den Befehl zum Weiterreiten. Langsam setzte sich der Zug wieder in Bewegung und folgte den tiefen Rinnen des Fahrwegs auf Glogau zu.
Sie erreichten die fürstliche Residenz erst in tiefer Nacht. Immer noch goss es in Strömen. Ein Achsbruch des Karrens, der die Mitgift der Markgräfin transportierte, hatte den Zug aufgehalten, und dann war auch noch die Kutsche in einem Schlammloch stecken geblieben. Jetzt war vom Glogauer Schloss fast nichts mehr zu erkennen. Die Flügel des großen Tores öffneten sich, und die Wagen mit ihrer Begleitmannschaft rollten über das Pflaster in den dunklen Hof. Diener rannten mit Fackeln heran, alles schrie durcheinander.
Die kleine Markgräfin öffnete die Kutschentür, und noch bevor sie einen Fuß auf den Boden setzen konnte, wurde sie von einem der schlesischen Ritter auf die Arme genommen und durch den Regen über den Hof getragen. Die beiden Hofdamen folgten eilig mit gerafften Röcken über das glitschige Pflaster. Barbara war die Nähe des Mannes unangenehm. Noch nie hatte sie einer so angefasst. Er roch schlecht und hielt sie so fest, dass sie sich gar nicht wehren konnte, selbst wenn sie sich getraut hätte. »Vielleicht werden zu Glogau die Damen immer getragen«, überlegte sie, während ihr die Regentropfen das Haar durchnässten und in den Kragen liefen.
Auch drinnen war es feucht und klamm und roch muffig nach Urin. Im Saal, wohin man Barbara und ihre Damen geführt hatte, brannten nur zwei Kohlebecken und wenige Wandfackeln. Das Holzfeuer im riesigen Kamin an der Stirnseite des Raumes war schon längst gelöscht, Tische und Bänke in Reih und Glied aufgeräumt. Die Motive der Wandteppiche waren im Fackelschein nicht zu erkennen, nur die dazwischen angebrachten Waffen – Schwerter und Spieße – blitzten manchmal auf, wenn sich ein züngelndes Flämmchen spiegelte. Die Fenster waren mit schweren Vorhängen verhängt. Die Frauen warteten, und unter ihren Röcken bildeten sich kleine Pfützen vom Regenwasser.
Aus einer Seitentür trat endlich ein aufgeregtes kleines Männlein, wie sich herausstellen sollte, der Schlossvogt. Er machte mit fast komischer Ernsthaftigkeit eine tiefe Reverenz vor den tropfnassen Damen und entschuldigte sich für den missglückten Empfang. Man habe gerechnet, dass der markgräfliche Zug wegen des schlechten Wetters noch die Nacht im drei Stunden entfernten Nonnenkloster zubringen würde. Deshalb habe sich der Herzog schon zur Nacht begeben und mit ihm die ganze Haushaltung.
»Ich werde Euer Liebden sogleich ins Frauenzimmer geleiten lassen«, sprach der Vogt beflissen, »dort könnt Ihr Euch trocknen. Ich schicke auch nach dem Herrenkoch, damit er Euch noch eine Nachtmahlzeit richtet.«
Zum Frauenzimmer gehörten ein größerer und drei kleinere Räume mit großzügigen Fensternischen zum Hof. Die Öffnungen waren mit teuren grünlichen Butzenscheiben verschlossen und nicht nur mit gegerbten Häuten wie in den gewöhnlichen Gemächern. An den Wänden hingen kostbare niederländische Wandteppiche in bunten Farben, die nach der neuesten Mode gewebt waren. Und auf dem Fußboden des größten Raumes lagen ebenfalls Webteppiche statt der üblichen Strohschüttung – das Äußerste an Luxus und Gemütlichkeit. Der einzige Kamin des Frauenzimmers war gerade geschürt worden und das Feuer begann aufzublaken. Barbara war trotz ihrer Erschöpfung freudig beeindruckt. Der finstere Saal war ihr unheimlich vorgekommen, aber hier empfand sie sofort eine wohlige Geborgenheit. Neugierig begann sie, sich in ihrem zukünftigen Domizil umzusehen.
»So schön! Und schaut nur, Frau Anna, ein eigenes heimliches Gemach! In Ansbach haben wir immer den Nachtscherben benutzen müssen.«
Das Frauenzimmer hatte tatsächlich einen eigenen Abort – einen kleinen Holzverschlag, der auf zwei vorkrängenden Außenbalken ruhte und mit einem hölzernen Lochsitz versehen war. Solch ein heimliches Gemach gab es sonst nur noch im herzoglichen Wohnbereich und in der Vogtswohnung. Für alle anderen Schlossbewohner waren irgendwelche Ecken und Nischen gut genug, um ihre Notdurft zu verrichten. Der Abort im Frauenzimmer bedeutete einen enormen Gewinn an Bequemlichkeit, sorgte er doch für frischere Luft und weniger Fliegen und Ungeziefer.
Barbara begutachtete fröhlich die Betten, die in den drei kleineren Zimmern standen. Sie puffte gegen die Matratzen, die frisch mit Stroh und Häcksel gefüllt waren und nach Scheune dufteten. In jeder Bettstatt lagen zwei Laken aus gestreiftem Londoner Tuch, mehrere weiche Federkissen und zwei Deckbetten, außerdem ein Pfulm, der den Rücken stützte, um das Schlafen in halb sitzender Stellung bequemer zu machen. Zwei der markgräflichen Aussteuertruhen standen bereits in einem der Zimmer, daneben ein Scherenstuhl und ein Tischchen mit einem Kerzenleuchter.
Es klopfte. Ein Küchendiener trug ein Tablett mit Brot, Käse und kaltem Fleisch, dazu ein Töpfchen mit Zwetschgenlatwerge und einige kandierte Früchte ins Zimmer. Kurz darauf brachte man aus dem Keller einen Krug heißen Weins, der mit Honig, Alant, Muskat und Zimt aromatisiert war. Schnell zogen das Kind und die beiden Frauen ihre klammen Reisekleider aus und wickelten sich in bereitgelegte Tücher und Decken. Dann ließen sie sich vor dem Kamin nieder und langten hungrig zu.
»Seht nur, hier gibt’s auch Latwerge!«
Die kleine Markgräfin liebte zu Mus zerdrücktes und mit Honig dick eingekochtes Obst. Sie langte mit dem Finger ins Töpfchen und schleckte ihn genüsslich ab.
»Das Brot ist dunkler als bei uns«, bemerkte die von Flachslanden, »und es schmeckt süßer, mein ich. Na, Euer Liebden werden sich schon gewöhnen. Schmeckt Euch der Käse? Wenn Ihr zu viel vom Zwetschgenmus esst, bekommt Ihr wieder Bauchweh, Liebden, das wisst Ihr doch. Wir wollen doch nicht gleich in der ersten Nacht den Durchfall bekommen. Und nehmt nicht zu viel vom Würzwein, das macht schlechte Träume.«
Barbara holte sich ungerührt von dem Geplapper mit den Fingern einen Brocken Fleisch vom Tablett, brach dann ein Stück Brot ab und tunkte es in die Latwerge.
Bis die drei gesättigt waren, ging es auf Mitternacht zu. Da klopfte es erneut an die Frauenzimmerpforte. Die Beulwitzin öffnete. Draußen stand ein Junge mit einem Bündel.
»Das hier ist für die neue gnädige Frau«, sagte er, bückte sich und setzte das kleine Knäuel auf dem Teppich ab. Sofort schoss ein wolliges, felliges Etwas hervor und wuselte japsend und fiepend um die verdutzte Beulwitzin herum.
»Ein Hündchen! Es ist ein Hündchen für mich!«, rief Barbara glücklich. »Schaut bloß, es hat auf den Teppich gepieselt!«
Das Kind grapschte den aufgeregten Welpen und drückte das Tier an die Brust.
»Noch mehr Flöhe!«, meinte die Beulwitzin griesgrämig und kratzte sich schon im Geiste.
Das Kind lachte begeistert. »Ich werd ihn Bless nennen, wegen des weißen Flecks über der Nase. Und er muss in meinem Bett schlafen. Morgen können wir ihm ein Halsband knüpfen und ein Glöckchen dran machen.«
Es dauerte eine Weile, bis die Hofdamen Barbara so weit brachten, sich schlafen zu legen. Nachdem sich die Beulwitzin geweigert hatte, zusammen mit dem Hund in einem Bett zu schlafen, legte sich das Fräulein von Flachslanden zu Barbara ins Fürstenbett. Das Kind hielt selig das pummelige braune Hündchen im Arm, und noch bevor die von Beulwitz im Nebenzimmer zu schnarchen anfing, war die zukünftige Herzogin von Groß-Glogau und Crossen fest eingeschlafen.
Universität Erlangen, Dezember 2001
Professor Walter Habermann vom Erlanger Lehrstuhl für Gerichtsmedizin saß im Konservierungsraum 2 des Instituts in der Glückstraße. Eigentlich wollte er an diesem Tag die Klausur für sein Hauptseminar über Wirkung und Nachweisbarkeit von Nervengiften vorbereiten, aber als sich der Kastellan der Plassenburg bei ihm angemeldet hatte, war er nur allzu gern zu einem Gespräch bereit gewesen – schließlich hatte er mit Haubolds Vater gemeinsam die Schulbank gedrückt und Gregor noch als Kind gekannt.
»Also, mein Lieber, dann zeig mal, was du für mich hast.«
Er holte umständlich seine Brille aus dem Etui. Haubold griff zu der Schachtel, die er vorsichtig auf den Präparationstisch gestellt hatte, und hob den Deckel ab. Darunter kamen in lauter kleine Tütchen verpackte Knöchelchen zum Vorschein, desgleichen ein Schädel mit aufgepinselter Nummer. Außerdem förderte der Kastellan noch einen Packen Fotos und eine Jurismappe mit Unterlagen zutage. Die meisten Fotos zeigten ein vollständiges Kinderskelett, von verschiedenen Seiten her aufgenommen und unterschiedlich vergrößert, außerdem zwei kleine Metallscharniere, vier schmale Beschläge und die Teile eines Schlosses.
»Das hier stammt alles aus einem Mauerloch im Untergeschoss der Kulmbacher Plassenburg«, begann Haubold und legte dabei die Fotos säuberlich auf der Tischplatte aus. »Es handelt sich ganz offensichtlich um ein menschliches Skelett, das in einer kleinen, stoffgefütterten Holztruhe lag und dort eingemauert wurde.«
»So, so«, meinte Habermann interessiert und sah sich die Aufnahmen an.
»Ich war schon im Labor der Ur- und Frühgeschichte bei Ihrem Kollegen Schreiber«, fuhr der Kastellan fort. »Ihm zufolge lässt sich das Alter des Skeletts auf zirka vier- bis fünfhundert Jahre schätzen. Was uns, das heißt die Bayerische Schlösserverwaltung und mich, jetzt von Ihnen interessiert, ist die etwaige Todesursache und vielleicht noch das Alter des Kindes und was Ihnen vielleicht sonst noch auffällt.«
»Muss ja richtig spannend für dich sein, wie? Ein Kinder- oder, sagen wir mal, der Größe nach ein Kleinkinderskelett, eingeschlossen in einer Truhe und auch noch im Keller einer Burg eingemauert, das klingt ja fast wie ein echtes Gruselmärchen. Gott sei Dank dürfte der Fall inzwischen verjährt sein!«
Habermann schmunzelte und holte die Tütchen mit den nummerierten Skelettteilen aus der Schachtel. Sorgfältig legte er die Knöchelchen auf dem Tisch aus und ordnete sie. »Fällt dir an dem Schädel was auf?«
Haubold zuckte mit den Schultern. »Wieso?«
»Weil keine Zähne da sind. Noch nicht einmal ein Milchzahnansatz. Das hier ist der Schädel eines Säuglings. Das Kind war vermutlich keine drei Monate alt, winzig wie das Knochengerüst ist. Und die Fontanelle, siehst du? Sie schließt sich normalerweise innerhalb des ersten Lebensjahres. Und hier ist sie noch ziemlich weit offen. Ich glaube, das war ein neugeborenes Kind, höchstens ein paar Wochen alt.«
»Sehen Sie irgendetwas, das auf einen gewaltsamen Tod schließen lässt?«, fragte Haubold.
»Tja, auf den ersten Blick nicht«, erwiderte der Professor und breitete sämtliche Knöchelchen vor sich auf dem Schreibtisch aus. »Der Schädel ist intakt, und soweit ich sehe, ist das Skelett vollständig. Keine Brüche oder sonstige erkennbare Spuren am Knochenmaterial. Aber das Baby könnte ja auch lebendig eingemauert worden sein, das arme Wurm. Dann erkennt man am Skelett natürlich gar nichts. Wir müssen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Gift? Erstickt? Wenn du mehr wissen willst, müsste ich die Gebeine unter einem Spezialmikroskop betrachten und ein oder zwei Knöchelchen in Scheibchen sägen und auf Giftstoffe analysieren lassen, das dauert aber ein bisschen. Und ob da nach so langer Zeit noch was herauskommt … «
»Ach, könnten Sie mir nicht den Gefallen tun, Herr Habermann? Eine Untersuchung wäre ganz wunderbar. Schließlich ist es ja sozusagen ›meine‹ Burg, und ich habe die Knochen selber gefunden. Und würden Sie mir Bescheid geben, sobald Sie etwas wissen? Im Übrigen soll ich Ihnen natürlich schöne Grüße von meinem Vater bestellen.« Haubold zog sämtliche Register der Überredungskunst.
»Ja, der Papa – wie geht’s ihm denn, dem alten Knaben? Immer noch gesund und munter? Er soll mal an die alten Zeiten denken und sich bei mir blicken lassen, wenn er im Lande ist!« Habermann nickte freundlich. »Na gut, mein Lieber, ich werde mich mal mit dem Skelett beschäftigen. Ich rufe dich auf deiner Burg an, sobald Ergebnisse da sind.«
»Prima. Herzlichen Dank.«
Haubold verabschiedete sich ein bisschen enttäuscht. Da würde wohl nicht viel herauskommen. Na, wenigstens hatte er einen netten kleinen Ausflug in seine alte Studentenstadt machen können. Ob es noch das alte »Café Leiche« gab, in das die Medizinstudenten immer nach der praktischen Anatomie gingen und sich über ihre neuesten Leichensektionen unterhielten? Langsam schlenderte er an der Philosophischen Fakultät vorbei Richtung Kollegienhaus.
Eine Woche später saß der Kastellan in seinem Büro, als das Telefon läutete. Es war Habermann aus Erlangen.
»Hallo, Gregor, hier Habermann, das dauert ja, bis man zu dir durchkommt. Ich war schon mit dem Kulmbacher Fremdenverkehrsamt, dem Landschaftsmuseum Obermain und der Kasse des Zinnfigurenmuseums verbunden. Ich habe die Ergebnisse der Knochenuntersuchungen für dich, aber ich glaube nicht, dass es dir viel weiterhelfen wird!«
»Tut mir Leid, äh, ich meine, schön, dass Sie anrufen, Herr Professor. Ich bin ganz gespannt, schießen Sie los.«
Haubold schnappte sich einen Stift und wühlte in dem Durcheinander auf seinem Schreibtisch nach einem leeren Notizblatt. Habermann fing an.
»Um es kurz zu machen: Sämtliche Analyseergebnisse waren negativ. Das heißt, wir haben keine Rückstände von irgendwelchen Giften in der Knochenmasse gefunden, soweit sie überhaupt noch nachweisbar gewesen wären, wobei wir besonders auf damals bekannte natürlich vorkommende Gifte wie zum Beispiel Tollkirsche, Schierling, Bilsenkraut, Pilzgifte und so weiter geachtet haben. Meine Assistentin, eine sehr gewissenhafte und verlässliche junge Dame, hat jedes einzelne Knöchelchen unterm Mikroskop angesehen – nichts. Keine Spur irgendeiner Gewaltanwendung – Einkerbungen durch einen Messerstich, Knochenbrüche oder Ähnliches. Absolut nichts, tut mir Leid. Aber schließlich braucht man, um einen Säugling umzubringen, auch keine drastischen Mittel einzusetzen – ein Baby ist beispielsweise leicht schon mit einem Kissen zu ersticken. So etwas hinterlässt natürlich keine Spuren, die heute noch feststellbar wären.«
Haubold ließ den Stift aus den Fingern gleiten und legte die Stirn in Falten.
»Ja, dann kann ich Ihnen nur für Ihre Mühe danken. Tut mir Leid, dass ich Ihre Zeit in Anspruch genommen habe.« Enttäuschung klang in seiner Stimme mit. »Ich lasse dann die Knochen von einem Mitarbeiter abholen und wieder auf die Plassenburg bringen. Wenn es Ihnen nächste Woche recht ist?«
»Kein Problem, soll nur vorher anrufen. Nur eines wäre da noch. Meiner Assistentin ist noch etwas aufgefallen, womit sie nichts anfangen konnte. Vielleicht sagt dir das ja was. Fräulein Jungkunz hat ungefähr in der Mitte der Schädelbasis ein winziges, wie soll ich sagen – Löchlein entdeckt. Es ist ihr aufgefallen, als sie durch die Öffnung der Fontanelle ins Schädelinnere geschaut hat. Wie gesagt, nur ein klitzekleiner Punkt mit nicht einmal einem Millimeter Durchmesser. Was das bedeuten soll, weiß ich allerdings auch nicht.«
Der Kastellan überlegte. »Seltsam. Und so ein, äh, Löchlein, wie Sie sagen, ist an dieser Stelle des menschlichen Schädels nicht normal?«
»Absolut nicht. Aber ob das im Zusammenhang mit dem Tod des Babys steht – ich kann es dir wirklich nicht sagen.«
»Na dann, trotzdem vielen Dank, und einen schönen Tag noch.«
»Wiederhören. Und nochmals Grüße an deinen Vater«, sagte Habermann und legte auf.
Haubold blies die Backen auf und seufzte. Das war’s dann wohl, dachte er.
Glogau, Mai 1527
Heinrich, Herzog von Groß-Glogau und Crossen, stand am offenen Spitzbogenfenster des Rittersaals und schaute sich das Treiben im Schlosshof an. Ein bäuerlicher Ochsenkarren hatte gerade den Frondienst an Käse und Eiern gebracht, und der Küchenschreiber stand mit seinem Kerbholz beim Abladen dabei, um die genauen Mengen zu verzeichnen. Zwei wütende Kater fauchten einander mit gesträubten Nackenhaaren an und teilten Hiebe aus, bis eine Magd sie auseinander trieb. In der Ecke des Schlosshofes wurde unter verzweifeltem Quieken ein fettes Schwein dem Schlachter zugeführt, der schon mit gewetztem Messer bei seinen dampfenden Bottichen wartete. Die Hühner stoben wild gackernd umher. Und zwischendrin reparierten zwei Zimmerleute die Holzrinne, die vom Dach der Kemenate zur Zisterne führte.
Heinrich von Groß-Glogau war nicht mehr jung, und seine ersten beiden Ehen waren kinderlos geblieben. Die dritte Verbindung mit dem Markgraftum Ansbach war eher auf politische Überlegungen zurückzuführen als auf den Wunsch nach einer weiteren Ehefrau, die überdies noch ein Kind war. Das, was ihn wirklich interessierte, waren weder Politik noch Frauen. Seine große Leidenschaft galt der Alchemie. So oft es seine Zeit erlaubte, verschwand der Herzog in seinem Laboratorium im Ostflügel des Schlosses, um sich dort mit den Geheimnissen der Scheidekunst zu beschäftigen, allerdings bis jetzt noch ohne das ersehnte Ergebnis, nämlich die Komponenten zu entdecken, aus denen Gold zusammengesetzt werden konnte.
Das Kind marschierte zielstrebig auf den Mann zu, der immer noch aus dem Fenster blickte. Es blieb stehen und wartete eine Weile, aber der Mann bemerkte es nicht. Barbara wusste nicht recht, womit sie anfangen sollte, und trat verlegen von einem Fuß auf den anderen. Schließlich war sie das Warten leid, machte noch zwei Schritte, zupfte den Herzog am Ärmel und sagte: »Gibt’s was zu sehen, Euer Liebden?«
Sie erschrak sofort über ihre eigene Kühnheit und entschuldigte sich.
»Vergebt mir, wenn ich störe, aber ich wollte mich nur für das Hündchen bedanken. Ihr seid zu freundlich zu mir.«
Der Mann drehte sich um, und er und das Kind sahen sich an. Barbara hatte sich keinen Traumprinzen zum Mann erwartet – sie war dazu erzogen worden zu nehmen, wen man ihr zugesprochen hatte, aber die Enttäuschung war ihr an den Augen abzulesen. Der Herzog kam ihr älter vor als erwartet, und er war selbst nach damaligen Begriffen ein abstoßender Mann. Sein Gesicht war seit seiner Jugendzeit von einer Flechte entstellt, die ihm auch bis auf einige zerfledderte Reste den Haarwuchs genommen hatte, weshalb er sogar im Haus die Kalotte trug, eine runde Kappe, die er tief in die Stirn zog. Bei einem Sturz vom Pferd vor vielen Jahren hatte er sich drei Vorderzähne ausgeschlagen, vom vierten war nur eine Ecke geblieben, die schwärzlich über die Unterlippe ragte. Seitdem hatte er auch eine verkrüppelte Hand und einen lahmen Arm, der kraftlos an der Seite herabhing.
Barbara versuchte sich wieder zu fassen und dem Blick des Herzogs standzuhalten. Dieser schaute das Kind mit hochgezogenen Brauen an und begann schließlich zu kichern.
»Ich sehe, man hat Euch nicht recht auf mich vorbereitet, Euer Liebden. Aber keine Angst – ich bin zwar nicht so jung und hübsch wie Ihr, aber ich tue Euch nichts und bin im Allgemeinen recht friedlich. Ihr werdet das Leben als Herzogin von Glogau schon erträglich finden.«
Barbara brachte noch immer kein Wort heraus. Der Herzog führte sie schließlich zu zwei Scherenhockern vor dem großen Kamin, in dem ein munteres Feuer flackerte und angenehme Wärme ausstrahlte.
»Setzt Euch, meine zukünftige Herrin, und plaudert mir ein bisschen von der Reise und von meinen lieben Vettern in Ansbach.«
Das Kind begann zu erzählen, erst ein wenig ängstlich und zurückhaltend, aber schließlich lebhaft und ohne Scheu. Von den fröhlichen Spielen im Ansbacher Frauenzimmer, von ihren beiden älteren Schwestern, die eine üppig und dick, die andere dünn und pickelgesichtig, und von ihrem kleinen Brüderchen Albrecht, das den lieben langen Tag herumgetragen wurde, weil es ständig Blähungen hatte und brüllte. Und als später der Kaplan und Sekretär des Herzogs eintrat, um ihn zu landesherrlichen Geschäften zu rufen, traf er die beiden in angeregtem Gespräch an.
Brief der Herzogin Barbara von Groß-Glogau und Crossen an die Markgräfin von Brandenburg-Ansbach, 23.Juni 1527
Gottes Gruß und Gesundheit zuvor, herzliebe Frau Mutter. Nun sind die Festlichkeiten vorüber und der Umritt im ganzen Land ist gemacht, und ich finde Muße, Euch zu schreiben und mitzuteilen, wie es mir seit meiner Reise von Ansbach herauf ergangen. Ihr wisst, dass es mit dem Schreiben bei mir noch recht langsam geht und meine Buchstaben oft ungelenk sind, aber ich werde den Brief am Schluss von meins gnedigen Herrn Kaplan prüfen lassen, damit nicht zu viele Unpassheiten darin sind.
Meine Ankunft war bei gottserbärmlichem Wetter und Dunkelheit, weshalb schon das ganze Schloss in tiefem Schlaf. Man zeigte uns sofort die Frauengemächer, welche mir gar recht gefielen. Alles ist kostbarer und teurer als daheim, und zu meinem Entzücken schenkte mir der Herzog gleich am ersten Abend ein niedliches Hündlein, das ich Bless nenne und mir nicht von der Seite weicht.
Als ich den Herzog erstmals sah, bin ich gar sehr erschrocken, denn er ist hässlichen Angesichts, alt wie mein Vater und schlenkert den Arm. Auch sieht er mit dem einen spitzigen Zahn aus wie ein Rätterich, aber er ist von sanfter und freundlicher Art. Er spricht mir von den sonderbarsten Dingen, die ich vorher nie gehört, aber ich lerne jeden Tag neu, so von Gold- und Edelsteinmacherei, von Tieren mit langen Nasen bis auf die Erde herab, die in fernen Ländern leben, wo es so heiß ist, dass alle Menschen schwarz angebrannt sind, und von leuchtenden Sternen, die weit weg über der Erde am Firmament hängen.
Dafür erzähle ich ihm aus meinem Wissen über das Leben unseres Herrn Jesus, über die Aventüren der Ritter und Damen an König Artus' Hof und die neuen Streiche meines Hündleins. Dann lacht er oft herzhaft und nennt mich im Scherz sein Liebfräulein. Er kann teutsch und lateinisch lesen wie ein Pfaff, stellt Euch vor, aber schreiben tut er nichts als seinen Namen. Derohalben bot ich ihm an, ihn die Buchstabenschrift zu lehren, was ihn recht zum Lachen brachte, und er meinte, dann könnt er wohl den Kaplan hinauswerfen, der tauge nemlich zu nichts als bloß zum Schreiben. Ihr merkt wohl, liebste Frau Mutter, dass ich mich mit meinem Ehegemahl gar schön vertrage.
Zum Frauenzimmer gehören zwanzig adelige Damen, davon drei mir direkt beigegeben sind. Das eine ist ein Fräulein von Schwarzburg, nicht viel älter als ich, groß und dünn wie eine Bohnenstange und recht schweigsam. Die zweite ist eine Frau von Stein-Schlupka, sie näht und stickt mit mir und erzählt dabei viel Geschichten. Die dritte heißt Maria von Schweinicka, ist die Älteste und soll mich in gutem Benehmen und Anstand unterweisen. Zu den Frauenzimmer-Knechten gehören zwei Türhüter, ein Stubenheizer, ein Weinträger, ein Essenträger, zwei Jungfernknechte, eine Köchin, zwei Wäscherinnen und zwei Schneider mit ihren Knaben. An Aufwartern fehlt es mir also nicht.
Einmal am Tag besucht mich der Kaplan, Herr Degenhart, und spricht mit mir über Glaubensdinge und was ich sonst noch als Landesherrin wissen soll. Wir disputieren über allerlei Fragen, so ob die lutherische Religion besser sei als der alte Glaube oder ob die Frauen dem Manne stets untertan sein sollen, wie die Bibel befiehlt. Ich finde, man braucht seinem Gemahl nicht zu folgen, wenn er unrechte Dinge sagt oder tut, aber der Kaplan meint, so etwas dürfe ich gar nie auch nur denken. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich glaube, dass die Frauen doch eine Seele haben, denn sie sind genauso Kinder Gottes und wenn sie sündigen können, so können sie doch wohl auch heiligmäßig sein. Das hat er für gar sehr erschröcklich befunden, aber er war mir nicht lang bös.
Die Hochzeit, auf die ich mich guterdings gefreut hatte, war anstrengend genug. Ich trug ein Kleid, das war schön wie ich es vorher nie gesehen: So viele Püffchen am Ärmel, Gold- und Perlenstickerei, Bänder, Spitzen und schweres Amsterdammer Tuch. Man konnte glauben, es sei ganz aus Gold gemacht. Es war aber so schwer, dass ich kaum gehen konnte und das lange Stehen in der Kirche machte mich sehr müde. Mein Schmuck, der aus der Truhe mit den Kleinodien der Glogauer Herzöge stammte, glitzerte am Hals und an der Brust: eine Kette mit goldenem gehämmertem Kreuz mit Saphirlein und Perlen, und ein dreieckiges Kleinod am Kleid mit einer Rubinrose um einen Smaragd und einem Hängeperlein, dazu ein Ring mit einem großen Türkisen und ein Goldarmband mit zweien Papageien. Auf dem Kopf trug ich eine wintzige karmesinrote Kappe aus Atlas mit Perlenborte, daran drei Herzen und gestickte Falken, und mein schwartzes Haar hing offen bis zu den Hüften. So schön habt Ihr Euer Tochter nie gesehen. Nach dem langen Gottesdienst mit der Verheiratung war ich so müde, dass man mich ins Frauenzimmer brachte, um mich auszuruhen.
Zum Festbankett durfte ich mich, Gott sei gedankt, umziehen und etwas meinem Körper Bequemlicheres tragen. Der Schmuck wurde gewechselt und ich bekam jetzt ein Kehlband aus zwölf Gliedern mit einer Diamanttafel und einem anhangenden Kruzifix, einen goldenen Gürtel und ein Ringlein mit einem »M« für Maria. Und erstmals durfte ich, weil ja verheiratet, mein Haar hochstecken und unter einer Frauenkalotte verstecken, die war goldgewirkt und am Rand mit weißen Perlein behängt. Ich fand mich sehr schön.
An der Festtafel saßen alle vom glogauischen Adel fein aufgereiht, der Herzog und ich in der Mitte. Man hatte das beste Tafelgeschirr aus der Silberkammer geholt, Schüsseln aus getriebenem Silber, Tabletts mit gravierten Bildern, fein ziselierte Salzfässlein und Senftöpfchen. Einige vom Adel aßen sogar mit Gabeln, wobei sich der von Trupka versehentlich in die Lippe stieß und dabei gar sehr beschmutzte. Ich teilte meinen Teller mit dem Herzog, der mir die besten Stücke vorlegte und mir den Blamenser gar zierlich mit dem Löffel fütterte. Dabei lachten wir alle über die Späße des Narren und sahen den Akrobaten zu, die rechte Verrenkungen machen konnten. So konnte ein Mädchen auf dem Bauch liegend mit den Füßen über ihren Kopf langen und diese neben die Ohren setzen, andere sprangen von den Händen auf die Füße und machten Bögen wie eine Brücke. Mein Hündchen Bless durfte neben mir an der Tafel sitzen und der Herzog und ich fütterten es mit Wiltpret, dass es schmatzte. Schließlich kam der vierte Gang, der allerlei Naschwerk aus Zuckerguss umfasste, geformt in der Gestalt des heiligen Sankt Georg. Dazu spielten die Musikanten manch liebliche Melodien. Die vom Adel fingen mit Zutrinken an, auch mein Herr Gemahl. Als mir der Herzog schließlich selber zuprostete, musste ich mittrinken. Ich nahm von ihm den schweren Pokal, der so groß war wie mein Kopf und mit Wein gefüllt. Aber weil das Gefäß so schwer war und ich es mit den Händen nicht umgreifen konnte, geriet es ins Wanken und rutschte mir aus der Hand. Ich schrie auf, und der ganze Wein ergoss sich über mich und den Herzog. Wir saßen da wie die nassen Pudel, und die ganze Gesellschaft wurde still und wartete auf das Donnerwetter des Herzogs, der, wie alle wussten, nur ungern badete. Doch mein Gemahl schaute mich an, wie mir der Schreck und die Scham in den Gliedern saß und der Wein aus dem Kleid tropfte, und fing an zu prusten, bis auch der letzte Tischgast ebenfalls lachte.
Damit endete für mich das Festmahl, ich verließ die Tafel und ging ins Frauenzimmer, wo ich das nasse Zeug auszog und von meinen drei Hofdamen in ein leichtes, fließendes Gewand gekleidet wurde. Sie nahmen mir die Haube und den Schmuck ab, kämmten mein Haar und legten mir einen zartgewebten Nachtmantel um. Obwohl ich plötzlich schrecklich müde wurde, führten mich nun meine zwanzig Frauen vom Adel unter viel fröhlichem Geschnatter zu den herzoglichen Gemächern im anderen Flügel des Schlosses. Dort warteten schon die wichtigsten Adeligen des Herzogtums, um Zeugen des Beilagers zu sein. Allerdings weil ich noch zu jung bin und noch nicht blute wie eine erwachsene Frau, so sagte mir die Schweinicka, brauchte ich nichts zu befürchten und müsste nur ruhig die Zeremonie über mich hergehen lassen. Ich wusste nicht recht, was sie damit sagen wollte, hielt aber zu allem fein still.
Die edelsten glogauischen Damen führten mich in das Schlafgemach meines Gemahls, kleideten mich aus und brachten mich zu Bett. Kurz darauf trat der Herzog ein, splitterfasernackt, nur, und da musste ich fast lachen, ein Nachtmützchen auf dem Kopf. Er legte sich ein wenig ächzend und vom Wein schwankend neben mich in die Bettstatt. Ich war gar sehr überrascht, konnte ich doch sehen, dass der Herzog ein Anhängsel hatte, das genauso aussah wie das Schniedelin von meinem herzlieben Brüderchen Albrecht, nur größer und umgeben von dunklen Löckchen. Das sagte ich ihm auch, und er lachte gar herzlich. Dann hob er die Bettdecke von mir und schaute mich genau an, wobei ich ganz steif lag und mich recht schämte. Noch nie hat mich ein Mann ohne Kleider gesehen, aber bei einem Ehemann darf das wohl sein, denke ich mir.
»Viel habt Ihr noch nicht von einem Weibsbild«, sprach mein Gemahl, »aber das wird ja wohl noch kommen, so Gott will. Bis dahin muss ich wohl mit weniger zufrieden sein.«
Er fragte, ob ich nicht vielleicht ein bisschen mit seinem Schniedelin spielen wollte. Zunächst getraute ich mich nicht es anzufassen und piekte nur verlegen mit dem Zeigefinger hin. Aber als ich merkte, dass es ganz weich und gar nicht unangenehm war, griff ich ganz hin. Da geschah etwas recht Seltsames. Liebste Frau Mutter, wie staunte ich, als das kleine Würmchen in meiner Hand fest und dick und groß wurde. Schnell ließ ich wieder los, doch der Herzog erklärte mir, dass dies schon recht seine Ordnung habe und bei Mann und Weib so gehöre. Da langte ich auf sein Geheiß wieder hin und rieb und drückte gehorsam, bis der Herzog anfing gar arg zu schnaufen. Schließlich machte er einen kleinen Seufzer, der Schniedel fing an zu ruckeln und zu hüpfen, und ein weißer Saft quoll über meine Hände, dass ich gleich wieder erschrak. Ich glaubte, ich habe ihm vielleicht wehgetan und all seine Körpersäfte begännen auszulaufen, aber mein Gemahl lachte mich gutmütig aus und meinte, ich habe meine Sache schon recht gemacht wie ein Eheweib. Da war ich stolz und zufrieden, und wir scherzten und unterhielten uns noch eine ganze Weile. Plötzlich wurde aber die Tür aufgerissen, und unter Hochrufen und großem Gelächter kamen die vom Adel herein, die vor der Tür gewartet hatten, und feierten uns ausgelassen. Danach führte man mich wieder ins Frauenzimmer, wo mich die Schweinicka dann ins Bett brachte. Das war der Tag meiner Hochzeit.
Am nächsten Früh nach der Morgensuppe erschien der Herzog vor der Tür zum Frauenzimmer und bat um Einlass. Er war recht froh gelaunt und nannte mich im Scherz »Frau Herzogin«. Dann zog er einen kleinen güldenen Gegenstand unter seinem Umhang hervor und gab ihn mir mit den Worten, das sei seine Morgengabe an mich. Es war ein Pokällein, ganz wie die großen Trinkgefäße, nur klein genug, dass ich es gut heben konnte. Darauf war ein Bild von dem heiligen Christophorus, wie er das Jesulein übers Wasser trägt, umrahmt von schönen Saphirlein und Smaragden. Und es stand darauf geschrieben »Gloria Dei in eternitate. Barbara von Gots Gnaden Herzogin zu Groß-Glogau.« Und der Herzog sagte: »Damit Ihr Euch nie mehr an einem Schluck Wein überhebt.«
Das freute mich gar sehr, und ist das Pokällein jetzt mein liebstes Trinkgefäß. In dem Pokällein fand ich zudem noch einen kleinen güldenen Ring mit einem Kreuz aus lauter Rubinsteinen, die leuchten und glitzern, schöner als das Morgenrot. Den trag ich jetzo am Daumen, weil er für die andern Finger noch zu groß.
Herzliebe Frau Mutter, ich bitt Euch, grüßt meine Schwestern und Brüder, besonders aber den kleinen Albrecht, an den ich oft denken muss. Und grüßt auch meine alte Amme, die Martsch, die ich immer noch recht lieb habe. Behüt Euch Gott, Eure gehorsame Tochter Barbara, Herzogin von Groß-Glogau und Crossen.
Gegeben am Sonntag nach Trinitatis anno 1527 in der Veste zu Glogau.
Plassenburg, Januar 2002
Der winterliche Vollmond schien aus einem eisklaren Nachthimmel auf die Plassenburg und das darunter liegende Kulmbach. Es war bitterkalt. Aus den Kaminen der Stadt und der alten Festung stiegen Rauchwölkchen wie schneeweiße Zuckerwatte.
Um den alten hölzernen Tisch in der kühlen Temperierkammer der Plassenburger Gemäldesammlung saßen Gregor Haubold, Pfarrer Heinrich Kellermann und der Kulmbacher Archivar Wolfgang Kleinert mit nachdenklichen Mienen. Mit diesen dreien war die Speerspitze der Kulmbacher Plassenburg-Forschung versammelt; es fehlte nur noch der Hauptschullehrer Ulrich Götz, der an diesem Abend Elternsprechstunde hatte.
Vor den Männern stand, nur von einer Schreibtischlampe spärlich beleuchtet, der Karton mit den Säuglingsgebeinen, der kurz nach Weihnachten wieder aus Erlangen zurückgekommen war. Die kleinen Knöchelchen waren inzwischen sauber nummeriert und geordnet, und die Gestalt des winzigen Menschleins ließ sich deutlich erkennen.
»Makaber«, meinte der Archivar, ein stämmiger Mittdreißiger mit Mecki-Haarschnitt und Vollbart. Kleinert stammte aus dem unterfränkischen Königshofen und war ein redseliger, trinkfreudiger und gemütlicher Mensch, außerdem gläubiger Katholik. Der Gedanke an einen möglichen Kindermord beunruhigte ihn zutiefst.
»Wer bringt denn so was fertig?« Der Archivar verzog angewidert das Gesicht und schüttelte den Kopf.
Pfarrer Kellermann putzte seine randlose Brille und setzte sie wieder auf sein markantestes Körperteil, die Nase. »Vier- bis fünfhundert Jahre soll das also alt sein – da wären wir beim Jahr 1500 aufwärts.«
Kellermann, der aussah wie der alt gewordene Luther, war eigentlich Experte für Reformationsgeschichte, beschäftigte sich aber auch schon seit Jahren mit der Historie der Plassenburg. Schüttere kleine Löckchen umrahmten seinen runden Schädel von Ohr zu Ohr. Wie immer in seiner Freizeit trug er einen uralten beige gemaserten Shetlandpullover mit Zopfmuster und eine abgewetzte Cordhose. Wenn man ihn so sah, konnte man kaum glauben, dass er in der Kirche eine imposante Erscheinung abgab – doch im Talar schien er wie eine Inkarnation des großen Reformators selbst.
Haubold begann mit seinen Überlegungen.
»Ich denke, wir können davon ausgehen, dass die Truhe mit dem Kind zwischen 1554 und 1577 auf keinen Fall eingemauert werden konnte, denn nach der Zerstörung der Burg im Bundesständischen Krieg war die Anlage eine riesige Baustelle. Da waren nur Arbeiter und eine kleinere Soldatenbesatzung – ziemlich unwahrscheinlich, dass es um diese Zeit einen Säugling auf der Burg gegeben hat.«
»Glaube ich auch«, meinte der Archivar. »Erst ab 1577 unter Georg Friedrich lässt sich die markgräfliche Hofhaltung wieder auf der Plassenburg nachweisen, und das nur zeitweise. Da könnte so was schon passiert sein. Und – vorausgesetzt natürlich, dass die Datierung der Gebeine stimmt – dann können wir im Jahr 1603 aufhören zu suchen. Danach hielt sich nämlich der markgräfliche Hof im neuen Schloss in Bayreuth auf, und die Plassenburg war nie mehr Residenz.«
Kleinert rieb sich den Bart.
»Wie sieht es denn vor 1553 aus?« Kellermann meldete sich zu Wort. »Wenn wir um 1500 anfangen zu suchen, sind wir in der Regierungszeit Friedrichs des Älteren. Der residierte zwar die meiste Zeit in Ansbach, war aber mit seiner Hofhaltung jedes Jahr mindestens einmal auf der Plassenburg. Nach Friedrichs Tod kam es zur Landesteilung unter seinen Söhnen Georg und Albrecht Alkibiades. Georg erhielt das Unterland und blieb im Ansbacher Schloss. Wir müssen uns mit Albrecht beschäftigen, denn der übernahm das so genannte ›Land auf dem Gebirg‹ – das Oberland mit der Plassenburg.«
»Soviel ich weiß, ist Albrecht als Söldnerführer in kaiserlichen Diensten ständig herumgereist«, warf Kleinert ein.
»Genau«, meinte Haubold. »darum glaube ich, dass Albrechts Regierungszeit für uns eher uninteressant ist. Wir sollten uns auf die Jahre bis zu Friedrichs Tod 1538 und dann wieder auf die Zeit zwischen 1577 und 1603 konzentrieren.« Der Kastellan schaute Einverständnis heischend in die Runde.
Kleinert stieß mit dem Zeigefinger Luftlöcher in Richtung des Kastellans. »Wer sagt uns denn überhaupt, dass das Kind wirklich aus der markgräflichen Hofhaltung stammt? Es könnte ja genauso von einer Frau aus der Dienerschaft sein oder von einer Soldatenbraut aus der Besatzungszeit in den fünfziger Jahren. Dazu muss die Hofhaltung nicht auf der Burg gewesen sein.«
Haubold stand auf und ging zu einem der Schränke neben der Tür. »Prinzipiell hast du schon Recht, Wolfgang«, sagte er und holte ein Tütchen aus dem linken Schrank heraus, »aber da ist noch das hier.« Und er legte zwei kleine Metallscharniere, vier kleine, verzierte Beschläge und ein ebenso winziges Schloss auf den Tisch. »Das alles fand sich bei dem Kinderskelett, zusammen mit zerfallenen Holzteilen und Textilresten, wahrscheinlich von einer Truhe, in der die Leiche lag. Schaut Euch bloß die Metallarbeit an – wunderschöne Ornamente, Blumenmuster und ein ganz außergewöhnlich fein herausgefeiltes Schloss. Das war keine Allerweltstruhe, in die man vielleicht ein ganz normales Kind gesteckt hätte. Ein einfacher Hofbediensteter wäre an eine solche Truhe gar nicht herangekommen. Nein, ich bin überzeugt, dass hier höher gestellte Mitglieder der Hofhaltung am Werk waren und dass es sich um ein ganz besonderes Kind handelte.«
»Also gut«, warf Pfarrer Kellermann ein, den es nun langsam in den nahe gelegenen Gasthof zum Bier zog, »es war kein gewöhnliches Kind. Wir müssen also nach potenziellen Eltern unter den höheren Hofchargen suchen. Was ich tun kann, ist, die Kulmbacher Taufregister der Zeit zu durchsuchen. Vielleicht war das Kind ja getauft – vorausgesetzt natürlich, das Kind ist in Kulmbach oder auf der Burg geboren. Und vielleicht ist etwas in den Sterberegistern zu finden – man weiß ja nie.«
»Der nächste Schritt wäre, noch einmal die Plassenburg-Geschichte des Ritters von Lang auf Hinweise zu durchforsten. Das könnte ich tun«, erbot sich der Kastellan.
Kleinert stöhnte. »Ich habe momentan einfach keine Zeit, um mich darum zu kümmern. Die Registratur wird auf EDV umgestellt. Ihr könnt euch vorstellen, was da im Archiv los ist. Aber ich telefoniere gern mit meinem Kollegen Horn in Bamberg, ob ihm irgendetwas in den Plassenburg-Archivalien im relevanten Zeitraum aufgefallen ist.«
Die drei Geschichtsforscher hatten in dem kühlen Depotraum längst angefangen zu frieren. Sie verließen die Temperierkammer und machten sich auf den Weg nach Kulmbach ins »Schiff«, wo der Kastellan wie immer ein Bier und eine doppelte Currywurst mit Pommes, dafür aber ohne Salat bestellte.