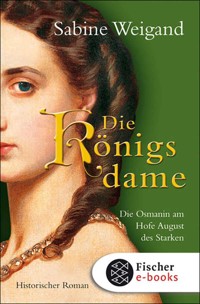
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die wahre Geschichte der osmanischen Mätresse Sie ist Kriegsbeute und Tochter des Paschas – Fatmah, die osmanische Schönheit, bezaubert Sachsens König August den Starken. Aber wem kann Fatmah am Hofe von Dresden trauen? De Villeroy, dem französischen Gesandten, der sich elegant über Augusts mangelndes Kriegsglück lustig macht? Oder dem jungen polnischen Grafen Worowski, der im Geheimen für die Freiheit seines Volkes kämpft? Da gerät Fatmah in eine Intrige um Magie, Mord und Verrat. Kann die Königsdame ihr Schicksal wenden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Sabine Weigand
Die Königsdame
Historischer Roman
Roman
Über dieses Buch
Als junges Mädchen kommt Fatmah nach Dresden. Angstvoll und alleingelassen muss sie die fremden Sitten am sächsischen Hof erlernen. Sie wird Zofe von Augusts mächtigster Mätresse, Constantia von Cosel. Bis Fatmah selbst das Interesse des Königs erregt und für Constantia zur Rivalin wird. Wem kann Fatmah am Hofe trauen? De Villeroy, dem französischen Gesandten, der sich elegant über Augusts mangelndes Kriegsglück lustig macht? Oder dem jungen polnischen Grafen Worowski, der im Geheimen für die Freiheit seines Volkes kämpft? Da gerät Fatmah in eine Intrige um Magie, Mord und Verrat. Kann die Königsdame ihr Schicksal wenden?
Spannend, authentisch erzählt, historisch präzise – der neue Bestseller von Sabine Weigand.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: bürosüd°, München
Coverabbildung: akg-images, Berlin
Die Vignetten, die den einzelnen Büchern vorangestellt sind,
stammen aus: Karl-Ludwig von Pöllnitz, Das galante Sachsen
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2007
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400080-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Erstes Buch
Dresden, Oktober 1747
Irgendwo bei Asow am Schwarzen Meer, September 1699
Depesche des Zaren von Russland an den Kurfürsten von Sachsen und König von Polen vom 20.Oktober 1699
Dresden, Mai 1700
Königlich polnischer und Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 15.Mai 1700
Fatmah
Brief der Anna Constantia Hoym an August II., König von Polen und Kurfürst von Sachsen, nach Warschau, 14.Februar 1701
Fatmah
Klissow in Polen, 9.Juli 1702
Dresden, September 1702
Depesche des schwedischen Königs Karl XII. an seinen Feldmarschall Rehnskjöld, Oktober 1702
Südpolen, Januar 1703
Fatmah
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Ostpolen, Schloss Sanok, August 1703
Dresden, September 1703
Königlich polnischer und Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 30.Oktober 1703
Dresden, 8.November 1703
Fatmah
Zweites Buch
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Dresden, April 1704
Königlich polnischer und Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 26.April 1704
Irgendwo im Spreewald, Juni 1704
Warschau, Juli 1704
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Dresden, September 1705
Fatmah
Brief Augusts von Sachsen-Polen an Anna Constantia Hoym, Fraustadt in Polen, 2.Februar 1706
Eildepesche Augusts an Constantia nach Dresden, 5 Tage nach der Schlacht
Dresden, April 1706
Königlich polnischer und Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 20.Mai 1706
Dresden, Juni 1706
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Fatmah
Königlich polnischer und Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 16.Dezember 1706
Altranstädt, Dezember 1706
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Dresden, Januar 1707
Fatmah
Eildepesche des französischen Gesandten Vicomte de Villeroy nach Versailles, 1.März 1707
Dresden, Anfang April 1707
Gratulationsschreiben des Königs August, Kurfürst von Sachsen, an König Stanislaw von Polen, 8.April 1707
Polen, Mai 1707
Dresden, Juni 1707
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Altranstädt, Juni 1707
Fatmah
Dresden, 7.September 1707
Drittes Buch
Königlich polnischer und Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 26.September 1707
Fatmah
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Spreewald, Dezember 1707
Dresden, März 1708
Dresden, Juni 1708
Eildepesche des Königs August von Sachsen an seine Majestät, den Zaren von Russland, 1.Juli 1708
Nachricht Julas an Sophie vom 9.Juli 1708
Karlsbader Generalia-Antzeiger und Intelligentz-Blatt vom 3.August 1708
Karlsbad, August 1708
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Fatmah
Königlich-Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 5.Oktober 1708
Versailles, Dezember 1708
Dresden, Januar 1709
Irgendwo in der Nähe von Smolensk in Weißrussland, Januar 1709
Versailles, Januar 1709
Jagdschloss Moritzburg, 10.Mai 1709
Königlich-Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 27.Mai 1709
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Fatmah
Poltawa, Juli 1709
Eildepesche des Zaren von Russland an König August von Sachsen, 9.Juli 1709
Fatmah
Irgendwo in der Nähe von Minsk, Ende September 1709
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Königlich-Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 25.Oktober 1709
Irgendwo in der Nähe von Minsk, November 1709
Fatmah
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Östlich von Warschau, Mai 1710
Dresden, Juli 1710
Viertes Buch
Fatmah
Königlich-Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 20.Dezember 1710
Schreiben des Königs August von Polen an Madame Fatima von Kariman, Dresden, 2.Januar 1711
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Dresden, Juli 1711
Königlich-Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 16.Juli 1710
Dresden, Oktober 1711
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Moritzburg, Februar 1712
Fatmah
Königlich-Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 26.April 1712
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Dresden, September 1712
Spreewald, Oktober 1712
Dresden, Dezember 1712
Dresden, Januar 1713
Warschau, Februar 1713
Geheimes Aerztliches Bulletin vom 20.März 1713
Fatmah
Depesche des französischen Gesandten Vicomte de Villeroy nach Versailles, 15.April 1713
Geheimes Aerztliches Bulletin vom 20.Mai 1713
Dresden, Juni 1713
Geheimer Bericht des Hofapothekers Rexrath vom 15.Juni 1713
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Spreewald, Juli 1713
Dresden, 19.August 1713, zwei Uhr morgens
Dresden, 19.August 1713, drei Uhr morgens
Rapport des Geheimpolizei-Agenten Anton Sartorius an den Minister des Geheimen Kabinetts Graf Flemming vom 23.August 1713
Fatmah
Depesche des Königs August von Polen an König Friedrich Wilhelm von Preußen vom 24.August 1713
Dresden, 25.August 1713
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Dresden, 8.September 1713
Königlich-C hurfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 2.November 1713
Berlin, Nossen und Stolpen, Februar und März 1714
Fünftes Buch
Bericht des französischen Gesandten zu Dresden, Vicomte de Villeroy, nach Versailles, abgesandt am 3.April 1714
Dresden, Mai 1714
Fatmah
Brief der Gräfin Constantia von Cosel aus der Haft in Stolpen an König August den Starken vom 13.Oktober 1714
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Gut Särchen, Januar 1715
Rapport des Geheimpolizei-Agenten Anton Sartorius an den Minister des Geheimen Kabinetts Graf Flemming vom 11.Januar 1715
Revers des Grafen Flemming an Anton Sartorius vom 12.Januar 1715
Berliner Ordinari- und Postzeitung vom 16.1.1715
Schloss Pillnitz, September 1715
Tarnograd in Polen, Herbst 1715
Brief Jan Michal Worowskis an Fatmah vom 20.Februar 1716
Irgendwo in Polen, März 1716
Dresden, April 1716
Gefälschtes Eilbillet Fatmahs an Jan Michal Worowski vom 7.Mai 1716
Gut Särchen, 23.Juni 1716
Festung Königstein, 24.Juni 1716
Aus den Memoiren des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy
Dresden, 25.Juni 1716
Brief Worowskis aus der Haft auf dem Königstein an Fatmah vom 26.Juni 1716
Festung Königstein, 28.Juni 1716, Morgengrauen
Fatmah
Festung Königstein, 28.Juni 1716
Königlich-Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 29.Juni 1716
Von Sachsen nach Schweden, Juni bis September 1716
Fatmah
Karlskrona, Oktober 1716
Brief des französischen Gesandten zu Dresden, Alphonse Louis Baptiste de Villeroy, an Madame Fatima Spiegelska nach Oloschitz, 9.Juni 1717
Schreiben Fatmahs an den Vicomte de Villeroy vom 26.April 1718
Schriftlicher Geheimbefehl des Grafen Flemming per Kurier an Jan Michal Worowski vom 15.September 1718
Dresden, 16. bis 19.September 1718
Depesche des Vicomte de Villeroy an Madame Fatima Spiegelska in Polen vom 20.September 1718
Dresden, 20.September 1718
Gut Oloschitz, 29.Oktober 1718
Festung Frederikshald in Norwegen, 30.November 1718
Königlich-Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 7.Dezember 1718
Gut Oloschitz, Juni 1719
Eintrag des Pfarrers von Nowy Wilowa im Kirchenbuch vom 14.März 1720
Nachwort
Personen
Erstes Buch
August der Starke
Dresden, Oktober 1747
Der Große Garten vor den Toren der Stadt lag im warmen Sonnenlicht. Es war einer dieser goldenen Herbsttage, an denen die Natur noch einmal in aller Schönheit erstrahlt, bevor die tristen, düsteren Nebel und kalten Schauer des Spätherbstes den Winter ankündigen. Rote und gelbe Blätter tanzten im Gras unter den alten Bäumen, ein milder Wind trieb das Laub über die Wiesen, und die Eichhörnchen vergruben geschäftig ihre Vorräte. Selbst die Goldfische in den Teichen überwanden noch einmal ihre einsetzende Winterträgheit und schnappten großmäulig nach den letzten Wasserläufern. Am hellblauen Himmel war kein einziges Wölkchen zu entdecken.
Die schwarze Reisekutsche rollte die von Skulpturen gesäumte Hauptallee entlang, vorbei an den herrlichen Vasenplastiken am Eingang, dem heiter plätschernden Brunnen und der wilden Kentaurengruppe. Die wenigen Spaziergänger und Reiter, die sich im Park verlustierten, sahen dem Gefährt neugierig nach. Es trug ein Wappen an der Seite, das zu Dresden unbekannt war, russisch vielleicht, schwedisch oder gar spanisch. Der König hatte wohl wieder ausländischen Besuch, was zwar nicht mehr so oft vorkam wie zu Zeiten seines seligen Vaters, des starken August, aber immerhin war die sächsische Hauptstadt für den europäischen Adel auch jetzt noch eine Fürstenresidenz von Rang.
In Sichtweite des Gartenpalais, das im Zentrum des Parks lag, gabelte sich der Weg, und der alte Kutscher lenkte seine beiden Grauschimmel nach rechts. Beim ersten der beiden Kavaliershäuser, die ganz in der Nähe des Lustschlösschens lagen, hielt er sein Gefährt an, sprang etwas steifbeinig ab und öffnete den Schlag. Der Kalesche entstieg eine vornehme Dame von edler Haltung, ganz in einen nachtblauen Umhang gehüllt, der mit schimmerndem Nerz verbrämt war. Sie war nicht mehr jung; ihr zu einer kunstvollen Frisur hochgestecktes rabenschwarzes Haar wurde von vielen silbergrauen Strähnen durchzogen. Auffälliger noch als die Tatsache, dass sie keine Perücke trug, ja, nicht einmal die Haare gepudert hatte, war der fremdländische Schnitt ihrer Züge: hohe Wangenknochen, mandelförmige Augen, ein schmaler, feiner Mund. Und obwohl sichtbare Fältchen ihr Gesicht durchzogen, trug sie keine Schminke, kein Wangenrot, kein Brauenschwarz.
Die Dame richtete ihren Umhang und blieb dann einen Augenblick auf dem Kiesweg stehen. Langsam ließ sie ihren Blick über die Südwestfassade des Gartenpalais schweifen, schaute dann zum Ententeich hinüber, dessen Wellen sich sanft kräuselten, dann zum muschelförmigen Bau des Parktheaters, über den gerade ein Schwarm Spatzen hinwegflatterte. Sah sie tanzende Gestalten am Ufer, lachende Mädchen, die Arme voller Blumen, Höflinge in Seidenhosen und bunten Überröcken, die ihnen galant zuwinkten, den König gar, wie er auf seinem Lieblingsschimmel verwegen über eine steinerne Bank setzte? Gedankenverloren fuhr sich die Dame mit der behandschuhten Hand über die Augen, dann raffte sie ihre Röcke, und während der Kutscher bei seinen Pferden wartete, schritt sie über den Rasen zum Gartenpalais. Langsam ging sie die kunstvoll gestaltete Mauer entlang, als ob sie etwas suchte, und schließlich blieb sie bei einem Rhododendronbusch stehen, schob ein paar Zweige zur Seite und sank in die Knie. Sie klopfte an einen der Steine im Mauersockel, legte schließlich achtlos die Handschuhe ab, schüttelte und rüttelte so lange, bis sie den Stein aus der Mauer entfernt hatte. Dann griff sie mit der Rechten in den dahinter liegenden Hohlraum, tastete, suchte und zog schließlich die geschlossene Faust wieder heraus. Sie machte ein paar Schritte aus dem Schlagschatten des Schlösschens hinaus in die Sonne, und dann öffnete sie die Finger: Auf ihrer Handfläche lag ein schwerer, dunkel angelaufener, silberner Siegelring. Beinahe andächtig nahm die Dame das alte Schmuckstück zwischen Daumen und Zeigefinger und polierte es mit dem Ärmel ihres Kleides. Sie drehte den Ring so, dass das Motiv der Stempelfläche im Sonnenlicht aufblitzte, ein dräuender Greif mit Krone und Schwert. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, und für einen kurzen Augenblick sah sie aus wie das junge Mädchen, das sie einst gewesen war. Dann strich sie sich mit einer nachdenklichen Geste eine lose Haarsträhne aus der Stirn, steckte den Ring in die Tasche ihres Umhangs und ging langsam zur Kutsche zurück.
Wie lange war es her? Fünfundzwanzig, dreißig Jahre? Wie die Stadt sich verändert hat, dachte sie, während der Kutscher durch die Gassen fuhr, die ihr einmal so vertraut gewesen waren. Natürlich, das Schloss war noch da, und es sah genauso aus wie früher. So viele Jahre hatte sie darin gelebt, schlimme, einsame Jahre, aber auch glückliche und unbeschwerte. Immer noch wirkte der Renaissancebau von außen etwas finster. Von der Spitze des Hausmannturms schlug es gerade zur Mittagsstunde; der Klang der großen Glocke war ihr vertraut wie ehedem.
Die Augustusbrücke, die vor der Residenz über die Elbe führte, vorher ein schmaler Übergang, hatte man erneuert und verbreitert, nun verband ein modernes Wunderwerk aus massiven Steinbögen die beiden Stadthälften. Und gleich in der Nähe des Schlosses, gegenüber dem Taschenberg-Palais, an das sie so viele Erinnerungen knüpfte, erhob sich etwas Neues, Großartiges, ein jetzt schon weithin berühmtes Meisterwerk der Baukunst, ein Festplatz, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte: Der Zwinger, dessen Anfänge sie damals noch hatte emporwachsen sehen. Sie ließ die Kutsche durch das Kronentor einfahren. Das ist also aus all seinen Plänen geworden, dachte sie. Hier unter freiem Himmel hat er in den letzten Jahren rauschende Feste gefeiert, verschwenderische Bälle und große Konzerte gegeben. Die Gebäude waren erst halbfertig gewesen, als sie Dresden verlassen hatte – nun bildeten sie einen steingewordenen Traum in ihrem strahlend hellen Weiß mit den sonnenüberfluteten kobaltblauen Dächern. Zusammen mit den vielen Vergoldungen ergab das die drei wettinischen Farben, genau so, wie er es gewollt hatte!
Beim Nymphenbad hielt die Kutsche, und wieder stieg die Dame aus. Sie ließ sich am Rand des Wasserbeckens nieder und tauchte gedankenverloren eine Hand ins Wasser. Die aus dem Wasserfall sprühenden Tropfen netzten ihr Gesicht, es störte sie nicht. Fast schien es ihr, als sei es gestern gewesen, als sie zusammen mit ihm das schattige Grottenwerk bewundert hatte, den tropfsteinartigen Schmuck, die Wasser speienden Delphine und Tritonen, die Nymphen in den steinernen Nischen. Wie verzaubert waren sie gewesen von der verwunschenen Atmosphäre, und dabei war damals alles erst im Entstehen begriffen. Jetzt waren die steinernen Kaskaden grün vom Moos, und uralte Karpfen schwammen im Wasserbecken. Sie ließ eine Weile das Wasser durch ihre Finger rinnen und betrachtete das Spiel des Sonnenlichts auf seiner Oberfläche. Dann kehrte sie zur Kutsche zurück und ließ weiterfahren.
Die altvertraute Frauenkirche stand nicht mehr. An ihrer Stelle thronte ein monumentaler neuer Kirchenbau aus Elbsandstein, fast hundert Meter hoch, mit einer prächtigen hohen Kuppel, die hell aufglänzte und beinahe ein wenig orientalisch anmutete. Gerüste standen noch an einigen Stellen, und das vereinzelte Klopfen und Hämmern von Handwerkern verriet, dass der kunstvolle Bau trotz seiner Einweihung vor vier Jahren noch immer nicht ganz fertig war. Überwältigt von der Schönheit des grandiosen Kuppelbaus, wies die Dame ihren Kutscher an zu halten und ließ ihren Blick bewundernd über die herrliche Kirche schweifen.
Auch die Neustadt, die damals noch überall im Aufbau gewesen war, hatte sich prächtig entwickelt. So viele herrschaftliche Häuser mit herrlichen Fassaden, neue Straßen, weite Plätze, alles glänzend sauber und ohne stinkenden Abfall auf den Straßen. Und mitten auf dem Neustädter Markt das Standbild des Königs: der Goldene Reiter, wie man ihn von Anfang an genannt hatte. Sie ließ die Kutsche erneut halten, blieb aber sitzen und bewunderte das gleißende Ebenbild Augusts des Starken, wie er in stolzer Haltung auf einem kurbettierenden Ross thronte. Genauso saß er immer zu Pferd, dachte sie, den Rücken durchgedrückt, die Schultern tief, den Kopf leicht geneigt. Die Lebensähnlichkeit des goldenen Abbilds berührte sie mehr, als sie geglaubt hatte, und sie seufzte leise. Wie oft war sie mit ihm geritten, durch blühende Gärten, auf fröhlichen Jagden! Einmal hatte sie ihn sogar im Wettrennen besiegt, drunten auf den Elbwiesen! Abrupt ließ sie den roten Samtvorhang des Kutschfensters fallen und lehnte sich wieder zurück. Nachdem sie den Ring aus seinem Versteck geholt hatte, war es jetzt an der Zeit, das Zweite zu tun, was sie sich vorgenommen hatte. Sie klopfte an die Rückwand zum Kutschbock, und die Kalesche fuhr über die Augustusbrücke zurück bis zum Eingangsportal der Hofkirche.
Die neue Kirche, die der Kurfürst-König August III. und seine Gemahlin, die Kaisertochter Maria Josepha von Habsburg, vor fast zehn Jahren in Auftrag gegeben hatten, war nun beinahe fertig. Bis auf den Turm, der einmal den Eingang auf der Elbseite krönen sollte, stand die dreischiffige Basilika aus Sandstein schon in aller Pracht neben dem Schloss, wunderbar anzusehen mit ihren Balustraden und den unzähligen Heiligenstatuen.
Die Dame in Blau entstieg ihrer Kutsche und betrat den großen dreischiffigen Innenraum durch einen Seiteneingang, weil das Hauptportal noch durch Gerüste versperrt war. Der Eindruck des Kirchenschiffs war umso großzügiger, als es noch keine Bankreihen enthielt; etliche Seitenaltäre und die Kanzel waren schon aufgestellt, und in einigen Kapellen leuchteten bereits herrliche sakrale Gemälde in allen Farben. Die Dame sah sich suchend um, schließlich fragte sie einen der Handwerker, die in der Apsis arbeiteten, nach dem Eingang zur Gruft. Der Mann wies mit stuckbefleckten Fingern in Richtung Haupteingang. »Da vorne, links von der großen Säule, wo das offene Gitter ist.«
Sie lenkte ihre Schritte dorthin, stieg die Treppe hinunter und betrat den ovalen, weiß gekalkten Raum, den der jetzige König als zukünftige Grablege für sich und seine Gemahlin hatte anlegen lassen. Die Dresdener nannten sie jetzt schon die Stiftergruft. In einer Wandnische stand auf halber Höhe eine einfache silberne Kapsel, und die Dame im blauen Umhang ging zögernd darauf zu. Drei junge Mädchen mit leeren Körben steckten vor der Nische flüsternd die Köpfe zusammen, offenbar hatten sie den Arbeitern Essen gebracht und sahen sich nun das hell glänzende Gefäß an, dessen Inhalt jedes Kind in Dresden kannte: das Herz des alten Königs. August der Starke war in Polen gestorben, und dort, im Krakauer Dom, ruhten auch seine Gebeine. Aber sein Herz hatte man auf seinen letzten Wunsch hin in Dresden beigesetzt, der Stadt, die er am meisten geliebt hatte.
Ein grauhaariger Priester in schwarzem Messgewand war lautlos heruntergekommen und wandte sich nun schmunzelnd an die drei Essenträgerinnen. »Vorsicht, meine jungen Damen, treten Sie nur nicht zu nahe an den König heran. Wissen Sie nicht, dass sein Herz wieder zu klopfen beginnt, wenn ein schönes Mädchen daran vorbeigeht?«
Die drei Jungfern kicherten verlegen, zupften an ihren Häubchen und traten schnell ein paar Schritte zurück, während der Geistliche sich zu der Dame in Blau umdrehte. »Er hat die Frauen sehr geliebt, unser alter König«, erklärte er.
»Ich weiß«, sagte sie einfach. Dann trat sie dicht an die Silberkapsel. Vorsichtig tastend berührten ihre Finger das glatte Metall, glitten die bauchige Wölbung entlang und blieben schließlich auf der Inschrift ruhen.
»Haben Sie ihn gekannt?« Der Priester sah ihr mit forschendem Blick ins Gesicht.
Ein wehmütiges Lächeln spielte um ihre Lippen. »Es ist lange her.«
Etwas wie Erkennen brach sich in den Augen des alten Mannes Bahn. Er sah fast vergessene Bilder vor sich: Ein schwarzhaariges Kind in orientalischer Aufmachung, die meerblauen Augen voller Angst. Ein etwa fünfzehnjähriges Mädchen, gekleidet in eine schwere brombeerfarbene Robe, das sich fügsam vom König vor das Taufbecken der Hofkapelle führen ließ. Eine schöne, selbstbewusste junge Frau in Schleiern und Pluderhosen, die anmutig auf dicken samtenen Kissen thronte und alle mit ihren Geschichten in den Bann zog …
»Fatima«, sagte er mit ungläubiger Miene.
Sie nickte und ließ ihre Hand sinken, die immer noch auf der Urne geruht hatte. Einträchtig standen die beiden eine Weile vor der Nische, bis die Dame in Blau schließlich ihren Umhang fester zog.
»Passen Sie gut auf ihn auf, Herr Pfarrer«, lächelte sie. Dann stieg sie die Stufen der Gruft hinauf und trat wieder hinaus ins helle Sonnenlicht. Der alte Kutscher öffnete den Schlag und half ihr hinein. »Wohin jetzt, Madame?«, fragte er.
Sie holte den Siegelring aus der Manteltasche und steckte ihn an ihren Daumen.
»Nach Hause, Fritz«, sagte sie, und löste mit zwei Griffen ihr hochgestecktes Haar. »Nach Hause.«
Irgendwo bei Asow am Schwarzen Meer, September 1699
Beißender Pulverqualm lag über dem Schlachtfeld. Es war die Stunde nach dem Kampf. Der Geruch nach Rauch, Blut und Exkrementen hing in der Luft. Schrecklich, ja gespenstisch war die Stille nach dem langen, verzweifelten Toben. Nur manchmal drang das Stöhnen eines Verwundeten an die Ohren der Soldaten, die den Leichenacker nach Beute und Überlebenden durchkämmten. Dann folgte nur zu oft ein Todesschrei – Erlösung für die, denen nicht mehr zu helfen war.
Jetzt lagen sie beinahe friedlich nebeneinander, russische und osmanische Tote, die einen in grüner Uniform, die anderen in ihren roten türkischen Pluderhosen und den bunten Turbanen. Tapfer hatten beide Seiten gekämpft, aber schließlich hatte ein unerwarteter Ausfall der russischen Kavallerie alles entschieden. Die türkischen Linien waren auf ganzer Länge eingebrochen, selbst die Janitscharen hatten ihr Heil in blinder Flucht gesucht. Der Versuch der Pforte, mit den gefürchteten Elitetruppen des Beylerbey von Smyrna die Festung Asow zurückzuerobern, war gescheitert.
Alexander Danilowitsch Menschikow, Freund und Vertrauter des Zaren Peter Alexejewitsch, der später einmal der Große heißen sollte, ritt an der Spitze eines Grüppchens von Offizieren über das Schlachtfeld. Er war erschöpft, aber bester Laune, denn das von ihm kommandierte Preobraschenski-Regiment hatte mit einem genial geplanten taktischen Manöver der Schlacht die entscheidende Wendung gegeben. Asow würde russisch bleiben, und der Zar würde es ihm danken. Menschikow hatte es allen gezeigt, die ihn wegen seiner Herkunft aus armen Verhältnissen verächtlich einen Piroggenverkäufer und Schweinehirten schimpften.
»Zum Hauptlager!«
Er trieb seinen Schimmel an, und die Gruppe galoppierte in Richtung Westen, wo sich hinter einem Hügel das türkische Zeltlager befand. Schon von weitem sahen sie die Rauchschwaden, die über dem Lager hingen, und der Brandgeruch biss ihnen in die Nase.
»Oho, deine Leute haben ganze Arbeit geleistet, Alexander Danilowitsch«, grinste einer der Offiziere und wies mit dem Kinn auf die zerstörten, brennenden Zelte.
Menschikow stieß einen Fluch aus. »Verdammt, Simjonow, das war dein verwahrloster Haufen! Das Preobraschenski-Regiment plündert nicht ohne meine Erlaubnis!«
Er gab seinem Pferd die Sporen und setzte über die Schanzen und Gräben hinweg, mit denen die Türken ihr Lager geschützt hatten. Es mussten über dreitausend Zelte und Wagen gewesen sein, der Stärke der Armee nach zu schließen, und viel war von ihnen nicht übrig geblieben, nachdem Teile der russischen Armee gleich nach der Schlacht die Zeltstadt überrannt hatten. Mord, Brand und Plünderung, das galt den Soldaten als Lohn für den Sieg. Jetzt waren sie dabei, alles, was nicht niet- und nagelfest war, davonzuschleppen. Die verzweifelten Schreie von Frauen und Mädchen drangen an Menschikows Ohr. Das ist die widerliche Seite des Krieges, dachte er, und Ekel stieg in ihm auf. Aber wer wollte schon den Soldaten verbieten, ihren Triumph auszukosten? Sie hatten sich die Beute und das bisschen Vergnügen verdient.
Kamele, Ziegen und Schafe rannten in wilder Panik durch die Gassen der Zeltstadt. Ein Mann in blutbefleckter grüner Uniform wich einem bockenden Maultier aus und lief Menschikow dabei fast ins Pferd; er lachte und schwang einen reich verzierten türkischen Krummsäbel in der Hand. Überall lagen Leichen, auch die von Frauen und kleinen Kindern. Menschikow hatte nie verstehen können, warum die hohen Offiziere der Türken stets Kind und Kegel mit auf die Feldzüge nahmen. Wollten sie so ihren Soldaten ihre Siegessicherheit demonstrieren? Jetzt mussten sie für diese Sorglosigkeit büßen – die russischen Soldaten kannten keine Gnade.
»Herr Oberst!«
Einer seiner Adjutanten, ein junger pickelgesichtiger Sibirier, gab ihm ein Zeichen, zu folgen. In leichtem Trab ritten sie auf eine große Zeltburg zu, die in der Mitte des riesigen Lagers aufgebaut war. Bemalte Lederbahnen, bunt gewirkte Teppiche mit goldenen Fransen und Troddeln, seidene Vorhänge und gedrechselte Zeltgestänge fügten sich zu einem großen, fast dorfähnlichen Gebilde aus einzelnen Zelten, Schattendächern und Hütten. Auf den Zeltspitzen flatterten bunte Wimpel, und hoch über allem wehte die grüne Fahne mit dem Halbmond. Das musste das Quartier des Beylerbey Ali Kariman Pascha sein, des obersten Befehlshabers der Türken.
Menschikow und seine Offiziere stiegen ab und betraten das Labyrinth der Zeltburg. Auch hier lagen die Toten übereinander, zumeist kostbar gekleidetes Dienstpersonal und Soldaten der Deli, der Leibgardekavallerie des Beylerbey. In einem Zelt fanden sie die Musikkapelle der Janitscharen, allesamt niedergemetzelt, zwischen den Musikern die zerbrochenen Trommeln, Oboen, Pfeifen und Pauken. Sie stießen auf das Küchenabteil; die Köche lagen mit durchschnittenen Kehlen um das Feuer. Eine Leiche steckte kopfüber in einem riesigen Kessel mit Suppe, die Beine baumelten über den Rand.
In einem der nächsten Zelte lagen auf dem Boden aufgereiht die Prunkwaffen des Beylerbey, wunderbar gravierte Krummsäbel, edelsteinbesetzte Dolche, ein Rossschweif und zwei herrliche Pistolen mit Einlegearbeiten aus Perlmutt. In einer Truhe hatte man sorgsam zusammengefaltet die Ehrengewänder Ali Karimans aufbewahrt: Seidene Umhänge mit Pelzbesatz, weiße Turbane, goldbestickte Hosen und spitze, nach oben gebogene Stoffschuhe. Menschikow nickte grimmig. Niemand hatte gewagt, hier etwas wegzunehmen – diese Beute war für ihn allein bestimmt, Alexander Menschikow, den siegreichen Feldherrn!
Schließlich erreichten sie das Hauptzelt. Menschikow schob den schweren Stoff am Eingang zur Seite und stieß einen Laut der Überraschung aus. Drinnen lag auf kostbaren Teppichen die Leiche des erlauchten Beylerbey Ali Kariman Pascha, reich geschmückt und angetan mit allen Zeichen des hohen Würdenträgers. Die seidene Schnur hing noch um seinen Hals – er hatte einen ehrenvollen Tod gewählt.
»Bringt ihn hinaus und sorgt dafür, dass er seinem Rang gemäß anständig bestattet wird.« Menschikow ließ den Vorhang fallen und trat auf das nächste Zelt zu. Der tote Körper eines unwahrscheinlich fetten alten Mannes von schwarzer Hautfarbe versperrte ihm den Weg, die Finger um einen gebogenen kleinen Dolch gekrallt. Menschikow fiel ein, dass die Osmanen ihre Frauen angeblich von kastrierten schwarzen Sklaven bewachen ließen. Das hier musste also der Harem des großen Beylerbey sein. Er stieg über die Leiche hinweg ins Zelt. Von seinen Stiefeln fiel Schmutz auf die hellen Seidenteppiche, die in mehreren Lagen den Boden bedeckten. Im Luftzug klimperte ein Windspiel aus winzigen goldenen Glöckchen. Der Duft von Ambra und Moschus füllte den Raum; Menschikow sog schnuppernd die Luft ein. Dann sah er das Grauen. Auf Kissen und Polstern lagen wie Puppen mit grotesk verdrehten Gliedmaßen sechs leblose Frauengestalten. Kaum eine hatte noch einen Fetzen am Leib, und man konnte unschwer erkennen, dass ihnen nicht nur einmal Gewalt angetan worden war. Einem jungen Mädchen hatte man die Brüste abgeschnitten, zwei älteren Frauen bestialisch den Unterleib zerfetzt. Blut aus durchschnittenen Kehlen und gespaltenen Schädeln glänzte noch feucht auf den Teppichen – das Gemetzel mochte wohl noch keine Stunde her sein. Menschikow schauderte es, er fluchte leise. Gewalt gegen Frauen fand er eines Mannes unwürdig, barbarisch. Er spuckte aus und wollte sich schon zum Gehen wenden, als sein Blick auf eine Gestalt fiel. Ungläubig kniff er die Augen zusammen. Tatsächlich, er hatte sich nicht getäuscht: Dort hinten im Halbdunkel, in einer Ecke des Zelts stand reglos und stumm – ein Kind. Ein Mädchen, starr wie eine Salzsäule, die Augen vor Angst weit aufgerissen. Sie mochte vielleicht zehn oder zwölf Jahre alt sein, hatte langes, bis auf die Hüften reichendes schwarzes Haar und hellgolden gebräunte Haut. Ihr schlanker Körper steckte in einem bis zum Boden reichenden Gewand aus feinem Seidenstoff, in den goldene Münzen und bunte Halbedelsteine eingenäht waren.
»Heiliges Mütterchen von Kasan«, flüsterte Menschikow und kratzte sich am Kopf. Er machte einen Schritt auf das Kind zu und streckte die Hand aus.
»Hab keine Angst, ich tu dir nichts«, sagte er auf Russisch.
Das Mädchen wich langsam bis an die Zeltwand zurück.
»Hab keine Angst!«, sagte Menschikow noch einmal. Er ging zu der Kleinen und lächelte sie an. In ihren großen violettblauen Augen stand wilde Panik. Was hatte dieses Kind alles mitansehen müssen! Menschikow nahm das Mädchen sanft beim Handgelenk und schrie im selben Moment überrascht auf – mit einer blitzschnellen Bewegung hatte sie sich gebückt und ihn in die Hand gebissen. Dann flüchtete sie von ihm weg und kauerte sich zitternd an den blutig zerfleischten Körper einer der toten Frauen.
Zwei russische Ordonnanzen waren auf Menschikows Schrei hin in das Zelt gestürmt und blieben nun angesichts der merkwürdigen Szene wie angewurzelt stehen. Menschikow leckte sich kopfschüttelnd das Blut von der Hand und deutete dann auf das Mädchen.
»Nehmt sie mit und seht zu, dass ihr nichts geschieht. Aber passt auf, dass sie euch nicht auch noch beißt.« Er grinste. »Das wird ein nettes kleines Geschenk für den Zaren … «
Fünf Wochen später erreichte die siegreiche Armee Moskau.
Hunderte von Kerzen erhellten den kleinen Saal mit seinen reich geschnitzten Decken und holzgetäfelten Wänden. Die schweren roten Samtvorhänge waren zugezogen, sonst hätte man von den Fenstern aus die unzähligen Türme und Dächer der Stadt sehen können. Moskau war ganz aus Holz gebaut; trotzdem wirkte es märchenhaft reich, gekrönt von tausenden goldenen Kirchenkuppeln, die in den letzten Strahlen der untergehenden Sonne noch einmal rötlich aufglänzten.
Im Raum war es mollig warm, das Feuer im Kamin wurde von zwei Einheizern ununterbrochen geschürt. Um eine kleine Festtafel saßen ungefähr zwanzig Personen und feierten eines der wüsten Fress- und Saufgelage im kleinen Kreis, die der Zar so liebte. Der lange Tisch bog sich unter seiner Last: Krüge und Flaschen mit rotem Wein standen da, silberne Schüsseln mit Braten aller Art, Rübensuppe, Eierspeisen, gesottener Fisch, Tabletts mit Piroggen und Blini, Spieße mit Täubchen und Hühnern, Platten mit Obst und süßen Kuchen. Es herrschte heilloses Durcheinander; alles war schon halb aufgegessen, die Dekoration zerstört, die fettigen Reste über das Tischtuch verteilt. Weinkaraffen kullerten leer über den Holzdielenboden, was nichts ausmachte, denn man war längst zum Wodka übergegangen. Die Männer soffen den Schnaps aus großen kristallenen Gläsern, und jedesmal, wenn einer einen Trinkspruch ausbrachte, tranken sie sie leer und warfen sie über die Schulter gegen die Wand. Beflissene Diener brachten immer wieder Nachschub. Einer der Gäste war schon sinnlos betrunken vom Stuhl gefallen, etliche andere hingen schräg in ihren Sesseln, mit roten Köpfen, rülpsend und mit den Armen fuchtelnd. Es herrschte Hochstimmung, man riss unanständige Witze, sang Sauflieder, brüllte vor Lachen.
Ganz oben an der Tafel saß Peter Alexejewitsch, der Zar aller Reußen, ein ganzes Brathuhn in der Hand. Er war der Einzige im Raum, der noch einigermaßen nüchtern wirkte, was allerdings nicht daran lag, das er weniger trank, sondern daran, dass er unglaublich viel vertrug. Er hatte sein Oberkleid ausgezogen und trug nur ein einfaches rauleinenes Kamisol, das über der behaarten Brust aufsprang. Jung sah er aus, der kaum Achtundzwanzigjährige, mit seinen kastanienbraunen Locken und dem kleinen Schnurrbart, jung, wild und unbekümmert. An seinem Hals hing eine dralle Blondine und hielt ihm lachend ein Glas an die Lippen, aus dem er gierig trank. Das war Anna Mons, Tochter eines deutschen Wirts und Weinhändlers aus der Moskauer Vorstadt und seit fast zehn Jahren schon die Geliebte des Zaren.
Der Zar nahm Anna Mons den Pokal aus der Hand, stand auf und prostete seinen Gästen zu.
»Trinkt, meine Freunde, auf Russland, auf Moskau und auf die Weiber! Heut Abend soll im Kreml kein Tropfen Wodka mehr übrig sein! Na sdarowje!«
Einer der Männer, ein bärtiger Dickwanst in Generalsuniform, erhob sich schwankend und mühevoll und reckte seinen Becher in die Luft. »Auf Peter Alexejewitsch, den größten Zaren, den Russland je besessen hat!«
Alles grölte vor Lachen – Peter maß stolze zwei Meter und vier Zentimeter. Auch Peter selbst prustete und blies dabei eine sprühende Fontäne roten Weines vor sich auf Teller und Tischtuch.
In diesem Moment flog die zweiflügelige geschnitzte Tür auf, dass im Luftzug alle Kerzen flackerten. Mit weit ausholenden Schritten stürmte ein schmutziger Offizier in der grünen Uniform der Preobraschenski-Garde herein, riss sich die Pelzmütze vom Kopf, warf seinen Reiseumhang auf den Boden und grüßte zackig.
Der Zar sprang auf, stieß einen Freudenschrei aus und stürmte auf den Eindringling zu.
»Aleksascha! Alter Türkenschlächter!«
»Peter Alexejewitsch! Stolz und Freude Russlands!«
Die beiden Männer fielen sich lachend in die Arme und klopften sich gegenseitig heftig den Rücken. Die Gesellschaft brach in Hochrufe aus: »Ein Hoch dem Sieger von Asow! Hoch Menschikow! Es lebe die russische Armee!«
Der Zar nahm Menschikow in den Arm, den er um fast einen ganzen Kopf überragte, und drehte ihn zu den Gästen hin.
»Schaut ihn euch gut an, ihr alle! So sieht ein Sieger aus! Dieser Mann hat unserem Mütterchen Russland die Festung Asow gerettet!« Er packte den Freund bei den Schultern und küsste ihn stürmisch auf beide Wangen. »He, Anna, komm her und begrüße unseren großen Feldherrn, wie sich’s gebührt!«
Anna Mons trat hüftenschwingend auf Menschikow zu, umarmte ihn und küsste ihn unter dem Beifall der anderen auf den Mund. Der Oberst hob sie hoch und schwenkte sie einmal um sich herum.
»Dreitausend tote Osmanen! Achtzig Kolumbrinen erbeutet, hundert leichte Feldgeschütze und dreißig schwere! Zwanzig Kisten mit Sprengminen. So viele Musketen und Bajonette, dass wir ein ganzes Regiment damit ausrüsten können! Zweitausend Wagen mit Proviant, vierhundert Pferde und Kamele!«, zählte Menschikow auf. »Jetzt, meine Freunde, können wir endlich auf Seiten Sachsens in den Kampf gegen den Schweden eingreifen!«
»Ja, jetzt haben wir den Rücken frei, beim Heiligen Nikolaus.« Der Zar klatschte in die Hände. »Wodka!«, schrie er, »Wodka für den Helden von Asow! Wir wollen heute Abend feiern, bis wir umfallen!«
»Halt!« Menschikow hob die Hand. »Ich habe noch etwas ganz Besonderes aus Asow mitgebracht, mein Fürst und Freund, etwas, das ich dir als Beweis meiner ewigen Freundschaft zum Geschenk machen will.« Er drehte sich zur Tür und winkte. »Sieh selbst, ob es dir gefällt!«
Ins Zimmer trat, geschoben von einer alten Dienerin, das türkische Mädchen aus dem Zelt. Man hatte sie in die traditionelle russische Frauentracht gesteckt, eine Art hochgeschlossenen, sackartigen roten Kaftan, der bis zum Boden reichte und dessen Ärmel an den Handgelenken gerafft waren. Aufrecht stand das Kind da, das Haar fiel ihr in langen Locken über den Rücken.
»Was ist denn das?« Der Zar wirkte amüsiert.
»Oh, bloß ein Fundstück aus dem Zelt des türkischen Oberfeldherrn«, meinte Menschikow schulterzuckend. »Ist doch hübsch, oder?«
Peter stellte sich in ganzer Größe direkt vor dem Mädchen auf. Er schürzte die Lippen und schaute auf die Kleine herab, bemerkte kopfnickend ihre kindliche Gestalt, die noch kaum sprießenden Brüste, den langen, schlanken Hals. Mit dem Zeigefinger hob er ihr Kinn an und sah ihr ins Gesicht. Fast prallte er zurück. Unter geschwungenen schwarzen Brauen und dichten Wimpern blickte ein tiefblaues Augenpaar starr durch ihn hindurch, als ob es den Zaren von Russland gar nicht gäbe.
»Wie heißt du, Kleine, he?«
Das Mädchen antwortete nicht.
»Sie wird schon wieder sprechen«, fiel Menschikow ein. »Sie hat Schlimmes erlebt. Aber so in ein, zwei Jahren, denke ich, wirst du sie schon zu etwas gebrauchen können!« Er grinste anzüglich, machte eine obszöne Handbewegung und zwinkerte dem Zaren zu. Die ganze Gesellschaft grölte.
»Ja, aber was mache ich bis dahin mir ihr?«, fragte Peter mit gespielter Verzweiflung. »Anna!« Er winkte die Blondine heran. »Bring die Kleine in den Tjerem zu den Frauen. Und zieh ihr dieses hässliche altmodische Zeug aus. Dawai.« Er klatschte ihr seine riesige Pranke aufs üppige Hinterteil. Anna Mons nahm das Mädchen bei der Hand und führte es hinaus.
Keine Stunde später tanzte Menschikow in Unterhosen auf dem Tisch.
Depesche des Zaren von Russland an den Kurfürsten von Sachsen und König von Polen vom 20.Oktober 1699
Peter Alexejewitsch, Herr und Fürst des ganzen Groß-, Klein- und Weißrussland, zu Moskau, Kiew, Wladimir et cetera, Zar zu Kasan, Zar zu Astrachan, Zar zu Sibirien et cetera, Herr zu Pleskau und Großfürst zu Smolensk, Twer, et cetera p. p. an seine hochwohlgeborene Majestät König August II. von Polen.
Meinen allerfreuntlichsten Gruß zuvor, geschetzter Bruder und Freund. Wir können der Freude nicht genuhg ausdrücken, in der Welt einen solchen Bundesgenoßen wie Euer Serenität an unsrer Seite zu wißen. Derohalben ist es uns eine gantz speciale Freude und wir sind überauß glücklich, Ihnen die guthe Nachricht von eigner Handt mitzutheilen: Mit Gottes Hülfe haben wir den Feindt im Süden gravement geschlagen. Bei Asov am Schwartzen Meer hat die glorreiche rußische Armee mit Grandeur die Truppen der Pforthe vernichtet. Der Friede mit dem Sultan steht kurtz bevor und wird im Sommer gemacht sein.
Unserem Plan, en commun gegen den König von Schweden vorzugehen, indem sich das rußische und sechsische Kriegsvolck, auch das von Denemarck, zu guthem Zwecke verbündet, steht alßo nunmehr nichts mehr im Wehge. So Gott will, sind Livland und Estland bald wiederum pohlnisch, die polnische Krohne ist Ihnen endlich unbestriten, und Rußland besitzt dann ein schöhnes Stück Küßte an der Oßtsee, wo man einen magnifiquen Hafen bauen kann. A la bonheur!
Wir lassen bereits in den nechsten Tagen unsre Armee gegen den Schweden marschiren und versehen uns genzlich der Abmachung, daß Ihre sechsischen und polnischen Truppen im Wintter die livlendische Grentze überschreithen. So Gott will, ist dieser Krieg im Sommer vorbey.
Cher Auguste, wir kennen und schetzen Sie als großer Bewunderer und Verehrer alles Schöhnen. Alß Beweiß unserer tiefsten Verbundenheyt und ernstesten Absichten senden wir Ihnen ein Present von besondrer, gantz delicater Art, sofern die Wehge noch schneefrei und ohne Incommodation zu befahren sind. Es ist eine junge türckische Dame von beßonderer Delicatesse. Wir glauben, dass dies Geschenck Ihnen viel Distraction und Annehmlichkeit bereithen wird, und thut es auch besonderß in kalten Nächten gute Dienste. Auch in Sachsen, so hörtt man, sind die Wintter hart …
Für alle weitteren Absprachen erhält unßer Gesandter, Graf Boris Iwanowitsch Bulganin, mit gleicher Post entsprechende Instructions und auch Vollmacht für wichtige Dezisionen und Beschlüße.
Indeßen empfelen wir uns zu bestendiger Freuntschafft, in der wir getreulich verharren alß Ihr Peter etcetera etcetera.
Dresden, Mai 1700
Dresden, die Hauptstadt des Fürstentums Sachsen, war zwar nicht der Nabel der Welt, aber doch eine Fürstenresidenz von europäischem Rang. Die Stadt bildete das pulsierende Herzstück des wohl reichsten deutschen Staates, in ihren Mauern vereinten sich Geld und Kultur, Kunst und Bildung, Bürgerfleiß und Adelsstolz. Hier im Elbtal lebten beiderseits des träge dahinfließenden Flusses wohl an die zwanzigtausend Menschen, teils dicht gedrängt in winkligen, noch mittelalterlich anmutenden Gassen, aber auch in der weitläufigen, luftigen Neustadt am rechten Elbufer, die Kurfürst August seit dem großen Brand von 1685 nach modernsten Gesichtspunkten Stück für Stück wieder aufbauen ließ. Durch Handel und Gewerbe waren die Dresdner wohlhabend geworden, vor allem aber durch die Tatsache, dass die Stadt seit Jahrhunderten Sitz der sächsischen Herzogs- und Kurfürstenfamilie der Wettiner war und die gesamte Landesverwaltung in ihren Mauern barg.
Dominiert wurde die Stadt seit jeher von den Gebäuden der kirchlichen und weltlichen Herrschaft: der Kreuzkirche und dem Schloss. Erstere, berühmt wegen ihres außergewöhnlichen Turmes, der in seiner Breite fast die ganze Frontfassade einnahm, lag am Altmarkt. Es war ein protestantisches Gotteshaus – Sachsen als Stammland Luthers war dem Katholizismus spinnefeind und seine Bewohner wohl das am stärksten protestantisch geprägte Volk Deutschlands.
Das Schloss selber beherrschte trutzig und imposant das linke Elbufer. Es war ein kolossaler, vielflügeliger Bau. Durch die dunkle Farbe des Elbsandsteins, aus dem es erbaut war, wirkte es von außen beinahe ein wenig düster, trotz der unzähligen reich verzierten Giebel, der vielen kleinen Türmchen und der blitzenden Fensterfronten. Weil die Landesherren ihre Residenz im Lauf der Zeit immer wieder erweitert und umgebaut hatten, war sie zu einem wahren Labyrinth geworden, in dem man sich nur schwer zurechtfand.
Die privaten Gemächer des Kurfürsten August von Sachsen lagen im ersten Stockwerk des Westflügels. Es handelte sich dabei um eine ganze Flucht von luxuriösen Räumen, vom Teesalon bis hin zum Schlafzimmer, die meisten davon mit Zwischentüren verbunden. Herrliche Stuckdecken, Pilaster und Ziersimse schmückten diesen Bereich des Schlosses, alles in Weiß und Gold gehalten. Die Wände waren mit Seidentapeten bespannt, in jedem Zimmer eine andere Farbe. Kostbarste Möbel aus Silber oder exotischen Hölzern bildeten die Einrichtung, dicke Damastvorhänge schluckten Lärm und Sonnenlicht. Auf dem hellen Parkettboden lagen weiche geknüpfte Teppiche aus dem Orient, die Wände zierten Malereien und kostbare Wirkwaren aus den Niederlanden. Selbst das kleinste Zimmer hatte noch einen zierlichen Kachelofen, um im Winter die Kälte abzuhalten.
In einem dieser prunkvollen Räume, dem gelben Empfangssalon, saß der Kurfürst von Sachsen und König von Polen mit heruntergelassenen Hosen auf dem Kackstuhl. An der Wand hinter ihm schwebte eine halb nackte, blumenumkränzte Aurora auf goldenem Prunkwagen der Morgenröte entgegen. Kleine pausbäckige Cupidos umflirrten die Göttin, einer davon zielte mit seinem winzigen Pfeil geradewegs auf den vor ihm hockenden Fürsten.
August trug gemäßigte Staatsgarderobe, waren doch am Vormittag nur die üblichen Empfänge und Besprechungen zu erledigen. Sein pflaumenfarbener Justeaucorps mit den vierundzwanzig Achatknöpfen stand offen und ließ die gleichfarbige, mit Silberstickereien verzierte Weste sehen, an deren Kragen die feine weiße Spitze des Hemds hervorlugte. Die Beine steckten in weißen Strümpfen, die unter dem Kniebund der Hose verschwanden, an den Füßen trug August schwarze Atlasschuhe mit hohen roten Absätzen, die oben am Rist mit einer Silberspange dekoriert waren. Auf Orden und Prunkwaffen hatte der Kurfürst heute verzichtet, nicht aber auf die dunkelbraune Allongeperücke, deren üppige Locken ihm bis auf die Schultern fielen. Das Gesicht des Dreißigjährigen verzog sich wie im Schmerz, als sich sein Darm mit lautem Geräusch entlud.
»O Gott, wie ich diese Purgierkuren hasse! Flemming, mein Riechtier.«
Der Minister griff nach dem kleinen Kristallgefäß in Form eines trompetenden Elefanten, das auf dem Beistelltisch stand, und reichte es dem Kurfürsten. Der sog begierig den Duft des darin enthaltenen rosenölgetränkten Stoffbausches ein. Auch Flemming wünschte sich, er hätte sein Riechfläschchen mitgenommen. Er drückte sein feines weißes Taschentuch an die Nase.
Der Minister war untersetzt und dicklich, hatte runde Maulwurfsäuglein, die ständig blinzelten, einen kleinen Mund und ein Paar Hängebacken, die beim Sprechen leicht zitterten. Man sah es ihm nicht an, aber er war der hellste und wachste Geist bei Hof, ein Politiker von höchsten Fähigkeiten und der bedeutendste Ratgeber des Kurfürsten. Sein wichtigstes Talent lag allerdings darin, stets genau zu wissen, was in seinem Herrn vorging, um ihn auch während seiner schlimmsten Launen lenken zu können.
»Halten Sie durch, Majestät«, sprach er in beruhigendem Tonfall, »nur noch morgen ein letztes Bouillon piquant, dann haben Sie es hinter sich und sind wieder gesund und munter.«
August schnaufte. »Wenn ich nur ein Klistier von weitem sehe, bekomme ich Zustände! Gesund, pah! Ich bin gesund! Diese Ärzte sind allesamt Quacksalber! Dass ich zu dick bin und einen empfindlichen Magen habe, weiß ich selber, aber soll ich deshalb von Wasser und Brot leben? Also, was steht in der nächsten Stunde an?«
Flemming machte einen Bückling. »Draußen warten die Gesandten von Preußen, Frankreich und Russland, Majestät. Sie wissen, die monatliche Vormittagsbesprechung … «
»Ah, ist es schon wieder so weit?« Wieder verzog der Kurfürst-König das Gesicht, stöhnte leise und griff sich an den aufgeblähten Bauch. Diese Darmkrämpfe waren wirklich unerträglich! Das nächste Mal würde er auf keinen Fall zusätzlich diesen ekelhaften Aufguss aus Koloquinten und Sennesblättern trinken! Er erhob sich mit einem kleinen Ächzen, zog die Hose hoch und schloss die Knöpfe. »Na denn, ich lasse bitten!«
Flemming trat zur Tür und öffnete schwungvoll die geschnitzten Eichenflügel. »Majestät sind jetzt bereit, die Herren zu empfangen!«
Die drei Gesandten traten nacheinander ein und zelebrierten jeder eine höfische Verbeugung mit Kratzfuß. Sie verbeugten sich so tief, dass die herunterbaumelnden Locken ihrer Allongen fast den Boden berührten.
Der Kurfürst-König, der inzwischen auf seinem Audienzstuhl Platz genommen hatte, machte eine leichte, aufwärts gerichtete Handbewegung. »Bonjour, meine Herren, erheben Sie sich, je vous en prie. Wir sind außerordentlich erfreut, Sie zu sehen. Aber ich vermisse den Grafen Stratmann – er wird doch nicht unpässlich sein?«
Flemming neigte sich zu Augusts Ohr und sagte halblaut: »Der kaiserliche Gesandte weilt derzeit bei Hof in Wien, Sire.«
»Ach ja, ach ja, ich vergaß.« August runzelte die dichten dunklen Augenbrauen, die seinem Blick oft etwas Theatralisches verliehen. Dann blickte er die Botschafter reihum an. »Nun, meine Herren, wer von Ihnen möchte den Anfang machen?«
Graf Bulganin, der russische Gesandte, ein dürrer, schmallippiger älterer Herr in goldbesticktem Samtjabot und schwarzen Hosen, trat einen zierlichen Schritt vor.
»Wenn ich um die außerordentliche Gunst bitten darf … «
August nickte gnädig. Auf einen Wink hin brachte derweil ein Diener für den Preußen und den Franzosen zwei niedrige, quastenbehängte Taburetts, auf denen sich die beiden in größter Zufriedenheit niederließen. Bei der Audienz einen Polsterhocker zu erhalten, um zu Füßen des Königs sitzen zu dürfen, war eine besondere Gunst, die nicht immer gewährt wurde.
»Euer Majestät«, begann der russische Botschafter, »werden sich höchst allergnädigst erinnern, dass Seine Zarische Serenität, Peter Alexejewitsch, in Seiner allerfreundschaftlichsten Korrespondenz mit Euer Hochgeboren geruht hat, ein Präsent zu erwähnen, das auf den Weg nach Dresden gebracht worden ist … «
August sah fragend zu Flemming hoch, der ihm daraufhin wieder etwas ins Ohr flüsterte. Die Züge des Kurfürsten von Sachsen und Königs von Polen erhellten sich.
»Ja, Wir erinnern uns, Graf Bulganin. Fahren Sie fort.«
»Nun, Sire, die Versendung dieses kleinen Geschenks hat sich wegen des strengen Winters in Russland zu des Zaren allergrößtem Leidwesen und Chagrin verzögert und konnte erst im zeitigen Frühjahr vorgenommen werden. Jetzt erst kann ich das große Vergnügen für mich in Anspruch nehmen, Ihnen diese Bezeugung russischer Freundschaft und Treue präsentieren zu dürfen.«
Bulganin klatschte dreimal laut in die Hände. Die Eichentür öffnete sich erneut, und herein kamen zwei in russischer Dienertracht gekleidete Männer, die eine kleine goldene, an den Seiten mit Samtstoffen verhängte Sänfte trugen. Die beiden gingen gemessenen Schrittes mit ihrer, wie es aussah, nicht allzu schweren Last bis in die Mitte des Raumes und setzten das Geträge dort vorsichtig ab. Dann entfernten sie sich rückwärts unter wiederholten Bücklingen.
Einen endlosen Moment lang stand die Sänfte einfach nur da, neugierig beäugt von allen Anwesenden. Durch die Fenster fielen schräg die Sonnenstrahlen auf das glänzende Ding, brachen sich in den großen Wandspiegeln am anderen Ende des Raumes und tauchten alles in ein warmes, schimmerndes Licht. Der König, dem nie etwas schnell genug gehen konnte, wurde schon ungeduldig, doch gerade als er den Mund öffnen wollte, um etwas zu sagen, griffen zwei kleine Hände durch die Vorhänge und drückten den bunten Stoff zur Seite. Ein verschleierter Kopf, von dem nur ein Paar violettblauer Augen sichtbar war, erschien. Und schließlich stieg mit anmutigen Bewegungen eine Gestalt aus der Sänfte, die aussah wie den Märchen aus Tausendundeiner Nacht entsprungen.
Der Russe warf einen triumphierenden Seitenblick auf seine beiden Kollegen, die mit offenem Mund dasaßen. »Darf ich meinem Herrn, dem Zaren, Eurer Majestät Wohlwollen berichten?«
August antwortete nicht; er sah nur verblüfft auf diese exotische Erscheinung, die so gar nicht in einen sächsischen Empfangssalon passte. Das Mädchen trug kirschrote, halb transparente Pluderhosen, eine Art kurzärmelige blaue Bluse, die den Bauch freiließ und einen durchsichtigen, fast bodenlangen Schleier, in den glitzernde Spiegelstückchen eingewebt waren. Überall an ihrem Körper klirrten Ketten mit Goldmünzen; an den Handgelenken und den nackten Knöcheln bimmelten Glöckchen. Das rabenschwarze Haar fiel in unzähligen kleinen Zöpfchen über ihren Rücken. Mit kleinen Schritten ging das feenhafte Wesen auf August in seinem Audienzstuhl zu, ließ sich vor ihm auf die Knie sinken und berührte mit der verschleierten Stirn die Spitze seines linken Schuhs.
Graf Bulganin trat an ihre Seite. »Sie wurde in der Zeltburg des türkischen Oberbefehlshabers vor Asow gefunden, Sire, vor einigen Monaten. Vielleicht eine seiner Sklavinnen. Jetzt«, der Russe breitete lächelnd die Arme aus, »ist sie die Ihre.«
Der Kurfürst-König sah lange auf die kniende Gestalt herunter, die, das Gesicht immer noch am Boden, sich inzwischen ein Stück von ihm zurückgezogen hatte. Dann hob er den Kopf. »Graf Bulganin, richten Sie Ihrer Zarischen Majestät aus, dass Wir besonders erfreut sind und hoffen, Uns dereinst revanchieren zu können.«
Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen stand der König auf und zog seine silberbestickte Weste glatt. »Graf, würden Sie die Freundlichkeit haben, die Schüssel hinauszutragen?« Er deutete auf den Leibstuhl hinter sich.
Bulganin platzte fast ob dieser unerhörten Ehre, nahm den Behälter mit den Exkrementen des Königs und trug ihn feierlich durch die Tür hinaus, als sei es der heilige Gral selbst.
August winkte lässig mit der weißgepuderten Hand. »Nun lasst Uns bitte alle allein«, versetzte er in Richtung der anderen beiden Gesandten auf ihren Taburetts.
Flemming sah aus, als wolle er protestieren, hielt sich aber zurück. Der Preuße und der Franzose machten mit verkniffenen Gesichtern ihre Abschiedsreverenz und zogen sich zurück. Für diesmal hatte ihnen Bulganin die Schau gestohlen.
»Das war nicht sehr diplomatisch, was, Flemming?«
Der Minister schüttelte mit schiefem Lächeln den Kopf. »Nein, Sire.«
»Macht nichts.« August umrundete derweil mit vorsichtigen Schritten das kniende Mädchen. Er hatte sich inzwischen daran erinnert, was der Zar ihm über das »Geschenk« geschrieben hatte. Ein kleiner Bettwärmer für kalte Nächte, so ähnlich hatte es doch geheißen …
»Jetzt will ich erst einmal mein Geschenk näher besehen. Mohren und Zwerge hab ich ja schon, aber eine kleine Muselmanin … « August bückte sich, nahm das Mädchen bei der Hand und zog es mit einer graziösen Bewegung hoch. Groß ist sie ja nicht, dachte er, als sie so vor ihm stand. Dann nahm er den Schleier und hob ihn über ihren Kopf. Ein ernstes Gesicht blickte ihn an, dunkle geschwungene Brauen, leicht schräg stehende Mandelaugen, hohe Backenknochen, ein regelmäßig geschnittener Mund. Es war schön – doch es war nicht das Gesicht einer Frau.
Mit einem Blick erfasste August den schmalen, noch kindlichen Körper, die eckigen Schultern, den noch nicht vorhandenen Busen.
»Das ist ja noch ein Kind«, entfuhr es ihm. Empört wandte er sich an Flemming, seine fleischigen Lippen bebten. »Dieser russische Barbar glaubt wohl, ich vergreife mich an Kindern! Der König von Polen, ein Päderast! Gott im Himmel, wie dégoutant! Kammerdiener!«
Die Tür öffnete sich, und ein Lakai trat ein.
»Bring Er dieses … dieses Mädchen weg!« August wies mit einer fahrigen Geste auf die immer noch reglos dastehende Gestalt. »Am besten zu Madame Hoym, ja genau. Sie soll sich um das arme Ding kümmern. Vite, vite.«
Nachdem der Diener die Kleine hinausgeführt hatte, sah August seinem Minister mit trübseligem Blick in die Augen. »Da können Sie mal sehen, Flemming. Diese Moskowiter sind doch eine Schande für die gesamte moderne Zivilisation. So was müssen wir nun Bundesgenossen nennen! Und ich lasse diesen Bulganin auch noch die königliche Schüssel tragen, mein Gott, ich könnt mich in den Hintern beißen!«
Königlich polnischer und Churfürstlich Sächsischer Hoff= und Staats=Calender vom 15.Mai 1700
»Am heutigen Tage traf unsere allergnedigste Serenißima, die Kurfürstin=Königin Christiane Eberhardine, von Pretzsch aus bey Hof ein. Ihre königliche Hoheyt hat den kleinen Printzen Friedrich August bey sich, der Seiner Majestät, seinem Vater, noch am Abend anlesslich der großen Masquerade vorgestellt wird. Vivat der kleyne Printz!
Morgen sollen beyde Majestäten sowie der immer noch anwehsende Markgraf von Bayreuth-Kulmbach an der Wildschweinhatz im Schloß=Hof teylnehmen.
Vor dreyen Tagen kam als außer=gewehnliches Geschenk Seiner czaarischen Majestät, des großen Peter von Russland, ein türckisches Mädchen an den Hof. Ist um die zwelf Jahr alt, und vermuthet man, sie sey von hoher Geburt, gar vielleicht die Tochter eines Sulthans, was aber nicht mit Sicherheyt zu sagen ist, denn das Kindt ist stumm. Madame Hoym hat sich ihrer allergütigst angenommen und hat verlauthen laßen, sie würd sie haltten alß sey sie ihr eigen Fleysch und Bluth.
Gestern gieng die alljärliche Faßten=Kur unseres allerhöchsten Kurfürsten und Königs zu Ende. Der Hof=Medicus Doctor Tropanegger vermeldet, Ihre Majestät habe teglich ein Bouillon piquant und einen Purgier=Aufguß erhaltten und zuletzt 29 Töpgen Sauerbrunnen getruncken. Der Serenißimus erfreut sich nunmehro wieder außgetzeichneter Gesundheyt, mißt um den Bauche 103 Centimetres und wieget einhundertundfünff Kilo=Gramms … «
Fatmah
Sie stinken. Aus allen ihren Poren dringt übler Geruch. Obwohl sie sich mit sämtlichen Wohlgerüchen der Welt parfümieren, riechen sie darunter schlimmer als der alte Ziegenbock, den meine Schwester Zeynep im Innenhof neben ihrem Schlafzimmer halten lässt. Ich glaube, sie waschen sich nicht! Sie meinen, edel und vornehm zu sein, aber ich habe noch nie gesehen, dass einer von ihnen ins Bad geht. Ja, ich habe in dem ganzen großen Palast überhaupt noch kein Bad entdeckt. Erst habe ich gedacht, sie lassen nur mich einfach schmutzig sein, weil ich eine Sklavin bin, aber nun glaube ich, dass sie selber so sind. Allah, manchmal muss ich mir die Nase zuhalten, damit mir nicht von ihrem Gestank übel wird. Aber es ist ja kein Wunder, dass sie riechen, denn sie tragen so enge und dicke Kleider, dass es dem Körper nicht zuträglich ist und sie dauernd schwitzen müssen, obwohl es hier doch so kalt ist. In den Frauenkleidern kann man sich kaum bewegen. Obenherum ist eine Art hartes Gitter aus Leder mit Knochen oder Metall, in das man sich zwängen muss, dann ist man darin wie eingesperrt. Dafür sind untenherum lauter Reifen, die das Gewand weit von den Beinen weghalten, sodass es darunter dauernd kühl und zugig ist. Wenn man das Gitter anhat, kann man kaum atmen und kommt sich vor wie in den Folterkellern des Padischah. Ich kann nicht verstehen, warum sich die Frauen so quälen und wie sie es bloß aushalten können. Vielleicht schreibt ihnen ihr Glaube diese Art Kleidung vor. Als ich so ein Folterkleid das erste Mal anhatte, bin ich nach einer Stunde umgefallen. Ich habe es noch mehrmals versucht, aber es geht nicht, ich bekomme keine Luft, und mir wird schwindelig und schlecht. Jetzt lassen sie mich ein lockeres, langes Kleid anziehen, das aber immer noch an den Hüften einschnürt. Zwar falle ich nun nicht mehr um, aber ich glaube, ich werde mich nie daran gewöhnen. Fast genauso schlimm sind die Schuhe, die man hier trägt. Sie sind unter den Fersen hoch, dass man meint, nach vorne kippen zu müssen, und sie machen Blasen, weil sie an den Zehen so eng sind. Wie wünsche ich mir ein Paar schöne weiche Pantöffelchen von daheim!
Jeden Abend wenn ich zu Bett gehe, weine ich, weil ich hier fort will. Die Menschen sprechen eine Sprache, die hart und abgehackt klingt. Ich verstehe nichts von dem, was sie sagen, obwohl ich viele von ihren Gesten deuten kann. Ich bin ganz allein. Ach Allah, ich flehe zu Dir, sieh meine Tränen und nimm mich weg aus diesem Land, von diesen fremden Leuten. Bitte, ich will wieder nach Hause. Dauernd frage ich mich: Warum strafst Du mich so, Allmächtiger? Ich habe nichts Schlimmes getan, genau wie Anam, meine Tanten, Zübeyde und Aischegül. Nicht einmal der dicke Mustafa hat jemals etwas Schlimmes getan, er hat immer gut über uns gewacht, wie es die Pflicht der Eunuchen ist! Warum, o Barmherziger, hast Du zugelassen, dass unser Haremlik im Blut ertrunken ist? Jede Nacht träume ich grauenhafte Dinge – Dinge, die ich am Tag gar nicht denken will. Ich schreie dann wohl, glaube ich, weil immer eine Dienerin kommt und mir übers Haar streicht und versucht, mich wieder zu beruhigen. Sie bringt mir auch meistens heiße Milch und ein neues Schlafgewand, weil das alte nass vom Schweiß ist. Und dann singt sie mir Lieder vor, mit merkwürdigen Melodien, die meine Ohren beleidigen. Es hört sich an, wie wenn ein Schaf blökt, weil es sich verlaufen hat und nach der Herde schreien muss, Allah kerim!
Ich kann mich gar nicht genug darüber erstaunen, dass die Frauen hier keinen Schleier tragen. Nicht einmal die Lieblingsfrau des großen Sultans von Sachsen, dem ich jetzt gehöre, verhüllt ihr Gesicht. Jeder kann sie einfach anschauen und sehen, ob sie hübsch oder hässlich ist! Der gnädige, allmächtige, große Allah möge verhüten, dass ich noch hier bin, wenn ich älter bin. Aman! Ich müsste ja mein nacktes Gesicht schamlos jedem Diener, jedem lüsternen Mann zeigen. Eine größere Schande kann ich mir nicht vorstellen.
Seltsam ist auch das Haar der Franken, bei denen ich jetzt lebe. Die Diener sind meist braun- oder hellhaarig, manchmal auch dunkel, aber so schwarze Haare wie wir Osmanlis hat keiner. Und die vornehmen Menschen haben fast alle weißes oder graues Haar, das wie dicke Wolle aussieht. Sie tragen es entweder hoch auf dem Kopf aufgetürmt oder in Locken lang herabhängend, Männer wie Frauen. Und die Männer haben allesamt keinen Bart! Dabei birgt das Gesichtshaar doch heilige Kraft: »Der Bart ist Allahs Licht«, sagt der Imam. Aber vielleicht ist ihr Gott ja auch nackt und bloß im Gesicht, wie sie. Ich weiß es nicht, denn sie haben mich noch nicht mit in ihre Moschee genommen.
Die Frau, in deren Haushalt ich wohne, heißt Hoym Hanimefendi. Die meisten sagen aber Madame zu ihr. Sie ist ein großes und lautes Weib, lacht viel und muss jeden Abend den Sultan besuchen. Zu mir ist sie freundlich und tätschelt mir immer die Wangen, was mir gar nicht gefällt. Aber ich muss ja froh sein, dass sie mich gut behandelt und nicht schlägt, wie sie es bei einer Sklavin leicht könnte. Ich habe ihr meinen Namen aufgeschrieben, und dass ich nach der Lieblingstochter des Propheten benannt bin, aber sie kann unsere Schrift nicht lesen. Wenn die Leute hier schreiben, dann sieht es aus, wie wenn ein Huhn übers Papier gelaufen wäre, nicht so rund und fein geschwungen wie bei uns. Weil sie nun nicht wissen, wie ich wirklich heiße, haben sie mir einen Namen gegeben: Sie nennen mich »Du«, und dabei zeigen sie mit ausgestrecktem Finger auf mich. Das ist so demütigend und beleidigend. Daheim hätte mein Vater jeden dieser Finger zur Strafe abhacken lassen! Inzwischen glaube ich aber, dass sie es gar nicht böse meinen!
Im Selamlik der Hoym Hanim gehen nicht nur Frauen, sondern auch viele Männer ein und aus. Sie haben hier keine Mohren als Eunuchen; ich habe im Palast überhaupt erst einen Mohren getroffen, und das war der Leibdiener für die Schlafkammer des Sultans. Warum aber der Sultan einen Eunuchen für sich braucht, habe ich noch nicht herausgefunden.
Immer bete ich darum, dass mich mein Schicksal wieder heimführen wird. Man muss an das gute Kismet glauben, sagt der Imam. Aber dann denke ich wieder, ich weiß doch gar nicht, wohin ich gehen soll! Alle sind sie tot, alle. Mein Babadjim hat die Seidenschnur gewählt, weil er die Schlacht verloren hat. Das haben sie mir im Haremlik nicht gesagt, aber ich habe gehört, wie sie leise darüber geredet haben. Er ist einen ehrenvollen Tod gestorben und darf jetzt im Garten des Paradieses die süßesten Früchte genießen, Inschallah. Das hat er verdient, denn er ist immer gut zu uns gewesen, auch zu mir, obwohl ich nur ein Mädchen und die zweite Tochter seiner siebten Frau bin. Damals, als ich heimlich aus den Frauengemächern ausgerissen bin, um das Schattenspiel auf dem Meydan zu sehen, hat er dem Eunuchen die Rute aus der Hand genommen und ihm verboten, mich zu schlagen. Und nun, wo mein armer Vater tot ist, frage ich mich: Wer lebt jetzt wohl in unserem schönen Haus in Adana mit den Wassergärten, den Säulengängen und den schattigen Innenhöfen? Bestimmt gehört alles nun fremden Leuten! Kann ich dort noch hin? Würde man mich aufnehmen? Und wenn, kenne ich zu Hause überhaupt noch jemanden? Ich weiß es nicht, eyvah! Nichts gehört mir mehr, nichts ist mehr, wie es war.





























