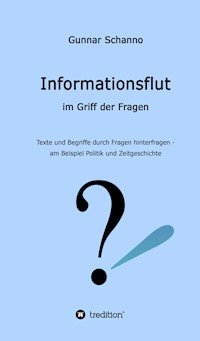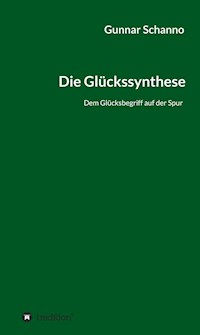7,80 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Beobachtungen des Autors und Fachjournalisten Gunnar Schanno enden nicht im Abgesang auf das Buch, wie es als dominierendes Medium über ein halbes Jahrtausend geherrscht hat. Doch fragt er schonungslos kritisch, wie die Rollenverteilung sein wird zwischen dem Buch und seinen elektronischen Konkurrenten. Ist das Buch nur noch Beuteobjekt der Internetkrake? Wie verlief sein Weg vom Premiumprodukt der Medienkultur zum Nebenprodukt? Wie verläuft künftig sein Weg als eher kleines "added value" zur Informationsmaschine Internet? Was bleibt noch für das Buch, leidet es an Altersschwäche, ist es aussterbende Spezies? Ist der Buchmarkt reif für das Internet? Die Betrachtungen des Autors sind auch eine Hommage auf das Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der Autor, Gunnar Schanno, ist Fachjournalist und Buchautor gesellschaftspolitischer Themen.
Nach erfolgreicher Buchhandelslehre mit Abschluss in Freiburg im Breisgau studierte er Kommunikationswissenschaft an der Mainzer Universität und war langjährig in einem Wissenschaftsverlag tätig. Für das Branchenmagazin Buchhändler heute war er regelmäßiger Autor. Er ist auch publizistisch aktiv in interkulturellen Gesellschaften.
Im vorliegenden Werk gibt er einen kulturkritischen Rückblick auf die Hochform des Buchs vor dessen Abstieg zum Nebenprodukt unter den Medien und pointiert in anregenden Sprachbildern, wie und mit welchen Konsequenzen die sich überstürzenden technologischen Entwicklungen im Medienbereich das Verhältnis zur Kultur-Ikone Buch rasant verändern - sowohl für den Leser als auch für traditionelle Buchverlage oder Buchhandlungen – nicht zuletzt für Autoren!
Der Autor selbst hat sich der Dynamik unterworfen und das Werk in das doppelgesichtige Konzept von Print- und e-Book gestellt. Das erschien nur folgerichtig, da viele im Buch gelisteten Literaturquellen aus der Online-Welt stammen. Mehr noch: Er hat die im Buch beschriebenen Konsequenzen nicht unbeachtet gelassen und einem mit Innovationspreisen bedachten Verlagsformat den Vorzug gegeben, das sich auch als Netzwerk versteht mit Anbindungen an Unternehmen, darunter auch verschiedenste Verlage, Universitäten, Forschungseinrichtungen und natürlich mit Einbindung in die Welt von Online-Portalen.
Gunnar Schanno
Das Buch im Griff des Internets
Ein kulturkritischer Zustandsbericht
© 2013 Gunnar Schanno
Lektorat, Korrektorat und Satz:
Angelika Fleckenstein, spotsrock.de
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Printed in Germany
ISBN: 978-3-8495-6970-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Das Buch - ein Archetyp der Kultur
Das Buch - Premiumprodukt der Kultur
Das Buch - fortan ein Nebenprodukt der Kultur?
2. Das Buch - Premiumprodukt der Wertschöpfung
Das Buch - fortan ein Relikt der Wertschöpfung?
Das Buch als Medium wirtschaftlicher Zwänge – das Internet im Reich der Freiheit
Das Buch - fortan Phantom der Netzwerkwelt
Wo bleibt das Buch - Abspaltung seines Contents?
Das Buch - einst Machtinstrument der Bildung
Das Buch – zwischen Beziehungs- und Billigobjekt
Wo bleibt der Verleger – der Büchergott?
Das Buch – sein eigener Konkurrent
3. Das Internet als interaktiver Turbolader für gesellschaftspolitische Dynamik
Open Content statt Buch
Bildungsserver statt Buch
Wissenspool statt Buch
Das Internet als Turbosystem politischer Prozesse – nicht das Buch
Das Internet als Turbosystem individueller Prozesse – nicht das Buch
Das Buch – Würdigung einer Ikone
4. Das Buch als Quellgrund des Internets
Das Buch im Wandel seiner Funktionen
Das Buch – seine ökonomisierte Massenform
Das Buch als Reihe – ein Objekt technischer Dimensionen
Das Taschenbuch - Prototyp des Massenmarkts
Das Kontinuum - auch ein Buchprinzip
Das Sachbuch als Fitmacher für die Wissensgesellschaft
Rowohlt: Tempo in der Buchbranche
Reclam: Der klassische Pionier aller Textreihen
Goldmanns Tausend Taschenbücher
Fischers Tausend Taschenbücher
Erzählungen und Gedichte aus 1001 Suhrkamp-Taschenbüchern
Die Büchermasse - reif für das Internet
5. Das Buch als koexistentes Medium
Die Printwelt an ihren Grenzen
Wozu noch Bücher?
Das Buch – ein Hybrid-Produkt
Wo bleibt die Buchbranche?
Wo findet das Buch sein Survival?
6. Literatur
Print-Quellen
Online-Quellen (ohne Subdomain alswww.-Zugangskürzel)
Vorwort
Die Beobachtungen des Autors enden nicht im Abgesang auf das Buch, wie es als dominierendes Medium über ein halbes Jahrtausend geherrscht hat. Doch fragt er schonungslos kritisch, wie die Rollenverteilung sein wird zwischen dem Buch und seinen elektronischen Konkurrenten. Ist das Buch nur noch Beuteobjekt der Internetkrake? Wie verlief sein Weg vom Premiumprodukt der Medienkultur zum Nebenprodukt? Wie verläuft künftig sein Weg als eher kleines „added value“ zur Informationsmaschine Internet? Was bleibt noch für das Buch, leidet es an Altersschwäche, ist es aussterbende Spezies? Ist der Buchmarkt reif für das Internet?
Die Betrachtungen des Autors sind auch eine Hommage auf das Buch. Alle Kapitel beleuchten das Buch aus der Perspektive des Bedrohungspotenzials der Internetmacht. Nicht weil es immer häufiger seine Besitzer über Online-Buchshops wechselt, sondern weil das reale Buch bedrohlich schnell ersetzt wird durch das virtuelle: Sei es als EBook, sei es durch elektronischen „Content“, aber auch, weil das Buch verdrängt wird durch den Zeit fressenden, Aufmerksamkeit zehrenden Aktionismus im Internet.
In diesem Kontext verweist der Autor immer auch auf die veränderten ökonomischen Bedingungen der Medienwelt, die in weiten Bereichen das Ausmaß einer Entökonomisierung erreicht haben. Das Medium Buch nämlich ist reales Ressourcen und Geld zehrendes Produktionsgut aus der Welt klassischer Ökonomie. Das Internet ist virtuell, so gut wie ressourcenfrei, ist Massenmedium und Massenspeicher und ist so gut wie frei verfügbar für die Masse. In bedrohlichem Maß wird das dem Buch zum Verhängnis.
Der Autor nennt auch in seinem stets vorwärtstreibenden Stil weiterführende Argumente für die Überlegenheit des Internets gegenüber traditioneller Buchkultur: Nämlich besonders da, wo es als informationelles Turbosystem gesellschaftliche Prozesse beschleunigt oder gar aufheizt. Der Autor erkennt aber zugleich beispielreich die Unüberwindlichkeit des Buchs an - als einen unauslöschlichen und bleibenden Archetyp der Kultur.
1. Das Buch - ein Archetyp der Kultur
Das Buch - Premiumprodukt der Kultur
Das Buch: Ein Massenphänomen, ein Markt. Ein halbes Jahrtausend war das Buch ein Königsmedium. In seiner europäischen Form als Druckwerk seit dem 15. Jahrhundert hat es als unverwechselbares Medium seine heutige Form und Erscheinung erhalten und bewahrt. Zwischen dem 15. Jahrhundert, beginnend und verbunden mit dem Namen Johannes Gutenberg und seiner Erfindung des Buchdrucks, und endend mit dem 20. Jahrhundert, verbunden mit dem sich beschleunigenden Transfer der Buchinhalte in elektronische Medien, hatte das Buch seine unangefochtene monomediale Stellung als Premiumprodukt der Kultur.
Das gedruckte Buch: Einst die alleinige Quelle für Wissen, Weisheit und Weltkultur, als Kulturträger, als Bildungsgut, als Materialisierung und Schatzkammer des Geistes, als Medium für die Kulturtechnik des Lesens. Das Buch als Medium, seine Durchdringung in der Bevölkerung als Maßstab für Bildungsstand. Wo kein Buch, da keine Bildung! Das Buch aber auch als Lustobjekt, wenn es das Schöne, Erhebende und Erhabene in kunstvoller Schrift und Grafik wiedergab, wenn es Bekenntnisse zu Glaube, Liebe und Hoffnung weitertrug. Das Buch als Kult, wenn es zum künstlerisch gestalteten Objekt erkoren wurde. Das Buch als Qualobjekt, wenn sein Inhalt für die Schule des Lebens zum Lern- und Bewährungsstoff bestimmt war. Das Buch als Vademekum, als Lebenselixier, in anthropomorpher Erhöhung als Freund, Begleiter, als Tröster, Helfer, Ratgeber, Retter. Das Buch aber auch als Verderber, als Anstifter, Träger von Irrtümern, als Schund, wenn es für Kritik und indizierte Verteufelung seines Autors steht. Das Buch auch als Hassobjekt, wenn mit ihm und seiner Verbrennung stellvertretend der Autor verbrannt werden sollte. Das Buch als Kleinod häuslicher Atmosphäre und Kulisse der Bücherwand, als Prestigemittel, wenn es Status, Bildungsstand und Ansehen signalisierte.
Das Buch im Mittelpunkt von was? Ja, doch auch noch von Buchmessen! Noch sind sie Bühne des Buchs – bei aller Manie um E-Book & Co. Immer noch, so heißt es, sei Büchermesse auch Büchermasse. Die Leipziger Buchmesse zum Beispiel ist das jedes Jahr stattfindende märzliche El Dorado der Bücherwelt, in der die bundesrepublikanische Vielfalt inmitten der Internationalität im Bücherkosmos auch atmosphärisch zu spüren ist, mehr als auf der Frankfurter. Wenn es Freude und Interesse am Buch zu wecken gilt, dann ist eine Messe, auf der eben dieses Objekt im Mittelpunkt steht, allemal ein guter Anlass. Es ist ein guter, sinnenfroher Anlass, weil das Buch der klassische Mittelpunkt unter den Medien geblieben ist. Es ist es geblieben allen Zweifeln zum Trotz, umringt und inmitten der Konkurrenz neuer Medien und weltumspannender Netzwerke der Informationsflut. Womit sonst als mit dem Buch soll sich ein Ehrengast der Buchmesse vorstellen, Identifizierbarkeit erreichen, Kulturnähe propagieren – auch Neuseeland als Ehrengast 2012 auf der Frankfurter Buchmesse ließ veritable Bücher „tanzen“. Die Unterscheidung zur Tourismusmesse war wieder dank Buch gerettet.
Das Buch – das antiquarische vornehmlich - Objekt der Liebhaberei, wenn nicht der Begierde. Das Buch in kapitalistischer Wirtschaftsverfassung als Produkt, als Handelsobjekt, als Geldquelle. Wenn das Buch nicht in Reichweite, nicht greifbar, einfach nicht zur Hand war, dann war oft nichts als Rat- und Hilflosigkeit, dann war guter Rat teuer, dann war Suche nach Quellen schwarz auf weiß angesagt, dann war oft jede mündliche nichts als eine unbewiesene Aussage, solange ein Nachschlagen im Buch nicht Gewissheit schuf. Das Buch war Premiumprodukt der Kultur, wie analog dazu der Kulturträger Mensch so etwas wie das Premiumprodukt der Natur darstellt.
Die Universalität des Buchs bestand in seiner Funktion und Leistung, der Flüchtigkeit geistiger Inhalte entgegen zu wirken, den Geist wie in der Flasche zu bannen, seiner immerzu habhaft zu sein, seine inhaltlich-verkündende Substanz buchstäblich material dingfest werden zu lassen, sie in identischen, thematischen Einheiten rezipierbar zu machen für den Einzelnen allein oder zu teilen mit einer Vielzahl von Menschen: Darin war das Buch das eindimensionale monomediale Medium in Solitärstellung bis zum Aufkommen technisch basierter Verbreitungsträger von Schrift, Bild und Ton. Seine Universalität beginnt es um die Jahrtausendwende abzugeben an das World-Wide-Web.
Das Buch - fortan ein Nebenprodukt der Kultur?
Das Ende des Buchzeitalters? Die Gutenberg-Galaxis (McLuhan 1962) am Ende? Der Medienwissenschaftler Marshall McLuhan (1911-1980) prägte mit dem Titel seiner geradezu epochalen Schrift von der Gutenberg Galaxy (1962) die Metapher schlechthin für ein halbes Jahrtausend Buchzeitalter. Inzwischen ist die Rede vom Ende der Gutenberg-Galaxis. Ein unscheinbares kleines „e“ für „elektronisch“ ist zum Killervirus der haptischmaterialen Bücherwelt geworden. Wird das Buch zum Nebenprodukt der Kultur?
Es wird aber auch von einer Zukunft der Gutenberg-Galaxie gesprochen (Essay-Sammlung APuZ, 42-43, 2009), die nicht davon ausgeht, dass das Buch als Massenmedium in gedruckter Form gänzlich Vergangenheit sein wird, sondern in Ergänzung, nicht einmal in Konkurrenz zum elektronisch geschaffenen Ersatz, zu elektronischen Medien seine Zukunft haben wird.
Einige griffige Titel seien deshalb angeführt, weil sie auch zwei Protagonisten ins Namensspiel bringen, die am Beginn des alten und am Beginn des neuen Medienzeitalters postiert sind: Von Gutenberg zu Gates (im Einführungskapitel von Wunderlich und Schmid, 2008). Bill Gates, 1975 Mitgründer des Computer-Betriebssystems Microsoft: Ist er der Gutenberg der beweglichen Erscheinungsform als Voraussetzung für die elektronisch basierte Massenverbreitung von Information auf technischen Gerätschaften, wie seiner Zeit der echte Gutenberg der Meister der beweglichen Letter war als Voraussetzung für die druckwerkbasierte Massenverbreitung von Information in Buchform?
Es ließe sich darüber reflektieren, wie verwandt die Phänomene sind, wie sehr der Mensch als Rezipient der geblieben ist, der er war, als es auch Sensation war, als die ersten Buchexemplare in drucktechnisch identischer Form in Erscheinung traten, wie es Sensation war, als sich Text- und Bildinhalte digitalisiert über elektronische Netzwerke, seit den 1970er Jahren unter dem Kurz-, Sammel- und Netzwerkbegriff Internet, über die Welt zu verbreiten begannen.
2. Das Buch - Premiumprodukt der Wertschöpfung
Das Buch - fortan ein Relikt der Wertschöpfung?
Eine weitere Charakterisierung bringt die Lage des Buchs aus den Konsequenzen des Internets mit dem Begriff der „digitalen Ökonomie“ auf den Nenner, wie er sich analog dazu als Titel des Kapitels Von der Gutenberg-Galaxis zur digitalen Galaxis (Zimmermann 2008) findet. Immerzu kreisen die zahlreichen Analysen letztendlich auch um die Gefahr der Internetkonkurrenz für jegliches Druckwerk (auch und besonders für die auf Tagesaktualität hin verbreitete Zeitung). Konkurrenz nämlich entsteht aus der schieren Masse elektronischmultimedial und sekundenschnell präsentierter Information, mit der jeder Nutzer weltweit und jederzeit seine Interessen aus allen Wissensgebieten abdecken kann.
Der Wissbegierige, der Informationssuchende, der einst und vornehmlich aus Bücherquellen schöpfende Leser, bedarf er – außer zeitnäherer Zeitungsquelle - noch der kompakten, dinglich geschlossenen Form des Buchs? Bieten nicht die schnell über Stichworte gesammelten und zusammengeführten Informationspartikel aus welchen Quellen auch immer genug Ersatz für kostenträchtigen Bucherwerb? Das Buch - eine abnehmende Spezies, ein Relikt der Wertschöpfung, fernhin nur noch museales Objekt? Das Buch - der friedliche, pflanzenfressende, langsam verdauende Dinosaurier des Kulturhabitats, gejagt und vernichtet vom schnell agierenden, neu aufkommenden, fleischfressenden, schnell verdauenden Tyrannosaurus Rex der digital-basierten Zivilisation? Das Buch, das langsame Objekt bewusster Entschleunigung in geschütztem Raum für Ruhe und Konzentration, für bedächtiges In-die-Hand-nehmen, für Zeit zum Umblättern, für disziplinierte Blickrichtung und Augenbewegung, als mono-mediales Objekt reinen Mono-Taskings?
Die Brisanz von Internetnutzung liegt jedoch in all den multi-medialen Möglichkeiten beschleunigter Rezeption, weniger im Reiz eines von Gerätschaft unterstützten multimedialen Multi-Taskings, und auch weniger in der Verführung durch Abruf ungeheurer Informationsmassen und der globalen Verbreitung elektronischen Inhalts. Die Brisanz liegt in der Erosion des ökonomischen Prinzips, das im Buchzeitalter galt und noch erhalten ist - doch in sinkender Kurve. War schließlich mit dem Buch als Produkt, als Ware doch eine ganze Wertschöpfungskette verbunden über die Stadien Verlag, Satzbetrieb, Druckerei, Buchbinderei, Zwischenhändler, Buchhandlung.
Diese traditionelle Wertschöpfungskette ist mit der Schaffung und Verbreitung des Internets unterbrochen worden. Die Millionen von Arbeitsstunden, die unzählige Informationslieferanten welcher Befähigung oder Sachbezogenheit auch immer damit verbringen, Informationsstoff welcher Qualität auch immer in die Netze einzustellen, sie finden keinen dem Arbeits- und Zeitaufwand entsprechenden ökonomischen Gegenwert. Der Lebensunterhalt der Lieferanten speist sich in der Regel aus anderen Quellen, wie es etwa familiäre oder sonstige soziale Einbettungen in unterschiedlichste Lebenssicherungssysteme sind.
Die Ironie des Vorgangs liegt also auch darin, dass es noch weitgehend die materialen Produkte der Ökonomie sind, also die der Realwirtschaft, ob im Bereich von Medien-, Konsum- oder Gebrauchsgütern, die dem Heer von Zuträgern in elektronische Netze die ökonomische Absicherung, zumindest aber finanzielle Gegenwerte bieten. Es ist eine verkehrte Welt der Wirtschaft, in der nicht für konsumierte Ware bezahlt wird, es ist eine Hybridform der Wirtschaft, die vom Prinzip Hoffnung lebt. Mögen es unaufgeforderte Werbeangebote sein, meist in Form so genannter Banner, die im Umfeld der gesuchten Information erscheinen, die Aufmerksamkeit des Internetnutzers wecken und ihn zu Erwerb, zu Kauf, zum Konsumenten eines ähnlichen oder anderen als dem momentan genutzten Gut verführen sollen.
Die Wirtschaft, genauer die Betriebswirtschaft, die Unternehmer, die Lohnabhängigen, die für das Internet schreibenden Aktivisten und Einzelkämpfer, sie ringen dennoch letztlich um nichts anderes als um finanzielle Vergütungen in welchen Bezahlformen auch immer, also um finanziell honorierten Gegenwert ihrer immer zeit- und, wenn Online-Präsenz unternehmerisch dimensioniert ist, auch kostenaufwendigen Inputs in das Internet. Wird die Technik an anderer Stelle helfen und den Schaden für die Medienindustrie wettmachen, den sie angerichtet hat? Wird sie den Kreis derer, für die ein virtueller Content konkret genug und sein applizierter Online-Abruf der Bezahlung wert ist, weiten können? Kann etwa diese unter dem Kürzel App für Applikation - im Sinne des Abrufs möglichst bezahlter Online-Informationen, nicht zuletzt das elektronische Buch - das ökonomische Prinzip von Input und Profit für die Content-Lieferanten wieder stabilisieren helfen?
Das Buch als Medium wirtschaftlicher Zwänge – das Internet im Reich der Freiheit
Während die Herstellung von Büchern in Printform bei allen Rationalisierungsmöglichkeiten immer nachrechenbar mit Kosten verbunden ist, umweht bei den Millionen von Internetnutzern das elektronische Medium geradezu ein Fluidum materialer Unabhängigkeit, informationeller Freiheit. „Ein Buch lesen“, so hieß oder heißt es beim Charakterisieren des üblichen Rezipierens von Druckwerken in Buchform. Seine Bilder anschauen, betrachten, so heißt es auch, so das Druckwerk auch Bildinhalte hat. Das Internet aber, es wird genutzt, ins Internet „geht man“. In ihm rezipiert der Nutzer wie von freischwebenden, ätherischen Inhalten, die jeder in die Welt senden und aus ihr empfangen kann. Mit dem Internet ist um die Zweijahrtausendwende konkurrenzlos ein neues Land der unbegrenzten Möglichkeiten wie aus dem Nichts entstanden. Mit der digitalen Welt ist ein Utopia des Geistes wahr geworden, wie es einst sozialutopische Lehren vor, mit und nach Karl Marx herbeiführen wollten.