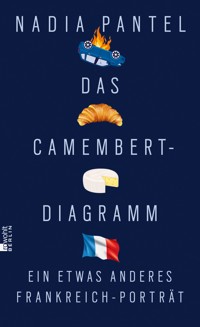
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kaum ein anderes Land zieht uns so sehr an wie Frankreich – aber wie genau kennen wir unseren wichtigsten Nachbarn eigentlich? Nadia Pantel wirft einen ganz neuen Blick auf Leben, Kultur und Gesellschaft des Landes – und zwar anhand des populärsten französischen Exportguts, des Essens. Sie führt uns in vertraute und unbekannte Gegenden und zeigt mit wunderbarem Charme und Witz, wie eng in Frankreich Essen mit Politik, Gesellschaft und Geschichte verbunden ist. Pantel nimmt uns mit in eine Bretterbude in der Bretagne, wo ein Dutzend Austern für Luxus stehen, den sich jeder leisten kann; sie denkt beim Pain au chocolat über Mutterschaft und Kindererziehung nach, bei einem Bœuf Mafé im Sternerestaurant über Kolonialismus, bei den Sammlern von Camembert-Etiketten in der Normandie über die gesellschaftlichen Niedergangsdiagnosen oder am Würstchengrill der Gelbwesten über die anhaltenden Unruhen im Land und erörtert mit dem «Steak-frites-Nationalismus» die heiklen Auswüchse der politischen Kulinarik. Ein originelles, sinnenfrohes Porträt – und zugleich eine genussvolle Einladung, Frankreich mit anderen Augen zu entdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Nadia Pantel
Das Camembert-Diagramm
Ein etwas anderes Frankreich-Porträt
Über dieses Buch
Kaum ein anderes Land zieht uns so sehr an wie Frankreich – aber wie genau kennen wir unseren wichtigsten Nachbarn eigentlich? Nadia Pantel wirft einen ganz neuen Blick auf Leben, Kultur und Gesellschaft des Landes – und zwar anhand des populärsten französischen Exportguts, des Essens. Sie führt uns in vertraute und unbekannte Gegenden und zeigt mit wunderbarem Charme und Witz, wie eng in Frankreich Essen mit Politik, Gesellschaft und Geschichte verbunden ist. Pantel nimmt uns mit in eine Bretterbude in der Bretagne, wo ein Dutzend Austern für Luxus stehen, den sich jeder leisten kann; sie denkt beim Pain au chocolat über Mutterschaft und Kindererziehung nach, bei einem Bœuf Mafé im Sternerestaurant über Kolonialismus, bei den Sammlern von Camembert-Etiketten in der Normandie über die gesellschaftlichen Niedergangsdiagnosen oder am Würstchengrill der Gelbwesten über die anhaltenden Unruhen im Land und erörtert mit dem «Steak-frites-Nationalismus» die heiklen Auswüchse der politischen Kulinarik. Ein originelles, sinnenfrohes Porträt – und zugleich eine genussvolle Einladung, Frankreich mit anderen Augen zu entdecken.
Vita
Nadia Pantel, geboren 1982, studierte in Freiburg im Breisgau, Berlin und Krakau Geschichte und Germanistik. Von 2018 bis 2022 war sie für die «Süddeutsche Zeitung» Korrespondentin in Frankreich, lebte in Paris und bereiste das ganze Land. In dieser Zeit schrieb sie ihre erfolgreiche Kolumne «La Boum» über ihren Pariser Alltag. Seit 2022 ist sie Reporterin für den «Spiegel», schreibt weiterhin über Frankreich, zusätzlich aber auch über Mittel- und Osteuropa. Für ihre journalistische Arbeit wurde sie unter anderem mit dem Deutschen Reporterpreis (2021), dem Deutsch-Französischen Journalistenpreis (2023) und dem Herbert-Riehl-Heyse-Preis (2023) ausgezeichnet.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Zitat S. 16: E. M. Cioran, «Über Frankreich», in der Übersetzung von Ferdinand Leopold, © Suhrkamp Verlag, Berlin 2010
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Getty Images; Shutterstock; 123RF
ISBN 978-3-644-02189-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
J’aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer.
Anne Sylvestre
PrologCarottes râpées oder Wie alles begann
Meine Oma konnte nicht gut kochen, meine Oma konnte gut essen. In Rum getränkten Kuchen zum Beispiel oder Nougatpralinen, die so groß waren, dass der Hersteller sie «Rocher» nannte. Es waren nicht die kleinen von Ferrero, sondern massige Dinger, die wirklich aussahen wie Felsen. An sich führte meine Oma das Gegenteil eines mondänen Lebens. Gemeinsam mit meinem Opa lebte sie in einem kleinen Haus, das zur Hälfte aus einer Garage bestand, in die gerade mal ein Peugeot 205 hineinpasste. Doch wenn ich mich an meine Oma erinnere, dann erscheint sie mir manchmal wie ein alternder Filmstar, der durch eine Aneinanderreihung von Fehlern und Missverständnissen in einem hundsöden Dorfleben feststeckte. Zwischen Weinreben und Spargelfeldern, im Hinterland der französischen Atlantikküste. In ihrer Schreibtischschublade lagerten viel zu große Sonnenbrillen. Sie leerte nie ihren Briefkasten, ohne sich vorher die Lippen rot zu schminken. War ihr Küchenmülleimer voll, nahm sie den Beutel aus dem Eimer, knotete ihn zu und warf ihn aus dem Fenster, weil sie zu faul war, ihn zur Mülltonne zu tragen.
Hinterm Haus baute mein Opa Gemüse an. Er brachte meiner Oma seine Ernte, und sie zerkochte und verhäckselte alles widerwillig zu einem grünbraunen Brei, den sie Suppe nannte. Kaum war mein Opa gestorben, ließ sie Gras über die Beete wachsen. Sie mochte weder die Garten- noch die Küchenarbeit. Doch sie erzählte gern davon, wie schick sie manchmal essen gegangen sei, als sie noch als Sekretärin arbeitete. «Schick» war eines ihrer Lieblingswörter. Ihre Geschichten von früher brachte sie selten zu Ende, weil ihr meistens irgendetwas in den Kopf schoss, was sie so sehr zum Lachen brachte, dass sie die Pointe vergaß.
Einmal im Jahr, immer in den Herbstferien, fuhren meine Eltern und ich meine Oma besuchen. Ich setzte mich in Hamburg auf die Rückbank, in den ersten Jahren auf einen Kindersitz, der mit orangem Frottee bezogen war, und saß und saß und saß. Wir fuhren durch das Ruhrgebiet und Belgien, je nach Stau erreichten wir den Paris umschließenden Boulevard périphérique vor oder nach der Übernachtungspause. Als ich dreißig Jahre später nach Paris zog, war ich überrascht, dass der Périphérique einfach nur eine Stadtautobahn ist. Ich war in dem Glauben groß geworden, es handele sich um den inneren Kreis der Hölle. Schon viele Kilometer bevor wir ihn erreichten, erteilten mir meine Eltern Sprechverbot, weil ihnen die Umfahrung von Paris den Angstschweiß auf die Handinnenflächen trieb. Wenn es meinen Eltern gelungen war, sich auf die Autobahn Richtung Orléans einzufädeln, traute ich mich wieder, «Wann sind wir da?» zu fragen. Weil sie dann nicht mehr «Nicht jetzt», sondern «Noch sechs Stunden bis Bordeaux» antworteten. Mittags hielten wir an einer Raststätte, die den biblischen Namen «Arche» trug, und meine Mutter belehrte uns, dass die korrekte Aussprache «Arsch» lautete. Meinen anschließenden Lachanfall fand sie übertrieben.
Schließlich erreichten wir das weiße Haus mit dem Magnolienbaum vor der Tür, gleich neben der Autobahnauffahrt. Ich liebte dieses Haus nicht nur, weil meine Oma dort lebte, sondern auch, weil es in Frankreich stand. Als Erstes ging ich immer in die Garage, am Peugeot vorbei zu den Vorratsschränken. Um die Besuche ihrer Enkel vorzubereiten, investierte meine Oma nicht in Spielzeug, sondern in Essen, und ich kontrollierte die Regale, um das Ausmaß ihrer Zuneigung zu begutachten. Es gab Nüsse und Cracker für den Aperitif, Gläser und Dosen mit Pasteten, die uns als Vorspeise serviert wurden, und immer eine Flasche «Pacifique», alkoholfreien Anissirup, der das Wasser genauso milchig gelb färbte wie Pastis.
Die schönsten Ausflüge führten in den Supermarkt. Meine in Deutschland eher bescheiden veranlagten Eltern füllten den Einkaufswagen in Frankreich mit fröhlicher Selbstverständlichkeit. Béchamelsauce in Blätterteig mit Käse überbacken – pourquoi pas? Bei der Planung des Abendbrots fiel niemals das grauenhafte Wort «Aufschnitt», das klingt, als könne man Genuss grammgenau abwiegen. Stattdessen wurde das Essen in Gruppen gedacht: zuerst dies, dann das, dann jenes. Eine gemeinsame Mahlzeit ohne Menüfolge hätte sich für meine Großeltern wie eine Deklassierung angefühlt. Mein Opa war Kaninchenzüchter und Anstreicher, körperlich harte Arbeit für wenig Geld, aber das bedeutete nicht, dass er sich beim Essen fühlen wollte, als wäre das Leben hart und ärmlich.
Wie sehr mich diese jährlichen Fressurlaube prägten, fiel mir schon als Kind auf. Es waren die achtziger Jahre, bei meinen deutschen Schulfreundinnen zu Hause wurde Eisbergsalat in einer Sauce ertränkt, für die man Maggiwürze und Wasser zusammenrührte. Ich aß brav auf, um später mit meiner Mutter über diese Barbarei zu lästern.
Meine französische Mutter war in Deutschland in vielen Bereichen zur radikalen Konvertitin geworden. Sie liebte bayrische Trachtenmode, sie flocht Adventskränze, sie vertraute beim Autofahren auf Regeln und nicht allein auf ihre eigene Wendigkeit. Niemand konnte ihr vorwerfen, sie hätte sich nicht angepasst. Doch beim Essen zog sie eine Grenze. Da blieb sie Französin, und zwar weniger aus Sentimentalität denn aus Dünkel. Eine Mayonnaise kauft man nicht in der Tube, die rührt man selber an. Wenn ein Kind keine Artischocken essen will, stimmt etwas nicht mit ihm. Wer einem Stück Käse nicht mit Respekt und exakten Messerschnitten begegnet, wird des Massakers bezichtigt.
Diese kulinarische Arroganz färbte auf mich ab. Als kleines Kind sagte ich den Satz «Ich bin Halbfranzösin» mit demselben Stolz wie «Ich habe schon mein Seepferdchen» – als hätte ich ein Abzeichen auf der Badehose und ein anderes, unsichtbares, auf der Brust. Schließlich gilt eine französische Herkunft im deutschen Identitätsgefüge nicht als Migrations-, sondern als Savoir-vivre-Hintergrund.
Frankreich fühlte sich auf die Art nah und vertraut an, wie es auch die eigenen Eltern tun. Zunächst zu selbstverständlich für eine genauere Betrachtung. Als ich zu studieren begann – und auch in den ersten Berufsjahren als Journalistin –, zog es mich nach Osteuropa, nach Georgien, Polen, auf den Balkan. Ich interessierte mich für Orte, von denen ich kaum etwas wusste, und begriff nicht, dass diese Ahnungslosigkeit eigentlich auch für Frankreich galt. Es war ein Land der Kindheitserinnerungen, mit dem ich den Hedonismus und die Unbeschwertheit meiner Oma verband. Es schien mir unnötig, dieses gute Leben genauer zu hinterfragen.
Ich war schon relativ erwachsen, Mitte dreißig und schwanger, als Frankreich erneut und diesmal mit Nachdruck an meine Tür klopfte. Ich bekam das Angebot, als Korrespondentin nach Paris zu ziehen. Ein halbes Jahr später lösten mein Freund und ich unsere Wohnung in Deutschland auf, legten unseren noch nicht sitzfähigen Sohn in seine Babyschale und begannen ein neues Leben. Meine Oma hatte immer davon geträumt, dass ich mich in einen Franzosen verlieben und bei ihr auf dem Dorf eine Familie gründen würde. Nun trug ich tatsächlich einen Säugling durch Frankreich, nur leider kam ich gut zehn Jahre zu spät. Sie war gestorben, als ich mich am wenigsten für ihr Land interessiert hatte.
An unserem ersten Abend in der Pariser Wohnung saßen wir auf dem Holzfußboden und aßen Taboulé, Célerie rémoulade und Carottes râpées aus Plastikschalen – die Standardvorspeisen meiner französischen Herbstferien. In diesen ersten Wochen dachte ich noch, dass es an mir lag, wenn ich ständig über Essen schrieb. Mal berichtete ich über einen Minister, der zurücktreten musste, weil er auf Kosten des Steuerzahlers Hummer gekauft hatte, dann über einen Bäcker, der durch einen Hungerstreik das Bleiberecht für seinen Lehrling aus Mali erkämpfte, immer wieder über Käse, und regelmäßig entpuppten sich Köche als geeignete Interviewpartner. Dabei ging es nie um Rezepte oder Gartechniken, sondern immer um politische, gesellschaftliche Fragen. Nur schienen sich diese Fragen ein ums andere Mal auf dem Teller zu verdichten.
Ich war mit meiner Obsession nicht allein. Im Fernsehen lief eine Talkshow, «Politiques, à table!», in der Politiker mitten in einer Küche befragt wurden. Die Moderatorin sprach mit ihnen über ihre Überzeugungen und Pläne, während im Hintergrund das Lieblingsessen der Gäste zubereitet und dann zum Abschluss gemeinsam verzehrt wurde.
Wenn ich zur Métro ging, stieg ich meistens bei der Station Alexandre Dumas ein. Ich wusste, dass Dumas als einer der großen französischen Autoren in die Ruhmeshalle des Panthéon überführt worden war und dass er «Die drei Musketiere» und «Der Graf von Monte Christo» geschrieben hatte. Als ich einmal nachschauen wollte, wann er genau gelebt hatte, 1802 bis 1870, stieß ich auf sein posthum veröffentlichtes Spätwerk: ein mehrere Hundert Seiten dickes kulinarisches Lexikon, das «Grand dictionnaire de cuisine». Da verbringt jemand Jahrzehnte damit, die sagenhaftesten literarischen Figuren zu entwerfen, aber zum Lebensabend setzt er sich noch einmal hin und schreibt Rezepte auf. Dumas notiert allein siebzehn Omelettevarianten. Mal mit Austern, mal mit Tomaten, mal mit Erdbeeren. Und immer so erklärt, dass man es direkt nachkochen kann. Kennen Sie die kulinarischen Beiträge von Goethe oder Schiller? Nein? Aha.
Als ich im Dezember 2018 durchs Land fuhr, um zu verstehen, warum die Wut der Gelbwesten so eskalierte, dauerte es nicht lange, bis ich einen Teller in der Hand hielt. Ich stand an einem Kreisverkehr in der Nähe von Libourne, und die anwesenden Gilets jaunes hatten nicht nur die Straße versperrt, sie hatten auch einen Grill aufgestellt. Natürlich machte einer von ihnen eine Familienpackung Carottes râpées auf.
Die französischen Hauptstadtjournalisten berichteten zu diesem Zeitpunkt über die Gelbwestenproteste, als handele es sich um Menschen von einem anderen Stern. Wer sind bloß diese Leute, und warum sind sie so zornig? Als ich mich darüber wunderte, dass mir die Kreisverkehrabende so vertraut vorkamen, fiel mir auf, dass ich in der Welt meiner Oma zu Gast war. In Dörfern, in denen sich Paris wie eine snobistische Parallelrealität anfühlt.
Meine Oma war schon Witwe, als sich in ihrem Dorf eine viel beachtete Umwälzung ereignete. Neben dem Bahnhof, an dem zu ausgewählten Stunden der Zug nach Bordeaux hielt, eröffnete ein Bäcker. Es war, als wäre die Zivilisation zurückgekehrt. Jahrelang war in Saint-Médard vor allen Dingen darüber geredet worden, ob das Dorf eventuell einer Schnellzugtrasse des TGV weichen muss. Das Dorf war nicht wichtig, die Menschen hier waren nicht wichtig, früher hatte es mal ein Restaurant gegeben, aber das war lange her. Doch nun, es war das neue Jahrtausend: Schnellzugpläne vom Tisch und ein Bäcker vor Ort.
Denke ich an die Euphorie rund um die Bäckereieröffnung zurück, dann kommt es mir vor, als hätten meine Oma und ihre Nachbarn ihre Lebensqualität direkt daran gemessen, wie einfach oder schwer sie Zugang zu gutem Essen hatten. Weil man hier, in der von Autobahn und Feldern zerfledderten Zone zwischen Stadt und Land, ohne zu fahren, nirgendwo hinkommt, holte ein Einkaufsbus die Rentner einmal die Woche ab und brachte sie zu «Super U» im Nachbarort. Sie kauften stangenweise Baguette, froren es zu Hause ein und tauten es in Tagesrationen auf. Freudlose Zeiten. Die Rückkehr des Bäckers hingegen war wie ein Versprechen, dass noch nicht alles vorbei war, weder mit dem Dorf noch mit seinen Witwen.
Um genau dieses Aufbäumen ging es auch am Würstchengrill der Gelbwesten. «Schau mal», sagte ein Mann, den wir später im Buch noch besser kennenlernen werden und der mich sofort duzte, «hier sieht man, dass die Leute auf unserer Seite sind.» Er zeigte mir ein kleines Essenslager, das sie zwischen zwei Kiefern neben dem Kreisverkehr angelegt hatten. Dort sammelten sie Spenden; eine große Tüte Croissants, eine Flasche Wein, eine Palette Senf. Es sei wie zur Zeit der Revolution, wurde mir erklärt, wer den Aufstand lebendig halten wolle, müsse ihn auch ernähren.
Die Sache mit dem Essen, das hatte ich nun begriffen, ist ernst. So stellte ich in mein Regal zwischen die Bücher von Philosophen, Historikerinnen und Politikwissenschaftlern ein sehr dickes und großes Buch mit dem Titel «On va déguster la France», «Wir probieren Frankreich». Es handelt sich um eine Art kulinarische Enzyklopädie, zusammengestellt von dem Journalisten und Restaurantkritiker François-Régis Gaudry. Gaudry moderiert jeden Sonntag eine einstündige Radiosendung auf France Inter, in der es offiziell um Rezepte geht, die sich aber anhört wie eine tiefenpsychologische Analyse des Landes. Die Sendung läuft von elf bis zwölf Uhr, als ersetzte sie den wöchentlichen Kirchgang.
In Gaudrys Enzyklopädie lernt man, dass nicht völlig falschliegt, wer sich Frankreich als Nabel der essenden Welt vorstellt. Als die französische Küche 2010 von der Unesco in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen wurde, ging es nicht darum, spezifische Rezepte auszuzeichnen. Nicht das Bœuf bourguignon oder das Omelette wurden hervorgehoben, sondern die Tatsache, dass es den Franzosen gelungen ist, die Nahrungsaufnahme zu einer Kunstform zu erheben.
Relativ weit vorne in seinem Wälzer, zwischen allerlei berühmten Köchen, hat Gaudry eine Warnung versteckt. Es ist ein Zitat des rumänischen Philosophen Emil Cioran, der ab 1937 in Paris lebte und schon 1941 raunte, Frankreich drohe vor lauter Fresserei völlig zu verblöden: «Wenn man an nichts glaubt, werden die Sinne zur Religion. Und der Magen zum letzten Ziel. Das Phänomen der Dekadenz ist von der Gastronomie nicht zu trennen. … Die Lebensmittel ersetzen die Ideen. Seit über einem Jahrhundert wissen die Franzosen, dass sie essen. Vom letzten Bauern bis hin zum verfeinertsten Intellektuellen ist die Essenszeit die tägliche Liturgie der seelischen Leere. … Der Bauch war das Grab des Römischen Reiches, er wird – unausweichlich – Grab der französischen Intelligenz sein.»
Ich schaute in meinen zu vollen Kühlschrank und fragte mich, ob Cioran recht hatte. War die «Haute Cuisine» nichts anderes als ein Vorbote für den Untergang des Abendlandes? Niemand glaubt mehr an Gott oder einen höheren Sinn, und das Einzige, was noch wichtig ist, ist der Härtegrad der karamellisierten Zuckerschicht auf der Crème brûlée? Hach, dachte ich, Crème brûlée …
Dann entschied ich, dass Cioran sowohl den Franzosen als auch mir mit einer Überdosis moralischer Verbissenheit begegnete. Es war natürlich irre «french» von ihm, davon auszugehen, dass Frankreich kurz vor seiner Selbstauslöschung steht. Davor zu warnen, ist in Paris noch beliebter als ein Stück Käse zwischen Hauptgang und Dessert.
Aber selbst bei diesem Stück Käse geht es nur bis zu einem gewissen Grad um Käse, eigentlich geht es um den Luxus, stundenlang zusammen am Tisch sitzen zu können. Bei dem ständigen Reden über Essen werden Fett, Zucker oder Kohlenhydrate kaum erwähnt. Stattdessen ist zum Beispiel ein Stück Foie gras ein guter Anlass für Frankreichs jährlichen Weihnachtsstreit: Darf man im Namen der Tradition Tiere quälen? Das Umkreisen der Küche ersetzt nicht die großen Debatten, es gibt ihnen einfach nur einen kulinarischen Rahmen.
Die Fragen, die mich als Journalistin in Frankreich beschäftigen, unterscheiden sich kaum von denen, die mich auch in Deutschland umtreiben. Es sind europäische Fragen: Wie geht ein wohlhabendes Land damit um, wenn die Jahre des stetigen Aufschwungs sich dem Ende zuneigen? Wofür lohnt es sich noch, auf die Straße zu gehen? Warum setzen sich Politiker durch, die statt Lösungen nur Sündenböcke anbieten? Wie positionieren sich Frauen in einer Gesellschaft, in der ständig über Feminismus gesprochen wird, aber fast alle wichtigen Ämter von Männern bekleidet werden? Wie setzt sich eine frühere Kolonialmacht mit ihren Verbrechen auseinander? Wie verändert der islamistische Terror das Zusammenleben? Warum gewinnen nationalistische Ideen wieder an Einfluss? Sind Toleranz und Offenheit nur noch Worthülsen? Wie erziehen andere Leute ihre Kinder, und schaffe ich es, mein eigenes zu erziehen? Und welche Frage vergesse ich zu stellen?
So allgemeingültig die Fragen, so spezifisch sind die Antworten. Als Journalistin war ich 2023 und 2024 nicht nur in Frankreich, sondern auch viel in den Niederlanden und Polen unterwegs. Wenn ich dort mit den Menschen über den Erfolg von Marine Le Pen, Geert Wilders und Jarosław Kaczyński sprach, über Politiker also, die auf Nationalismus und rassistische Rhetorik setzen, wurde mir oft gesagt: Na ja, dieser Aufstieg der Rechten, das ist jetzt halt in ganz Europa so. Einerseits ist das richtig, andererseits steckt hinter dieser Verallgemeinerung manchmal eine Vermeidungsstrategie. Was können wir schon tun oder ändern – so drehen sich eben die Räder der Welt. Sobald Dinge jedoch Hoffnung machen oder Stolz nähren, löst sich diese Verallgemeinerungstendenz auf. Dann wird Europa zerteilt in nationale, ja sogar regionale Kompetenzzentren. Dann wird von der niederländischen Toleranz geschwärmt und dem polnischen Widerstandsgeist, von Pariser Eleganz oder schwäbischem Fleiß.
Für meinen Blick auf Frankreich bedeutet das, dass ich mich beim Beschreiben der Konflikte nicht abwimmeln lassen will. Und dass ich beim Anblick einer perfekten Tarte au citron reagiere, als wäre mir ein Katzenbaby auf den Schoß geklettert. Das Hirn löst sich auf in einer Wolke fluffigster Hingabe. Was aber natürlich nicht ewig dauert, Katzenbabys sind ruhelos und Törtchen schnell aufgegessen.
Wenn ich über Baguette als nationales Einheitsbrot schreibe, dann deshalb, weil mich interessiert, wie der Zentralismus das Land geprägt hat. Wenn ich darüber nachdenke, warum mein Sohn jeden Tag um sechzehn Uhr ein Pain au chocolat mit seinem Kindergartenfreund Adrien teilte, dann, um dem französischen Selbstbewusstsein in Sachen Erziehung auf die Spur zu kommen. Wenn ich den Koch Mory Sacko vorstelle, der als Erster für afrikanische Küche mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, dann liegt es daran, dass ich herausfinden will, wie eine Gesellschaft gleichzeitig von wachsender Toleranz und zunehmenden Abgrenzungsreflexen geprägt sein kann. Wenn ich über Essen schreibe, dann deshalb, weil es mir als der beste Weg erscheint, mich so tief wie möglich in die französische Politik, Geschichte und Kultur hineinzuwühlen.
Es war kurz nach der Europawahl 2019, als ich zum ersten Mal von der Existenz des «Camembert-Diagramms» hörte. Ich saß halb konzentriert vor dem Fernseher und schaute mir an, aus welchen Farben sich der Kreis zusammensetzte, der die abgegebenen Stimmen illustrierte. «Comme vous voyez ici sur le camembert», sagte die Moderatorin, und ich lebte zu diesem Zeitpunkt schon lange genug in Paris, um «Quoi?» zu denken statt «Hä?». «Wie Sie hier auf dem Camembert sehen können» – von welchem Camembert sprach die Frau? Dann verstand ich: Das runde Diagramm, mit dem man die Verteilung von Geld, Wählerstimmen oder auch Urlaubszielen anzeigt, ist auf Französisch nicht nach einer Torte, sondern nach einem Käse benannt.
Ein Tortendiagramm, das bei genauerem Hinsehen ein Käse ist: Dieses Verstehen auf den zweiten Blick illustriert gut die Art und Weise, auf die Deutsche Frankreich kennenlernen und umgekehrt Franzosen Deutschland. Vieles sieht zunächst genauso aus, wie man es von zu Hause kennt. Zum Beispiel in der Politik: Es gibt in beiden Ländern ein Parlament, in dem gestritten wird, und einen Präsidenten, der zu großen Anlässen große Worte findet. Und am Ende einer Wahl werden die Ergebnisse als bunter Kreis angezeigt. Doch wie viel wichtiger die großen Worte eines französischen Präsidenten sind als die eines deutschen, versteht man erst, wenn man sich tiefergehend auf das Land einlässt. Und dann bemerkt man auch, dass die Referenzgröße für «rund» zwar auf beiden Seiten des Rheins ein Nahrungsmittel ist, jedoch ein jeweils sehr unterschiedliches.
Ich muss Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass man einen Camembert schneidet wie eine Torte, nicht wie ein Brot – also in Dreiecke statt in Scheiben. Das habe ich in der strengen Käseschule meiner Mutter gelernt. Sie begründete das damit, dass jeder gleich viel von der Rinde und gleich viel vom cremigen Kern des Camembert bekommen soll. Égalité et fraternité – Gleichheit und Brüderlichkeit. Da soll noch mal jemand sagen, es gehe beim Nachdenken über Essen nicht um die großen Fragen.
1Baguette und Zentralismus
Zu den Dingen, die Deutsche gern über sich selbst glauben, gehört erstens, dass sie ein distanziert-kritisches Verhältnis zu ihrem Land haben, und zweitens, dass sie diese kritische Distanz ablegen müssen, wenn es um Brot geht. Ich habe in Deutschland schon oft emotionale Gespräche über Brot geführt. Darüber, wie gesund deutsches Brot sei, und dass in anderen Ländern unter dem Label «Brot» ja meist Dinge verkauft würden, die genauso gut als Pappe durchgehen könnten. Deutsche sind in diesem Zusammenhang stolz auf Brote, die im Zweifel wochenlang halten. Schwere Sauerteigobjekte, gegen deren Geschmack sich nur die derbste Leberwurst durchsetzen kann. Weißbrot hingegen? Minderwertig.
Ich verspreche, dass ich im Folgenden nicht ständig mit Erinnerungen an die Ferien bei meiner Oma nerven werde, aber ich habe mich schon als Kind ins Baguette verliebt. Im Nachhinein würde ich sagen, dass mir seine Zurückhaltung gut gefiel. Das Baguette war kein Körnerbrot, auf dem man ewig herumkauen musste. Es bot sich eher als neutrale Unterlage an, als eine Bühne für Käse, Marmelade oder Pastete. Oder als großzügiger Schwamm für Salatsaucen und Suppenreste. Meine deutsch gewordene französische Mutter, auch in Sachen Brot eine radikale Konvertitin, erzählt gerne, wie sie als Kinder beim Mittagessen in der Schule aus dem Inneren der Baguettescheiben Kugeln formten, um einander zu bewerfen. Sie will damit unterstreichen, was für eine müllige Brotvariante sie in Frankreich vorgesetzt bekam. Ich hingegen träumte von Pausenbroten aus weichem Weizenmehl, während ich die Vollkornbrotstullen in meinem Ranzen verschimmeln ließ.
Natürlich habe ich die Bedeutung des Baguettes unterschätzt. Und ich habe auch unterschätzt, dass sich Deutsche und Franzosen in ihrem ausgeprägten Brotstolz nicht viel nehmen. Deutsches Brot wird seit 2014 von der Unesco als Weltkulturerbe gelistet, das französische Baguette seit 2022. Die Unesco hat das deutsche Brot dafür ausgezeichnet, dass es in so vielen Varianten daherkommt, Dinkel, Roggen, Hafer, Weizen. Frankreich hingegen hatte nur einen Kandidaten ins Rennen geschickt: das Baguette. Während in Deutschland noch nicht einmal Einigkeit darüber herrscht, ob man den letzten Rest des Brots nun Knust, Kante, Kanten oder Knäppchen nennt, gilt in Frankreich: ein Land, ein Brot.
Östlich des Rheins die föderale Bundesrepublik, in der, um thematisch in der Nähe des Pausenbrots zu bleiben, das Einschulungsalter eines Kindes davon abhängt, ob es in Bayern oder Sachsen aufwächst. Westlich des Rheins das zentralistische Frankreich, in dem beim Baccalauréat, dem Abitur, jeder Schüler im Land dieselben Fragen beantworten muss.
Dass Frankreich organisiert ist, als seien alle auf Sternfahrt Richtung Paris unterwegs, lässt sich unter anderem am Streckennetz der Bahn ablesen. Ob Bordeaux, Marseille, Straßburg oder Lyon – alle Großstädte sind auf direktester Linie mit Paris verbunden. Die fünfhundertachtzig Kilometer von Bordeaux nach Paris legt der TGV innerhalb von zwei Stunden zurück und macht auf dem Weg keinen einzigen Zwischenstopp. Angenommen, Kassel wäre in Frankreich, hätte dort noch nie ein Schnellzug gehalten. Doch weil die Stadt in Deutschland liegt, kommt jeder Reisende früher oder später in den Genuss, die Betonsäulen von Kassel-Wilhelmshöhe zu betrachten. Wenn ich französischen Kollegen erzählte, dass ich für eine deutsche Tageszeitung arbeite, die in München gemacht wird und nationale Relevanz hat, nickten sie jedes Mal brav. Doch an ihrem perplexen Blick ließ sich ablesen, dass sie mir nicht glaubten. Wie kann es sein, dass nicht alle wichtigen Zeitungen aus Berlin kommen?
Auch wenn spätestens seit den achtziger Jahren unter François Mitterrand regelmäßig versucht wird, den nicht Pariser Teilen des Landes mehr Gestaltungsmacht einzuräumen, bleibt Frankreich von Jahrhunderten des Zentralismus geprägt. Ludwig XIV. schuf seinen Hofstaat in Versailles nicht nur, um genügend Adlige um sich herum zu haben, die ihn amüsieren, sondern vor allem auch, weil er die regionalen Fürsten entmachten wollte. «L’état, c’est moi» – «Der Staat, das bin ich» –, sagte der Sonnenkönig und sorgte dafür, dass im Rest des Landes keine andere Sonne leuchtete. Wollen französische Eltern ihre Kinder zum Stromsparen ermahnen, sagen sie übrigens bis heute «C’est pas Versailles ici», «Wir sind hier nicht in Versailles», während sie in ungenutzten Zimmern das Licht ausmachen. In Deutschland spricht man im Energiesparkontext eher vage von unnötiger Schlossbeleuchtung, in Frankreich ist klar, dass es diesen einen Ort gab, an dem sich alle Verschwendung und auch alle Macht konzentrierte – Versailles. Wo übrigens zu Zeiten Ludwigs XIV. tatsächlich horrende Summen für Kerzen ausgegeben wurden.
Die Französische Revolution köpfte dann zwar den König, zwei Ludwige waren in der Zwischenzeit vergangen, die Guillotine traf auf Ludwig XVI., doch sie schrieb die Geschichte des Zentralismus fort. 1792 wird die erste Französische Republik ausgerufen. Für sie gilt: Sie ist «une et indivisible», einig und unteilbar. Dieser Anspruch der Einigkeit und Gleichheit aller Bürger wird von Paris aus vorgegeben und durchgesetzt.
Der Preis dieses Zentralismus ist eine Geschichte brutaler Unterdrückung regionaler Unterschiede. In der Bretagne oder im Baskenland wird heute verzweifelt versucht, lokale Sprachen wiederzubeleben, die von Paris aus plattgewalzt wurden. In der Vendée, im Westen Frankreichs, werden die Erinnerungen an den lokalen Widerstand gegen die Pariser Revolutionäre lebendig gehalten.
Gleichzeitig führte der Zentralismus zu einer besonderen Form des nationalen Zusammenhalts. Zum Beispiel beim Baguette. Ein Land, in dem ständig über alles gestritten wird, kann sich, ohne zu zögern, auf ein Brot einigen, das alle und alles verbindet. Die große Woher-kommen-wir-Frage führt in Frankreich zum Brot. Ohne die Revolution gäbe es nicht die heutige Republik – und hätte es die Revolution gegeben ohne den Schrei nach Brot? Vor meinem inneren Auge tragen die zornigen, hungrigen Frauen, die am 5. Oktober 1789 von Paris zum König nach Versailles marschieren, nicht Lanzen und Mistgabeln auf ihren Schultern, sondern die letzten Baguettestangen, die sie auf dem Marché Faubourg Saint-Antoine noch auftreiben konnten.
Tatsächlich reicht die Geschichte des Baguettes bis in die Zeit der Revolution zurück. Am 15. November 1793 beschließt der Nationalkonvent in Paris, dass die Franzosen im ganzen Land dasselbe Brot essen sollen. Schluss mit den Zeiten, in denen für die Reichen nur das besonders fein gemahlene Mehl verwendet wird, während die Armen sich mit den Resten, mit Backwaren aus Kleie begnügen müssen. Per Dekret wird verordnet: «Alle Bäcker dürfen, unter Androhung einer Gefängnisstrafe, nur noch eine Art Brot herstellen: Le Pain Égalité.» Das Brot der Gleichheit. Es besteht schon damals größtenteils aus denselben Zutaten, die bis heute die Basis des Baguettes sind: Weizenmehl, Wasser, Hefe, Salz.
Seine lange Form bekommt das Baguette, laut einer Legende, um Messerstechereien zu verhindern. Als Ende des 19. Jahrhunderts in Paris die Métro gebaut wird, schneiden die Arbeiter in der Mittagspause ihre runden Brote mit Messern in Scheiben. Haben sie Streit, zücken sie ebendiese Brotmesser. Angeblich beauftragt der leitende Ingenieur Fulgence Bienvenüe daher eine Bäckerei damit, dünne Brote herzustellen, die man mit der Hand in Stücke reißen kann.
Dieses Brot ist so berühmt, dass man es sogar pantomimisch darstellen kann. Mein Sohn hat als Fünfjähriger mal seinem Plüschaffen eine Laugenstange unter den Arm geklemmt. Dazu sagte der Affe: «Bonjour.» Es war völlig klar, das Kind spielte Frankreich.
Jahrelang wurden die ökonomischen Unterschiede im Land anhand von Baguettes gemessen. Um festzustellen, wo die Menschen besonders viel und wo sie besonders wenig für Nahrungsmittel ausgeben, wurde ein Nahrungsmittel gesucht, das überall gleichermaßen gerne gekauft wird. Die Wahl fiel auf das Jambon-Beurre-Sandwich, ein halbes Baguette, belegt mit Butter und Schinken. Der sogenannte Jambon-Beurre-Index zeigte jedes Jahr, wo die wirtschaftlich starken Regionen lagen und wo die schwachen. Nirgends war das Sandwich so teuer wie in Paris (vier Euro im Jahr 2017), am günstigsten war es in Regionen fern der Hauptstadt. In Marseille bekam man das Sandwich 2017 im Schnitt für 2,56 Euro.
Als die Unesco das Baguette am 30. November 2022 zum Weltkulturerbe erklärte, war Emmanuel Macron gerade auf Dienstreise in den USA. Kaum erreichte die gute Nachricht den Präsidenten, ließ er sich ein Baguette bringen und trat in der französischen Botschaft in Washington vor die versammelte Presse. Macron hielt das Baguette in seiner linken Hand und sah es so zärtlich an, als könnte es seinen Blick erwidern. «Diesen wenigen Zentimetern Know-how, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, wohnt der Esprit französischer Könnerschaft inne», sagte Macron und steigerte sich Satz für Satz weiter in eine Baguette-Euphorie hinein. Das Brot sei «unnachahmlich», es habe einen «unschätzbaren Wert», es sei «ein Traum, den wir unseren Kindern schenken». Wer Tag und Nacht arbeite, könne ein «unvergleichliches Produkt» wie das Baguette erschaffen. Der amerikanische Traum verwandelt den Tellerwäscher in einen Millionär. Der französische Traum verwandelt einen Habenichts in einen Bäcker.
Nachdem das lange, dünne Brot auf einer Unesco-Konferenz in Marokko den Weltkulturerbestatus erhalten hatte, wedelte auch Dominique Anract, der Präsident der französischen Bäckervereinigung, triumphierend ein Baguette durch die Luft. Ähnliche Bilder sind von dem Moment, als das deutsche Brot gekürt wurde, nicht bekannt. Aber was hätten die deutschen Bäcker auch tun sollen? Alle möglichen unterschiedlichen Brötchenvarianten jonglieren?
Anract schwenkte also seine Brotstange, die versammelten Unesco-Experten lachten, und dann begann der Bäckermeister eine große Rede: «Das Baguette ist ein lebendiges Erbe, das uns durchs Leben begleitet. Wenn ein Baby zahnt, geben ihm seine Eltern eine Baguettespitze, auf der es kauen kann. Wenn ein Kind größer wird und zum ersten Mal allein zum Einkaufen geschickt wird, holt es ein Baguette. Für unsere Alten ist der tägliche Gang zum Bäcker manchmal der einzige soziale Kontakt des Tages.»
Die Unesco zeichnete das Baguette nicht für seinen Geschmack aus oder für die Art und Weise, wie es hergestellt wird. Das Baguette wurde Weltkulturerbe, weil es das französische Talent symbolisiert, mithilfe eines Nahrungsmittels die ganz großen Fragen in den Blick zu nehmen. Ein Baby braucht die Fürsorge seiner Eltern, ein Kind will die Welt entdecken, ein alter Mensch gleitet langsam aus dem Leben – all das lässt sich erzählen am Verhältnis des Einzelnen zum Baguette. Ersetzt man in Dominique Anracts Rede das Wort «Baguette» durch Synonyme für «Staat», kommt man dem französischen Selbstverständnis noch einmal näher. Ein zentrales Brot ernährt die Bürger, und ein zentral organisierter Staat begleitet sie von der Wiege bis ans Sterbebett.
In der Begründung der Unesco heißt es, das Baguette habe einzigartige «soziale Praktiken» entstehen lassen. Damit ist nicht der Verzicht aufs Brotschneiden gemeint, sondern die Tatsache, dass Baguette nur frisch gebacken gut schmeckt. Kauft man es zum Abendessen, muss man es bereits am nächsten Morgen ziemlich ausdauernd toasten, damit es einem noch Freude bereitet. Ist man dem Leben so zugewandt wie die Unesco, sieht man darin einen Vorteil. Wer Baguette liebt, muss jeden Tag zum Bäcker, und das hilft gegen Trübsinn und Einsamkeit, denn jemand, den man so regelmäßig sieht, mag man irgendwann. Und wenn nicht, dann sucht man sich eben einen netteren Bäcker.
Der Bäcker an meiner Pariser Straßenecke hatte, glaube ich, keine sonderlich großen Ambitionen. Sein Brot war in Ordnung, seine Törtchen eher trocken. Aber er hatte die Gabe, seinen Kunden ans Herz zu wachsen. Ich habe meine Nachbarin im Verdacht, dass sie sogar zweimal täglich zu ihm ging. Einmal führten der Bäcker und ich folgenden Dialog: «Sie haben aber gute Laune», sagte ich. «Ja», sagte er, «wenn es regnet, bin ich immer aus Trotz gut drauf.» Ich wandte ein, dass vor seiner Bäckerei bestes Wetter war. Und er sagte: «Ah stimmt, ja, wenn die Sonne scheint, bin ich sowieso glücklich.»
Was sein inneres Wetter betraf, war er also ein richtiger Weltkulturerbebäcker. Doch ganz so lax wie die Unesco sind die Franzosen dann doch nicht. Ein netter Bäcker ist gut, ein hervorragender ist besser. Daher wird jedes Jahr in Paris das beste Baguette der Stadt gekürt. Auch beim «Pain Égalité» sind nicht alle gleich. Es soll gerecht zugehen – und dennoch exzellent.





























