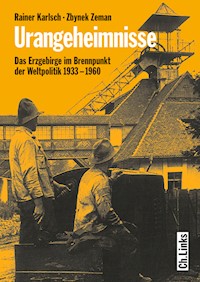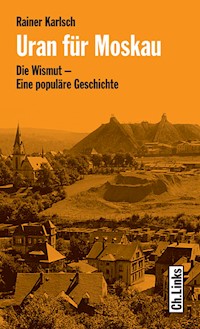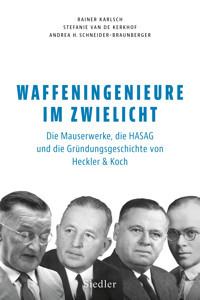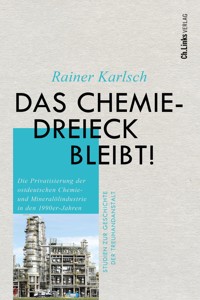
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Studien zur Geschichte der Treuhandanstalt
- Sprache: Deutsch
Skandal oder Erfolgsgeschichte?
Im Jahr 1990 stellte sich die Frage, ob eine eigenständige ostdeutsche Großchemie überhaupt noch gebraucht wird. Belegschaftsproteste zwangen die Treuhandanstalt nach dem Verkauf moderner Werke zu einem Strategiewechsel. Die Altlastensanierung und die Modernisierung des mitteldeutschen Chemiedreiecks entwickelten sich zu den mit Abstand teuersten Vorhaben der Treuhand und dauerten mehr als zehn Jahre. Rainer Karlsch zeichnet strukturpolitische Entscheidungen sowie Machtkämpfe anhand von Akten der Treuhandanstalt, der Ministerien, der Landesregierungen, der Betriebe und von Nachlässen nach. Er analysiert erstmals die Privatisierungen der mittelständischen chemischen Betriebe und zieht eine fundierte und differenzierte Bilanz der umstrittenen Arbeit der Treuhandanstalt.
DieStudien zur Geschichte der Treuhandanstalterscheinenin Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte München–Berlin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 964
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Skandal oder Erfolgsgeschichte?
Im Jahr 1990 stellte sich die Frage, ob eine eigenständige ostdeutsche Großchemie überhaupt noch gebraucht wird. Belegschaftsproteste zwangen die Treuhandanstalt nach dem Verkauf moderner Werke zu einem Strategiewechsel. Die Altlastensanierung und die Modernisierung des mitteldeutschen Chemiedreiecks entwickelten sich zu den mit Abstand teuersten Vorhaben der Treuhand und dauerten mehr als zehn Jahre. Rainer Karlsch zeichnet strukturpolitische Entscheidungen sowie Machtkämpfe anhand von Akten der Treuhandanstalt, der Ministerien, der Landesregierungen, der Betriebe und von Nachlässen nach. Er analysiert erstmals die Privatisierungen der mittelständischen chemischen Betriebe und zieht eine fundierte und differenzierte Bilanz der umstrittenen Arbeit der Treuhandanstalt.
Die Studien zur Geschichte der Treuhandanstalt erscheinenin Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte München–Berlin
Über Rainer Karlsch
Rainer Karlsch, Jahrgang 1957, studierte Wirtschaftsgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin, 1986 Promotion. Er war Mitarbeiter am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Humboldt-Universität und der Historischen Kommission zu Berlin sowie von 1999 bis 2001 am Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgeschichte der Freien Universität Berlin. Seit 2004 ist er freier Publizist mit den Schwerpunkten Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte. Von 2017 bis 2021 war er am Institut für Zeitgeschichte München–Berlin tätig.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Rainer Karlsch
Das Chemiedreieck bleibt!
Die Privatisierung der ostdeutschen Chemie- und Mineralölindustrie in den 1990er-Jahren
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorwort der Herausgeber
Einleitung
I. DDR-Chemie: Vom Hoffnungsträger zum hoffnungslosen Fall?
1. Die Anfänge der Grundstoff- und Spezialitätenchemie
2. Genesis des mitteldeutschen Chemiedreiecks
3. Das Chemieprogramm: Ein Modernisierungsversuch aus eigener Kraft
4. Westöffnung und Kompensationsgeschäfte
5. Heizölprogramm und Mineralölexporte als Devisenquelle
6. Umweltkrise, Bürgerproteste, erste Stilllegungen
II. Treuhand: Die überforderte Behörde
1. Reaktionen der westdeutschen Chemieindustrie auf den Mauerfall
2. Strukturelle Probleme der DDR-Chemie
3. Die Konstituierung des Arbeitsbereichs Chemie der Treuhandanstalt
4. Bestandsaufnahmen
5. Der Schock der Währungsunion und die Kapitalentwertung
III. Schnäppchenjagd? Die ersten Privatisierungen
1. Rückkehrer: Henkel KGaA in Genthin
2. Sonderfall Schwarzheide
3. VEBA auf Einkaufstour
4. Hoechst in Guben
IV. Machtkampf in der Treuhandanstalt
1. Fortsetzung der deutsch-deutschen Kooperation?
2. Neuausschreibung und Verkauf der PCK-Raffinerie
3. Streitfall Minol
4. Die Neuling-Affäre
5. Intrigen um den Raffinerieverkauf
V. Das Großchemieprojekt
1. Die Chemieteams und der Lenkungsausschuss
2. Krise im Frühjahr 1991 und vorsichtige Kurskorrektur
3. Die Genesis des Kanzlerversprechens
4. Ein umstrittenes Pipelineprojekt
5. Der Leuna-Minol-Vertrag
VI. Industriepolitik à la Treuhand: Die Restrukturierung des Standorts Leuna
1. Auf der Kippe: Die Nachverhandlungen des Raffinerievertrags
2. Die Privatisierung der Leuna-Chemie
3. Das Chemieparkkonzept
4. Die Leuna-Minol-Affäre
VII. Schrumpfen, Stilllegen, Neubeginnen
Bitterfeld: Von der Apotheke des RGW zum Chemiepark
1. Großinvestitionen auf der »grünen Wiese«
2. Auflösung der Chemie AG: Kostenreduktion versus Arbeitsplätze
3. Das Chemieparkkonzept nimmt Konturen an
4. Das Ringen um die Chlorchemie
5. Neujustierung des Chemieparkkonzepts
6. Die Privatisierung der ehemaligen Kombinatsbetriebe
Sodawerke Bernburg und Staßfurt
Chemiewerk Bad Köstritz GmbH (Thüringen)
Elektrokohle Lichtenberg
Resümee
Filmfabrik Wolfen: »Ein Elefant, der sich zum Sterben legt«
7. In der Globalisierungsfalle
8. Versuche zur Privatisierung der Filmfabrik
9. Überlebenskämpfe
10. Der kurze Traum vom neuen deutschen Fotokonzern: Die ORWO AG
11. Das Scheitern der Privatisierung der Dessauer Magnetbandfabrik
12. Resümee
VIII. Die teuerste Privatisierung der Treuhand: Der Olefinverbund
1. Buna auf der Suche nach einem Partner
2. Abspaltungen, Ausgliederungen und die Sächsische Olefinwerke AG (SOW) Böhlen
3. Umstrittene erste Schritte zur Standortsicherung
4. »Stand alone« oder die Drohung mit dem Staat
5. Die Privatisierung des Olefinverbunds an Dow Chemical
6. Die Rolle der EU-Kommission
IX. Branchenstudien: Raffinerien, Agrochemie, Pharma- und Kosmetikindustrie
Mineralölindustrie: Das Elend der kleinen Standorte
1. Hydrierwerk Zeitz: Stilllegung, Verwertungszentrum oder Industriepark?
2. Das lange Ringen um den Schmierölproduzenten Addinol
3. Chancen für Spezialanbieter
Altölraffinerie Klaffenbach
Paraffinwerk Webau GmbH
Ceritolwerk Mieste GmbH
Völpker Montanwach GmbH
4. Haushaltschemie: Zu schwach, um zu bestehen
Agrochemie: Erhalt der Hauptstandorte
5. Überkapazitäten in der Düngemittelindustrie
6. Der Verkauf des Düngemittelwerks Rostock an den Marktführer Norsk Hydro
7. Stickstoffwerk Piesteritz: Zu teure Restrukturierung?
8. Das Ende von Fahlberg-List und ein Neustart auf der »grünen Wiese«
9. Abwicklung der Anhaltische Düngemittel und Baustoff (ADB) GmbH Coswig
10. Gärungschemie Dessau: Opfer des Einigungsvertrags?
11. Strukturkrise im Zeitraffer
Pharmahersteller: Schnelle und erfolgreiche Privatisierung
12. Bildung und Auflösung des Kombinats GERMED
13. »A tempo«-Privatisierungen und Liquidationen
Schließung eines modernen Werkes? Pharma Neubrandenburg GmbH
Verkauf der Pharma-Großhandelsdepots an die Gehe AG
Pharmazeutisches Werk Halle
Die handstreichartige Privatisierung der Isis-Chemie GmbH
14. Die Privatisierung der »großen Drei«
Jenapharm GmbH
Arzneimittelwerk Dresden (AWD)
Berlin-Chemie AG
15. Reprivatisierungen und Verkäufe der mittelständischen Betriebe
Ankerpharm GmbH Rudolstadt
Serumwerk Bernburg AG
Oranienburger Pharmawerk GmbH
Leipziger Arzneimittelwerk GmbH
Philopharm Quedlinburg
Esparma GmbH, Osterweddingen
Feinchemie Sebnitz GmbH
Laborchemie Apolda
16. Sonderfälle: Sächsisches Serumwerk Dresden GmbH und Apogepha GmbH
Apogepha Arzneimittel GmbH, Dresden
17. Bilanz der Privatisierung
Kosmetikhersteller: Vom Markt verdrängt
18. Aschenputtel: Die Kosmetikindustrie der DDR
19. Kombinatsauflösung von unten
20. Erfolgreiches Management-Buy-out: Florena Waldheim-Döbeln GmbH
21. In der Marktwirtschaft gescheitert: Berlin Kosmetik GmbH
22. Von Monopolisten zu Nischenanbietern
Synthetische Fettalkohole aus Rodleben
Zitza Zeitz
Gerana cosmetics GmbH
Episan-Cosmetic GmbH, Zeulenroda-Triebes (Thüringen)
Herbacin cosmetic GmbH, Wutha-Farnroda (Thüringen)
Dental-Kosmetik GmbH, Dresden
Duftstoffe und Aromakompositionen aus Miltitz
Patina Halle
Die Zulieferer
Plasta Oederan
Oli Cosmetics GmbH & Co. KG Oberlichtenau
Metallwerk Wasungen
23. Schrumpfen auf einen gesunden Kern
Resümee
Anhang
Abkürzungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Archivquellen
Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (BArch Berlin), Abteilung DDR
BArch Berlin, B 412 (Treuhandanstalt)
Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv Berlin (SAPMO-BArch)
Bundesarchiv Koblenz (BArch Koblenz)
Brandenburgisches Landeshauptarchiv (BLHA)
Landesarchiv Sachsen-Anhalt (LASA)
Landesarchiv Berlin (LAB)
Sächsisches Staatsarchiv Chemnitz
Sächsisches Wirtschaftsarchiv Leipzig
Russisches Staatsarchiv für Zeitgeschichte (RGANI), Moskau
Unternehmensarchive
Privatarchive und Nachlässe
Stadtarchiv Gera
Stadtarchiv Rudolstadt
Zeitschriften und Zeitungen
Literatur
Personenregister
Dank
Erläuterungen
Impressum
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
Vorwort der Herausgeber
Noch in der Spätphase der DDR gegründet, entwickelte sich die Treuhandanstalt zur zentralen Behörde der ökonomischen Transformation in Ostdeutschland. Ihre ursprüngliche Aufgabe war die rasche Privatisierung der ostdeutschen volkseigenen Betriebe (VEB). Sehr bald aber wies ihr die Politik zahlreiche weitere Aufgaben zu. Sukzessive sah sich die Treuhandanstalt mit der Lösung der Altschuldenproblematik, der Sanierung der ökologischen Altlasten, der Mitwirkung an der Arbeitsmarktpolitik und schließlich ganz allgemein mit der Durchführung eines Strukturwandels konfrontiert. In ihrer Tätigkeit allein ein behördliches Versagen zu erkennen wäre daher ahistorisch und einseitig, auch wenn die Bilanz der Treuhandanstalt niederschmetternd zu sein scheint. Denn von den etwa vier Millionen Industriearbeitsplätzen blieb nur ein Drittel übrig. Das öffentliche Urteil ist daher ganz überwiegend negativ. Die Kritik setzte schon ein, als die Behörde mit der Privatisierung der ersten VEBs der DDR begann. Bis heute verbinden sich mit der Treuhandanstalt enttäuschte Hoffnungen, überzogene Erwartungen, aber auch Selbsttäuschungen und Mythen. Außerdem ist sie eine Projektionsfläche für politische Interessen und Konflikte, wie die Landtagswahlkämpfe 2019 in Ostdeutschland deutlich gemacht haben. Umso dringender ist es erforderlich, die Tätigkeit der Treuhandanstalt und mit ihr die gesamte (ost-)deutsche Transformationsgeschichte der frühen 1990er-Jahre wissenschaftlich zu betrachten. Dies ist das Ziel der Studien zur Geschichte der Treuhandanstalt, deren Bände die Umbrüche der 1990er-Jahre erstmals auf breiter archivalischer Quellengrundlage beleuchten und analysieren.
Die Privatisierung der ostdeutschen Betriebe brachte für viele Menschen nicht nur Erwerbslosigkeit, sondern auch den Verlust einer sicher geglaubten, betriebszentrierten Arbeits- und Lebenswelt. Insofern ist die Erfahrungsperspektive der Betroffenen weiterhin ernst zu nehmen und in die wissenschaftliche Untersuchung ebenso zu integrieren wie in die gesellschaftspolitischen Konzepte. Der mit der Transformation einhergehende Strukturwandel hatte Folgen für Mentalitäten und politische Einstellungen, die bis in die Gegenwart hineinreichen. Dabei wurden die individuellen und gemeinschaftlichen Erfahrungen und Erinnerungen stets von medial geführten Debatten über die Transformationszeit sowie von politischen Interpretationsversuchen geprägt und überlagert. Diese teilweise miteinander verwobenen Ebenen gilt es bei der wissenschaftlichen Analyse zu berücksichtigen und analytisch zu trennen. Der erfahrungsgeschichtliche Zugang allein kann die Entstehung und Arbeitsweise der Treuhandanstalt sowie die Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft nicht hinreichend erklären. Vielmehr kommt es darauf an, die unterschiedlichen Perspektiven miteinander in Relation zu setzen und analytisch zu verknüpfen, um so ein differenziertes und vielschichtiges Bild der Umbrüche der 1990er-Jahre zu erhalten.
Diese große Aufgabe stellt sich der Zeitgeschichte erst seit Kurzem, denn mit dem Ablauf der 30-Jahre-Sperrfrist, die für staatliches Archivgut in Deutschland grundsätzlich gilt, ergibt sich für die Forschung eine ganz neue Arbeitsgrundlage. Das öffentliche Interesse konzentriert sich auf die sogenannten Treuhandakten, die im Bundesarchiv Berlin allgemein zugänglich sind (Bestand B 412). Sie werden mittlerweile auch von Publizistinnen und Publizisten sowie Journalistinnen und Journalisten intensiv genutzt. An dieser Stelle sei aber daran erinnert, dass schon sehr viel früher Akten anderer Provenienz allgemein und öffentlich zugänglich waren – die schriftliche Überlieferung der ostdeutschen Landesregierungen oder der Gewerkschaften, um nur einige Akteure zu nennen. Darüber hinaus können seit einiger Zeit auch die Akten der Bundesregierung und der westdeutschen Landesverwaltungen eingesehen werden. Die Liste ließe sich fortsetzen.
Bei aller Euphorie über die quantitativ wie qualitativ immer breiter werdende Quellengrundlage (allein zwölf laufende Aktenkilometer Treuhandüberlieferung im Bundesarchiv Berlin) sollte allerdings nicht aus dem Blick geraten, dass Historikerinnen und Historiker die Archivalien einer Quellenkritik unterziehen müssen. Dies gehört grundsätzlich zu ihrem Arbeitsauftrag. Da die Erwartungen der Öffentlichkeit an die Aussagekraft vor allem der Treuhandakten hoch sind, sei dieser Einwand an dieser Stelle ausdrücklich gemacht. So gilt es, einzelne Privatisierungsentscheidungen der Treuhandspitze zu kontextualisieren und mit anderen Überlieferungen abzugleichen. Zur Illustration der Problematik mag ein Beispiel dienen: Treuhandakten der sogenannten Vertrauensbevollmächtigten und der Stabsstelle Recht enthalten Vorwürfe über »SED-Seilschaften« und »Korruption«, die sich auch in der Retrospektive nicht mehr vollständig klären lassen. Die in Teilen der Öffentlichkeit verbreitete Annahme, die Wahrheit komme nun endlich ans Licht, führt daher in die Irre und würde ansonsten nur weitere Enttäuschungen produzieren. Es gibt eben nicht die historische Wahrheit. Stattdessen ist es notwendig, Strukturzusammenhänge zu analysieren, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, Widersprüche zu benennen und auch auszuhalten. Dazu kann die Zeitgeschichtsforschung einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie mit quellengesättigten und methodisch innovativen Studien den historischen Ort der Treuhandanstalt in der Geschichte des vereinigten Deutschlands bestimmt, gängige Geschichtsbilder hinterfragt und Legenden dekonstruiert.
Im Rahmen seines Forschungsschwerpunktes »Transformationen in der neuesten Zeitgeschichte« zu den rasanten Wandlungsprozessen und soziokulturellen Brüchen der Industriegesellschaften seit den 1970er-Jahren hat das Institut für Zeitgeschichte München–Berlin (IfZ) im Frühjahr 2013 damit begonnen, ein großes, mehrteiliges Projekt zur Geschichte der Treuhandanstalt inhaltlich zu konzipieren und vorzubereiten. Auf der Grundlage der neu zugänglichen Quellen, die erstmals systematisch ausgewertet werden konnten, ging das Projektteam insbesondere folgenden Leitfragen nach: Welche politischen Ziele sollten mit der Treuhandanstalt erreicht werden? Welche Konzepte wurden in einzelnen Branchen und Regionen verfolgt, und was waren die Ergebnisse? Welche gesellschaftlichen Auswirkungen haben sich ergeben? Wie ist die Treuhandanstalt in internationaler Hinsicht zu sehen?
Bei der Projektvorbereitung und -durchführung waren Prof. Dr. Richard Schröder und Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué unterstützend tätig, denen unser ausdrücklicher Dank gilt. Über Eigenmittel hinaus ist das IfZ-Projekt, das ein international besetzter wissenschaftlicher Beirat kritisch begleitet hat, vom Bundesministerium der Finanzen von 2017 bis 2021 großzügig gefördert worden. Auch dafür möchten wir unseren Dank aussprechen. In enger Verbindung hierzu standen zwei von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Einzelprojekte von Andreas Malycha und Florian Peters.
Dierk Hoffmann, Hermann Wentker, Andreas Wirsching
Einleitung
In der Chemieregion um Halle (Saale) verflog der Jubel über die deutsche Einheit rasch. Die Großbetriebe der chemischen Industrie hatten nach der Einführung der D-Mark ab Sommer 1990 Tausende Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt. Erste Betriebsteile wurden stillgelegt und weitere Abschaltungen standen bevor. In allen Betrieben drohten Entlassungswellen. Vor allem jüngere Menschen wollten sich nicht damit abfinden und suchten ihr Glück im Westen.
In den Medien erschienen Berichte über Bitterfeld als »dreckigste Stadt Europas«. Es war von Umweltschäden in apokalyptischen Ausmaßen die Rede. »Schauermärchen gehen um von Gartenzwergen, denen die Nasen abgefallen sind, von Kochgeschirr, das, im Herbst versehentlich draußen stehengeblieben, im Frühjahr in der Hand zerbröselt.«[1] Ein regelrechter »Katastrophen-Tourismus« setzte ein. Der Spiegel schrieb dazu pointiert: »Nur der Papst war noch nicht in Bitterfeld. Alle anderen, Wichtige und Wichtigtuer, haben den Ausflug in die Chemieregion absolviert, pflichtgemäß und naserümpfend.«[2]
Die überbordenden Hoffnungen, dass mit der D-Mark rasch alles besser werden würde, hatten sich nicht erfüllt. Ernüchterung und Enttäuschung breiteten sich aus. Im Frühjahr 1991 wurde die Stimmung zunehmend aggressiver. Es kam zu Protestdemonstrationen gegen die Treuhandanstalt, deren Präsident, Detlev Karsten Rohwedder, inzwischen den zweifelhaften Ruf des bestgehassten Managers in Deutschland genoss.[3] Die Treuhand sollte die ostdeutschen Betriebe möglichst schnell privatisieren und aus den Erlösen ihre Tätigkeit finanzieren, war aber mit dieser Aufgabe überfordert. Die Werke der Großchemie erwiesen in Gänze als unverkäuflich.
Am 18. März 1991 lebten die Montagsdemonstrationen in Leipzig wieder auf und richteten sich nun gegen die Politik der Betriebsstilllegungen.[4] Die Gewerkschaften erhöhten den Druck auf die Regierung und die Treuhand. Die Industriegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik (IG CPK) organisierte am 19. März eine Großkundgebung »Arbeit und Zukunft« vor dem Haupteingang zur LEUNA-WERKE AG.[5] Daran nahmen mehr als 20 000 Menschen, Werksangehörige und ihre Familien, teil. Die Stimmung war aufgeheizt, zumal aus der Treuhand Zahlen über die noch abzubauenden Arbeitsplätze nach außen gedrungen waren. Der Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Weise brachte die Gemütslage der Belegschaft auf den Punkt, als er sagte, dass bisher nur Personalabbau stattgefunden habe, aber von der Treuhand keine Perspektiven für die Chemiebetriebe aufgezeigt worden seien. Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik, Hermann Rappe, appellierte an die Treuhand, künftig Privatisierungen »ruhig und besonnen vorzunehmen«.[6] Er verlangte einen Kurswechsel in Richtung Sanierung vor Privatisierung.
Die spätere Präsidentin der Treuhandanstalt, Birgit Breuel, zeigte sich von den Protesten beeindruckt und hielt dies in ihrem Tagebuch fest.[7] Angesichts der Hiobsbotschaften aus dem Beitrittsgebiet herrschte in der Kanzlerrunde in Bonn Krisenstimmung.[8] Ein Signal zum Umsteuern musste aus der Politik kommen. Bundeskanzler Helmut Kohl äußerte gegenüber dem Leiter der Abteilung Wirtschafts- und Finanzpolitik im Bundeskanzleramt Johannes Ludewig, den Wunsch nach einem Termin vor Ort.[9] Ludewig verwies auf die bereits bestehenden Kontakte zur Buna AG in Schkopau. Aus Schkopau, einem kleinen Ort nahe Halle (Saale), liege eine Einladung vor.[10]
Als Helmut Kohl am Vormittag des 10. Mai 1991 in Schkopau eintraf, schwankte die Stimmung zwischen Bangen und Hoffen. Betriebsrätin Ingrid Häußler begrüßte ihn und appellierte: »Bitte enttäuschen Sie unser Vertrauen nicht.« Darauf Kohl: »Das ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass ich dies versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten.«[11] Er wich vom Manuskript ab und gab anstelle einer unverbindlichen Erklärung de facto eine Bestandsgarantie für die Unternehmen des Chemiedreiecks. Der Schlüsselsatz lautete: »Ich werde alles tun, dass dieses Chemie-Dreieck erhalten bleibt und weiter ausgebaut wird.«[12] Kohl wiederholte sein Versprechen sinngemäß am Nachmittag des 10. Mai vor Arbeitern der Chemie AG in Bitterfeld: »Der Standort des Chemiedreiecks in Mitteldeutschland bleibt. Wir werden etwas Vernünftiges daraus machen.«[13]
Während im korrigierten Redemanuskript noch stand, dass »Leuna, Buna, Bitterfeld und Wolfen als Produktionsstandorte erhalten bleiben«, fehlte im Bulletin der Bundesregierung vom 17. Mai 1991 diese Passage.[14] Im öffentlichen Bewusstsein blieb aber die mündliche Rede ausschlaggebend und natürlich beriefen sich Landes- und Kommunalpolitiker, Gewerkschaftsfunktionäre und Betriebsräte in der Folgezeit immer wieder auf die »Standortgarantie«. Dies setzte die Treuhand unter Zugzwang.
Bis zu den Demonstranten vor dem Rathaus in Halle, die am Nachmittag des 10. Mai auf den Kanzler warteten, um ihre Wut und Enttäuschung über den Niedergang der Wirtschaft und die drohenden Massenentlassungen herauszuschreien, hatte sich die Botschaft noch nicht herumgesprochen, oder sie wurde als Täuschungsmanöver empfunden.[15] Die Situation geriet außer Kontrolle als der Kanzler mit Eiern beworfen wurde, kurzzeitig die Selbstbeherrschung verlor und er auf einen der Werfer, den 21-jährigen Jurastudenten Matthias Schipke, stellvertretender Vorsitzender der Jungsozialisten in Halle, zustürmte. Nur mit Mühe konnten seine Begleiter eine Schlägerei verhindern.[16] »Da ich nicht die Absicht habe – wenn jemand vor mir steht und mich bewirft – davonzulaufen, bin ich eben auf die Menschen zu. Und da hat ein Gitter dazwischengestanden. Und das war von Nutzen“, erklärte Helmut Kohl später.[17] Der »Eierwerfer von Halle« wurde verhaftet, blieb aber straffrei, da Kohl auf eine Anzeige verzichtete.[18]
Der Eierwurf wurde von Kommentatoren als ein symbolischer Wendepunkt für das Verhältnis zwischen dem »Kanzler der Einheit« und Teilen der ostdeutschen Bevölkerung betrachtet. Dabei geriet fast in Vergessenheit, dass mit dem »Kanzlerversprechen« am 10. Mai 1991 auch die Weichen für die Zukunft der Chemieregion gestellt werden sollten. Die Anfänge einer Industriepolitik, die später unter dem Slogan »Erhalt von industriellen Kernen« subsummiert wurde, sind in den Krisenmonaten des Frühjahrs 1991 zu verorten.
Die chemische Industrie und die Raffinerien wurden in der vorliegenden Studie als Untersuchungsgegenstand gewählt, weil es sich um Branchen mit großer volkswirtschaftlicher Bedeutung handelt. Auch gab es zwischen den wichtigsten Standorten der Chemieindustrie in West- und Ostdeutschland historische Bindungen, die bis Anfang des 20. Jahrhunderts zurückreichten und eng mit der Entstehungsgeschichte des sogenannten mitteldeutschen Chemiedreiecks verbunden waren.[19] So waren bspw. die Ammoniakwerk Merseburg GmbH, besser bekannt unter dem Werksnamen Leuna, und die Stickstoffwerke Piesteritz, Gründungen der BASF AG, Ludwigshafen, bzw. der Bayerischen Stickstoffwerke AG, Troisdorf. Auch in den Jahrzehnten der deutschen Teilung rissen die Verbindungen zwischen den Betrieben sowie Kombinaten der chemischen Industrie der DDR und den westdeutschen Chemiekonzernen nicht ab. Es gab vielfältige Lieferbeziehungen, die vor allem in den 1970er-Jahren eine gewisse Dynamik entfalteten. Daher war nach dem Fall der Mauer, wenn auch nur für kurze Zeit, die Hoffnung unter den Belegschaften der ostdeutschen Chemiewerke groß, dass sich die westdeutschen Branchenriesen für komplette Standortübernahmen einsetzen würden. Als diese Erwartungen zerstoben, richteten sich die Blicke umso mehr auf die Politik und die Treuhand. Dabei zeigte sich in keiner anderen Branche so rasch und so deutlich, dass ihr ursprünglicher Auftrag, schnellstmöglich zu privatisieren und aus den Erlösen die eigene Tätigkeit, einschließlich der Sanierung von Betrieben, zu finanzieren, nicht annährend zu erfüllen war. Die chemische Industrie mutierte zum größten Problemkind der Treuhand.
Auch wenn es nicht offen kommuniziert wurde, sah sich die Privatisierungsagentur aufgrund des öffentlichen Drucks seit dem Frühjahr 1991 gezwungen, in einem in der Geschichte der Bundesrepublik bisher beispiellosen Ausmaß sowohl Industriepolitik als auch die Sanierung von Umweltaltlasten zu betreiben. Wie passt dies zu dem in den Debatten um die Politik der Treuhand vorherrschenden Bild einer neoliberal denkenden und handelnden Behörde? Auf welche Widerstände stieß die Treuhand bei ihrem Kurswechsel und welche Akteure drängten auf den Erhalt »industrieller Kerne«? Wie beeinflussten die in den 1990er-Jahren weiter an Dynamik gewinnende Globalisierung und der am 7. Februar 1992 in Maastricht geschlossenen Vertrag über die Europäische Union (EU) den Transformationsprozess in der ostdeutschen Chemieindustrie?
Abgesehen von der internationalen Dimension des Geschehens bestand ein wichtiges Anliegen des Treuhandprojekts des Instituts für Zeitgeschichte München–Berlin (IfZ) auch darin, die regionalen Spezifika der Privatisierungspolitik zu untersuchen. Diese Thematik wurde in den Publikationen von Wolf-Rüdiger Knoll über die Privatisierungspraxis in Brandenburg, von Eva Lütkemeyer über die Transformation der Werftindustrie in Mecklenburg-Vorpommern und von Dierk Hoffmann über den Mythos eines sächsischen Sonderwegs behandelt.[20] In diesen Kontext ordnet sich auch die vorliegende Studie ein. Kein anderes ostdeutsches Bundesland war stärker von den Werken der Großchemie, mit ihren Zehntausenden von Arbeitsplätzen, geprägt als Sachsen-Anhalt. Die wirtschaftlichen Probleme des Landes waren in einem erheblichen Maße mit der Großchemie verknüpft.
Wer die Schwierigkeiten des Transformationsprozesses in den 1990er-Jahren besser verstehen will, kommt nicht an einer Analyse des Zustands der DDR-Wirtschaft in den letzten Monaten ihrer Existenz vorbei. Allerdings birgt die Fixierung auf die Zeitenwende 1989/90 die Gefahr, nur eine »Schlussbilanz« zu ziehen, und die längeren historischen Trends und Rahmenbedingungen, die zum Scheitern des planwirtschaftlichen Modells führten, außer Acht zu lassen. Daher werden im ersten Abschnitt des Buches die Herausbildung des mitteldeutschen Chemiedreiecks und dessen Spezifika, die Modernisierungsversuche in den 1960er- und 1970er-Jahren und die Kumulierung von wirtschaftlichen und ökologischen Problemen in den 1980er-Jahren behandelt.
Die im März 1990 gegründete Treuhand sollte das »Unmögliche wagen« (Wolfram Fischer) und die gesamte Volkswirtschaft der DDR innerhalb von nur vier Jahren privatisieren.[21] Die Einmaligkeit dieser Aufgabe wird von vielen Autoren hervorgehoben und mit dafür ins Feld geführt, dass die Arbeit der Treuhand von Beginn an von Irrtümern und Fehlern begleitet wurde. Sie verwaltete die von der Politik befeuerte »Illusion« (Wolfgang Seibel), dass ein neues Wirtschaftswunder möglich sei und der »Aufbau Ost« innerhalb einer kurzen Zeit bewältigt werden könne.[22] Als sich diese Erwartungen erkennbar nicht einlösen ließen, und anstelle eines Aufschwungs nach der Einführung der D-Mark ab Juli 1990 die Talfahrt der ostdeutschen Wirtschaft einsetzte, diente die Treuhand der Politik als »Prellbock« (Dieter Grosser) und wurde später zur »erinnerungskulturellen Bad Bank des Ostens« (Constantin Goschler/Marcus Böick).[23]
Mit der ihr zugedachten Aufgabe der schnellen Privatisierung von mehr als 8500 Betrieben war die Treuhand von Anfang an überfordert, zumal ihr noch eine Reihe weiterer Aufgaben zuwuchsen. Die Privatisierungsagentur musste sich um die Regelung von komplizierten vermögensrechtlichen Fragen ebenso kümmern, wie um die Finanzierung von Sozialplänen und die Beseitigung von ökologischen Altlasten. Die These von der »überforderten Behörde«, die angesichts dieser Konstellationen ihren Auftrag nicht bzw. nur teilweise erfüllen konnte, hat daher weite Verbreitung gefunden (Andreas Rödder, Dierk Hoffmann).[24]
Die Vereinigungskrise erreichte mit der der Ermordung des Präsidenten der Treuhand, Detlev Karsten Rohwedder, am 1. April 1991 einen Kulminationspunkt. Danach wurde die Treuhand von der Politik in die Pflicht genommen, ihre bis dahin radikal verfolgte Privatisierungs- und Betriebsschließungsstrategie zu überdenken und sich in stärkerem Maße auch um die Sanierung ihrer Unternehmen zu kümmern. In einem besonderen Maße traf dies auf die Standorte der Großchemie zu. Die Anfänge der Politik zur Bewahrung von industriellen Kernen sind im Kanzlerversprechen zum Erhalt des mitteldeutschen Chemiedreiecks vom 10. Mai 1991 zu sehen.[25]
Warum hielten sich die westdeutschen Chemiekonzerne, die zu den Weltmarktführern gehörten und in den 1980er-Jahren große Gewinne erwirtschaftet hatten, mit Investitionen in Ostdeutschland zurück? Wie verlief der Kampf um die wenigen »Perlen« der Treuhand, darunter die größte und modernste ostdeutsche Raffinerie in Schwedt/Oder? Welche Intrigen spielten sich dabei in der Privatisierungsagentur ab? Wie kam es zur Initiierung des Großchemieprojekts und in welchem Verhältnis standen Schrumpfen, Stilllegungen und Neuinvestitionen? An welchen Punkten gab es Alternativen zu dem von der Treuhand eingeschlagenen industriepolitischen Kurs?
Abschließend wird danach gefragt, wie die Privatisierungspolitik der Treuhand im Bereich der Großchemie und Raffinerien sowie der kleineren, konsumnahen Branchen mit dem Abstand von mehr als drei Jahrzehnten einzuschätzen ist. Hat sich dieser Kraftakt gelohnt oder wurden nur überlebte Strukturen mit viel Geld konserviert? Ist die lange Zeit dominierende Erzählung von der Deindustrialisierung Ostdeutschlands und den daraus resultierenden vielfältigen sozialen und mentalen Problemen im Licht der inzwischen vorliegenden Erkenntnisse über den Zustand der DDR-Wirtschaft und den Verlauf des Transformationsprozesses in den 1990er-Jahren noch zeitgemäß? Wie ordnet sich die Branchengeschichte in die Gesamtgeschichte der Treuhand ein? Und nicht zuletzt, welche Langzeitwirkungen hat der Transformationsprozess in den untersuchten Branchen bis heute?
Ein Schwachpunkt vieler Darstellungen zur Geschichte der Treuhand besteht darin, dass zur Illustration der eigenen Thesen oft nur einzelne Privatisierungsfälle vorgestellt werden.[26] Dies führt zu einseitigen Bewertungen. Im neunten Kapitel der Studie wird daher der Versuch unternommen, die Privatisierungsverläufe in wichtigen Zweigen der chemischen Industrie anhand der inzwischen frei zugänglichen Akten der Treuhand und anderer Quellen umfassend zu analysieren. Mit diesem Vorgehen wird die Basis für die Bewertung der Arbeit der Treuhand erweitert. Auch können bisher empirisch nicht hinreichend gestützte Thesen einer Prüfung unterzogen werden.
Zum Verantwortungsbereich des Direktorats Chemie der Treuhand gehörten ab Sommer 1990 17 Aktiengesellschaften und 205 GmbHs. All diese Unternehmen in den Blick zu nehmen, ist in einer Studie kaum möglich. Meine Branchenstudien beschränken sich daher auf die Unternehmen der Mineralölindustrie, Pharmazie, Kosmetik, Haushaltschemie und Düngemittelproduktion. Ausgeklammert bleiben die Betriebe der ehemaligen Kombinate Plast- und Elastverarbeitung Berlin sowie Chemieanlagenbau Grimma.[27] Von ihren Profilen her sind sie nicht der chemischen Industrie zuzurechnen. Nicht behandelt werden auch die zum Chemiefaserkombinat Schwarza und zum Reifenkombinat Pneumant Fürstenwalde gehörenden Betriebe. Beide Branchen bilden einen Schwerpunkt in der Monografie von Wolf-Rüdiger Knoll.[28]
Bereits untersucht wurde die weitgehend gescheiterte Privatisierung der Klein- und Mittelbetriebe der Lacke- und Farbenindustrie.[29] Zum gleichnamigen Kombinat gehörten zwölf Betriebe, 39 Produktionsstätten und weniger als 8000 Beschäftigte. Die Treuhand verfolgte anfangs die Idee einer Gesamtprivatisierung der Lacufa AG. Für einen Einzelkäufer war das Unternehmen jedoch zu heterogen und zu groß, seine Einzelbetriebe aber wiederum zu klein und nicht wettbewerbsfähig. Der Ökonom Horst Albach bewertet das Gesamtkonzept zur Privatisierung der Lacufa AG, deren Aufsichtsrat er angehörte, als »grundsätzlich falsch« und spricht von einem »Mortalitätsprozess«.[30] Nur wenige Betriebe mit insgesamt wenigen Hundert Beschäftigten blieben übrig.
Anzumerken ist, dass trotz des weitgehenden Scheiterns der Transformation der Betriebe der Lacke- und Farbenindustrie eines der erfolgreichsten Brandenburger Unternehmen ausgerechnet aus dieser Branche hervorging: die ORAFOL Europe GmbH in Oranienburg. Im April 1991 wurde die ORAFOL Klebetechnik GmbH im Zuge eines Management-Buy-in/Management-Buy-out- (MBI/MBO) Verfahrens privatisiert. Das Unternehmen produzierte selbstklebende grafische Produkte, Klebebandsysteme und reflektierende Materialien. Die neuen Eigentümer und Geschäftsführer Holger Loclair verpflichteten sich zu Investitionen in Höhe von 3,5 Millionen DM und zum Erhalt von 60 Arbeitsplätzen.[31] Im Jahr 2019 setzte die ORAFOL-Gruppe mit 1080 Mitarbeitern in Oranienburg und 2500 Beschäftigten weltweit mehr als 620 Millionen Euro um.[32] Es ist eine der erstaunlichsten Erfolgsgeschichten eines ostdeutschen Unternehmers nach der Einheit.
Allein diese Geschichte zeigt bereits, dass eine Verengung des Blicks auf die frühen 1990er-Jahre zu kurz greift. Der wirtschaftliche Transformationsprozess endete nicht mit der Ablösung der Treuhandanstalt durch die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) ab 1995. Die BvS hatte insbesondere im Bereich der chemischen Industrie noch vielfältige Aufgaben zu bewältigen. Dazu gehörte der Abschluss der Privatisierungen, die Kontrolle und Nachbesserung von Privatisierungsverträgen, die Wahrnehmung von Eigentümerfunktionen bei den noch immer zahlreichen in öffentlicher Hand befindlichen Unternehmen, die Altlastensanierung und anderes mehr. Der Untersuchungszeitraum endet daher in der vorliegenden Studie erst im Jahr 2000.
Frühere Publikationen zur Geschichte der Treuhand beruhten vor allem auf der von der Anstalt selbst im Jahr 1994 herausgegebenen fünfzehnbändigen Dokumentation, Zeitungsartikeln und Zeitzeugeninterviews. Die Treuhanddokumentation enthält für die Forschung unverzichtbare Quellen, auch wenn sie eiligst und lückenhaft zusammengestellt wurden.[33] Der Historiker Marcus Böick – er veröffentlichte im Jahr 2018 die bisher umfangreichste Studie zur Geschichte der Treuhand – hat neben Zeitzeugeninterviews mit ehemaligen Treuhandmitarbeitern vor allem diese Dokumentation genutzt, konnte damals aber noch keinen Einblick in die Akten der Anstalt nehmen.[34]
Für das vorliegende Buch wurden die inzwischen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesarchivs noch während der Laufzeit des IfZ-Projekts erschlossenen Akten der Treuhand, insbesondere die Unterlagen des Vorstands, des Verwaltungsrats, des Leitungsausschusses sowie des Chemiedirektorats genutzt. In oft mühevoller Kleinarbeit wurden vom Bundesarchiv auf Nachfrage des Autors auch die Akten Dutzender kleinerer Betriebe, über deren Privatisierung oder Liquidation bisher kaum Informationen vorlagen, für die Nutzung vorbereitet. Damit konnte die Quellengrundlage für die Analyse des Privatisierungsgeschehens in einzelnen Zweigen der chemischen Industrie entscheidend erweitert werden.
Die Treuhand verfügte in den ersten zwei Jahren ihrer Tätigkeit über außergewöhnlich große Handlungsspielräume. Trotzdem fanden tagtäglich Interaktionen mit den Bundesbehörden und Landesregierungen statt. Daher war eine Einsichtnahme in die für das Thema relevanten Akten des Bundeskanzleramts, des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) und des Bundesministeriums für Wirtschaft (BMWi) ebenso unverzichtbar, wie die Durchsicht der Bestände der Landesarchive von Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie des Sächsischen Staatsarchivs in Chemnitz und des Sächsischen Wirtschaftsarchivs in Leipzig. Die Aktivitäten großer westdeutscher Konzerne in den ostdeutschen Bundesländern, darunter BASF, Hoechst und Schering (heute Bayer-Pharma), konnten mithilfe der entsprechenden Unternehmensarchive analysiert werden.
Wichtige Informationen und Quellen stammen aus zahlreichen Gesprächen mit Geschäftsführern von privatisierten Unternehmen und Infrastrukturgesellschaften. Die betrieblichen Unterlagen wurden zumeist erstmals für die historische Forschung freigegeben und gewährten tiefere Einblicke in Einzelfallentscheidungen, aber auch allgemeine wirtschaftliche Probleme in den 1990er-Jahren.
Besonders reizvoll war die Auswertung der Tagebücher und Nachlässe zweier Treuhanddirektoren, die für die wichtigsten Privatisierungen in der chemischen Industrie und Mineralölindustrie die Verantwortung trugen: Hans-Peter Gundermann und Klaus Schucht. Sie verfolgten in erbitterter Konkurrenz zueinander unterschiedliche Strategien. Das konfliktträchtige Innenleben der Treuhand lässt sich anhand ihrer Aufzeichnungen gut illustrieren. Nicht zuletzt waren neben der Nutzung der genannten umfangreichen schriftlichen Quellen vor allem bei kleineren Unternehmen auch Zeitzeugeninterviews und Privatarchive eine wichtige Hilfe.
I. DDR-Chemie: Vom Hoffnungsträger zum hoffnungslosen Fall?
1. Die Anfänge der Grundstoff- und Spezialitätenchemie
Ein Pendant zum Ruhrgebiet, dem größten industriellen Ballungsraum in Deutschland, entstand Ende des 19. Jahrhunderts in Teilen der preußischen Provinz Sachsen (heute Sachsen-Anhalt) und im angrenzenden Nordwestsachsen. Anders als im durch eine polyzentrische Agglomeration geprägten Ruhrgebiet konzentrierte sich die industrielle Verdichtung auf zwei Städte und ihr weiteres Umland: Halle an der Saale und Leipzig an der Pleiße. Bis dahin war Leipzig in erster Linie eine bedeutende Handels- und Messestadt und Halle eine Kultur- und Universitätsstadt. Die industrielle Entwicklung beider nur rund 40 Kilometer voneinander entfernt liegender Zentren erhielt entscheidende Impulse durch die Erschließung nahe gelegener Braunkohlelagerstätten.[1] Für den industriellen Verdichtungsraum zwischen Halle und Leipzig bürgerte sich der Begriff »mitteldeutsches Industrierevier« ein.[2]
Das erste große chemische Werk in Mitteldeutschland verdankte seine Gründung allerdings nicht der Braunkohle, sondern den Steinsalz- und Kalkstein-Vorkommen nahe Bernburg. In dieser Kleinstadt an der Saale errichtete die belgische Solvay AG 1882 eine Sodafabrik.[3] Das Werk sollte die rasch wachsende Nachfrage der Textil- und Glasindustrie an Chemikalien zur Herstellung von Reinigungs- und Bleichmitteln bedienen.[4] Der Solvay-Konzern baute sein Bernburger Werk zur weltweit größten Sodafabrik aus.[5]
Im benachbarten Staßfurt hatte die Industrialisierung noch eher begonnen. Dort nahm der preußische Staat 1851 das erste Kalibergwerk der Welt in Betrieb.[6] Zehn Jahre später gründete der Chemiker Adolph Frank in Staßfurt die erste chemische Fabrik zur Herstellung von Chlorkalium.[7] Nahezu zeitgleich kam es zu weiteren Gründungen von Unternehmen der Kalichemie. Zeitgenossen verglichen die durch die Kaligewinnung und Kalichemie ausgelöste wirtschaftliche Entwicklung Staßfurts um die Jahrhundertwende mit dem Goldrausch in Kalifornien.
Die Gewinnung von Kalisalzen blieb noch bis zum Ende des Ersten Weltkriegs ein deutsches Monopol. Die Kalichemie stand also am Beginn der Entwicklung der Chemieindustrie in Mitteldeutschland. Später forcierte die DDR den Abbau des »weißen Goldes« und dehnte den Kalibergbau immer weiter aus.[8] Die DDR war in den 1980er-Jahren hinter der Union der Sozialistischen Sowjetrepublik (UdSSR) und Kanada drittgrößter Kaliexporteur der Welt.[9]
Ein weiteres industrielles Erbe, das von der DDR bruchlos fortgeführt wurde, war die Produktion von Teer, Leichtölen und Kraftstoffen in Braunkohlenschwelereien. Diese waren ebenfalls ab Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet worden.[10] Die ausschließlich auf der Nutzung heimischer Braunkohle basierenden Anlagen belasteten mit ihren Abfällen in hohem Maße die Umwelt. Die DDR wollte sich von diesem industriellen Erbe trennen, hielt dann aber aufgrund ihrer wachsenden Auslandsverschuldung an der Weiternutzung der Schwelereien fest, um mehr Mineralölprodukte zulasten der heimischen Energiebilanz exportieren zu können. Mit der Braunkohlechemie verbunden waren auch Paraffinfabriken, die in der Nähe der genannten Schwelereien gegründet wurden. In Mitteldeutschland gehörten dazu Unternehmen in Webau, Köpsen und Gerstewitz.[11]
Ein weiterer Spezialzweig entstand mit der Gewinnung von Montanwachs. Dieser Grundstoff diente unter anderem zur Herstellung von Schuh- und Lederpflegemitteln. Als besonders geeignet für die Produktion von Montanwachs erwies sich die Braunkohle aus dem Revier Oberröblingen nahe Eisleben.[12] Wie schon im Fall der Kalisalz- und Sodaproduzenten, kam es zur Ausbildung eines natürlichen Monopols.
Die erste Montanwachsfabrik errichtete die Hamburger Firma Schliemann & Co. in Völpke im Jahr 1900. Wenige Jahre später nahm die A. Riebeck’sche Montanwerke AG, Halle, gleich drei Montanwachsfabriken im Revier Halle-Röblingen in Betrieb. Das Unternehmen gehörte zu den finanzstärksten Aktiengesellschaften im mitteldeutschen Industrierevier und verfügte in Amsdorf über die weltweit leistungsstärkste Anlage zur großtechnischen Gewinnung von Montanwachs.[13]
Vorweg genommen sei an dieser Stelle, dass die natürlichen Monopole bei der Produktion von Soda und Montanwachs den betreffenden Unternehmen nach der deutschen Einheit den Übergang zur Marktwirtschaft entscheidend erleichterten.
Nicht nur auf den verschiedenen Gebieten der Kohlechemie (auch Carbochemie genannt), sondern auch in der Kosmetikindustrie entstanden hauptsächlich in Sachsen Unternehmen, die überregionale Bedeutung erlangten. Impulse für die industrielle Herstellung von ätherischen Ölen kamen aus dem Fernhandel. In der Messestadt Leipzig hatten weltweit operierende »Drogenhandlungen« ihren Sitz. Sie handelten mit Rohstoffen, die zur Fabrikation von Duft- und Aromastoffen und Parfümen benötigt wurden. Zu den wichtigsten Herstellern dieser Produkte gehörten die Firmen Schimmel & Co. sowie Heine & Co.[14] Schimmel & Co. stieg zum weltweit führenden Unternehmen der Riechstoffindustrie auf. Das rasante Wachstum machte im Jahr 1900 den Neubau einer Fabrik in der Gemeinde Miltitz, nahe Leipzig, nötig.[15]
Ebenfalls in Leipzig begann 1884 der Vertrieb von Zelluloid. Carl Ernst Mey, Begründer des deutschen Versandhandels, wandte sich diesem neuen Produkt zu und ließ 1887 in Eilenburg ein Werk zur Produktion von Cellulosenitrat bauen. Dieser Grundstoff diente zur Herstellung von Zelluloid und Lacken – Produkte, die hauptsächlich für die Film- und Schallplattenherstellung verwendet wurden.[16] Seit 1889 firmierte das Unternehmen als Deutsche Celluloid-Fabrik AG und später als Eilenburger Chemiewerk.
Auch in Dresden etablierten sich Unternehmen der Kosmetikindustrie. Der Aufstieg zu einer weltbekannten Firma mit Fertigungsstätten in mehr als 20 Ländern gelang den Lingner-Werken, dank des von Karl August Lingner zwar nicht selbst erfundenen, aber sehr geschickt vermarkteten Mundwassers »Odol«.[17] Fast zwei Drittel ihres Umsatzes erzielten die Lingner-Werke im Ausland. Eine weitere wichtige Innovation aus Dresden war die erste maschinell hergestellte und in Metalltuben abgefüllte Zahncreme »Chlorodont«. Die vom Apotheker und Chemiker Ottomar Heinsius von Mayenburg entwickelte und in den Leo-Werken produzierte Zahncreme gehörte zu den führenden europäischen Marken. Ihr Erfolg basierte auf einem cleveren Marketing, das Mayenburg mit Aufklärungskampagnen zur Mundhygiene kombinierte.[18]
In den sächsischen Kleinstädten Waldheim, Döbeln und Rothenkirchen siedelten sich ebenfalls Produzenten von Kosmetika an. Seit 1875 produzierte die von August Bergmann gegründete Parfümerie- und Feinseifenfabrik in Waldheim verschiedenste Kosmetika.[19] Im Jahr 1920 ließ Bergmann das Warenzeichen »Florena« beim Reichspatentamt in München registrieren.[20] Diese Marke sollte zu den ganz wenigen gehören, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR verblieben und eine große Bekanntheit erlangten.
Zu den herausragenden Firmen der Branche gehörte die Rothenkirchen ansässige Londa GmbH, ab 1930 Teil der Franz Stöher AG. Mit der Marke »Wella« entwickelte sich das Unternehmen zum umsatzstärksten europäischen Produzenten von Haarpflegemitteln.
Von den vorstehend nur kurz skizzierten Gründerjahren bis zum Ersten Weltkrieg vollzog sich ein entscheidender Wandel in der chemischen Industrie: die Schwerpunktverlagerung von den Schwer- zu den Feinchemikalien. Zur erstgenannten Gruppe gehören unter anderem Soda und Schwefelsäure, zur zweiten Gruppe Farbstoffe und Arzneimittel.[21] Während die Produktion chemischer Grundstoffe nur relativ wenige theoretische Kenntnisse erforderte, waren diese für die Herstellung von Farbstoffen und Arzneimitteln unerlässlich. Dies wiederum hatte eine starke Annäherung von Industrie und Universitäten zur Folge.
2. Genesis des mitteldeutschen Chemiedreiecks
Der rasante Aufstieg der deutschen chemischen Industrie begann mit der Produktion von Anilinfarben. Aus den giftigen und übelriechenden Abfällen der Teerherstellung produzierte sie Farbstoffe, die schon bald die aus natürlichen Rohstoffen gewonnenen Farbstoffe verdrängten. Ihre Firmennamen verweisen auf diese Ursprünge: Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co. AG (später Bayer AG), Leverkusen, Badische Anilin- und Sodafabrik AG (BASF), Ludwigshafen, Farbwerke Hoechst AG, vorm. Meister, Lucius & Brüning (Hoechst), Cassella Farbwerke Mainkur, Frankfurt am Main. Lediglich die Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA) hatte ihren Stammsitz außerhalb der Rhein-Main-Region in Berlin eingerichtet. Die Bedeutung der Teerfarbenchemie bestand nicht nur in der Produktion von neuen und billigen Farbstoffen. Die Anilinfarben waren die ersten Erzeugnisse in der Geschichte der Menschheit, die auf synthetischem Wege hergestellt wurden.
Auf vielfältigste Weise mit der Farbstoffindustrie verbunden war die Entwicklung der pharmazeutischen Industrie. Die Erfahrungen mit der Synthese von Farbstoffen führten zu der Erwartung, dass man auf ähnliche Weise auch Arzneimittel herstellen könne.[22] Manchmal bildeten Farbstoffe den Ausgangspunkt für die Herstellung eines Medikaments. Die großen Farbstoffhersteller Hoechst und Bayer begannen daher auch mit der Produktion von pharmazeutischen Produkten und waren damit so erfolgreich, dass sie schon bald den Weltmarkt dominierten.
Zwar wurden auch in Mitteldeutschland und Berlin zahlreiche pharmazeutische Unternehmen gegründet, aber nur wenige erlangten überregionale Bedeutung. Zu ihnen gehörten die Chemische Fabrik von Heyden AG in Radebeul, Dr. Madaus & Co. GmbH ebenfalls in Radebeul, die Sächsisches Serumwerk AG, Dresden, Dr. Byk AG Oranienburg, das Werk von Dr. Willmar Schwabe in Leipzig sowie Betriebsstätten der Schering AG in Berlin-Adlershof und Eberswalde.[23] Vor dem Zweiten Weltkrieg entfielen nur rund 5 Prozent der pharmazeutischen Produktion des Deutschen Reiches auf diese und andere in Mitteldeutschland ansässige Hersteller. In der DDR sollte daher auf die pharmazeutische Industrie nur ein kleiner Anteil am Gesamtumsatz der chemischen Industrie entfallen, sehr im Unterschied zur Bundesrepublik Deutschland.
Während Unternehmen der pharmazeutischen Industrie in Großstädten, oder zumindest in deren Nähe gegründet wurden, begann der Aufstieg der mitteldeutschen Großchemie in der Nähe von Braunkohlevorkommen. Zum ersten wichtigen Standort des später sogenannten Chemiedreiecks mit den Eckpunkten Bitterfeld-Halle-Merseburg entwickelten sich Unternehmensgründungen in Bitterfeld und Greppin (Wolfen). Familiäre Verbindungen zwischen Walther Rathenau, Direktor der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), und Franz Oppenheim, Direktor der AGFA – zwei der bedeutendsten Berliner Industriellen –, beeinflussten die Standortfindung. Oppenheim bekam vom Gründer der AEG, Emil Rathenau, und von seinem Sohn Walther den entscheidenden Hinweis. Die AEG stand im Begriff, in Bitterfeld eine Leichtmetallfabrik zu bauen. Nahe Bitterfeld wurde die billigste Braunkohle in ganz Deutschland gefördert. Auch die gute Eisenbahnanbindung, preiswertes Bauland und niedrige Löhnen sprachen dafür, die Elektrochemische Werke GmbH dort anzusiedeln.[24] Nur wenige Wochen später folgte die Konkurrenz in Gestalt der Chemischen Fabrik Griesheim und gründete in Bitterfeld die Chemische Fabrik Elektron AG.[25] Dank dieser Unternehmen stieg Bitterfeld zum innovativen Zentrum der Leichtmetallproduktion und Chlorchemie auf.[26]
Die AGFA erwarb Bauland in den nahe gelegenen Dörfern Wolfen, Greppin und Thalheim, um dort 1894 eine Farbenfabrik zu bauen. In Berlin hatten dem Unternehmen dafür sowohl das Bauland als auch die staatlichen Genehmigungen gefehlt. Just in diese Zeit fiel die Hinwendung der AGFA zur Fotochemie, beginnend mit der Produktion von Filmentwicklern. Es folgte die Herstellung von Trockenplatten und Rollfilmen. Das dafür notwendige Zelluloid bezog die AGFA aus der bereits erwähnten Celluloidfabrik Eilenburg. Allerdings erwies sich Berlin-Treptow als Produktionsstandort angesichts zunehmender Luftverschmutzung als problematisch für die auf saubere Luft angewiesene Filmherstellung. Der um die Jahrhundertwende einsetzende Boom des Kinos, erfolgreiche eigene Forschungsarbeiten und nicht zuletzt die rasant wachsende Nachfrage nach Kinofilmen im Ausland veranlassten die AGFA-Direktion, in Konkurrenz mit dem amerikanischen Weltmarktführer Eastman Kodak zu treten, und eine neue Filmfabrik zu bauen. Für Wolfen sprachen die nahe gelegenen firmeneigenen Kohlengruben sowie der Bezug von Vorprodukten aus der Farbenfabrik. Nach knapp einem Jahr Bauzeit lief die Filmproduktion im Juli 1910 an.[27] Die AGFA Filmfabrik Wolfen entwickelte sich in wenigen Jahren zur größten Filmfabrik Europas.[28] Mit ihr wuchs die einstige 500-Seelen-Gemeinde Wolfen zu einer ganz von den AGFA-Fabriken dominierten Stadt, einschließlich vielfältiger Sozial- und Sporteinrichtungen sowie Werkswohnungen.
Mit den Ansiedlungen von Unternehmen der Großchemie in Bitterfeld und Wolfen verschob sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Schwerpunkt der Branche weg vom Landkreis Bernburg hin zur Region um Halle. Dies änderte zunächst nur wenig an der Dominanz der älteren Chemiestandorte an Rhein und Main.
Stärker in den Fokus als Standort für die Großchemie rückte das mitteldeutsche Industrierevier während des Ersten Weltkriegs. Die Region lag fernab der Fronten. Erst die kriegswirtschaftlichen Investitionen begründeten das mitteldeutsche Chemiedreieck. Auch in Bayern entstand während des Ersten Weltkriegs, begünstigt durch bereits vorhandene Wasserkraftwerke, in der dünn besiedelten Region zwischen Trostberg, Töging am Inn und Burghausen an der Salzach ein Chemiedreieck.[29]
Mit dem staatlich geförderten Aufbau von Anlagen zur Düngemittelproduktion sollte die Lebensmittelkrise im Kaiserreich gemindert werden. Zwei konkurrierende Verfahren für die Synthese von Ammoniak kamen zur Anwendung: das Kalkstickstoffverfahren der Bayerische Stickstoffwerke AG, Trostberg, und das Haber-Bosch-Verfahren der BASF, Ludwigshafen. Nachdem die Bayerische Stickstoffwerke AG (ab 1978 SKW Trostberg AG) bereits in Trostberg ein Werk gebaut hatte, errichtete das Unternehmen in Piesteritz, nahe der Lutherstadt Wittenberg, 1915 ein zweites Kalkstickstoffwerk. Ausgangsstoff war Karbid, das in acht Öfen gewonnen wurde.
Der Volkswirt Walter Eucken, Begründer der Freiburger Schule des Ordoliberalismus und einer der Vordenker der sozialen Marktwirtschaft, spricht in seiner Habilitationsschrift von den Besonderheiten des Vertrags, da das Werk in das Eigentum des Reiches überging, das damit auch das Risiko des Unternehmens zu tragen hatte.[30] Die Bayerischen Stickstoffwerke erhielten eine Beteiligung am Gewinn und mussten im Gegenzug alle Patentrechte, Lizenzen usw. für die Zwecke dieses Betriebes zur Verfügung stellen. Die Errichtung des Stickstoffwerks war primär ein politisches Projekt und veränderte in der Folgezeit die Wirtschafts- und Sozialstruktur der Lutherstadt Wittenberg einschneidend.[31] Im Jahr 1920 wurden die Reichsstickstoffwerke privatisiert und firmierten fortan unter Mitteldeutsche Stickstoffwerke AG. Die Erzeugung von Ammoniak auf Basis von Kalkstickstoff wurde in Piesteritz eingestellt, da sich das Haber-Bosch-Verfahren als leistungsfähiger erwiesen hatte. Das Piesteritzer Werk spezialisierte sich auf die Herstellung von Phosphordüngern, hochkonzentrierter Salpetersäure und Karbid.[32] Diese Produktionen beruhten auf dem Einsatz einheimischer Rohstoffe: Koks, Kalk und mineralische Phosphate.
Später wurde das Piesteritzer Werk an die Bayerische Stickstoffwerke AG – inzwischen Teil der Vereinigte Industrieunternehmungen AG (VIAG) des Reiches – verpachtet und 1933 Teil dieses Unternehmens. Damit kam es zu einer Verknüpfung des »bayerischen« mit dem »mitteldeutschen Chemiedreieck«. Dies zu erwähnen ist wichtig, da SKW Trostberg nach der deutschen Einheit wieder in Piesteritz aktiv wurde. Auch das größte im »bayerischen Chemiedreieck« ansässige Unternehmen, die Wacker Chemie AG, Burghausen, bemühte sich in den 1990er-Jahren um den Erwerb eines Chemiewerks im sächsischen Nünchritz und baute den Standort erfolgreich aus. Auf beide Fälle wird später noch einzugehen sein.
Kehren wir zur Chronologie zurück. Nicht nur die Bayerische Stickstoffwerke AG entdeckte den mitteldeutschen Raum für die kriegswichtige Produktion von Düngemitteln und Salpetersäure, sondern auch die BASF. Bereits im Dezember 1914 hatten der Konzern und das Kriegsministerium einen Vertrag zum Bau einer Salpetersäurefabrik in Oppau geschlossen. Ursprünglich sollte diese Anlage noch erweitert werden, doch auf Anregung von Fritz Haber, der als Chemiesachverständiger im Kriegsministerium fungierte, und nach einem französischen Luftangriff im Frühjahr 1915 auf das Werk in Oppau, entschloss sich der Vorstand der BASF, bei Leuna ein neues Werk, weitgehend finanziert vom Reich, zu bauen.[33]
Nach der Fertigstellung der dritten Ausbaustufe Ende 1922 bot das Leuna-Werk ein imposantes Bild. Es hatte einschließlich des Rangierbahnhofs eine Längenausdehnung von 4,5 Kilometer und eine größte Breite von 1 Kilometer, die sich auf 2,1 Kilometer erhöht, wenn man noch die bis zur Saale sich erstreckende Wohnkolonie Neu-Rössen hinzurechnet.[34]
Die BASF sicherte sich verschiedene nahe gelegene Braunkohlegruben. Die ankommende Braunkohle – 210 Waggons pro Tag – wurde in vier Tiefbunkern entleert und aus diesen durch Förderwagen in die oberhalb der Dampfkessel gelegenen Bunker gebracht. Sieben Kesselhäuser wurden nahe der Hauptverbrauchsstellen des Dampfes errichtet. Ein großer Teil des Hochdruckdampfes diente der Gewinnung von elektrischer Energie. Da über den Kesseln auch noch die Bunkeranlagen angeordnet waren, erreichten die Kesselhäuser die imposante Höhe von 32 Metern. Die Kesselhäuser, die sich über eine Wegelänge von 1,7 Kilometer erstreckten, waren miteinander durch Leitungen verbunden. Näherte sich ein Besucher dem Werk von Osten her, so erblickte er ihre Reihe als eine ununterbrochene gewaltige Mauer, die von 13 Schornsteinen mit ungefähr 120 Metern Höhe überragt wurde.[35] Von den Zeitgenossen wurde das Leuna-Werk daher als eine »Hochburg der Technik« gefeiert.[36]
Im Verlauf des Ersten Weltkriegs stieg auch der Bedarf an Treibstoffen für die Kriegsmarine. Chemiker entwickelten einen Hydrierprozess zur Gewinnung von Tetralin, aus Steinkohlenteer gewonnener Kohlenwasserstoff. Daraufhin wurde die Tetralin-Werke GmbH, die spätere Deutsche Hydrierwerke AG, gegründet und ein Werk in Rodleben gebaut.[37]
Das nationalsozialistische Regime knüpfte an die geschilderten Technologien an und setzte mit Programmen zur Autarkie und Aufrüstung auf eine bevorzugte Ansiedlung im mitteldeutschen Raum.[38] Etwa die Hälfte der Investitionen der I. G. Farbenindustrie AG – der Konzern war 1925/26 durch den Zusammenschluss der größten deutschen Chemiewerke entstanden – entfiel zwischen 1933 und 1944 auf ihre Werke in Mitteldeutschland.[39] Deren gewachsener Stellenwert spiegelte sich auch in der divisionalen und regionalen Organisationsstruktur der I. G. Farben wider. Die Filmfabrik Wolfen fungierte als Leitwerk der Sparte III und war damit für die gesamte Produktion von Filmen, Fasern, Zellwolle und weiteren Produkten des Konzerns weit über Mitteldeutschland hinaus verantwortlich. Der Filmfabrik wurden Werke in Bobingen, Dormagen, München, Leverkusen, Rottweil, Berlin und Premnitz zugeordnet.[40] Nicht nur mit Blick auf die Sparte III der I. G. Farben, sondern insbesondere durch den weiteren Ausbau des Leuna-Werkes, den Bau des ersten Synthesekautschukwerks in Schkopau und den Neubau mehrerer großer Werke zur Treibstoffproduktion aus Braunkohle, entstand im Zuge der Aufrüstung ein dritter großer Ballungsraum der Chemieproduktion im Deutschen Reich.
Die mit Abstand größten Produktionskapazitäten für Treibstoffe, vor allem Flugbenzin, wurden von der I. G. Farben in Leuna errichtet. Von der Braunkohle-Benzin AG (Brabag) – eine im Oktober 1934 auf Weisung des Reichswirtschaftsministers gebildete Pflichtgemeinschaft von zehn Braunkohleproduzenten – wurden drei Hydrierwerke in Böhlen, Magdeburg und Zeitz gebaut.[41] Diese nutzten das Hydrierverfahren der I. G. Farben. Außerdem begann die Wintershall AG, Kassel, in Lützkendorf mit dem Bau einer Hydrieranlage, nachdem das Unternehmen dort bereits mit der Errichtung einer Fischer-Tropsch-Anlage zur Treibstoffproduktion und einer Schmierölanlage begonnen hatte.[42] Eine weitere, wesentlich größere Fischer-Tropsch-Anlage – mit dieser Technologie konnten im Unterschied zur Hydriertechnologie der I. G. Farben neben Kraft- und Schmierstoffen auch Chemierohstoffe gewonnen werden – baute die Brabag in Schwarzheide. Mit diesen Werken war der mitteldeutsche Raum während des Krieges überproportional an der deutschen Treibstoffversorgung beteiligt.[43]
Neben der Produktion von Benzin aus Kohle war die Herstellung von Synthesekautschuk von herausragender Bedeutung für die Kriegswirtschaft. Auf der Grundlage neuer Verfahren wurde 1936 mit dem Bau eines ersten Buna-Werks in Schkopau, in der Nähe von Merseburg, begonnen. Zu den Autarkieprojekten gehörte ebenfalls die Errichtung von Gipsschwefelsäureanlagen in der Farbenfabrik Wolfen und einer weiteren Anlage in Coswig (Anhalt). Damit sollte die deutsche Industrie unabhängig von Importen schwefelhaltiger Rohstoffe werden.[44]
Infolge der genannten Investitionen verschoben sich die regionalen Schwerpunkte der Chemieproduktion. Die »jungen« mitteldeutschen Standorte gewannen auf Kosten der »älteren« Standorte an Rhein und Main.
Die in der Tabelle auf der nächsten Seite genannten Unternehmen produzierten nicht nur mit neuen Verfahren strategisch wichtige Erzeugnisse – darunter Ammoniak, Magnesium, Methanol, Treibstoffe und Synthesekautschuk –, sondern waren auch in konsumnahen Gebieten innovativ. Dem Hydrierwerk Rodleben gelang 1928 die weltweit erste kommerzielle Herstellung von Fettalkoholen durch Hydrierung, die AGFA produzierte in Wolfen 1934 die erste vollsynthetische Faser, entwickelte zwei Jahre später ein universelles Colorfilmverfahren und war auch bei der Entwicklung von Magnetbändern führend, die Ammoniakwerk Merseburg GmbH (Leuna) nahm 1942 die weltweit erste Großanlage zur industriellen Herstellung von Caprolactam, einem Vorprodukt für die Chemiefaserindustrie, in Betrieb.
Aufrüstung- und Kriegswirtschaft führten dazu, dass im mitteldeutschen Industrierevier nahezu ein Viertel aller in der chemischen Industrie Beschäftigten tätig war.[45] Damit hatte sich die Region noch vor dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet und der Rhein-Main-Region zum größten deutschen Chemierevier, gemessen an der Beschäftigtenzahl, entwickelt. Die Neubauprojekte in Mitteldeutschland wurden daher in Ludwigshafen, Leverkusen und Frankfurt am Main mit gemischten Gefühlen gesehen.[46]
Hauptstandorte der chemischen Industrie im mitteldeutschen Industrierevier
Unternehmen
Standort
Gründungsjahr
wichtigste Produkte
Deutsche Solvay AG
Bernburg
1880
Soda
Deutsche Celluloid AG
Eilenburg
1887
Cellulosenitrat, Celluloid
Elektrochemische Werke
Bitterfeld
1894
Leichtmetall, Kunststoffe
Elektron AG
Bitterfeld
1894
Leichtmetall, Kunststoffe
AGFA-Farbenfabrik
Wolfen
1894
Farbstoffe, Düngemittel
AGFA-Filmfabrik
Wolfen
1909
Fotofilme, Chemiefasern
Bayerische Stickstoffwerke
Piesteritz
1915
Kalkstickstoff
Ammoniakwerk Merseburg
Leuna
1916
Ammoniak, Treibstoffe
Deutsches Hydrierwerk
Rodleben
1916
Tetralin, Fettalkohol
BRABAG-Hydrierwerk
Böhlen
1935
Treibstoffe
BRABAG-Hydrierwerk
Magdeburg
1936
Treibstoffe
BRABAG-Hydrierwerk
Schwarzheide
1936
Treibstoffe
Wintershall-Schmierölwerk
Lützkendorf
1936
Schmieröl, Treibstoffe
BRABAG-Hydrierwerk
Zeitz
1937
Treibstoffe
Buna-Werk I
Schkopau
1936
Synthetischer Kautschuk
WASAG
Coswig (Anhalt)
1937
Düngemittel
Bei der Analyse der vorstehenden Tabelle fällt auf, dass es sich bei den genannten Werken in allen Fällen um Tochterunternehmen handelte. Ihre Stammhäuser und auch die Forschungsabteilungen befanden sich in den alten Zentren der chemischen Industrie oder im Ausland.
Die Autarkie- und Kriegswirtschaft des nationalsozialistischen Regimes hatte lange nachwirkende strukturelle Konsequenzen für die chemische Industrie und Mineralölwirtschaft. Sie führte zu einer Auseinanderentwicklung von Grundstoffchemie und höherveredelter Chemie. In den Werken des Chemiedreiecks wurden vor allem Grundstoffe, Düngemittel, Synthesekautschuk sowie Foto- und Kinofilme produziert.[47] Wenig entwickelt war hingegen die Produktion von Pharmazeutika, Lacken und Farben, Kunststoffen, Farbstoffen und Haushaltschemikalien.[48] Solange Deutschland ungeteilt war, fielen diese Disparitäten nicht ins Gewicht. Die Zerreißung der überregionalen Arbeitsteilung und Einschränkung der Austauschbeziehungen zwischen den Chemiestandorten hatte dann aber nach 1945 erhebliche negative Folgen für den Osten.
Alle großen Chemiebetriebe in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), darunter sämtliche Werke der I. G. Farbenindustrie AG, wurden nach Kriegsende von sowjetischen Einheiten besetzt. Ein Teil der Anlagen wurde demontiert. Ab Mitte 1946 wurde sämtliche Werke der Großchemie als Reparationsleistung in Sowjetische Aktiengesellschaften (SAG) überführt. Nicht nur die Werke der Großchemie wurden verstaatlicht, sondern auch ein großer Teil der mittelständischen Betriebe. Viele Inhaber flüchteten und verlegten die Firmensitze in den Westen. Mit ihnen wanderten kaum ersetzbares Fachwissen und auch die international bekanntesten Markennamen ab. Dies betraf unter anderem Marken aus der Kosmetik- und Waschmittelindustrie, wie »Wella«, »Odol« und »Persil«.
Eine Zeit lang gab es noch einen Markendualismus in beiden deutschen Staaten. So wurden bspw. das Waschmittel »Persil« und das Mundwasser »Odol« sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in der DDR produziert und vertrieben. Doch je eher westdeutsche Unternehmen auf die internationalen Märkte zurückkehrten, desto energischer erstritten sie die Rechte an den gut eingeführten Marken und Warenzeichen. Die konsumnahe Chemie der DDR konnte daher auf den Westmärkten nur noch No-name-Produkte anbieten. Dies fiel aus Sicht der Wirtschaftsplaner nicht sonderlich ins Gewicht, da der Export inzwischen ganz überwiegend in die osteuropäischen Länder gelenkt wurde. Zudem blieben Qualität und Verpackung der Konsumchemie hinter den internationalen Standards zurück.
Nur in wenigen Fällen kämpften DDR-Betriebe ausdauernd um die Bewahrung von Markenrechten. Das bekannteste Beispiel dafür war der VEB Film- und Chemiefaserwerk Agfa Wolfen. Auf diesen Betrieb entfielen vor dem Zweiten Weltkrieg fast 90 Prozent der gesamten deutschen Fotofilmproduktion.[49] Kriegs- und Teilungsfolgen, vor allem die Mitnahme fast aller Manager und Wissenschaftler durch die Amerikaner im Juni 1945, schwächten den Betrieb. Kleinere Produzenten in Westdeutschland gewannen Marktanteile und in Leverkusen hatte die Agfa mit Erlaubnis der britischen Besatzungsbehörden bereits 1947 mit dem Aufbau einer neuen Rohfilmfabrik begonnen, um die Wolfener Kapazitäten zu ersetzen. Auf längere Zeit war Agfa Aktiengesellschaft für Photofabrikation in Leverkusen jedoch noch auf Rohfilmbezüge aus Wolfen angewiesen, um die rasch wachsende Nachfrage im In- und Ausland befriedigen zu können. Da auch der Wolfener Betrieb die Agfa-Warenzeichen nutzte, entbrannte ein heftiger »Bruderkampf«. Trotz starker politscher Widerstände in beiden deutschen Staaten schlossen die Agfa AG Leverkusen und der VEB Film- und Chemiefaserwerk Agfa Wolfen im April 1956 einen Grundsatzvertrag, der die gemeinsame Nutzung der weltbekannten Warenzeichen regelte. Wolfen konnte auch weiterhin Rohstoffe von Werken der Bayer AG, der Muttergesellschaft der Agfa, beziehen und Leverkusen konnte mit Filmen aus Wolfen seine Position auf den internationalen Märkten stärken. Es blieb eine »Ehe auf Zeit«. Leverkusen erweiterte seine Produktionskapazitäten und Wolfen begann in der DDR eine eigene Rohstoffbasis für die Filmproduktion auszubauen und bereitete die Einführung des neuen Warenzeichens »Original Wolfen« (ORWO) vor. Die Vertragsbeziehungen endeten im April 1964. Wolfen verkaufte die letzten dem VEB noch verbliebenen Agfa-Warenzeichen an Leverkusen und etablierte, anfangs mit einigem Erfolg, die Marke ORWO international. Mit der technologischen Entwicklung in der fotochemischen Industrie konnte ORWO jedoch immer weniger mithalten und wurde weitgehend von den Westmärkten verdrängt. Inzwischen hatten sich Konzentrationstendenzen durchgesetzt, sodass nur noch vier große Hersteller – Kodak, Fuij, Konica und Agfa-Gevaert – den Weltmarkt beherrschten.[50] Auf dem nunmehr oligopolistisch strukturierten Rohfilmmarkt war kein Platz mehr für ORWO. Der VEB konnte daher den größten Teil seiner Exporte nur noch in der Sowjetunion realisieren.
In den weniger innovativen Zweigen der Grundstoffchemie wurden Autarkieprojekte fortgesetzt. Dies betraf den Wiederaufbau der Gipsschwefelsäurefabrik in Wolfen und den Neubau einer Gipsschwefelsäurefabrik in Coswig (Anhalt).[51] Weitere Vorhaben, die diesem autarkistischen Ansatz unter den spezifischen Bedingungen der deutschen Teilung zuzuordnen sind, stellten die Gründung des VEB Jenapharm 1950 und ein 1958 vom Politbüro des ZK der SED beschlossenes Programm zur »Unabhängigmachung der fotochemischen Industrie von Zulieferungen aus der BRD« dar.[52]