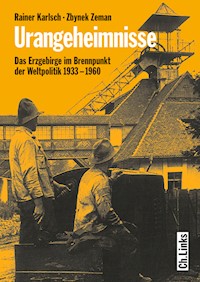
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Links, Ch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: DDR-Geschichte
- Sprache: Deutsch
Die Entwicklung der Atombombe war das größte geheime Unternehmen des 20. Jahrhunderts. Als der deutsche Physiker Otto Hahn Anfang 1939 die Entdeckung der Kernspaltung bekannt gab, stand der Beginn des Zweiten Weltkrieges kurz bevor. So war die weitere Atomforschung von dem Ziel geprägt, eine kriegsentscheidende Waffe zu entwickeln. Den dramatischen Wettlauf gewannen die Amerikaner, die im August 1945 zwei Atombomben gegen japanische Städte einsetzten.
In überraschend kurzer Zeit konnte die Sowjetunion den amerikanischen Vorsprung aufholen. Dies gelang vor allem durch den Abbau der Uranvorkommen in Sachsen und Böhmen, deren Bedeutung bis Kriegsende von allen Mächten unterschätzt worden war. Stalin erkannte sofort den strategischen Wert der kleinen Grenzregion. Unter Aufsicht seines Geheimdienstes entstanden in der SBZ/DDR und in der Tschechoslowakei zwei der größten sowjetischen Auslandsunternehmen.
Rainer Karlsch und Zbynek Zeman haben für ihre politische Geschichte des Uranbergbaus im Erzgebirge erstmals Quellen aus deutschen, russischen, tschechoslowakischen, amerikanischen sowie britischen Archiven ausgewertet und dokumentieren, mit welchen Methoden die Sowjetunion ihre "Uranlücke" zu schließen und den amerikanischen Vorsprung wettzumachen vermochte. Dabei stand das Erzgebirge im Zentrum der Weltpolitik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Rainer Karlsch/Zbynek Zeman
Rainer Karlsch/Zbynek Zeman
Urangeheimnisse
Das Erzgebirge im Brennpunkt der Weltpolitik 1933–1960
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
1. Auflage, September 2013 (entspricht der 3. Druck-Auflage von September 2007) © Christoph Links Verlag GmbH, 2002 Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel. (030) 4402 32-0www.christoph-links-verlag.de; [email protected] Umschlaggestaltung: KahaneDesign, Berlin, unter Verwendung eines Fotos vom ersten Uranerzschacht Europas im böhmischen Jáchymov in den 1930er Jahren, DIAMO Archiv, Příbram
Inhalt
Die Potsdamer Konferenz 1945
Der Wettlauf um die Atombombe
Hitlers Kernphysiker
Japanische Bombenvorhaben
Los Alamos – Das amerikanische Nuklearlabor
Stalins Atomprojekt
Der Angriff auf Oranienburg und die Zonenteilung 1945
Die sowjetische »Uranlücke« und das Erzgebirge
Uranbergbau im Erzgebirge
Bergbaustädte, Uranfarben und Radiumbäder
Der Beginn des Atomzeitalters
Grenzlandtragödien
Ein Industriegigant mit »strahlender Zukunft« – Das tschechoslowakische Nationalunternehmen Jáchymov
Hoffen auf ein tschechoslowakisch-sowjetisches Bündnis
Die Uranfrage im Spannungsfeld der internationalen Diplomatie
Die Anfänge des Nationalunternehmens
Der Uranfaktor in der tschechoslowakischen Innen- und Außenpolitik
Ein tschechoslowakischer Archipel Gulag
Ein »Staat im Staate« – Die Wismut AG in Ostdeutschland
Das größte Reparationsunternehmen des 20. Jahrhunderts
Kommandeure, Klassenkämpfer und Politaffären
Völkerwanderung ins Erzgebirge
Die sowjetische Geheimpolizei und ihre Helfer im Bergbaugebiet
Vom Zwangssystem zur Freiwilligenwerbung
Auf dem Weg zum Musterbetrieb
Sonderjustiz
Der Kalte Krieg der Worte und Spione
Bergleute zwischen Aufbegehren und Anpassung
Unfälle und Strahlenschäden
Die Sonderstellung der Wismut AG im Ostblock
Zusammenfassung
Anhang
Anmerkungen
Abkürzungsverzeichnis
Statistik
Quellen- und Literaturverzeichnis
Abbildungsnachweis
Danksagung
Personenregister
Zu den Autoren
Die Potsdamer Konferenz 1945
Am 24. Juni 1945 sah Stalin von der Terrasse des Leninmausoleums in Moskau der großen Siegesparade der Roten Armee zu, mit der das Ende des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde. Infanterie-, Kavallerie- und Panzerregimenter warfen unzählige Fahnen und Standarten der Wehrmacht in den Staub zu Stalins Füßen. Der verregnete Tag war voller Symbolik. Zwei Tage darauf erhielt Stalin vom Präsidium des Obersten Sowjets die höchste Auszeichnung »Held der Sowjetunion« und nahm den Titel »Generalissimus« an. Er stand im Zenit seiner Macht. Nun galt es, das Erreichte zu sichern. Doch schon bald schien sich eine neue Bedrohung abzuzeichnen. Genau einen Monat nach der Siegesparade in Moskau teilte ihm der amerikanische Präsident Harry S. Truman in Potsdam mit, dass die USA über eine Atombombe verfügten.
Im Residenzschloss Cecilienhof des früheren Kronprinzen der Hohenzollern bei Potsdam tagten seit dem 17. Juli zum dritten Mal die drei Großmächte. Auf der Konferenz unter dem Codenamen »Terminal« (Endstation) verhandelten der sowjetische, der amerikanische und der britische Staatschef über die Nachkriegsordnung. Ursprünglich sollte die Beratung in Berlin stattfinden, wurde aber nach Potsdam verlegt, weil sich in der ehemaligen Reichshauptstadt weder ein intaktes Gebäude für die Konferenz noch für die Unterbringung der Teilnehmer fand. So wohnten die drei Delegationen schließlich im Potsdamer Vorort Babelsberg. Auf ihrem täglichen Weg zum Schloss Cecilienhof konnten sie das ebenfalls stark zerstörte Zentrum von Potsdam umgehen, indem sie den Jungfernsee über eine Pontonbrücke überquerten.
Auf der Potsdamer Konferenz sah sich Stalin neuen Verhandlungspartnern gegenüber. Nachdem der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt am 12. April 1945 gestorben war, hatte sein Vizepräsident, Harry S. Truman, die Regierungsgeschäfte der USA als neuer Präsident übernommen. In Großbritannien sollte es noch während der Konferenz zu einem Machtwechsel kommen. Die konservative Partei verlor überraschend die Unterhauswahlen am 25. Juli. Premierminister Winston Churchill und sein Außenminister Anthony Eden mussten ihren Platz räumen, an ihre Stelle traten am 27. Juli Clement Attlee und Ernest Bevin.
Die achte Verhandlungsrunde in Potsdam am 24. Juli war für Churchill zugleich die letzte. Er beklagte sich eingangs über das sowjetische Vorgehen in Osteuropa und die Schaffung vollendeter Tatsachen zugunsten der dortigen kommunistischen Parteien. In dieser Sitzung gebrauchte er zum ersten Mal das Bild vom »eisernen Vorhang«, der heruntergelassen worden« sei,1 also lange vor seiner berühmten Rede in Fulton am 5. März 1946. Als Truman im Anschluss an diesen Konferenztag Stalin über den erfolgreichen Atomtest vom 16. Juli in der Wüste von New Mexico informierte, war die Stimmung bereits gespannt. Churchill beobachtete, wie der amerikanische Präsident zum sowjetischen Staatschef ging und die beiden Männer nur in Begleitung ihrer Übersetzer miteinander redeten. Churchill, der nur wenige Meter entfernt stand, hielt in seinen Memoiren dazu fest: »Es war ungemein wichtig, die Wirkung abzuschätzen, die diese umwälzende Neuigkeit auf ihn ausübte. Ich sehe alles vor mir, als wäre es gestern gewesen. Eine neue Bombe! Von unerhörter Sprengkraft! Vermutlich kriegsentscheidend gegen Japan! Welcher Glücksfall! Das war mein im Moment gewonnener Eindruck, und so war ich überzeugt, dass ihm die Bedeutung dessen, was ihm gesagt wurde, völlig entging. Die Atombombe hatte im Rahmen seiner ungeheuren Nöte und Mühen offenbar keine Rolle gespielt. Hätte er die kleinste Ahnung gehabt, welche Revolutionierung der Weltangelegenheiten in Gange war, hätte man das seiner Reaktion bestimmt entnehmen können. Es wäre nichts leichter für ihn gewesen als zu sagen: ›Vielen Dank für diese Mitteilung über Ihre neue Bombe. Ich bin natürlich kein Techniker. Darf ich morgen früh meine Sachverständigen für Kernphysik zu den ihren schicken?‹ Aber Stalins Züge blieben heiter und unbeschwert, und die Unterhaltung der beiden großen Staatschefs ging gleich darauf zu Ende. Während wir auf unsere Autos warteten, fand ich mich neben Truman. ›Wie ist es abgegangen?‹, fragte ich. ›Er stellte keine einzige Frage‹, antwortete er.«2
Doch Churchill irrte sich, als er annahm, dass Stalin über die amerikanischen Fortschritte bei der Entwicklung der Atombombe nicht im Bilde gewesen sei. Er unterschätzte sowohl Stalins Gerissenheit als auch seine Paranoia. Ihm war während vieler spätabendlicher Gespräche in Moskau, Teheran und Jalta entgangen, dass sich Stalin durchaus lebhaft für neue Technologien der Kriegsführung interessiert hatte – ein Interesse, das sie miteinander teilten. Zum Erstaunen Churchills jedenfalls nahm Stalin die Mitteilung Trumans gelassen auf. Im Stillen zog der sowjetische Staatschef jedoch seine eigenen Schlüsse. Die Amerikaner hatten offensichtlich seit Jahren an der Atombombe gearbeitet, ohne ihn davon in Kenntnis zu setzen, obwohl sie doch Verbündete waren. Das bestärkte ihn in seinem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber den westlichen Alliierten.
Das baldige Auseinanderbrechen der Anti-Hitler-Koalition nach dem Krieg war auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen. Eine wesentliche Rolle spielte dabei die sowjetische Politik in den gerade befreiten Ländern Mittel- und Osteuropas. Mit dem angelsächsischen Verständnis von Demokratie und liberaler Wirtschaftsordnung war diese nicht vereinbar. Während sich Briten und Amerikaner von der Ausdehnung des sowjetischen Einflussbereichs in Europa bedroht fühlten, sah Stalin im Atombombenmonopol seiner Kriegsverbündeten eine ebenso große Gefahr für sein Imperium. Das genaue Ausmaß war schwer abzuschätzen, denn die Informationen über Produktion, Zahl und Effektivität der Nuklearwaffen wurden als großes Geheimnis behandelt.
Der Wettlauf um die Atombombe
Hitlers Kernphysiker
Kurz vor Weihnachten 1938 kamen die Chemiker Otto Hahn und Fritz Straßmann im Rahmen einer Versuchsserie am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin zu einem merkwürdigen Ergebnis. Ziel der beiden Wissenschaftler war es, durch Neutronenbeschuss von Uran Radium zu gewinnen. Doch statt Radium aus dem Urankern herauszuschlagen, hatten sie ihn in zwei Teile gespalten. Erstmals war es offenbar gelungen, so die Schlussfolgerung, eine Kernspaltung herbeizuführen. Als Otto Hahn und Fritz Straßmann Anfang 1939 ihre Ergebnisse in der Zeitschrift »Die Naturwissenschaften« bekannt gaben, stand der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kurz bevor. So war die weitere Atomforschung bald davon geprägt, eine kriegsentscheidende Waffe zu entwickeln. Doch darauf hatten es die Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigten, keineswegs angelegt. Gleichwohl beteiligten sie sich in den Jahren nach 1939 an der Entwicklung der Atombombe, was sie nach 1945 erfolgreich zu verschleiern vermochten.
Im Frühjahr 1939 machten mehrere deutsche Wissenschaftler den Reichsforschungsrat – 1937 beim Reichserziehungsministerium zur Koordination wehrwissenschaftlicher Aufgaben gegründet – auf die militärischen Anwendungsmöglichkeiten der Kernspaltung aufmerksam. Daraufhin wurde Professor Abraham Esau, Direktor der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, zum Leiter der Fachsparte Physik des Reichsforschungsrats ernannt und mit der Bildung eines Expertengremiums für Fragen der Kernforschung beauftragt. Dieses nahm am 29. April 1939 in Berlin unter dem Namen »Uranverein« seine Arbeit auf. Er war ein lockerer Zusammenschluss von Wissenschaftlern verschiedener Institutionen. Unter der Leitung des Reichsforschungsrats sollten in diesem Gremium die weiteren Arbeiten zur Erforschung der Kernspaltung koordiniert werden.
Parallel zum Reichsforschungsrat wurde auch das Heereswaffenamt auf die neuen Möglichkeiten aufmerksam. Die entscheidenden Hinweise kamen vom Hamburger Physiker Paul Harteck. Er bemerkte in einem Schreiben vom 24. April 1939 an den Chef der Wissenschaftsabteilung des Heereswaffenamtes, Erich Schumann: »Das Land, das als erstes [von der Kernspaltung] Gebrauch macht, besitzt den anderen gegenüber eine nicht einzuholende Überlegenheit.«3
Von diesen Ausführungen beeindruckt, beauftragte Schumann im Sommer 1939 den Physiker Kurt Diebner mit der Prüfung der eingegangenen Hinweise. Diebner konsultierte mehrere Spezialisten und kam zu der Auffassung, dass die Atomforschung forciert werden müsse. Wenig später wurde dann beim Heereswaffenamt nicht nur ein kernphysikalisches Referat, sondern auch ein entsprechendes Labor auf dem Heeresversuchsgelände Kummersdorf in Gottow südlich von Berlin eingerichtet. Die Militärs legten damit den Grundstein für ein eigenes Uranforschungsvorhaben. Zugleich versuchten sie, alle Aktivitäten auf diesem Gebiet an sich zu ziehen. So wurde der gerade erst gegründete Uranverein kurzerhand dem Heereswaffenamt unterstellt. Nach Kriegsbeginn konnte dieses auch zahlreiche andere Wissenschaftler, die sich der Atomforschung widmeten, enger an sich binden, darunter Werner Heisenberg, bis 1941 Professor an der Universität Leipzig und anschließend Direktor am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin, Otto Hahn, seit 1928 Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie, Walther Bothe, Leiter des Instituts für Physik des Kaiser-Wilhelm-Instituts für medizinische Forschung in Heidelberg, Paul Harteck, Professor an der Universität Hamburg, und Nikolaus Riehl von der Auergesellschaft, die seltene Metalle und Uranerz verarbeitete.
Zentrum der militärisch koordinierten Forschungen sollte das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin werden, dem ab 1941 Werner Heisenberg vorstand. Nach und nach spielte sich aber Diebner mit seiner Forschungsgruppe in Gottow in den Vordergrund und stand in offener Konkurrenz zum Heisenberg-Team. Während Nobelpreisträger Heisenberg unbestritten der fähigste theoretische Physiker war, verkörperte Diebner den Typus des emsigen Praktikers. Im Gegensatz zu Heisenberg war er ein überzeugter Nazi. Gemeinsam mit dem Physiker Erich Bagge aus Leipzig bereitete er zwei Geheimkonferenzen vor, auf denen ausgelotet werden sollte, ob sich die jüngsten kernphysikalischen Entdeckungen für die Entwicklung neuer Waffen nutzen ließen. Diebner bewertete diese Frage ausgesprochen positiv und drängte in den folgenden Jahren stets darauf, die Atomforschung voranzutreiben, zum Teil auch gegen den Widerstand seines Vorgesetzten Schumann, der dem Projekt eher skeptisch gegenüberstand.
Doch zunächst war es Heisenberg, der die entscheidenden Überlegungen anstellte. Anfang Dezember 1939 verfasste er für das Heereswaffenamt einen Bericht über »die Möglichkeit der technischen Energiegewinnung aus der Uranspaltung«. Man sei dem Ziel, einen Reaktor zur Energieerzeugung zu konstruieren, sehr nahe gekommen. Die entsprechend angereicherten Isotope eigneten sich zugleich dafür, »Explosivstoffe herzustellen, die die Explosionskraft der bisher stärksten Explosivstoffe um mehrere Zehnerpotenzen übertreffen«.4 Die theoretische Hauptfrage in diesem Zusammenhang war die nach der kritischen Masse, d.h. nach der Menge spaltbaren Materials (Uran 235 oder Plutonium), die groß genug ist, um eine Kettenreaktion aufrechtzuerhalten, aber klein genug, um nicht unkontrolliert zu explodieren. Die Abschätzung dieser Masse war entscheidend für die Frage, ob sich eine Bombe entwickeln ließ. Für Heisenberg lag allerdings lediglich der Bau eines »Uranbrenners«, d.h. eines kleinen Reaktors, im Bereich des Machbaren.
Noch aber hatte man mit zahlreichen ungelösten Problemen zu kämpfen. Im Zentrum stand die Frage nach einem wirksamen Bremsstoff (Moderator), einer Substanz, die hindurchgehende Neutronen verlangsamte, aber nicht absorbierte. Die theoretischen Überlegungen ergaben, dass neben Kohlenstoff (Graphit) schweres Wasser (Deuteriumoxid, D2O) die beste Lösung wäre. Heisenberg entschied sich, für künftige Experimente schweres Wasser zu nutzen. Doch für die Produktion dieses Stoffes waren aufwändige Elektrolyseprozesse nötig. Entsprechende Anlagen gab es zu Kriegsbeginn in Deutschland nicht. Erst nach der Besetzung Norwegens 1940 und der Anbindung der norwegischen Firma Norsk Hydro in Rjukan rund 130 Kilometer westlich von Oslo an die I. G. Farbenindustrie AG stand den deutschen Wissenschaftlern schweres Wasser zur Verfügung. Norsk Hydro wurde nämlich verpflichtet, die Schwerwasserproduktion zu steigern und ausschließlich das Deutsche Reich zu beliefern.
Den deutschen Atomwissenschaftlern fehlte es Ende der dreißiger Jahre zunächst auch an ausreichenden Uranressourcen, um im großen Stil forschen zu können. Das Erzgebirge, die einzige Region, in der es kleinere Uranerzvorkommen gab, galt geologisch als gut erkundet, darunter die Gegend um Schneeberg und Johanngeorgenstadt. Der dortige Uranvorrat wurde von den Fachleuten aber nur auf wenige Tonnen geschätzt und man rechnete nicht mit großen neuen Funden. Die im Erzgebirge tätige Sachsenerz-Bergwerks AG konzentrierte sich daher auf die Förderung seltener Metalle, die von der Rüstungsindustrie nachgefragt wurden. Lediglich im schlesischen Schmiedeberg hatte man ab 1936 die Uranerzförderung durch den Aufschluss neuer Gänge steigern können. Nach der Besetzung des Sudetengebietes und der Zerschlagung der Rest-Tschechoslowakei waren im Frühjahr 1939 die ältesten europäischen Uranerzminen in den Besitz eines deutschen Firmenkonsortiums, mit der Auergesellschaft Berlin und der Firma Buchler aus Braunschweig an der Spitze, gekommen. Eine wesentliche Ausweitung erfuhr der Joachimsthaler Bergbau jedoch auch unter der Regie dieses Radiumsyndikats nicht. Das verfügbare Material blieb begrenzt.
Erst im Laufe des Jahres 1940 bahnte sich in Sachen Uranerzressourcen eine Lösung an, nachdem die Wehrmacht im Sommer ihren Blitzkrieg im Westen gewonnen hatte. In Belgien stieß man auf große Radium- und Uranoxydvorräte, die bei der Brüsseler Union Minière lagerten. Zwar hatte deren Direktor, Edgar Sengier, bereits im September 1939 die Verschickung der Bestände nach New York angeordnet, doch bislang war erst ein Teil auf den Weg gebracht worden. Bereits ab Juni 1940 kauften die Auergesellschaft und die Degussa bei der Union Minière Uranverbindungen. Der größte Posten, insgesamt 1244 Tonnen, wurde im Mai 1942 von der Rohstoffgesellschaft mbH (Roges), einer deutschen Kriegshandelsgesellschaft, erworben. Später kaufte die Roges auch in Frankreich Uranerze und erwarb weitere 200 Tonnen Uranverbindungen von der Union Minière, die bis zum Sommer 1944 im Auftrag der Auergesellschaft die Reinigung von Uranoxyd übernahm. Mit dem belgischen Uranoxyd standen der deutschen Forschung nun die damals weltweit größten Uranoxydvorräte zur Verfügung. Das war eine ausreichend große Menge, um eine Atombombe herzustellen.5
Neben der Gewinnung von schwerem Wasser und der Uranerzbeschaffung stellte die Weiterverarbeitung zu Uranoxyd und Uranmetall mit hohem Reinheitsgrad das nächstgrößte Problem dar. Im Herbst 1939 erteilte das Heereswaffenamt der Auergesellschaft den Auftrag zur Herstellung von reinem Uranoxyd. Die Firma baute daraufhin innerhalb weniger Wochen ein Werk in Oranienburg, dessen Produktionskapazität bei ca. einer Tonne Uranoxyd je Monat lag.6 Die Weiterverarbeitung erfolgte ab 1940 in den Uranschmelzanlagen der Degussa in Frankfurt/M. und ab Ende 1944 in einer zweiten Schmelzanlage in Berlin-Grünau.7
Insgesamt verfügte die deutsche Atomforschung damit über eine ausgesprochen gute Ausgangsposition. Als Nächstes brauchte man jetzt noch Zyklotrone zur Messung kernphysikalischer Konstanten. Zugang zu solch einem Zyklotron erhielten die deutschen Wissenschaftler nach der Besetzung Frankreichs im Sommer 1940. Im Pariser Institut von Frédéric Joliot-Curie sollte ein im Bau befindliches Zyklotron beschlagnahmt und nach Deutschland gebracht werden. Doch dazu kam es nicht. Die Anlage blieb in Paris und wurde mit Hilfe deutscher Firmen innerhalb weniger Monate fertig gestellt. Im wöchentlichen Wechsel arbeiteten sodann französische und deutsche Forschungsgruppen am Zyklotron.8 Wahrscheinlich wurden dabei auch bautechnische Unterlagen angefertigt und dem Heereswaffenamt sowie der Reichspostforschungsanstalt zur Verfügung gestellt.
Parallel dazu nahm man in Deutschland den Bau von Zyklotronen in Angriff, unter anderem am Siemens-Forschungslabor in Berlin, das von Gustav Hertz geleitet wurde, an den Instituten von Walter Bothe in Heidelberg und Gerhard Hoffmann in Leipzig sowie bei der Reichspostforschungsanstalt in Miersdorf bei Zeuthen und Berlin-Lichterfelde. Einer der engagiertesten Fürsprecher war Diebner, während Heisenberg eher bremste. Die Fertigstellung des ersten deutschen Zyklotrons zog sich dann allerdings noch bis 1943 hin.
Eine der wichtigsten Forschungsaufgaben war 1940 zunächst die Suche nach den chemischen Elementen 93 und 94, den so genannten Transuranen, heute bekannt unter den Namen Neptunium und Plutonium.9 Diese waren, so die theoretische Überlegung, leichter zu spalten als Uran 235 und kamen deshalb als potenzielle Kernsprengstoffe eher infrage. Im Sommer 1940 legte Carl Friedrich von Weizsäcker das Problem der Transurane dem Heereswaffenamt dar. In seinem Bericht nannte er zwei wichtige Anwendungsmöglichkeiten der neuen Elemente: Reaktoren zur Energiegewinnung und Kernsprengstoffe. Von Weizsäcker verwies aber einschränkend darauf, dass die Spaltbarkeit der Transurane noch nicht getestet werden könne. Ein praktischer Versuch sei erst möglich, wenn man geringe Mengen in einem Reaktor gewonnen habe.
Nachdem im Frühjahr 1940 in Hamburg und Berlin erste Modellversuche mit den neu entdeckten Elementen durchgeführt worden waren, sollten diese Arbeiten bald in Berlin fortgeführt werden. So errichtete man im Sommer desselben Jahres unter der Leitung von Werner Heisenberg und Carl Friedrich von Weizsäcker ein Laborgebäude auf dem Gelände des Instituts für Biologie und Virusforschung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Berlin-Dahlem. Um Neugierige fern zu halten, erhielt das Gebäude den Tarnnamen »Virushaus«. Tatsächlich installierte man dort einen kleinen Versuchsreaktor.
Nachdem Heisenberg im September 1941 die ersten 150 Liter schweres Wasser aus Norwegen erhalten hatte, konnte er eine neue Versuchsserie in Angriff nehmen, bei der ihm erstmals eine Steigerung der Neutronenzahl gelang. Dank der grundlegenden Arbeit von Fritz Houtermans »Zur Frage der Auslösung von Kern-Kettenreaktionen« wusste Heisenberg inzwischen auch, dass eine konstante Kettenreaktion mit Natururan zur Entstehung des Elements 94 führen musste. Damit schien klar, dass Heisenbergs Uranmaschine in absehbarer Zeit funktionieren würde.
Ende Oktober 1941 kam es zu einem legendenumwobenen Gespräch zwischen Heisenberg und dem berühmten dänischen Physiker Niels Bohr in Kopenhagen. Beide galten als die größten wissenschaftlichen Kapazitäten auf dem Gebiet der theoretischen Physik in ihren Ländern und genossen weltweit hohes Ansehen. Heisenberg hatte zuvor an einer Tagung des Deutschen Wissenschaftlichen Instituts in Kopenhagen teilgenommen. Da Bohr und seine Kollegen glaubten, man wolle sie für die deutsche Atomforschung vereinnahmen, blieben sie der Konferenz fern. Anlässlich eines privaten Gesprächs, das am Rande der Veranstaltung zu Stande kam, deutete Heisenberg gegenüber Bohr an, dass eine Atombombe machbar sei. In diesem Zusammenhang diskutierten die beiden Physiker die Frage, ob sich Wissenschaftler an der Entwicklung von Kernwaffen beteiligen sollten. Die Begegnung endete abrupt und mit einem Zerwürfnis. Bohr war entsetzt und fürchtete, Heisenberg wolle ihn aushorchen und sei gekommen, um ihn zur Kooperation mit deutschen Instituten zu bewegen.
Nach den Erfolgen der Blitzkriege ließ das Interesse des Heeres an der Atomforschung nach. Als der Krieg im Herbst 1941 so gut wie gewonnen schien, war der Bedarf an neuen Waffen stark gesunken. Das Heereswaffenamt nutzte Ende 1941 die Gelegenheit, um die Verantwortung für das inzwischen ungeliebte Atomprojekt an den Reichsforschungsrat abzugeben. Professor Erich Schumann, Leiter der Forschungsabteilung des Heereswaffenamtes, konzentrierte sich auf andere waffentechnische Ideen, wie den Bakterien- und Giftgaskrieg, für die er Hitler zu gewinnen suchte. Dem Oberkommando der Wehrmacht waren neuartige Waffen zwar stets willkommen, aber nur, wenn sie sich in absehbarer Zeit einsetzen ließen.
Am 26. Februar 1942 veranstaltete der Reichsforschungsrat in Berlin eine Tagung zum Stand der deutschen Atomforschung. Die Prominenz aus den Schaltstellen der Rüstungswirtschaft blieb dieser Veranstaltung allerdings fern. Dennoch drang die Kunde von den militärischen Anwendungsmöglichkeiten der Kernenergie in die höchsten Kreise des Staates. Reichspropagandaminister Joseph Goebbels notierte am 21. März 1942 in sein Tagebuch: »Die Forschungen auf dem Gebiet der Atomzertrümmerung sind so weit gediehen, dass ihre Ergebnisse unter Umständen noch für die Führung dieses Krieges in Anspruch genommen werden können. Es ergeben sich hier bei kleinstem Einsatz derart immense Zerstörungswirkungen, dass man mit einigem Grauen dem Verlauf des Krieges, wenn er noch länger dauert, und einem späteren Krieg entgegenschauen kann.«10
Rüstungsminister Albert Speer wurde im Frühjahr 1942 von Generaloberst Erich Fromm auf die Arbeiten des Uranvereins hingewiesen. Er wollte Genaueres wissen und lud am 4. Juni 1942 ins Harnack-Haus in Berlin zu einer Konferenz. Daran nahmen unter anderem der Chef des Heereswaffenamtes, General Wilhelm Ritter von Leeb, Generalfeldmarschall Erhard Milch und andere führende Militärs teil. Wieder war es Heisenberg, der das Thema der Uranbombe anschnitt und andeutete, sie habe eine gewaltige Vernichtungskraft und müsse nicht größer sein als eine Ananas. Die Offiziere waren von Heisenbergs Ausführungen begeistert. Allerdings bremste dieser umgehend die aufkommende Euphorie der Militärs und verwies auf den immensen materiellen und finanziellen Aufwand für den Bau einer Bombe, der, wenn überhaupt, erst in einigen Jahren zu realisieren sei. Speer wollte daraufhin wissen, welche Summe die Wissenschaftler für die Beschleunigung ihres Projektes benötigten. Als von Weizsäcker dann einen aus Speers Sicht lächerlich kleinen Betrag nannte, schien für ihn und die anwesenden Militärs festzustehen, dass das Projekt nicht mehr kriegsentscheidend sein könne, da sich die Wissenschaftler, so vermutete Speer, nur mit Grundlagenforschung beschäftigten.11 Obwohl Speer vom praktischen Wert der Uranforschung nicht überzeugt war, unterstützte er die Fortsetzung der Arbeiten. Im Jahr 1943 stellte sein Ministerium 3 Millionen Reichsmark und 1944 3,6 Millionen Reichsmark zur Verfügung.12
Adolf Hitler, der eine tiefe Abneigung gegen die »jüdische Physik« hegte und alles, was auch nur entfernt mit Albert Einstein in Verbindung stand, verteufelte, blieb gegenüber dem Atomprojekt zunächst skeptisch. Dabei wusste die Führung des Dritten Reiches offenbar doch mehr über das britisch-amerikanische Atomprojekt als lange Zeit angenommen. Wie sie mit ihren bruchstückhaften Kenntnissen umging, konnte bislang nicht ausreichend beantwortet werden.13
Die Alliierten erfuhren von dem deutschen Vorhaben durch Agentenberichte und begaben sich in einen dramatischen technologischen Wettlauf mit Nazideutschland. Bewusst nahmen sie auch Ziele ins Visier, die mit dem deutschen Atomprogramm im Zusammenhang standen. Angriffe britischer Kommandotrupps und norwegischer Widerstandskämpfer im Februar und amerikanischer Bomber im November 1943 führten zur Lahmlegung der Produktion von schwerem Wasser im Werk der norwegischen Norsk Hydro. Eine Fähre, die das restliche schwere Wasser nach Deutschland bringen sollte, wurde im Februar 1944 versenkt. Daraufhin wurde die Anlage der Norsk Hydro Mitte desselben Jahres demontiert und nach Deutschland gebracht. Zwischenzeitlich hatte man aber schon in den Werken der I. G. Farbenindustrie in Leuna und Bitterfeld drei kleine und in der Nähe von Arnstadt eine weitere Schwerwasseranlage installiert. Bei der Entwicklung neuer Verfahren zur Herstellung von schwerem Wasser hatten sich vor allem Paul Harteck und sein Mitarbeiter Hans Suess in Hamburg sowie Karl-Hermann Geib in Leuna hervorgetan. Wie kaum ein anderer verstand es Harteck dabei, allen praktischen Schwierigkeiten zum Trotz neue Lösungen zu finden.
Mitte 1943 organisierte der Direktor der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, Abraham Esau, eine große kernphysikalische Konferenz in Berlin, auf der 41 Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse vorstellten. Während Heisenberg nicht auftrat – seine Versuche am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik stagnierten, insofern hätte er nichts Neues berichten können –, gaben Diebners Mitarbeiter Einblicke in ihre Arbeiten in Gottow, die offensichtlich gut vorankamen. Während Heisenberg noch mit Uranplatten experimentierte, hatte sich Diebner für eine andere Versuchsanordnung entschieden. In einen mit schwerem Wasser gefüllten Zylinder hängte er in einer perfekten Gitteranordnung an Drähten befestigte Uranmetallwürfel. Umgeben war das Ganze in den ersten Experimenten von einem Wassermantel, bei späteren Versuchen, die unter dem Namen G-III liefen, von einem Kohlenstoffmantel. Trotz der geringen Größe der Gottower Uranmaschine, die ungefähr nur 2 mal 3 Meter maß, ergab das Experiment eine außerordentlich hohe Neutronenvermehrung.
Diebner wollte diese Versuche schließlich in größerem Maßstab wiederholen mit dem Ziel, zu einer sich selbst erhaltenden Kettenreaktion zu kommen. Doch zu Beginn des Jahres 1944 stand nicht genügend Bremssubstanz zur Verfügung. Der hartnäckige Diebner wollte diesen Engpass durch ein Tieftemperaturexperiment unter Verwendung von Uran und einer Kohlenwasserstoffverbindung (C5H10) als Moderator überbrücken.14 Die Idee für diesen – angeblich nicht mehr realisierten – Versuch kam von Harteck.
Angesichts der verstärkten alliierten Luftangriffe wurden die am Atomprojekt des Reichsforschungsrats beteiligten Einrichtungen ab Herbst 1943 nach Süddeutschland (Freiburg, Hechingen, Heidelberg) und die Diebner-Gruppe nach Thüringen (Stadtilm) verlagert. Für die Wissenschaftler um Heisenberg war die deutsche Niederlage nun absehbar. Sie konzentrierten sich 1944/45 daher nur noch auf ein Ziel: die Erzeugung einer Kettenreaktion in einer Uranmaschine. Dafür wurde in einem Felsenkeller in Haigerloch bei Tübingen ein letztes Experiment unter Vernachlässigung aller Sicherheitsmaßnahmen gestartet. Anfang März 1945 stand die von Werner Heisenberg geleitete Forschungsgruppe kurz vor einer sich selbst erhaltenden Kettenreaktion.15
Rückschauend urteilte Heisenberg über den Stand der Forschung: »Wir sahen eigentlich vom September 1941 eine freie Straße zur Atombombe vor uns.«16 Warum diese freie Straße von der Heisenberg-Gruppe dann nicht resolut beschritten wurde – um im Bild zu bleiben –, darüber streiten Historiker bis heute. War es so, wie Beteiligte an der Atomforschung später argumentierten, dass sich die Wissenschaftler weigerten, Hitler mit der Bombe zu bewaffnen? Hat Heisenberg das Projekt gar »in einer Abstellkammer« untergebracht und dann »sterben lassen«, wie der Wissenschaftsjournalist Thomas Powers meint?17 Oder ist Heisenberg eher an fehlerhaften theoretischen Überlegungen und begrenzten Ressourcen gescheitert? Er hat jedenfalls nichts unternommen, um die Arbeiten am Atomprojekt zu forcieren, obwohl er die Militärs mehrfach, wie geschildert, auf die Atombombe aufmerksam machte. Während Diebner und Harteck auf ein schnelleres Vorgehen drängten, hielt sich Heisenberg eher zurück. Es spricht vieles dafür, dass ihn – im Gegensatz zu Diebner – tatsächlich Skrupel plagten und er daher nur einen Reaktor, aber keine Bombe bauen wollte.
Während bislang Heisenberg, Weizsäcker und Harteck als die zentralen Figuren galten, lassen sich inzwischen noch andere Forschungsgruppen nachweisen.18 Sie kamen möglicherweise weiter als die Genannten und wurden von der zeitgeschichtlichen Forschung lange Zeit nicht wahrgenommen. Dies waren österreichische Wissenschaftler um Professor Georg Stetter in Wien und Innsbruck, Wissenschaftler der Reichspostforschungsanstalt in Berlin-Lichterfelde mit Manfred von Ardenne an der Spitze und in Miersdorf bei Zeuthen mit Dr. Georg Otterbein als Leiter sowie ein bisher nur schemenhaft zu verortendes Team der SS. Diese Gruppen kooperierten mit dem Diebner-Team und mehreren großen Industrieunternehmen, darunter Siemens, AEG und IG Farben.
Die Forschungsanstalt der Deutschen Reichspost hatte neben Routineaufgaben auch eine Reihe von kriegswichtigen Projekten übernommen, u.a. die Sprachverschlüsselung und die Entwicklung von Radargeräten. Diese Arbeiten wurden vom Reichspostminister Dr. Wilhelm Ohnesorge, einem frühen Weggefährten Hitlers und Mitglied der NSDAP seit 1920, stark gefördert. Mit der Ausweitung der Rüstungsforschung wollte er sein politisches Gewicht erhöhen. Seine Vision von einer wissenschaftlich-technischen Denkfabrik versuchte der Minister in Kleinmachnow bei Berlin zu realisieren.19 Im Dezember 1939 hatte ihn der Physiker Manfred von Ardenne auf die »ungeheure Bedeutung der Hahnschen und Straßmannschen Entdeckung« aufmerksam gemacht.20 Aus wissenschaftspolitischer Sicht ein kluger Schachzug. Die Reichspost verfügte über einen großen Etat für die Grundlagenforschung und einen sachverständigen Minister mit Geltungsdrang. Ohnesorge entschloss sich im Januar 1940 zur Förderung des Projektes »für die technische Entwicklung von Verfahren und Anlagen auf dem Gebiet der Atomzertrümmerung«.21 Im Institut von Ardenne in Berlin-Lichterfelde und in Miersdorf wurden daraufhin eine 1-Millionen-Volt-Anlage zur Herstellung radioaktiver Isotope und ein 60-Tonnen-Zyklotron gebaut. Ohnesorge wollte »seinem Führer« als Erster die »Uranbombe« liefern. Mehrfach berichtete er Hitler über die Fortschritte des Atomprojektes. Hitler soll sich jedoch im Juni 1942 eher amüsiert darüber gezeigt haben, dass ausgerechnet sein Postminister an neuen Waffen forschte. Doch Ohnesorge ließ sich von solchen Reaktionen nicht irritieren.
Nach dem fehlgeschlagenen Attentat auf Hitler im Juli 1944 verschoben sich die Kräftekonstellationen im Reich erheblich zugunsten der SS. Der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, drängte immer stärker darauf, die wichtigsten Rüstungs- und Forschungsprojekte seiner Organisation zu unterstellen. In diesem Zusammenhang erlangte SS-General Dr. Hans Kammler, Leiter der Gruppe C des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes der SS und Sonderbeauftragter für Raketen und Düsenjäger, einen enormen Machtzuwachs.22 Über die Ergebnisse der kernphysikalischen Forschungen unter der Regie der SS gibt es widersprüchliche Angaben. Hat es Anfang März 1945 in Thüringen gar einen Test einer kleinen Atomwaffe gegeben? Diese Mutmaßungen haben sich in jüngster Zeit verdichtet.
Abgesehen von offenen Fragen über die Dimension und den Stand der vom Heereswaffenamt, der Reichspost und der SS gelenkten Atomforschung deutet einiges darauf hin, dass Himmler und andere hohe SS-Führer diese und andere Projekte, unabhängig von ihrem Reifegrad, in den letzten Kriegsmonaten als Faustpfand für geheime Separatverhandlungen mit den Alliierten nutzen wollten.23
Obwohl die Alliierten mit einer deutschen Atombombe rechneten, begannen sie erst spät mit einer systematischen Aufklärung. Ende 1943 rief General Leslie Groves, der militärische Leiter des amerikanischen Atomprojektes, eine Einheit mit dem Tarnnamen »Alsos« (griechischer Name für Grove) ins Leben. Als Kommandeur der Einheit wurde Oberstleutnant Boris T. Pash eingesetzt. Dieser hatte sich durch seine eigenwilligen Methoden bei der Erkundung von angeblichen kommunistischen Aktivitäten einiger Angestellter des Labors von Ernest Lawrence in Berkeley, der bereits Anfang der dreißiger Jahre ein Zyklotron betrieb, einen Namen gemacht. Wissenschaftlicher Berater von Pash wurde der niederländische Atomphysiker und Kriminalist Samuel A. Goudsmit.24
Die wichtigste Aufgabe von Alsos bestand darin, herauszufinden, zu welchen Resultaten die deutschen Atomphysiker bei ihren Forschungen gekommen waren. Im Jahr 1944 richtete Pash sein Hauptquartier in London ein und konnte sich bald ein Bild von der deutschen Uranversorgung machen. Er erfuhr, dass die Deutschen 1940 beim Einmarsch in Belgien große Mengen Uranerze vorgefunden hatten und die Auergesellschaft diese verarbeitete.
Nach dem überraschend schnellen Vormarsch der alliierten Truppen zog die Alsos-Mission am 25. August 1944 in Paris ein. Doch der sofort befragte Joliot-Curie wusste weit weniger über die deutsche Uranforschung als erwartet. Eine neue Spur führte schließlich ins elsässische Straßburg. Dort stieß Pash Mitte November 1944 auf ein deutsches Physiklabor und zahlreiche Unterlagen. Für ihn stand fest: »Es gab keinen Zweifel. Das vorliegende Material bewies eindeutig, dass die Deutschen eine Atombombe weder hatten, noch in irgendeiner praktikablen Form konstruieren konnten.«25 Rückblickend erklärte Pash mit einigem Stolz: »Die Bestätigung der Tatsache, dass eine deutsche Atombombe keine unmittelbare Bedrohung darstellte, war vermutlich das bedeutendste einzelne Spionageaufklärungsergebnis der Kriegszeit. Diese Information allein rechtfertigte Alsos.«26
Groves war mit den Ergebnissen der Alsos-Mission allerdings noch nicht zufrieden. Er wollte unbedingt den Verbleib des belgischen Uranerzes geklärt wissen. In der Tat konnte der größte Teil des Erzes in der Nähe von Staßfurt bei Magdeburg ausfindig gemacht werden. Obwohl der Ort zur künftigen sowjetischen Besatzungszone gehörte, stieß die Alsos-Einheit Mitte April 1945 dorthin vor und ließ ca. 1 100 Tonnen Uranverbindungen abtransportieren. In der Zwischenzeit ging die Jagd nach den deutschen Atomwissenschaftlern weiter. In Heidelberg, Stadtilm, Hechingen und verschiedenen Orten Bayerns wurden sie schließlich aufgegriffen.
Noch weitgehend unklar ist, was im April 1945 wirklich in Thüringen geschah. Bei ihrem schnellen Vorstoß hatten die amerikanischen Truppen auch die Kleinstadt Stadtilm eingenommen und dort in einem Schulgebäude Friedrich Berkei, Stellvertreter von Kurt Diebner, und Dokumente zur Atomforschung aufgespürt. Von den umgehend herbeigeeilten Alsos-Mitarbeitern meldete Goudsmit, dass jene einen umfangreichen Fund gemacht hätten und er diesen gerade auswerte. Doch dann geschah etwas Ungewöhnliches. Goudsmit erhielt Order aus Washington, die weitere Analyse der Stadtilmer Dokumente abzubrechen und alle Unterlagen sofort nach Washington zu schicken. Außerdem sei das gesamte Material über Reaktorexperimente, Uran und schweres Wasser von vornherein als »geheim« zu klassifizieren.27
Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass dies keine Routineanweisung war. Stand in der Nähe von Stadtilm ein unterirdischer Reaktor? Aufgrund verschiedener Indizien haben Historiker starke Zweifel an der bisherigen Darstellung der Geschichte der deutschen Atomforschung angemeldet.28 Eine Klärung obliegt der weiteren Forschung.
Nach Kriegsende wurden zehn prominente deutsche Physiker, darunter Werner Heisenberg und Otto Hahn, für sechs Monate auf einem alten englischen Landsitz in Farm Hall interniert.29 In der Hoffnung, die Wissenschaftler würden sich über den Stand der deutschen Atomforschung austauschen, wurden alle ihre Gespräche vom britischen Geheimdienst abgehört. Die größte Sorge der Briten war, dass in Deutschland noch nukleares Material lagerte und Forschungsberichte versteckt waren und dass der ein oder andere für die Sowjetunion arbeitete. Viel bekam der britische Geheimdienst jedoch nicht zu hören, vor allem Diebner gab sich auffällig schweigsam. Vielleicht ahnten die deutschen Physiker, dass sie belauscht wurden.
Die Nachricht vom Abwurf der ersten amerikanischen Atombombe auf Hiroshima im August 1945 wollten die internierten Wissenschaftler erst gar nicht glauben. Doch dann erfuhren sie von der riesigen Dimension des amerikanischbritischen Projektes. Otto Hahn sagte zu Heisenberg: »Wenn die Amerikaner eine Uranbombe haben, dann sind sie [gemeint waren Heisenberg und seine Mitarbeiter – die Autoren] alle zweitklassig. Armer Heisenberg.«30
Als Antwort auf den ersten Atombombenabwurf und als Versuch, die Geschichte des deutschen Atomprojektes darzustellen, entwarfen die deutschen Wissenschaftler eine Presseerklärung. Sie betonten ausdrücklich, dass die deutsche Atomforschung nicht die Entwicklung eines Kernsprengstoffs zum Ziel gehabt habe. Später entstand daraus die Legende von den anständigen Wissenschaftlern. Sie hätten ihre Forschungsarbeiten bewusst verzögert, damit Hitler nicht in den Besitz der Atombombe gelangen konnte. Wenn man schon das Wettrennen um die Uranbombe verloren hatte, so wollte man wenigstens auf moralischem Gebiet der Bessere gewesen sein. Diese Sichtweise fand dann durch das 1956 publizierte Buch »Heller als tausend Sonnen« von Robert Jungk weite Verbreitung.
Japanische Bombenvorhaben
In den siebziger Jahren berichtete die amerikanische Presse erstmals darüber, dass auch die Japaner während des Zweiten Weltkrieges an Atomprojekten arbeiteten.31 Der führende Kopf des vom Heer seit Juli 1941, also fünf Monate vor dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor, finanzierten Projektes unter dem Codenamen NI war Professor Dr. Yoshio Nishina. Er hatte vor dem Krieg acht Jahre in Europa studiert und bei Rutherford in Cambridge sowie Bohr in Kopenhagen Vorlesungen gehört. Zurück in Japan, erhielt er 1931 ein eigenes kernphysikalisches Labor an der Universität von Tokio.
In Konkurrenz zum Heer unterhielt die japanische Marine unter dem Codenamen F-Go-Programm spätestens seit Sommer 1942 ein eigenständiges Atomprojekt. Wissenschaftlicher Leiter dieses Projekts war Dr. Bunsaku Arakatsu.32 Auch er hatte einige Jahre im Ausland studiert, darunter am berühmten Cavendish Labor bei Ernest Rutherford in Cambridge und 1926 an der Berliner Universität (heute Humboldt-Universität) bei Albert Einstein, in dessen Freundeskreis er Aufnahme fand. Arakatsu, der an der Universität von Kyoto Physik lehrte, war neben Nishina der führende Experte auf dem Gebiet der Kernphysik in Japan.
Die Atomprojekte von Heer und Marine hatten vor allem mit materiellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Diese wurden noch drückender, als sich die japanische Rüstungsindustrie ab 1943 zunehmenden amerikanischen Bombenangriffen ausgesetzt sah. Das größte Problem war jedoch der Mangel an Uranerz. An alle Kommandeure des Kaiserreichs erging daher Mitte 1943 der Befehl, dieses aufzutreiben.33 Außerdem bemühte sich die japanische Botschaft in Berlin um den Ankauf von zwei Tonnen Uranerz aus den Minen von Joachimsthal, freilich ohne den Deutschen den Verwendungszweck mitzuteilen. Nach einigem Hin und Her wurde Ende 1943 ein erstes U-Boot mit der wertvollen Ressource beladen und vom Flottenstützpunkt Kiel aus nach Japan entsandt. Ob dieser und spätere Transporte ihr Ziel erreichten, ist unklar. Darüber hinaus kaufte die Marine für die immense Summe von 100 Millionen Yen – das waren 1945 ca. 25 Millionen Dollar – Uranoxyd auf dem Schwarzmarkt in Shanghai.
Auf diese Lieferungen waren die Japaner angewiesen, weil die Uranquellen in den japanisch besetzten Gebieten in Korea, China und der Inneren Mongolei insgesamt nicht sehr ergiebig ausfielen. Die wichtigsten befanden sich auf der koreanischen Halbinsel. Auch deshalb wurde der teilweise unterirdisch angelegte industrielle Komplex für das F-Go-Projekt der Marine, für das rund 300 japanische Wissenschaftler gearbeitet haben sollen, nicht auf den japanischen Inseln, sondern in Hungnam (Konan) im Norden Koreas errichtet. Die Region um die nordkoreanische Stadt war nach der Besetzung durch japanische Truppen ab 1910 industrialisiert worden. Unter anderem standen dort eine der größten Düngemittelfabriken der Welt, leistungsfähige Wasserkraftwerke, Treibstofffabriken und eine Schwerwasseranlage. Möglicherweise installierte man in Hungnam auch ein Zyklotron.
Wie weit die Japaner mit dem Bau der Atombombe kamen, konnte bislang nicht ermittelt werden. Einziger Anhaltspunkt ist die Aussage eines aus sowjetischer Gefangenschaft geflüchteten japanischen Atomphysikers gegenüber dem amerikanischen Geheimdienst kurz nach Kriegsende. Der Mann war bis zuletzt im Forschungszentrum Hungnam tätig gewesen und berichtete, dass japanische Wissenschaftler am 12. August 1945, also nur sechs Tage nach der Explosion der amerikanischen Atombombe über Hiroshima, in der Nähe von Hungnam einen Atomversuch durchgeführt hätten. Die im Auftrag der Marine entwickelte Bombe sollte von Kamikazefliegern zur Verteidigung Japans eingesetzt werden. Die Mitteilung ließ sich nicht überprüfen, da Hungnam nur wenige Tage später von sowjetischen Truppen besetzt und die meisten Unterlagen über das Atomprojekt von japanischen Wissenschaftlern vernichtet wurden.34
Was auch immer in Hungnam geschehen ist, fest steht, dass das japanische F-Go-Atomprojekt bis 1945 weiter vorangeschritten war als bisher angenommen. Nach den beiden amerikanischen Atombombenabwürfen über Japan und der bedingungslosen Kapitulation haben die Japaner die Geschichte des eigenen Atomprogramms völlig verdrängt. Das Land sah sich ausschließlich als Opfer der Katastrophen von Hiroshima und Nagasaki. Die am eigenen Atomprogramm beteiligten Wissenschaftler schwiegen oder behaupteten, lediglich an der friedlichen Nutzung der Kernenergie gearbeitet zu haben. Auch in den USA bestand wenig Interesse daran, Details über die konkurrierenden Atomprojekte an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Kurz nach Kriegsende wurden die japanischen Zyklotrone von amerikanischen Besatzungstruppen zerstört und die wenigen noch verfügbaren Dokumente beschlagnahmt.
Los Alamos – Das amerikanische Nuklearlabor
Die Tatsache, dass die Entdeckung der Kernspaltung in Deutschland gemacht worden war, bestärkte berühmte Physiker wie Albert Einstein, Leo Szilard und Enrico Fermi – sie alle waren vor den deutschen bzw. italienischen Faschisten geflohen – in der Angst, Hitler könne eines Tages in den Besitz einer »ultimativen Waffe« gelangen. Auf Drängen von Szilard schrieb Einstein am 2. August 1939 seinen berühmten Brief an den Präsidenten der USA, Franklin D. Roosevelt, und warnte ihn vor dem Zerstörungspotential der Kernspaltung. In Reaktion auf Einsteins Brief berief der amerikanische Präsident im Oktober 1939 ein Urankomitee ein, das die tatsächlichen Möglichkeiten für den Bau einer Atombombe prüfen sollte. Weitere Anstöße dafür kamen aus Großbritannien.
Der Österreicher Rudolf Peierls und der Deutsche Otto R. Frisch, zwei nach England geflüchtete Wissenschaftler, hatten bereits vor dem Krieg Wesentliches in der Atomphysik geleistet. Anfang 1940 diskutierten sie darüber, ob sich Uran 235 mit schnellen Neutronen spalten ließ. Zu ihrer eigenen Verblüffung ergaben ihre theoretischen Berechungen, dass man dafür nicht mehrere Tonnen Uran 235, sondern nur wenige Kilogramm benötigte. Ihre Erkenntnisse fassten sie im April 1940 in einem kurzem Memorandum unter der Überschrift »Über die Konstruktion einer ›Superbombe‹ auf der Basis einer nuklearen Kettenreaktion in Uran« zusammen. Sie gingen davon aus, dass ein kleines Stück reinen Urans 235 die für eine Bombe nötige Kettenreaktion auslösen könne. Sie setzten sich auch mit den Schrecken einer solchen Bombe auseinander und erläuterten deren strategische und moralische Konsequenzen. »Als Waffe wäre der Superbombe so gut wie nichts entgegenzusetzen. Es gibt kein Material und kein Bauwerk, die der Wucht der Explosion standhalten könnten …« Des Weiteren schrieben sie: »Geht man davon aus, dass Deutschland diese Waffe besitzt oder besitzen wird, dann ist die Einsicht unumgänglich, dass es keine Schutzräume gibt, die effektiven und weiträumigen Schutz garantieren könnten. Die wirkungsvollste Antwort auf eine solche Waffe wäre wohl die Drohung, mit einer ähnlichen Waffe zurückzuschlagen.«35
Daraufhin wurde ein kleines Gremium von Physikern zusammengerufen, in dem diskutiert werden sollte, ob der Bau einer Atombombe wirklich machbar sei. Ende Juni 1940 gab G. P. Thomson, Physikprofessor am Londoner Imperial College, dem von ihm geleiteten Komitee den Namen MAUD.36 Nach einjähriger Arbeit berichtete das Komitee im Sommer 1941 der britischen Regierung. Die im Gremium vertretenen Wissenschaftler waren zu der Einschätzung gekommen, dass es durchaus möglich sei, eine Atombombe herzustellen. Unschlüssig war man sich nur in der Frage, ob man ein solches Projekt in Großbritannien, das sich inzwischen im Krieg mit Deutschland befand, realisieren solle.
Der britische MAUD-Report wurde auch der amerikanischen Regierung in Washington zur Kenntnis gebracht und führte in den USA zu einem gesteigerten Interesse am Bau einer Atombombe. Dies ging so weit, dass Präsident Roosevelt die Aufsicht über die weiteren Arbeiten im Herbst desselben Jahres selbst in die Hand nahm. Mit der Koordination beauftragte er Vannevar Bush, der das Mitte 1941 gegründete Amt für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung und damit alle kriegswichtigen Projekte leitete. Daraufhin wurden die Forschungen zur Kernspaltung an den Universitäten in Columbia, Princeton, Chicago und Berkeley forciert.
Während man sich in Deutschland auf schweres Wasser als Moderator festgelegt hatte, favorisierte man in den USA hoch reines Graphit. Im Sommer 1941 wurde die erste Versuchsanordnung aus Graphit und Uran an der Columbia-Universität in New York errichtet, und Enrico Fermi begann seine Experimente in einem Versuchsreaktor, der auf einem Squash-Platz der Chicagoer Universität stand.
Am 6. November 1941 wurde im Ausschuss der National Academy ein Memorandum über den Stand der Kernenergieforschung diskutiert. Man kam zu dem Schluss, dass unter Aufbietung aller Kräfte im Laufe der kommenden drei bis vier Jahre eine Atombombe entwickelt werden könnte.37 Einen weiteren Schub erfuhr das amerikanische Vorhaben nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 und der Kriegserklärung durch Deutschland vier Tage später. Nach diesen beiden Ereignissen war Präsident Roosevelt fest entschlossen, gemeinsam mit den Briten die Atomforschung auf Hochtouren voranzutreiben. Ende 1941 wandte er sich daher an Premier Churchill, um ihn für eine amerikanisch-britische Zusammenarbeit zu gewinnen. Noch konnte man sich dazu in Großbritannien allerdings nicht entschließen. Immerhin vereinbarte man einen intensiveren Austausch über die jeweiligen Forschungsergebnisse.
Ein halbes Jahr später, im August 1942, gingen die USA zur großtechnischen Umsetzung ihrer bisher im Labormaßstab durchgeführten Forschungen über. Jetzt wurde auch die Armee in das Atomprojekt, das man nach dem New Yorker Stadtteil Manhattan benannte, einbezogen. Zum militärischen Chef stieg General Leslie R. Groves, Absolvent der Eliteakademie Westpoint und Leiter aller Bauvorhaben der Armee, auf. Er hatte sich als energisch zupackender Pragmatiker bewährt.
Die wissenschaftliche Leitung des Manhattan-Projektes sollte Robert Oppenheimer übernehmen. Obwohl 1942 erst 38 Jahre alt, genoss Oppenheimer, der an der Universität in Berkeley theoretische Physik lehrte, weltweit Anerkennung. Er zeichnete sich durch ein phänomenales Gedächtnis aus und war an höchst unterschiedlichen wissenschaftlichen Problemen interessiert. Dennoch war es nicht nahe liegend, gerade ihm die Projektleitung zu übertragen. Er hatte bisher auf theoretischem Gebiet gearbeitet und sollte sich nun anwendungsorientierten Fragen widmen. Zudem galt er als Sicherheitsrisiko, weil er zeitweise in linksgerichteten Kreisen verkehrte und seine Frau Mitglied der Kommunistischen Partei war. Es gab Stimmen, die Oppenheimer vom Atombombenprojekt am liebsten fern gehalten hätten.38 Doch General Groves konnte sich schließlich mit seinem Vorschlag durchsetzen. Umgehend begann Oppenheimer, aus dem ganzen Land die besten Physiker zusammenzuholen. Anfangs rechnete er damit, dass er die vor ihm liegenden Arbeiten mit 150 Wissenschaftlern bewältigen könne. Bis Mitte 1945 wuchs jedoch allein sein Stab an wissenschaftlichen Mitarbeitern auf 2 500 an.39
Als die wichtigsten Personalfragen geklärt waren, musste eine Entscheidung über den Standort für das zentrale Atomlaboratorium getroffen werden, in dem die Bombe entwickelt, konstruiert und schließlich gebaut werden sollte. Oppenheimer plädierte für ein Gelände in New Mexico, etwa 60 Kilometer von Santa Fe entfernt. Einem in der Nähe gelegenen Canyon verdankte das Gebiet seinen Namen – Los Alamos, während des Zweiten Weltkriegs das am besten gesicherte und überwachte Objekt in den USA. Selbst der amerikanische Vizepräsident, Harry S. Truman, wusste vom Manhattan-Projekt bis zum Tod von Präsident Roosevelt nichts.
Das Labor in Los Alamos lag auf einem Hochplateau, gesichert durch hohe Zäune, elektronische Alarmmelder und Wachposten. Der Zugang war nur mit Sonderausweisen möglich. Die wichtigsten Mitarbeiter, die nach strengsten Kriterien ausgewählt worden waren, wohnten auf dem Gelände und unterlagen einer Vielzahl von Restriktionen. Ihre Post wurde zensiert, die Telefone abgehört. Zahlreiche Wörter, darunter »Uran« und »Kernspaltung«, durften nicht verwandt werden. Selbst in ihren Führerscheinen war kein Name eingetragen. Die Bodyguards, die die Wissenschaftler bewachten, wenn sie sich einmal außerhalb von Los Alamos bewegten, hatten zugleich die Aufgabe, sie zu überwachen.
Obwohl sich das FBI und General Groves die größte Mühe gaben, Los Alamos abzuschirmen, blieb das Sicherheitssystem lückenhaft. Da man unter hohem Zeitdruck stand, war eine gründliche Sicherheitsüberprüfung des Personals gar nicht möglich. Zudem hing der Fortschritt des Projekts vom schnellen Informationsfluss in der wissenschaftlichen Gemeinschaft ab. Dies wiederum war nur durch einen relativ einfachen Zugang zu den neuesten Informationen zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund wurden schon bald die Reisebestimmungen für die Mitarbeiter gelockert. Ein erstaunlicher Umstand, wenn man bedenkt, dass der amerikanische Geheimdienst plante, den führenden Kopf der deutschen Atomforschung, Werner Heisenberg, auf einer Reise in die neutrale Schweiz umbringen zu lassen.40 Den Umkehrfall zog man anscheinend nicht in Betracht.
Nachdem die Weichen für das Projekt gestellt waren, erreichte es in kürzester Zeit eine gigantische Dimension, vergleichbar nur mit der amerikanischen Autoindustrie. Insgesamt gehörten zum Manhattan-Projekt 37 Werke und Forschungseinrichtungen in 19 Bundesstaaten der USA. Zu den wichtigsten Anlagen zählten neben der in Los Alamos die in Oak Ridge, wo Uran 235 von Uran 239 separiert wurde, und die in Hanford, wo das größte Plutoniumwerk entstand. Die Kosten wurden auf ca. 2 Milliarden Dollar veranschlagt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























