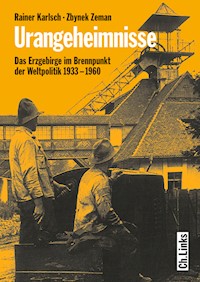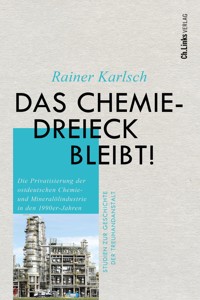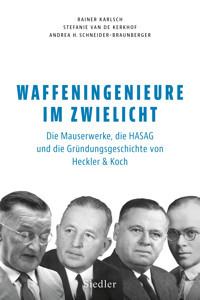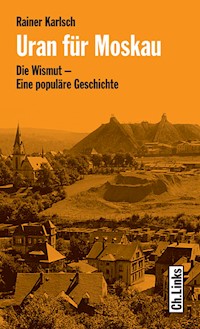
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Links, Ch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: DDR-Geschichte
- Sprache: Deutsch
Die sowjetisch-deutsche Wismut-Gesellschaft gehört zu den wenig bekannten und zugleich spannendsten Kapiteln der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Um im atomaren Wettrüsten gleichziehen zu können, benötigte die Sowjetunion nach 1945 dringend Uran. Das fand sie in Thüringen und Sachsen. Mit allen Mitteln wurde dort der Erzbergbau vorangetrieben, entstand ein abgeschottetes Unternehmen, das binnen zwei Jahrzehnten zum drittgrößten Uranproduzenten der Welt aufstieg. Doch nach der Katastrophe von Tschernobyl nahm die Atombegeisterung ab, und mit der deutschen Einheit fand die unrentable und umweltschädigende Produktion ein jähes Ende. Es begann ein langwieriger Sanierungsprozess, dessen Ergebnisse auf der Bundesgartenschau 2007 einer größeren Öffentlichkeit präsentiert werden.
Der ausgewiesene Wirtschaftshistoriker Rainer Karlsch legt nunmehr die erste populäre Gesamtdarstellung der Wismut AG vor, wobei er auch die umstrittenen Bereiche nicht ausspart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Rainer Karlsch
Uran für Moskau
Die Wismut – Eine populäre Geschichte
Ch. Links Verlag, Berlin
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage 2012 (entspricht der 4. Druck-Auflage von 2011)
© Christoph Links Verlag GmbH, 2007
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Umschlaggestaltung: KahaneDesign, Berlin,
unter Verwendung eines Fotos von den Spitzkegelhalden in Schlema
in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre
eISBN: 978-3-86284-101-1
Inhalt
Die Vorgeschichte
Auf dem Weg ins Atomzeitalter
Radiumbäder, Radiumcreme und Leuchtfarben
Die »Schneeberger Krankheit«
Strahlenschutz oder »Vernichtung durch Arbeit« in den Uranminen?
Stagnierende Uranerzförderung während des Krieges
Stalins Atomprojekt und die »Uranlücke«
Die Anfänge des sowjetischen Atomprojektes
Die »Uranlücke«
Legenden: Das Uran und die spätere Besatzungszoneneinteilung
Die Hinterlassenschaften des deutschen Atomprojektes
Hiroshima und die geopolitischen Folgen
Ein »Staat im Staate« entsteht (1947–1953)
Die sächsische Bergbauverwaltung des NKWD
Die Gründung der Wismut AG
Erkundung, Abbauverfahren und Erzaufbereitung unter Extrembedingungen
Kein Gulag im Erzgebirge
Der Arbeitsalltag
Die Anfänge einer neuen Personalpolitik
Die Beschäftigtenentwicklung
Schattenseiten
Militärtribunale und Sonderjustiz
Propagandakrieg: »Uransklaven« oder »Erzbergbau für den Frieden«?
Kultur und Ideologie
»Erzdiebe« und Spione
Der vorweggenommene 17. Juni
Strahlenschäden
Uran als Reparationsgut
Übergangsjahre (1954–1962)
Die Gründung der SDAG 1954
Ein »zusätzlicher Verteidigungsbeitrag«
Atomwirtschaftspläne und Intrigen
Ronneburg als neues Zentrum der Uranerzgewinnung
Aufbereitungsfabriken und Absetzanlagen
Das Grubenunglück von Niederschlema
Umweltsünden
»Sonnensucher«, Arbeitertheater und schreibende Kumpel
Das Regierungsabkommen vom 7. Dezember 1962
Die besten Jahre (1963–1977)
Die Wirtschaftsreform und die SDAG Wismut
Streit um die Perspektive des Uranbergbaus
Bekräftigung der Atomenergiepläne
Dresden-Gittersee und Königstein
Fortschritte in der Bohrtechnologie
Verbesserung des Strahlenschutzes
Berufskrankheiten und das Problem der Schwellenwerte
Krise und Ende des Uranbergbaus (1978–1990)
Das Kombinat
Komplizierte Preisverhandlungen
Produktion contra Umweltschutz: chemische Laugung unter Tage
Begleitbergbau
Eine neue Preisrunde auf höchster Ebene
Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
Umweltaktivisten gegen den Uranbergbau
Die Wende
Die Sanierung (1991–2007)
Der Preis der Einheit und das deutsch-sowjetische Abkommen vom 16. Mai 1991
Organisatorischer und personeller Umbau und die Bildung der Wismut GmbH
Sanierungsaufgaben und Grenzwerteproblematik
Das Altlastenkataster
Die Tätigkeit der Sanierungsbetriebe
Anerkennung von Berufskrankheiten und wissenschaftliche Begleitung
Bilanz
Nachwort zur 4. Auflage
Anhang
Anmerkungen
Abkürzungsverzeichnis
Tabellen und Statistiken
Quellen- und Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Ortsregister
Personenregister
Angaben zum Autor und Danksagung
Wichtige Wismut-Standorte in Sachsen und Thüringen
Die Vorgeschichte
Auf dem Weg ins Atomzeitalter
Mit der »Pechblende« fing alles an. Der Begriff stammt aus der Blütezeit des Bergbaus im Erzgebirge. Die Bergleute suchten nach Silber und anderen wertvollen Metallen. Stießen sie bei ihrer schweren Arbeit auf Pechblende, so bedeutete dies nichts Gutes. Mit seinem Glanz wie Pech täuschte das Mineral die Häuer. Sie hatten keine Verwendung für das schwarze, ins Grünliche und Bräunliche spielende, mitunter fettglänzende Mineral und warfen es auf Halde.
»Pech« stand demnach für die Farbe des Minerals und sagte auch etwas über dessen Unwert aus. Als »Blende« wurden Mineralien bezeichnet, die aufgrund ihres spezifischen Gewichts einen Metallgehalt vermuten ließen, der aber mit den damaligen Verhüttungstechniken nicht gewinnbar war. Kurzum, kleine Mengen Pechblende wurden schon seit Jahrhunderten gefördert, nur waren es nutzlose Funde. Der Aufschwung der Naturwissenschaften im ausgehenden 18. Jahrhundert führte dann zu neuen Erkenntnissen über die natürlichen Elemente. So beschrieb der österreichische Mineraloge Ignaz Edler von Born, der zu den führenden Mitgliedern der Wiener Illuminaten gehörte und Mozart zur Figur des Sarastro in seiner Oper »Die Zauberflöte« inspirierte, in seinem 1772 erschienenen Katalog der Mineralien von Sankt Joachimsthal (heute: Jáchymov) die Pechblende als Mineral.1 Der Chemiker Martin Heinrich Klaproth fand in dem Mineral schließlich 1789 ein neues Element, das er zunächst Uranit nannte. Die Namensgebung war eine Referenz an den 1781 entdeckten Planeten Uranus. 1790 wurde das neue Element in Uranium umbenannt. Klaproth hatte für seine Analysen Material aus einer Johanngeorgenstädter Mine verwendet. Dies war kein reines Uranmetall, sondern Uranoxyd (UO2). Uran kommt nämlich in der Natur nicht als reines Metall vor, sondern in Form von oxidierten Mineralien. Davon gibt es mehr als 200, wobei die Pechblende das Wichtigste ist. Inzwischen ist das alte Wort »Pechblende« kaum noch gebräuchlich, stattdessen ist zumeist nur noch von »Uran« bzw. »Uranerz« die Rede.
Nach der Entdeckung Klaproths sollten noch mehr als 60 Jahre vergehen, bis das schwarze Mineral erste wirtschaftliche Bedeutung erlangte. Der Hüttenchemiker Adolf Patera stellte 1852 aus Pechblende die ersten Uranfarben her. Sie wurden zum Färben von Glas und Keramik verwendet. Der Einsatz der fein gemahlenen Uranverbindungen verlieh dem berühmten böhmischen Glas eine hellgrüne Farbe.2 Aus Uranfarbe hergestellte orange, gelbe oder leuchtend rote Glasuren fanden außerdem bei der Färbung von Geschirr oder als architektonisches Beiwerk Verwendung.
Die Preise für die einst wertlose Pechblende stiegen an. Sie wurde nun sogar von den Halden geklaubt und an die Glasindustrie verkauft. Jetzt witterte auch der Staat ein Geschäft. Die Finanzverwaltung der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie nahm sich des neuen Gewerbes an. Sie veranlasste ab 1854 die Verarbeitung von Pechblende zu Uranoxydnatron (Urangelb) in einem Nebengebäude der staatlichen Silberhütte von Joachimsthal.3 Bis 1860 wurden dort ungefähr 7,4 Tonnen Uranfarben hergestellt. In den folgenden Jahren stieg die Produktion weiter an.
Seit 1871 firmierte das Joachimsthaler Unternehmen unter dem Namen »Königlich-Kaiserliche Uranfarbenfabrik«. Ihren Höhepunkt erreichte die Herstellung von Uranfarben schließlich 1921 bis 1930. In dieser Dekade wurden über 154 t Uranfarben produziert.4 Das Uranerz dafür kam überwiegend aus den prosperierenden Joachimsthaler Minen. Doch auch in Sachsen, in alten Minen des Silberbergbaus nahe Schneeberg und Johanngeorgenstadt, wurden kleinere Mengen Pechblende gefördert und für die Herstellung von Farben verwendet. Bereits seit 1825 wiesen die Statistiken des Oberbergamtes Freiberg die Uranproduktion und die Erlöse aus dem Verkauf aus. Ein halbes Jahrhundert lang beschränkten sich die industriellen Anwendungsmöglichkeiten der Pechblende nur auf die Uranfarbenherstellung. Gänzlich andere Perspektiven sollten sich für den seltenen Rohstoff dann dank der Forschungen französischer Physiker eröffnen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!