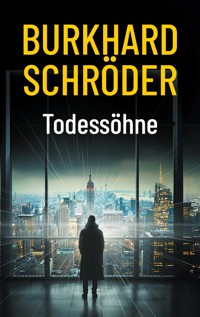Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Juan Conteguez ist jung und charmant. Konträr zu seinem Freiheitswillen liebt er die Tochter des spanientreuen Großgrundbesitzers Diego. An der Seite des Italieners Agustin Codazzi zieht er in den Befreiungskrieg gegen Spanien. Auf dem Schlachtfeld von Carabobo erringen die Kämpfer um Simón Bolívar die Unabhängigkeit Venezuelas. Mit einem Brief des Innenministeriums trifft Juan 20 Jahre später in Paris erneut auf Codazzi. Dank seiner Initiative haben Menschen vom Kaiserstuhl nach Missernten und großer Hungersnot einen Ausweg. Stephan Krämer, Sohn einer armen Bauernfamilie aus Endingen glaubt, dass in der Neuen Welt das Paradies auf ihn wartet. Er ist einer derjenigen, die einen Vertrag mit Codazzi schließen und 1843 in eine unbekannte Welt aufbrechen. Es ist ein Weg der mutigen Entscheidungen, voller Gefahren, tödlicher Hindernisse, Abenteuern und Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Burkhard Schröder ist 1958 in NRW geboren und in Solingen aufgewachsen. Beruf und Liebe führten ihn nach Krefeld, wo er bis heute lebt. Der zweifache Vater arbeitete bis zu seinem Ruhestand 2024 als Unternehmer.
Für meine Kinder Kerstin & Bastian
Inhaltsverzeichnis
1 BARINITAS (VENEZUELA), APRIL 1821
2 HAZIENDA DIEGO
3 BARINITAS
4 WALD NAHE DER HAZIENDA DIEGO
5 BARINITAS
6 WALD NAHE DER HAZIENDA DIEGO
7 BARINITAS
8 HAZIENDA DIEGO
9 ENDINGEN AM KAISERSTUHL
10 TAGUANES
11 HAZIENDA DIEGO
12 CARABOBO
13 MARACAY
14 BARINITAS
15 CHORONI/NEBELWÄLDER
16 EL JUNQUITO
17 CARACAS - VIER MONATE SPÄTER
18 PUERTO CABELLO
19 EL JUNQUITO / CARACAS
20 HAZIENDA DIEGO
21 EL PALITO - NÄHE PUERTO CABELLO
22 CORO
23 PUERTO CABELLO/CARACAS
24 CORO
25 ENDINGEN AM KAISERSTUHL
26 NÄHE VON LOS JUNCALAS
27 HAZIENDA DIEGO
28 NÄHE LOS JUNCALAS
29 CARACAS
30 BARINITAS
31 CARACAS
32 BARINITAS HAZIENDA DIEGO
33 EL JUNQUITO
34 BARINITAS
35 SAN BERNADINO, CARACAS
36 GUANARE
37 EL JUNQUITO
38 ENDINGEN
39 SAN BERNADINO
40 EL JUNQUITO
41 SAN BERNADINO/CARACAS
43 ENDINGEN
44 SAN BERNADINO / LA GUARIA
45 KARIBISCHES MEER, 2. OKTOBER 1840
46 EL JUNQUITO
47 LE HAVRE/VERNON
48 ENDINGEN
49 PARIS
50 ENDINGEN
51 PARIS
52 ENDINGEN
53 CARACAS/EL JUNQUITO
54 SAN BERNADINO
55 SAN BERNADINO
56 LA GUARIA / CARACAS
57 GEBIET DER KOLONIE, OKTOBER 1841
58 SAN BERNADINO/CARACAS
59 SAN BERNADINO/LA VICTORIA
60 SAN BERNADINO
61 PARIS-ENDINGEN, JUNI 1842
62 LA VICTORIA / COLONIA TOVAR
63 SAN BERNADINO
64 ENDINGEN
65 PLAYA MUCUTO
66 NANCY, FRANKREICH
67 SAN BERNADINO
68 LE HAVRE, FRANKREICH
69 EL JUNQUITO
70 LE HAVRE / ATLANTIK
71 SAN BERNADINO
72 ATLANTIK
73 EL JUNQUITO
74 LA GUARIA
75 SAN BERNADINO
76 PUERTO MAYA - CHORONI
77 SAN BERNADINO
78 CHORONI – NEBELWÄLDER
79 SAN BERNADINO
80 MARACAY
81 ISLA MARGARITA
82 LA VICTORIA
83 SAN BERNADINO
84 COLONIA TOVAR, 8. APRIL 1843
85 COLONIA TOVAR
EPILOG
1
BARINITAS (VENEZUELA), APRIL 1821
Wenn es darum ging, seine Probleme zu verheimlichen, zeigte Juan Conteguez nicht weniger Begabung als jeder andere. Und die Schwierigkeiten, in denen er jetzt steckte, hatte er sich selber eingebrockt. Es war seine Entscheidung, in den Krieg zu ziehen und wenn es sein musste, sein Leben für höhere Werte zu opfern, statt den einfacheren Weg zu gehen. So kauerte er vor seinem Haus und verschnürte seine Satteltaschen. Dabei fiel ihm eine Strähne seiner schwarzen Haare in sein Gesicht. Er strich sie zurück und ließ dabei seinen Blick auf seine fein gestriegelte, braune Andalusier-Stute schweifen. In der Ferne erblickte Juan den Kirchenturm, der hoch über die anderen Häuser hinausragte, aber auch einen ihm bekannten, älteren und gebeugt gehenden Mann, verarmt und stolz, mit der Hacke in der Hand vom Feld kommend. Der Mann trug seine Verantwortung, und Juan eben seine. Am Ende musste jeder sterben. Und da war vielleicht so ein Krieg wie dieser, dachte er, eine Schicksalsentscheidung. Die Peiniger seines Volkes waren das Gesetz und jede Menschlichkeit war durch sie außer Kraft gesetzt. Seinen Mitstreitern und sich selbst musste er Mut machen, obwohl ihm ein wenig bang war vor den Gefahren, die auf den 23jährigen Mann lauerten. Das Leben in Barinitas lief in seiner Kindheit meist ruhig und gleichförmig. Manchmal kamen Fremde in Kutschen mit goldfarbenen Wappen und Beschlägen durch den Ort. Sie nächtigten vor ihrer Weiterfahrt in einer größeren Posada, die es gegenüber der Kirche gab. Zusammen mit anderen Kindern aus dem Dorf stand Juan am Straßenrand und bestaunte die riesigen schwarzen Hüte der Reisenden, ihre blank geputzten Schuhe und eleganten Mäntel mit großen, weißen Spitzenkrägen. In Barinitas trug niemand derartige Kleidung. Er hörte, dass diese Männer zumeist Kaufleute aus dem fernen Spanien waren, die im ganzen Land herumreisten, um Geschäfte zu machen. Damals war er mit seinen Freunden in den Stall zu den Pferden geschlichen, während die Fremden im Wirtshaus aßen. Sie streichelten ihr glattes, seidiges Fell, das sich anders anfühlte als die Pferde im Dorf. Diese waren struppig, denn sie zogen den Pflug auf den Feldern und transportierten schwere Dinge. Deren Pferde hatten ihn beeindruckt. So wurde seine Stute seine Leidenschaft und ihr Fell erinnerte ihn an das der Pferde der durchreisenden Spanier, die er damals noch für Edelmänner hielt. Doch seine Meinung über die Spanier hatte sich in den Folgejahren grundlegend geändert.
Plötzlich fiel ein Schatten auf ihn und riss ihn aus seinen Erinnerungen. Er wandte den Kopf und sah ein paar bestickte Reitstiefel neben sich.
»Na, Juan«, sagte der Mann, der zu ihm getreten war. »Du willst dich also doch malträtieren lassen, statt vernünftig zu sein.«
Juan richtete sich auf und musterte den Neuankömmling. Héctor Diego sah aus, als sei er dem spanischen Hofe entsprungen. Seine hünenhafte, muskelbepackte Gestalt steckte in einem schwarzen Anzug. Ein silbernes Kreuz baumelte über der schrankbreiten Brust und unter seinem Hut fiel schwarzes, seidig schimmerndes Haar über Schultern und Rücken. Er blickte in das spöttisch grinsende und von der Sonne gebräunte Gesicht und lächelte dünn zurück.
»Hast du deine menschliche Seite entdeckt und willst mir alles Gute für die Reise wünschen?«
Héctor grinste noch breiter und spuckte in den Staub der Straße.
»Ich muss mit dir sprechen, Juan.«
»Ach ja? Was kann ich für dich tun?«
Juan schulterte seine Tasche, setzte sich langsam in Bewegung und zwang Héctor, ihm zu folgen.
»Du weißt genau, was du für mich tun kannst.«
»Dieselbe alte Leier? Was soll das? Ich liebe Andrea!«
Er wusste, dass ein solches Gespräch irgendwann kommen musste. Aber er hatte damit gerechnet, dass ihn der Alte persönlich ansprach und nicht seinen verkommenen Sohn vorschicken würde. Er war einer der zuverlässigsten Pächter des alten Diego und so ließ man ihm mehr Spielraum, als anderen. Doch die politischen Diskussionen gingen in letzter Zeit immer mehr auf Konfrontation zu, als um reine Standpunkklärung. Für die Gutsherren war es unabdingbar, dass ihre Pächter der spanischen Krone ihre Treue schworen. Alle Versuche ihn umzustimmen waren gescheitert. Die zarte Bande, welche ihn mit Héctors Schwester verband, wäre sicher für den alten Diego kein Problem, wenn er sich hätte anpassen können. Dass jetzt Andrea als Druckmittel ins Spiel gebracht wurde, machte Juan geradezu wütend.
»Komm schon, Juan. Weder mein Vater noch ich möchten, dass Andrea von einem Verräter der spanischen Krone unglücklich gemacht wird. Noch hast du die Chance, dich für uns zu entscheiden.«
»Eine Chance? Das ist lächerlich, Héctor. Du meinst eine Chance, mich gegen die Freiheit zu entscheiden?«
»Schließ dich den Truppen der Krone an, dann ist Andrea kein Thema mehr«, sagte Héctor. »Die Leute hören auf dich. Wenn du dich gegen Simón Bolívar aussprichst, könntest du das halbe Dorf schützen.«
Juan blinzelte entnervt mit seinem rechten Auge.
»Vor wem schützen? Vor den spanischen Horden?«
»Jemand wie du könnte uns nützen.«
Juan drehte sich um und sah Héctor herausfordernd in die Augen.
»Ganz recht. Euch könnte ich nützen. Ich will aber niemandem nützen, außer denen, die es nötig haben.«
»Da!«, Héctor zeigte mit ausgestrecktem Arm auf eine Gruppe Männer auf der anderen Straßenseite, die sich wie Juan entschieden hatten, gegen die Spanier zu kämpfen, »Die haben es nötig! Ich könnte kotzen, wenn ich das hier sehe. In trauter Eintracht mit den Verrätern!«
»Kein Wort mehr Héctor! Die Verräter sind woanders zu finden. Ich frage mich außerdem gerade, ob es dir vollkommen gleichgültig ist, dass die Menschen unter der spanischen Herrschaft zu leiden haben?«
Juan drehte ihm den Rücken zu und ging ein Stück weiter. Verblüfft folgte ihm Héctor mit großen Schritten, während Juan weiter sprach. »Was ist denn mit der von deinen spanischen Freunden versprochenen Freiheit und der Zuteilung von Land für kleine Bauern und Sklaven?«
»Die spanische Krone hat immer die Menschen in Großkolumbien zusammenhalten wollen. Aber die undankbaren Sklaven …«
»Undankbar? Erspare es mir.«
»Durch ihre Faulheit behindern sie einen erfolgreichen Außenhandel mit Europa. Du übersiehst, dass euer vorgebliches Elend von der Unfähigkeit und Unwilligkeit der rebellierenden Dummköpfe kommt!«
»Ich sehe nur, dass du zu den größten Ignoranten gehörst, die mir je begegnet sind. Es sind die Fehlleistungen Spaniens, die Ungerechtigkeit und die Raffgier der Spanier, die uns alle in diese Situation gebracht haben.« Juan machte eine Pause, bevor er fortfuhr. »Soll ich dir sagen, was dein Problem ist, Héctor? Genau genommen hast du sogar zwei. Erstens, du hängst dir das Mäntelchen des Menschenfreundes um, genauso wie deine spanischen Freunde. Aber in Wirklichkeit führt ihr einen schmutzigen Krieg gegen die Freiheit der eigenen Leute, die ihre Angelegenheiten selber in die Hand nehmen wollen. Dein zweites Problem ist, dass du gar kein Spanier bist.«
Héctor Diego erbleichte. Juan wusste, dass sein Gegenüber über erstaunliche Kräfte verfügte und Schlägereien nie aus dem Weg ging. Er fragte sich, wie weit er ihn würde reizen können. Ein Schlag von Diego war geeignet, jede Auseinandersetzung nachhaltig zu beenden.
»Warum erzählst du solche Scheiße, Juan? Ich bin Kreole, wie du.«
»Ach? Dann wissen deine spanischen Freunde, dass deine Mutter eine Halbindianerin war?«, fragte Juan und wandte sich zu Diego um, der ihn wütend anstarrte. »Nein, nicht mal das. Du bist in etwa so spanisch wie ein französischer Fischer. Du glaubst, mit deinem Königsgetue ein paar Leuten ans Bein pissen zu können. Lass mich damit in Ruhe.«
Juan sah, dass Héctor mit seiner Selbstbeherrschung kämpfte.
»Ist dir nicht klar, dass mein Vater bezüglich Andrea und dir eine Entscheidung zu treffen hat?«
»Ja, dein Vater. Aber nicht du. Also lass Andrea aus dem Spiel.«
»Du bist unser Pächter. Ich werde nicht zulassen, dass ihr Verräter alles zerstört, was unsere Väter mühsam in diesem Land aufgebaut haben.«
»Verschwinde, Héctor. Ich habe noch zu tun.«
Juan antwortete nicht mehr. Vielmehr starrten sie sich an. Die Spannung steigerte sich, als Héctor auflachte, seine Fäuste ballte und sich vor im aufbaute. Juan wich nicht einen Meter vor ihm zurück.
»Wir werden uns wieder sehen. Schneller als dir lieb ist, Conteguez!«
Er machte auf dem Absatz kehrt, stieg auf seinen Rappen und stürmte davon. Juan sah ihm nach und betrat sein Haus. Die Wasserflasche war mit frischem und kühlem Wasser aus dem Fluss befüllt. Er legte seine Tasche beiseite und nahm einen kräftigen Schluck, der ihm erfrischend die Kehle herunter lief. Er liebte Andrea und er dachte nicht im Traum daran, sie aufzugeben. Eines Tages würde ihr Vater begreifen, dass er im Unrecht war. Und doch wäre es möglich, dass Héctor seinen Vater Jorge solange bearbeitete und mit Unwahrheiten überhäufte, bis ihm keine Wahl blieb, als ihn von dem Land zu vertreiben. Juan entzündete die Kerzen, holte Papier aus der Lade und tauchte die Feder in die Tinte.
2
HAZIENDA DIEGO
Andrea lauschte an der halboffenen Tür, als sich ihr Bruder in das Arbeitszimmer setzte. Wartend zog sie ihre hohe Stirn in Falten. Ihr war bewusst, dass sie mit ihrem dunklen, schimmernden Haar, dem fein geformten Gesicht und den hohen Backenknochen mit einiges mehr als nur gutaussehend war und sie wusste, dass ihr Hauptanziehungspunkt für Juan, wie auch für andere Männer, vor allem ihre strahlenden Augen und ihr lachender Mund waren. Eigentlich fühlte sie sich immer gut gelaunt, es sei denn, sie sah sich mit Ungerechtigkeit und anderen negativen Eigenschaften konfrontiert.
»Also gut«, sagte Jorge, der seinem Sohn Héctor gegenüber saß. »Um wen geht es?«
»Der größte Schuft ist dein Pächter Juan Conteguez. Er ist der Rädelsführer. Die anderen sind nur Mitläufer, die ihm nach-plappern.«
Andrea verdrehte die Augen. Héctors Ansichten waren ihr nicht neu.
»Wir müssen solchen Auswüchsen entgegenwirken!«, sagte Jorge.
»Übe Druck auf ihn aus!«
»Ich habe ihm gedroht, dass ich dafür sorgen werde, dass er Andrea nicht mehr wiedersieht, wenn er sich den Verrätern anschließt.«
»Und wie hat er darauf reagiert?«
»Juan faselt von Liebe und will sich nicht von mir daran hindern lassen, Andrea auch weiterhin zu sehen. Ich glaube, du musst ein Machtwort mit meiner Schwester sprechen.«
»Noch nicht. Du wirst ihm zuerst eine Lektion erteilen.«
Héctor gab vor, den Vorschlag zu erwägen, als hätte er nicht längst schon darüber nachgedacht. »Ich könnte der königlichen Armee einen Hinweis auf dieses Rebellennest geben.«
»Nein! Dann zertrampeln mir die Horden das Land. Wir haben durch den Krieg kaum noch Arbeiter, und neue Sklaven bekomme ich auch nicht. Du sollst verhindern, dass die Leute Juan folgen aber nicht dafür sorgen, dass sie aus Trotz in den Krieg ziehen.«
»Ich werde es in die Hand nehmen und lasse mir etwas einfallen.«
Jorge räusperte sich. »Mache das. Aber übertreibe es nicht!«
Andrea hatte gehört, was sie schon vorher ahnte. Sie musste Juan warnen und entfernte sich leise von der Tür. Durch die Küche kam sie auf den Hof und zum Stall. Die Pferde schnaubten zur Begrüßung und sie flüsterte leise mit ihnen, damit sie ruhig blieben. Sie sattelte ihr Pferd und führte es unbemerkt über den Hinterhof. Erst als sie das Zuckerrohrfeld erreichte, stieg sie auf und trieb es an. Es dämmerte bereits und sie bemerkte die dicken Regenwolken am Horizont. In dieser Jahreszeit gab es in den Anden fast täglich einen Schauer. Als die ersten dicken Tropfen auf ihren Kopf fielen befürchtete Andrea, dass sie vollkommen durchnässt bei Juan ankommen würde und schnürte ihren Umhang zu, aber sie war bereits von Kopf bis Fuß tropfnass, als sie den Waldrand erreichte.
Was hatte Héctor nur vor? Würde er Juan aus der Kate jagen?, dachte sie. Dann wäre Jorge aufgebracht, weil er auf ihn als Pächter nicht verzichten konnte. Also würde er etwas anderes planen. Ihr Bruder war mitunter überaus brutal, aber eine Prügelei würde nichts an Juans Entschlossenheit ändern. Das musste auch Héctor wissen. Andrea war auch nicht gerade von Juans Plänen begeistert. Aber auch wenn sie traurig darüber war, teilte und verstand sie seine Beweggründe. Als sie an eine abschüssige Stelle des schmalen Pfades kam, sah sie, dass sich der Weg durch den starken Regen in einen reißenden Bach verwandelt hatte. Sie wollte stehen bleiben, aber es war schon zu spät. Ihr Pferd versuchte das Gleichgewicht zu halten, doch es kam so ins Rutschen, dass sie sich mit ihm überschlug. Schnell hechtete sie zur Seite, um nicht zerquetscht zu werden. Sie stolperte und stürzte den Abhang herab. Äste schlugen ihr schmerzhaft ins Gesicht. Das Pferd wieherte und rutschte ungebremst durch das Unterholz. Andreas Sicht war durch den Matsch und Blätter, welche auf ihrem Gesicht klebten, stark eingeschränkt. Zu spät bemerkte sie den großen Felsbrocken, auf den sie mit unverminderter Geschwindigkeit zuraste. Sie schlug mit ihren Füßen zuerst auf, drehte sich durch den Aufprall und schleuderte mit der Schulter gegen den Fels. Es dauerte einige Sekunden, bis der stechende Schmerz ihr Gehirn erreichte und sie in eine Ohnmacht fiel. Als sie nach einiger Zeit ihr Bewusstsein wieder erlangte, wusste sie nicht wie lange sie schon dagelegen hatte. Andrea versuchte sich aufzurichten, aber sie fiel gleich wieder hin, da die Schmerzen so stark waren, dass sie nicht aufstehen konnte. Sie rief nach ihrem Pferd, doch es war nichts von ihm zu hören oder zu sehen. Sie dachte, dass es entweder weiter unten ebenso verletzt lag, oder es in Panik durchgegangen war. Mit schwacher Stimme rief sie noch ein paar Mal ohne Erfolg. Der Regen nahm noch an Heftigkeit zu und dicke Tropfen schlugen auf den durchweichten Waldboden. Sie untersuchte ihren Fuß, doch da war vor lauter Dreck nichts zu erkennen. Bei dem Versuch, ihren Schuh auszuziehen, reagierte ihr Fuß schon auf die erste Berührung mit einem heftigen Schmerz und sie stöhnte auf. Es hatte ohnehin keinen Zweck. Womit hätte sie ihn auch verbinden sollen? Du musst dich zusammenreißen, ging es Andrea durch den Kopf und biss die Zähne zusammen. Trotz beginnenden Dunkelheit entdeckte sie weiter oberhalb eine Senke im Boden, über der ein umgestürzter Baum lag. Dort hätte sie einen vorübergehenden Schutz für diese Nacht. Andrea griff nach einem Ast über ihr und zog sich einen halben Meter den Abhang hoch. Als der Schmerz unerträglich wurde, ließ sie sich wieder fallen. Reiß’ dich endlich zusammen!, ermahnte sie sich und versuchte es ein weiteres Mal. Mit zusammengebissenen Zähnen zog sie sich einen Meter höher, griff nach dem nächsten Ast und schleppte sich weiter. Vor Anstrengung und Schmerz stand ihr der Schweiß auf der Stirn. Die Senke war noch etwa sechs Meter entfernt, doch der nächste kräftige Ast war zu weit entfernt, als dass sie ihn hätte erreichen können. Sie musste zwei Meter herankriechen, um ihn fassen zu können. Langsam robbte sie unter größter Kraftanstrengung dem Ast entgegen. Als sie ihn erreichte, zog sie sich schließlich bis zu der Senke, in der sie erschöpft zusammensank. Andrea legte sich in ihr Bett aus feuchtem Laub und ihr wurde schwarz vor Augen. Sie hätte nicht sagen können wie lange sie geschlafen hatte, als sie von einem Geraschel geweckt wurde. Ihre Augen hatten sich zwar an die Dunkelheit gewöhnt, aber mehr als ein paar Schritt weit konnte sie nicht sehen. Äste brachen und es hörte sich für sie an, als ob sich jemand durch das Blattwerk bewegt.
»Hallo!«, rief sie in der Hoffnung, dass Hilfe kam. »Ich bin hier!«
Keine Antwort. Wahrscheinlich habe ich mich getäuscht, dachte sie und ärgerte sich, wie unvorsichtig sie doch gewesen war obwohl sie eine gute Reiterin war und die Umgebung gut kannte. Sie hätte wissen müssen, dass bei diesem Wetter der Weg rutschig sein würde. Wieder ernahm sie ein Knacken im Unterholz. Diesmal war es deutlich näher. Als Andrea das tiefe Knurren vernahm, roch sie den strengen Geruch der Katze uns sah die leuchtenden Augen. Instinktiv rutschte sie in die hinterste Ecke der Senke.
3
BARINITAS
Dicke Regentropfen hämmerten auf den Tisch vor dem Haus, als würden ein paar Dutzend Trommler ihr Bestes geben, die Nachbarschaft wach zu halten.
Juan war gerade dabei, Koriander für seinen Eintopf zu hacken, als es an der Tür klopfte. Pater Valega stand mit einem Krug vor ihm, den er vor seinen kugelrunden Bauch hielt.
»Guten Tag, Vater. Kommen Sie doch rein!«, forderte ihn Juan auf.
»Grüß dich, Juan. Ich hatte keine Lust den Wein alleine in meiner Kirche zu trinken«, begrüßte ihn Valega lächelnd.
»Der Rebensaft scheint aber auf dem Weg hierher so dünn, wie Ihr Haarkranz geworden zu sein, Pater«, scherzte Juan.
Valega wischte sich das Wasser aus dem Gesicht.
»Ach Juan, wo denkst du hin. Ich habe ihn mit meinem Umhang vor dem Regen geschützt.«
»Darf ich Ihnen etwas zu essen anbieten?«
»Gerne, mein Sohn.«
Juan mochte es überhaupt nicht, wenn er mit mein Sohn angesprochen wurde. Aber er hätte Valega deshalb niemals kritisiert. Er reichte dem Geistlichen eine dampfende Schüssel und etwas Brot. Unauffällig, aber sorgfältig musterte Juan sein Gegenüber. Sicher hatte auch Valega von seinem Vorhaben gehört. Immerhin war Simón Bolívar seit Wochen Gesprächsstoff im Ort. Er hoffte, dass Valega nicht gekommen war, um ihn umzustimmen.
»Sie sind willkommen, was immer der Grund für Ihren Besuch sein mag«, sagte Juan neugierig und stellte zwei Becher auf den Tisch.
»Wirst du bald aufbrechen, um dich Bolívars Truppen anzuschließen?«, fragte ihn Valega direkt, während er die Becher füllte.
»Nicht nur ich. Mir werden über zwanzig Männer aus Barinitas folgen. Alles rechtschaffene Leute, denen etwas daran liegt, die Verhältnisse in Venezuela zum Besseren zu verändern, Vater.«
»Nichts anderes würde ich dir zutrauen, aber trotzdem mache ich mir Sorgen um dich und die Männer. Viele von ihnen werden nicht zurückkommen. Sie werden Frauen und Kinder hinterlassen, die nicht alle selbst für sich sorgen können.«
Juan wusste, dass seine Besorgnis nicht unberechtigt war. »Die Gemeinschaft wird sich ihrer annehmen«, sagte er.
»Ich hoffe, da denkst du nicht nur an mich. Schmeckt dir der Wein? Der Tropfen ist alt. Ein Messwein, der so recht für große Kirchenfeste geeignet ist. Ein kleiner Schluck zuvor, ein zweiter während der Wandlung und die Liturgie wird zur Offenbarung«, sagte Valega lächelnd.
»Viele werden sich um die Witwen und Weisen kümmern. So, war es doch immer. Die Menschen halten zusammen. Und ich verspreche, dass ich mein Bestes geben werde, dass den Männern nichts passiert.«
»Dann lass uns darauf trinken, dass alle gesund heimkehren«, antwortete Valega und hob sein Glas. »Es ist nicht so, dass ich dich nicht verstehe. Mir wäre es auch lieber, wenn die Spanier unser Land so schnell wie möglich verlassen würden«, sagte Valega und wischte sich geschlabberte Suppe von seinem Gewand.
»Aber so richtig begeistert sind Sie von meinem Vorhaben nicht!«
»Du müsstest wissen, dass ich als Geistlicher gegen jede Form von Gewalt bin. Auch die Spanier sind Kinder Gottes.«
»Vater, das ist kein Grund uns weiterhin von ihnen tyrannisieren zu lassen! Die Spanier haben Venezuela und seine Menschen lange genug ausgebeutet und gepeinigt, meinen Sie nicht auch?«
»Ich glaube, dass sie ohnehin bald verschwinden werden. Spanien kann sich auf Dauer seine Kolonien nicht mehr leisten und das El Dorado haben sie hier auch nicht gefunden.«
»So lange können wir nicht warten. Je mehr Probleme Spanien hat, umso mehr wird es die amerikanischen Länder ausquetschen. Es ist in den letzten Jahren nicht besser, sondern nur schlimmer geworden.«
»Ich gebe dir ja Recht. Die Dinge stehen alles andere als gut.«
»Morgen reise ich nach Palmarita am Apure und werde den Truppen mitteilen, dass ich mich mit meinen Männern anschließen möchte.«
»Warum reist du nicht einfach zu dem Marqués de Boconó. Seine Residenz ist in Barinas. Das ist doch viel näher.«
»Paez ist derzeit nicht in Barinas«, sagte Juan. »Unsere Männer sind bereit zu kämpfen. Nur Héctor Diego gefällt das nicht.«
»Hm. Wir wissen beide, dass seine Familie den Spaniern nahe steht.«
»Andrea aber nicht!«
Valega wusste von den beiden. Ihre Verliebtheit war kaum jemandem im Ort verborgen geblieben. »Verzeihe mir, dass ich neugierig bin. Was sagt der alte Jorge denn zu euch?«, fragte Valega.
»Er wird davon wissen, machte aber bisher keine Anstalten, das zu unterbinden. Doch Héctor war heute bei mir und hat mir massiv gedroht«, sagte er. »Wenn ich mit den Republikanern in den Krieg gegen Spanien ziehe, dann will er unterbinden, dass ich seine Schwester wiedersehe, und das macht mir Sorgen.«
»Héctor ist nicht der feinfühlige Musterknabe, aus der Kloster-schule. Aber noch hat Jorge das Sagen und nicht er.«
»Er wird den Grundbesitz aber in nicht allzu langer Zeit erben und dann haben wir alle mit diesem Hitzkopf zu tun, Pater.«
»Bis dahin ist noch Zeit, mein Sohn. Wer weiß, welche Änderungen in nächster Zeit auf uns zukommen.«
»Vater, ich liebe Andrea und möchte sie nach dem Krieg so schnell wie möglich heiraten. Mit oder ohne Jorges Zustimmung.«
»Bis sie mit 21 Jahren mündig ist, geht es nur mit Jorges Zustimmung.«
»Das dauert aber noch zwei Jahre. Würden Sie uns trauen?«
»Nichts lieber als das. Doch es verstößt gegen das Gesetz und ist unmöglich. Du wirst dich also gedulden müssen«, sagte er und leerte den Becher. »Morgen reise ich nach Merida. Bei dem Bischof habe ich eine Audienz und werde um Hilfe für ein neues Kirchendach bitten.«
»Könnten Sie Andrea diesen Brief von mir übergeben? Auf dem Weg kommen Sie doch an der Hazienda vorbei«, sagte Juan und zog das Kuvert aus der Tasche.
»Ich werde ihr den Umschlag unauffällig übergeben«, versprach er.
»Ich danke Ihnen, Vater.«
»Es würde mir genügen, wenn ich dich mal wieder in der Kirche sehe, mein Sohn!«, antwortete Valega.
»Wenn ich von Palmarita zurück bin, werde ich das machen.«
»Wir haben morgen weite Wege vor uns. Der Regen hat nachgelassen. Ich kann es wagen, ins Freie zu treten.«
Juan verabschiedete Valega und dachte noch eine Zeit über ihr Gespräch nach. Valega ist ein entschlossener Mann, der seinen Standpunkt vertreten kann, dachte er und legte sich schlafen. Kaum hatte er die Augen geschlossen, klopfte es erneut. Vollkommen atemlos stand Carlos vor ihm.
4
WALD NAHE DER HAZIENDA DIEGO
Unter dem hohen Baldachin der Bäume war der Boden dunkel. Kein Luftzug strich durch die riesigen Farne und blühenden Schlingpflanzen. Nach dem Regen war die Luftfeuchtigkeit so hoch, dass die Kleidung an ihrem Körper klebte. Andrea wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und Wasser aus den Augen. Sie streckte sich und riss mit einem lauten Knacken einen armdicken Ast von dem Baum über sich ab. Der Jaguar blieb ein paar Meter vor ihr stehen und fauchte sie an. Normalerweise hätte sie vor Angst laut geschrieen. Aber trotz ihrer Furcht blieb sie äußerlich ruhig. Sie wusste, dass Raubtiere die Angst ihrer Beute spüren.
»Du wirst mich nicht fressen, Mistvieh!«, brüllte sie so laut es ging und schlug mit dem Ast wild um sich. Der Jaguar wich irritiert zur Seite, ließ sie aber nicht aus den Augen. Andrea brüllte ihn erneut an. Diesmal wich die Katze nicht zurück, sondern schlich sich seitlich näher. Ängstlich rückte sie in die hinterste Ecke der Kuhle. Jetzt konnte sie nicht fliehen und die Raubkatze schien das zu wissen. Der Jaguar kam näher obwohl sie warnend mit dem Ast vor sich herum fuchtelte. Plötzlich preschte die Katze mit einem Satz vor und stürzte sich auf sie. Andrea spürte keine Schmerzen, als er ihr mit seinen Krallen den Oberschenkel aufschlitzte. Er wollte an ihre Kehle und hatte sein Maul, bereit zum tödlichen Biss, weit aufgerissen. Sie sah in seine entschlossenen Augen und die scharfen Zähne direkt vor sich und der scharfe Geruch aus seinem Maul raubte ihr fast den Atem. Mit dem Ast in ihrer Hand konnte sie nicht mehr ausholen. Kurz bevor sie seine Zähne an ihrem Hals hätte spüren können, stieß sie das Holz mit letzter Kraft in eines seiner Augen. Das Tier heulte auf und raste davon. Es dauerte eine Weile, bis Andrea begriffen hatte, dass der Jaguar nicht zurückkommen würde. Erleichtert ließ sie den Ast fallen und betrachtete die blutende Wunde an ihrem Bein, die heftig zu schmerzen begonnen hatte. Die Qual, die von ihrem gebrochenen Fuß ausging, nahm sie schon gar nicht mehr wahr. Als sie sah, dass die Blutlache im Laub immer größer wurde, riss sie sich den linken Ärmel ab und rollte ihn zusammen. Mit zusammengebissenen Zähnen wickelte sie stöhnend den Stoff um ihren Oberschenkel, zog die Enden fest zusammen und verknotete sie.
5
BARINITAS
Juan stürmte aus dem Haus und rannte mit Carlos durch die engen Gassen. Als sie die Hauptstrasse erreichten, waren die brennenden Häuser am südlichen Ortsende nicht zu übersehen. Aus den Rauchschwaden krochen und humpelten Menschen. Manche blieben auf der Straße liegen, andere schleppten sich ein paar Meter weiter, um dann zu Boden zu fallen. Er vernahm Kinderschreie und Hilferufe von allen Seiten. Aus den Augenwinkeln nahm Juan eine Bewegung hinter den Häusern wahr. Und da sah er sie! Etwa zwanzig Reiter machten sich eilig in die Ausläufer der Anden davon. Stechender Qualm ließ seine Augen tränen und er musste husten. Carlos half gerade einer Frau auf die Beine und schleppte sie aus dem Rauch heraus. Als sie Juan sah, funkelte sie ihn böse an.
»Das ist Ihre Schuld! Sie sind nur deshalb gekommen, weil Ihr unbedingt mit diesem Bolívar an-bändeln wollt!«, schrie sie.
»Du redest dummes Zeug, Weib«, entgegnete Juan. »Die Spanier überfallen seit Monaten Barinas. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie auch Barinitas angreifen würden.«
»Lass sie!«, sagte Carlos.
Andere kamen hinzu und halfen die Verletzten zu bergen und die Toten an den Straßenrand zu tragen. Juan säuberte gerade das blutende Gesicht eines Jungen, als er eine Hand auf seiner Schulter spürte. Er sah auf und blickte in die Augen Valegas, als plötzlich ein fürchterlicher Schrei aus einem Haus ertönte. Juan entdeckte eine Frau mit ihrem Kind in dem oberen Fenster eines brennenden Hauses. Carlos rannte los und er konnte ihn nicht mehr aufhalten.
»Das Haus stürzt gleich ein. Du kannst sie nicht mehr retten!«, schrie er ihm hinterher.
Doch er schien ihn nicht gehört zu haben oder wollte ihn nicht hören. Carlos hielt sich seine Jacke schützend vor das Gesicht und verschwand hinter den Rauchschwaden. Juan versuchte näher heranzukommen, doch die Hitze war unerträglich und die Gefahr zu groß. Von der Frau war nichts mehr zu sehen, aber von Carlos auch nicht. Mit lautem Krachen fielen große Stücke des Daches ein und Sekundenbruchteile später brach das ganze Haus in sich zusammen. Eine Wolke aus Staub, Splittern und Rauch füllte die umgebende Luft.
»Oh Herr, sei den armen Seelen gnädig«, sprach Valega und bekreuzigte sich. »Ich dachte immer, dass sie es nur auf die größeren Städte abgesehen haben. Aber jetzt greifen sie schon kleinere Orte an.«
»Das haben sie schon immer gemacht. Genauso wie sie auch schon immer vergewaltigt, gefoltert und gemordet haben!«, sagte Juan. »Wir müssen uns auf den nächsten Angriff vorbereiten!«
»Warum sollten sie Barinitas nochmals angreifen?«
»Sie werden erfahren haben, dass sich Männer aus Barinitas den Befreiungstruppen anschließen wollen.«
»Wie sollen wir uns gegen ihre Übermacht verteidigen?«
»Mir wird eine Strategie einfallen. Danach setzen wir uns zusammen und besprechen alles im Gemeindehaus«, antwortete Juan.
Bis in die späten Nachtstunden schritten sie durch die Trümmer. Als sich der Rauch legte, lag noch immer Brandgeruch in der Luft.
»Ich werde den Bischof nicht um Geld für eine neues Kirchendach, sondern um Hilfe für die Geschädigten bitten«, sagte Valega während Juan einen verletzten Mann auf eine Karre hob.
Juan überblickte entsetzt die Straße. Menschen trauerten um die Verstorbenen. Es bot sich ihm ein Bild des Grauens. Brennende Häuser, verletzte und tote Menschen, weinende Kinder du Frauen, wohin er auch sah. Auch in der Kirche sah es schrecklich aus. Vor dem Altar lagen unzählige Opfer des Anschlags auf dem Holzboden verteilt. Den Frauen, welche sich um die Verletzten kümmerten, sah er ihre Erschöpfung an. Juans Muskeln schmerzten von den Anstrengungen und Pater Valega sah aus, als hätte er sich in Schlamm und Asche gewälzt. Ein Fremder würde ihn in diesem Zustand kaum als einen Mann Gottes erkennen. Verzweifelt sah sich Valega in seiner Kirche um. »Sie werden sehen, dass morgen schon alles anders aussieht«, versuchte Juan ihm Mut zu machen.
6
WALD NAHE DER HAZIENDA DIEGO
Andrea lag in der Mulde und war wieder bei Bewusstsein. Überall in ihrem Körper hämmerte der Schmerz und ihre Lippen waren vom Fieber, welches in der Nacht über sie gekommen war, aufgeplatzt. Sie hatte Durst, Hunger und fühlte sich hundeelend. Als die Sonne aufging lauschte sie den Geräuschen des Waldes. Sie hatte Angst, dass der Jaguar wiederkommen könnte. Doch außer dem Zwitschern der Vögel war nichts zu hören. Fast nichts. Bis auf das Geräusch, sich nähernder Hufe eines Pferdes. Andrea atmete durch und rief um Hilfe, doch aus ihrer Kehle kam nur ein heiseres Krächzen.
»Verdammter Mist!«, jammerte sie. »Jetzt kommt endlich jemand und ich kann mich nicht bemerkbar machen!«
Die Schmerzen ignorierend stemmte sie sich auf ihre Ellbogen und schob sich langsam aus der Mulde heraus. Der Reiter kam näher.
»Hilfe! Ich bin hier!«, rief sie mit letzter Kraft.
Jetzt sah sie den Reiter zwischen den Bäumen den schmalen Pfad hinauf kommen. Er war jetzt auf gleicher Höhe mit ihr und sie erkannte in ihm Pater Valega. Andrea rief nochmals, doch er verminderte nicht seine Geschwindigkeit. Dann war er an ihr vorbei und hatte sie nicht wahrgenommen. Resigniert ließ sie sich auf den Rücken fallen und weinte verzweifelt.
»Dieses elende Loch im Wald wird mein Grab!«, schrie sie aus voller Kehle. Ihre Stimme war wieder da. Wieso konnte sie eben nicht laut genug rufen, als es darauf ankam? Plötzlich hörte sie wieder die Hufe des Pferdes. Valega kam dem Anschein nach zurück. Andrea musste sich bemerkbar machen. »Pater Valega! Ich bin hier!«, rief sie und wedelte mit beiden Armen. Schließlich erblickte er sie, trabte heran und sprang von seinem Pferd.
»Señorita Diego, was ist geschehen? Ich habe Ihr Pferd tot aufgefunden.«
»Ich bin so froh, Sie zu sehen, Pater!«, schluchzte Andrea und fiel ihm weinend in die Arme.
»Können Sie allein aufstehen?«, fragte er.
Andrea schüttelte den Kopf. »Ich kann mich kaum rühren. Mein Fuß scheint gebrochen zu sein. Ich wurde von einem Jaguar angegriffen.«
»Ein Jaguar hat Sie angegriffen? Und das haben Sie überlebt?«
»Es ist ihm nicht gut bekommen. Wie Sie sehen, lebe ich noch, Vater!« Er hob Andrea auf das Pferd und schwang sich anschließend selber herauf. Valega reichte ihr die Wasserflasche und Andrea trank gierig in großen Schlucken.
»Mit diesen Verletzungen müssen Sie versorgt werden. Im Kloster von Santo Domingo gibt es die besten Ärzte der Anden.«
»Können wir vorher zu unserer Hazienda? Mein Vater macht sich gewiss Sorgen.«
»Das hat Zeit, Señorita Diego. Ihren Vater werde ich auf dem Rückweg informieren.«
»Vater Valega? Wissen Sie, wie es Juan Conteguez geht?«
»Es geht ihm gut und er hat mir einen Brief für Sie mitgegeben«, sagte er und reichte der jungen Frau das Kuvert. »Barinitas wurde letzte Nacht von den Spaniern angegriffen. Es gibt Tote und Verletzte.«
»Das war es also. So ein Miststück«, sagte sie mit schmerzverzerrtem Gesicht. Jeder Schritt des Pferdes ließ sie ihre Verletzungen spüren.
»Was meinen Sie? Ich verstehe nicht!«, hakte Valega nach.
»Ach nichts. Ich habe nur eine Vermutung.«
»Andrea, wir befürchten, dass sie noch mal angreifen werden. Also könnte Ihr Wissen wichtig für die Menschen in Barinitas sein.«
»Vater, Sie vermuten doch längst, dass mein Bruder damit zu tun hat.«
»Glauben Sie, dass er dazu fähig wäre, Kinder und Frauen zu töten?«
»Nein. Doch ich kann mir vorstellen, dass er etwas anderes geplant hatte, um sich an Juan zu rächen. Vielleicht ist ihm die Sache einfach aus den Fingern geglitten, Vater.«
Der Pfad zum Kloster war schmal und an vielen Stellen konnte ihn Andrea kaum erkennen. Zudem wurde er von Stunde zu Stunde steiler. Das Pferd ging sicher, aber nur langsam unter der Last von zwei Reitern. Immer wieder hielt Valega kurz an, um es verschnaufen zu lassen. Schließlich stieg er ab und führte es mit dem Strick weiter in die Berge.
Andrea begann zu fiebern. Als sie endlich am Kloster ankamen, hatte sie ihr Bewusstsein verloren. Valega hielt sich nur wenige Stunden im Kloster auf und war schon vor Sonnenaufgang wieder auf den Beinen. Der Bischof musste warten. Er bat einen Novizen, dem alten Jorge Diego von dem Verbleib seiner Tochter zu berichten.
7
BARINITAS
Sie kamen in den frühen Morgenstunden bevor der erste Hahn krähte und banden ihre Pferde außer Sichtweite an. Fast lautlos umkreisten sie Juans Hof und warteten auf den Befehl zuzuschlagen. Kaum hatten sie die ersten Hütten erreicht, ließ Héctor alle Vorsicht fallen und gab den Befehl zum Angriff. Blindlings stürmten sie Juans Hof, aber der schien wie ausgestorben. Nur ein zerstreutes Huhn und ein paar Katzen liefen zwischen den Hütten herum. Keine Menschenseele weit und breit, Grabesstille und kein Rauch über der Feuerstelle. In Windeseile durchsuchten die Royalisten jedes angrenzende Gebäude. Aus Frust legten sie Feuer, zertrümmerten Krüge und Fässer, Möbel und alles, was sie fanden, ohne auf den geringsten Widerstand zu stoßen. Die Männer nahmen sich ein Haus nach dem anderen vor. Dabei machten sie sich nicht die Mühe an der Tür zu klopfen oder zu rufen. Vielmehr schlugen sie die Türen und Fenster ein und stürmten die Gebäude. Eins nach dem anderen war aber leer.
»Was ist mit der Kirche?«, fragte einer der Spanier.
Héctor sah ans Ende der Straße. Das Gotteshaus schien ruhig und verlassen. Er fragte sich, ob Juan vor Angst mit den anderen Haus und Hof verlassen hätte. Doch dazu war er zu stur. »Schauen wir doch mal nach«, antwortete er und ritt zur Kirche. Das Portal war wie erwartet verschlossen. Héctor rief einen Befehl und die Angreifer warfen sich gegen die massive, zweiflügelige Tür, die unter dem Ansturm erzitterte, aber nicht nachgab. Die Schreie der Angreifer schwollen an. Wieder und wieder rammten sie das Portal.
Währenddessen wurde im Innern der Kirche die Spannung mit jedem neuen Ansturm gegen die Tür unerträglicher. Zweiundzwanzig Männer hatten sich in den Seiten des Kirchenschiffs hinter Strohsäcken postiert, zusammen mit Frauen und Mädchen, deren Aufgabe es war die Büchsen nachzuladen. Juan hatte sich Mühe gegeben, es ihnen in der Kürze der Zeit beizubringen, aber zuviel durfte er nicht erwarten. Die meisten der Frauen hatten zuvor noch nie eine Muskete aus der Nähe gesehen. Jeder der Männer hätte diese Reihe von Handgriffen im Schlaf ausgeführt, hätte Pulver, Kugel und Dichtpfropfen in den Lauf gestopft und die Pfanne mit Zündkraut gefüllt, aber das hätte zuviel Zeit in Anspruch genommen. War ein Gewehr bereit, sollte es zum Schießen an einen der Männer übergeben werden, während unverzüglich das nächste nachgeladen wurde. Ruhig, mit den Fingern am Abzug, warteten die Verteidiger auf ein Zeichen Juans. Kühl betrachtete er den bebenden Querbalken und überlegte, wie lange er noch standhalten würde. Der Erfolg seines Plans hing davon ab, dass sie im richtigen Moment und perfekt aufeinander abgestimmt handelten.
»Die Spanier sind wohl zu erschöpft und haben sich zurückgezogen«, flüsterte ein junger Mann an Juans Seite, als es ruhig wurde.
»Das glaube ich kaum. Die hecken was aus. Seid bereit Leute!«
Juan hob seine Hand und im selben Moment entzündeten vier Männer pechgetränkte Lappen, die einen dicken und stinkenden Qualm machten. Zwei andere krochen über die erste Barrikade zur Tür und entfernten den schweren Querbalken aus der Führung. Durch die Geräusche in der Kirche angestachelt, rannten die Spanier erneut gegen die Tür. Diesmal gab sie auf der Stelle nach, und die ersten Eindringlinge fielen, einer über den anderen, hinein in die Kirche und gegen eine Barrikade aus Sandsäcken und scharfkantigen Steinen, die sie in dem Qualm nicht erkannten. Zweiundzwanzig Musketen feuerten gleichzeitig von beiden Seiten und mehrere Royalisten brachen schreiend zusammen. Juan legte Feuer an eine Lunte, und im Nu fraß sich die Flamme vor bis zu Beuteln mit einem Gemisch aus Pulver, Steinen und Metallsplittern, mit denen sie hinter der Tür bestückt waren. Die Detonation war erschütternd und schleuderte einen Hagel von Steinen und Splittern in die Menge der Angreifer. Die schwere Holztür riss aus den Angeln. Vom Lärm schon wie betäubt, wurden die Verteidiger von dem heißen Luftschwall ins Gesicht getroffen und warfen sich hinter die schützenden Sandsäcke. Juan erkannte, dass etliche der Royalisten wie Marionetten in einer lodernden Wolke übereinander stürzten und gab das Zeichen erneut zu feuern. Die Männer schossen mitten in das heillose Durcheinander der spanischen Angreifer. Dann flogen auch die ersten spanischen Kugeln durch das Kircheninnere. Einige der Eindringlinge lagen am Boden, aber andere feuerten hustend und mit vom Qualm tränenden Augen blindlings los und boten dabei den Kugeln der Verteidiger ein leichtes Ziel. Viermal konnten die Gewehre nachgeladen werden, bis es Héctor und einigen kühnen Royalisten gelang, die Barrikaden zu überklettern und ins Kirchenschiff vorzustoßen, wo sie Juans Leute schon erwarteten. In dem Tohuwabohu verlor er Héctor nicht aus den Augen. Kaum hatte er die Gegner abgeschüttelt, stürzte er sich mit dem Degen auf ihn. Mit aller Kraft ließ er die Klinge auf Héctor niedersausen, aber der Hieb ging ins Leere. Als hätte er die Gefahr gewittert, drehte sich der Hüne im selben Moment zur Seite und wich dem Schlag aus. Vom eigenen Schwung aus dem Gleichgewicht gebracht, taumelte Juan vornüber auf die Knie und sein Degen rutschte außer Reichweite.
»Das war es, du Bastard!«, schrie Héctor, hob sein Schwert und wollte Juan durchbohren. Doch in diesem Moment traf ihn ein Kolbenhieb am Hinterkopf. Er fiel um wie ein gefällter Baum und blieb reglos liegen.
»Vergebe mir Gott!«, rief Valega, der eine Muskete gepackt hielt.
Entgeistert starrte Juan, der sich bereits tot geglaubt hatte, auf die schwere Platzwunde an Héctors Hinterkopf und Valega krönte seinen Freudentaumel mit einem heftigen Tritt gegen die Rippen Héctors. Im Nu hatte sich unter den verbliebenen Angreifern herumgesprochen, dass ihr Geldgeber gefallen war und nach einer kurzen Diskussion darüber, ob sie ihren restlichen vereinbarten Lohn erhalten würden, begannen sie ihren Rückzug. Zunächst zögerlich, aber nach einer nächsten Salve der Verteidiger in wilder Flucht. Schweißgebadet und halb von dem brennenden Schwarzpulverdampf erstickt warteten die Männer und Frauen im Innern der Kirche, bis sich die Staubwolke gelegt hatte, dann traten sie ins Freie und atmeten die frische Luft. Das Stöhnen der Verwundeten ging unter im frenetischen Lärm einer Salve und in dem nicht enden wollenden Siegesschrei der Männer und Frauen. Alle strömten zu Juan und in ihrer Freude rangen sie ihn zu Boden. Er wusste, dass ihr Glücksgefühl, doch etwas ausrichten zu können, diejenigen Männer ermunterte, die bisher ihre Zweifel hatten und der Frevel dieser vorgeblich gottesfürchtigen Spanier eine Kirche zu stürmen, traf sie mit Entsetzen. Juan stand auf und ging zu Pater Valega, der gerade mit zwei Händen seine verschmutzte Soutane raffte und stand neben ihm, als er angesichts ihrer geringen Verluste ein Dankgebet zum Himmel sprach. Gleich darauf ernahm Juan ein zweites Gebet, in dem er um Vergebung bat, dass er das christliche Mitgefühl im Eifer des Gefechts derart aus dem Blick verloren hatte. Er sah sich um. Zwei Männer waren leicht verwundet, aber sie hatten eine Tote zu beklagen. Eines der Mädchen, das die Gewehre geladen hatte, war gerade fünfzehn Jahre alt. Nun lag sie da und starrte mit einem erstaunten Ausdruck ihrer Augen zur Kirchendecke. Als Juan den leblosen Körper des Mädchens entdeckte, wurde er wütend.
»Seht ihr das? Seht ihr, was für Helden diese feigen Schweine sind? Sie vergreifen sich an Kindern, statt sich mit Männern zu messen!«, rief er.
Juan stand dort, wo Héctor zusammengebrochen war und drehte mit der Fußspitze den leblosen Körper um. Mit einer Hand packte er den langen Haarschopf und erstarrte mitten in der Bewegung, denn der Gefallene schlug die Augen auf und sah ihn mit einem unerwartet neugierigen Blick an.
»Heilige Mutter Gottes, er lebt!«, keuchte er.
Juan kniete sich hin, schob Héctor vorsichtig die Hand unter den Nacken und half ihm, sich aufzurichten. Ein leiser Schmerzenslaut kam aus seiner Kehle. Ohne darüber nachzudenken, hob er den Verwundeten hoch und schleppte ihn aus der Kirche.
»Er lebt, Pater!«, sagte er und legte den Verwundeten neben die anderen Verwundeten auf die Erde.
»Schlecht für ihn, denn hinrichten müssen wir ihn doch«, sagte einer der Männer.
»Nein. Wir töten ihn nicht. Ich habe es mir anders überlegt. Er ist der Bruder der Frau, die ich heiraten werde. Es ist egal, welch ein Schwein er ist. Ich lasse ihn dennoch am Leben.«
Juan würde nie erklären können, weshalb er der Aufforderung nicht folgte, sondern stattdessen Wasser vom Brunnen holte und mit einen Lappen das Blut aus seinem Gesicht wischte. Eine ältere Frau half ihm, das dichte Haar zu entwirren und die Platz-wunde auszuwaschen, die bei jeder Berührung mit dem Wasser erneut zu bluten begann. Juan tastete den Kopf Héctors ab, aber die Knochen schienen heil zu sein.
»Ich hoffe, das war eine Lektion für dich und deine spanischen Freunde«, sagte Juan als Héctor seine Augen aufschlug.
»Warum hast du mich nicht getötet?«
»Weil du irgendwann mein Schwager wirst, ob dir das gefällt oder nicht.«
Héctor setzte ein unverschämtes Grinsen auf. »Wer sagt dir, dass du es nicht eines Tages bereuen wirst, mich am Leben gelassen zu haben? Und wer sagt dir, dass du meine Schwester heiratest?«
»Wenn die Spanier erst aus Venezuela vertrieben sind, wirst du sehen, wer die besseren Karten hat. Und jetzt halt die Klappe! Ich lasse dich nach Hause bringen. Sei froh, dass du noch am Leben bist und spar dir deine dummen Sprüche für die Royalisten auf.«
Juan wischte sich mit dem Ärmel seines verschmutzten Hemdes den Schweiß und Ruß aus den Augen. Er ging hinter die Kirche zu seinem Pferd, doch als er es losbinden wollte, spürte er eine Hand auf seiner Schulter und drehte sich herum. Valega stand bei ihm.
»Ich muss dir noch etwas berichten«, sagte er.
Juan hätte in diesem Moment nichts mehr erschüttern können. Er war erfüllt von Wut, Trauer und Ohnmacht ob der jüngsten Ereignisse.
»Ja, Vater?«
»Es geht um Andrea. Sie hatte einen Unfall mit ihrem Pferd.«
»Warum habt Ihr mir das nicht früher gesagt? Wo ist sie?«, fragte Juan entsetzt.
»Beruhige dich, mein Sohn. Es geht ihr gut. Ich habe sie im Wald gefunden. Sie war auf dem Weg zu dir, um dich vor Héctor und seinen Horden zu warnen. Andrea ist bei dem Unwetter von ihrem Pferd gestürzt und wurde von einem Jaguar angegriffen.«
»Oh mein Gott!«.
»Andrea hat nur leichte Verletzungen, aber sie ist noch schwach. Ich habe sie ins Hospital des Klosters von Santo Domingo gebracht.«
»Ich reite sofort zu ihr, Vater!«, sagte Juan entschlossen und griff nach den Zügeln seines Pferdes.
»So warte doch. In deinem Zustand der Erschöpfung kommst du nicht weit. Es geht ihr gut und du kannst ihr jetzt ohnehin nicht helfen. Wenn du ausgeschlafen bist, kannst du morgen zu ihr.«
»Ihr habt wahrscheinlich Recht, Vater. Aber ich sollte mir mal anschauen, was von meinem Haus übrig geblieben ist.«
Juan ging durch den Ort. Er sah Menschen weinend vor den Trümmern ihrer Häuser stehen. Diesmal war fast kein Gebäude verschont geblieben. Kaum war er in seine Straße eingebogen, sah er die qualmenden Überreste seines eigenen Hauses. Er blieb vor Wut betäubt stehen und Tränen liefen ihm über das Gesicht. Dabei bemerkte er nicht die dunkele Person, die ihn belauerte. Am liebsten wäre er sofort los geritten, um bei Andrea zu sein. Aber Valega hatte Recht. Er brauchte Schlaf und der Weg zum Kloster war selbst tagsüber nicht leicht, aber nachts wäre es geradezu töricht dorthin zu reiten.
8
HAZIENDA DIEGO
Immer wieder brach ihm der Schweiß aus und ihm wurde schummerig vor den Augen, doch nach einem Tag sah Héctor wieder klar und seine Atmung wurde ruhiger. Der alte Jorge verabschiedete gerade den Arzt und schloss die Tür hinter ihm.
»Wie kann man nur so dämlich sein?«, herrschte ihn Jorge an.
»Ich verstehe deinen Ärger. Es ist nicht so gelaufen, wie ich wollte.«
»Nur um Juan ging es. Niemand hatte ein Wort davon gesagt, Barinitas anzugreifen!«
»Du musst etwas für mich tun, Vater.«
»Warum sollte ich?«, fragte Jorge erbost.
»Weil Carlos dafür gesorgt hat, dass Juan nicht in den Krieg ziehen kann.«
»Ach ja?«
»Der Zustand seines Hauses wird ihm die Reiselust für die nächsten Monate nehmen. Carlos fordert als Lohn Andrea. Ich hatte sie ihm bereits zugesagt.«
»Du hast was?«, fragte Jorge ungläubig und starrte Héctor an.
»Vater, wenn du Andrea mit Carlos verheiratest, hast du einen loyalen Schwiegersohn, von dem du nicht befürchten musst, dass er sich gegen uns oder Spanien wendet.«
»Nein, Héctor!«, sagte er entschieden.
»Willst du lieber, dass sich Andrea an diesen Verräter hält?«
»Sie würde das niemals hinnehmen. Du kennst deine Schwester.«
»Und wenn wir Juan dafür in Ruhe lassen? Du musst ihr klar machen, dass wenn sie sich weigert, Juan von seinem Land gejagt wird und die Spanier sich noch mehr mit ihm und Barinitas befassen werden.«
Jorge setzte sich auf den Rand des Bettes und legte die Stirn in Falten.
»Sie wird mich dafür hassen!«
»Irgendwann wird sie es dir danken, Vater.«
»Ich mag diesen Schritt nicht gehen, aber ich denke darüber nach.«
Es klopfte an der Tür und ein indianischer Sklave streckte vorsichtig seinen Kopf durch die Tür.
»Verzeihen Sie die Störung. Besuch für die Herrschaften!«
»Wer ist es?« fragte Jorge.
»Ein Novize aus dem Kloster, Herr. Er sagt, er habe eine wichtige Botschaft.«
»Lass ihn herein.«
Der Novize schwebte beinahe lautlos in den Raum. Er hatte einen aufrechten Gang und eine Ruhe verströmende Ausstrahlung. Trotzdem wirkte sein Gesicht verspannt, als er seine Nachricht überbrachte.
Der Geistliche kehrte nicht alleine in sein Kloster zurück. Jorge war an seiner Seite, mit einer Nachricht für seine Tochter, die er ihr nur ungern überbringen wollte. Nach dem frühen Tod seiner Frau und der Mutter seiner Kinder war Jorge so ziemlich alleine für die Erziehung der Kinder zuständig. Die Lehrer, die er zum Unterricht ins Haus holte, lehrten sie der Sprache, Geschichte, Musik und Mathematik, nicht aber der Dinge, die im Leben ebenso wichtig waren. Das war seine Aufgabe als Vater. Während er mit Héctor zum Jagen ging und ihn im Kampf mit dem Schwert und Feuerwaffen lehrte, brachte er Andrea die Kunst der großen Maler und Dichter nahe. Sie entwickelte früh ein eigenständiges Denken, das sich in ihren Handlungen wiederspiegelte. Sie verschlang Bücher, so wie sich Héctor über Gebratenes hermachte, und entwickelte einen tiefen Sinn für das Schöne. Die Nähe zu ihrem Vater beruhte auf ein tiefes Vertrauen. Sie spürte, wenn mit ihm etwas nicht stimmte und ließ nicht locker, bis sie erfuhr was ihn bewegte. Andrea half ihrem Vater oftmals weise Entscheidungen zu treffen und so konnte er ihr nur selten etwas abschlagen. Mit der Nachricht aber, die er ihr überbringen musste, setzte er das Vertrauensverhältnis zu seiner Tochter aufs Spiel. Jorge wusste, dass sie ihn dafür hassen würde. Aber diesmal hatte Héctor einfach Recht. Es gab keine vernünftige Alternative. Die Spanier waren die Hauptabnehmer seines Zuckerrohres und der Rinder. Ohne die Loyalität gegenüber dem Königshaus würde alles zusammenbrechen, was er im Laufe von Jahrzehnten aufgebaut hatte. Er konnte nicht einfach einem Pächter gestatten sich mit dem halben Dorf auf die Seite Bolívars zu schlagen.
Die Sonne war untergegangen, als Juan nur einen Tag nach Jorge an die Pforte des Klosters klopfte. Es dauerte eine Weile, bis ein Mönch die Klappe im Tor öffnete und ihn misstrauisch ansah.
»Was wollt Ihr, Fremder?«
»Meine Verlobte liegt in Eurem Hospital und ich will sie besuchen.«
»Da müsst Ihr morgen wiederkommen. Jetzt lassen wir niemanden mehr ein.«
»Habt Mitleid. Ich habe einen langen Weg hinter mir und bin müde. Mein Pferd braucht Hafer und ich etwas zu essen.«
»Könnt Ihr dafür zahlen?«, fragte ihn der Mönch mit verschlagenem Blick. »Zeigt mir erst Euer Geld!«, verlangte er.
Juan griff in seinen Lederbeutel und hielt ihm ein paar Münzen unter die Nase.
»Bringt Euer Pferd in den Stall. Ich hole inzwischen Brot und Wein«, sagte er und hielt ihm fordernd die Hand entgegen.
Juan gab ihm zwei Pesos und schritt zu dem Stall. Nachdem er sein Pferd versorgt und etwas gegessen hatte, wurde er ins Hospital geführt. Ihm wurde übel, als er den großen Raum betrat. Stickige, faulige Luft schlug ihm entgegen. Es roch nach Blut, Fäkalien und Erbrochenem. Der Mönch bedeutete, ihm zu folgen und schritt in eine hintere Ecke zu einer Türe und ließ ihn in den kleineren Raum eintreten. Hier und da waren ein paar Lampen an den Wänden. Bei der diffusen Beleuchtung brauchte Juan ein paar Minuten, um etwas erkennen zu können. Der Mönch blieb vor dem Bett stehen, in dem Andrea lag. Sie drehte langsam ihren Kopf, als sie merkte, dass jemand an ihrem Bett stand und öffnete ihre Augen, als sie ihn sah.
»Du bist hier!«, sagte sie erstaunt mit einem Lächeln.
Juan beugte sich zu ihr herunter und umarmte sie. Doch der Mönch räusperte sich verlegen.
»Was steht Ihr hier noch herum? Habt Ihr nichts zu tun?«, herrschte er den Mann in seiner Kutte an.
»Soweit ich weiß, seid Ihr nicht verheiratet und solche, äh, wie soll ich es sagen? Vertraulichkeiten, kann ich nicht dulden, mein Herr!«
»Redet keinen Unsinn. Wir sind längst verlobt und jetzt schert Euch zum Teufel. Und überhaupt. Was ist das hier für ein bestialischer Gestank? Wollt Ihr, dass die Kranken an dem Gestank zugrunde gehen und so die Betten schneller frei werden? Lüftet gefälligst die Räume!«
»Das Öffnen der Fenster ist strengstens untersagt.«
»So ein Unfug!«
Andrea zerrte an Juans Ärmel und wollte etwas sagen, doch er schüttelte nur den Kopf und wandte sich wieder an den Geistlichen.
»Ihr habt sicher einen Garten, wo meine Verlobte frische Luft bekommt und danach möchte ich mit dem Prior sprechen.«
»Ihr könnt Eure Verlobte gerne für ein paar Minuten in den Garten bringen, wenn Ihr versichert, dass Ihr Anstand bewahrt und sie anschließend zurück bringt. Aber den Prior könnt Ihr nicht sprechen.«
»Ich fürchte, dass ich mich nicht abweisen lassen werde!«
»Er ist nicht im Kloster.«
»Wer ist sein Stellvertreter?«
»Das bin ich«, erwiderter der Mönch.
»Dann sage ich Euch jetzt, dass ich meine Verlobte sofort aus dem Kloster holen und dem Bischof schreiben werde, wenn Ihr nicht sofort alle Fenster öffnet. Einen solchen Gestank vermutet man in einem Schweinestall und nicht in einem Kloster!«
Juan schob den Mönch beiseite und beugte sich wieder über das Bett. Vorsichtig legte er seine Arme unter ihren Körper und hob sie behutsam hoch. Andrea stöhnte kurz, doch sie lächelte, als sie in seine Augen sah und seine Nähe spürte. Juan beachtete den Mönch nicht weiter und trug sie durch die Räume und Gänge hinaus in den Klostergarten. Hier war es ruhig und die sternenklare Nacht in den Bergen sorgte für frische und saubere Luft. Andrea atmete tief durch, so als hätte sie seit Tagen die Luft angehalten.
»Juan!«, hauchte sie und schlang ihre Arme um ihn.
Er beugte sich zu ihr und küsste sie zärtlich.
»Du kannst mich herunterlassen. Es tut mir sicher gut, ein paar Schritte alleine zu gehen«, sagte sie und schmiegte sich an ihn.
»Den Mönch werde ich mir noch vorknöpfen!«, sagte er grimmig.
»Es hat mir gefallen, wie du dich durchsetzen konntest, Juan.«
Ihre Augen funkeln wie die Sterne am Himmel, dachte Juan und küsste sie. Dabei streichelte er sanft ihren Rücken und umfasste schließlich ihr wohlgeformtes Hinterteil und Andrea drückte sich enger an ihn.
»Komm!«, sagte er und führte sie langsam zu dem Pferdestall. Andreas Schmerzen waren fast verschwunden. Sie wollte ihn nur noch spüren und seine Wärme genießen. Durch ein hochgelegenes Fenster drang sanftes Licht in den Stall. Er führte sie geradewegs zu dem Strohlager, welches unsichtbar hinter den eigentlichen Stallungen lag und legte sie vorsichtig dort ab. Sie zog ihn zu sich heran und öffnete mit einer Hand die Schnüre seiner Beinkleider.
»Komm Liebster«, flüsterte sie und zog ihn zu sich herab.
Andrea zuckte unter seinem muskulösen Körper. Sie hatte es sich so sehr gewünscht, mit ihm Liebe zu machen, bevor er in diesen schrecklichen Krieg zog. Und es war ihr egal, dass sie nun nicht mehr als Jungfrau in die ihr aufgezwungene Ehe gehen würde, denn sie liebte Juan über alles, auch wenn sie ihn verloren hatte. Sie liebten sich, bis sie durch ein Geräusch gestört wurden. Der Mönch trug eine Lampe und rief nach ihnen. Juan war im Liebestaumel gar nicht bewusst, wie die Zeit vergangen war, seit er sie aus ihrem Bett getragen hatte und zog Andrea noch gerade rechtzeitig hinter einen Bretterverschlag, wo sie nicht gesehen werden konnten. Er hörte Schritte in der Nähe und die Laterne des Mönchs warf einen Lichtschein auf das Stroh neben ihnen. Doch sehen konnte er sie nicht. Andrea lächelte amüsiert und er grinste, als sie merkten dass er den Stall verließ.
»Ich muss dich in dein Bett zurückbringen, bevor der Mann das halbe Kloster alarmiert, um nach uns zu suchen«, sagte er.
»Am liebsten würde ich die ganze Nacht mit dir im Stroh verbringen.«
»Selbst wenn dies hier nicht ein Kloster voller Mönche wäre, ist es unmöglich. Ich muss morgen zurück nach Barinitas.«
Ihre Augen lächelten nur kurz, und Juan bemerkte, dass sie eine gewisse Traurigkeit zu überspielen versuchte.
»Pater Valega hatte mir berichtet, was geschehen ist. Du hast dich tapfer geschlagen, Liebste«, sagte er, um sie aufzumuntern.
»Wäre er nicht gekommen, wäre es mein Tod gewesen.«
Nachdem sie ihre Kleidung überprüft hatten, trug sie Juan aus dem Stall und lugte um die Ecken, um sicherzugehen, dass sie nicht bemerkt wurden. Der Garten des Klosters war jedoch menschenleer und so brachte er sie zurück in ihr Bett. Er küsste sie noch einmal, setzte sich an ihren Bettrand und hielt ihre Hand. Doch sie zog sie zurück.
»Was ist?«, fragte er irritiert.
»Juan, ich habe lange über uns nachgedacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es unter den Umständen besser ist, wenn wir uns nicht mehr sehen«, sagte sie, ohne ihm in die Augen zu blicken.
»Ich verstehe nicht«, war alles, was seine Lippen hervorbringen konnten.
»Du wirst in einen sinnlosen Krieg ziehen, und ich will nicht zu den Frauen gehören die erfahren, dass der Mann den sie lieben, gefallen ist. Juan, du hast dich dazu entschlossen. Das akzeptiere ich. Aber ich kann nicht mit der Angst leben, dich nie wieder zu sehen«, sagte sie.
»Ich glaube nicht, was ich da von dir höre. Anscheinend hast du mich nie geliebt. Sonst könntest du so etwas nicht sagen.«
»Ich habe dich immer geliebt, Juan.«
»Ich liebe dich und ich werde zurückkommen. Das verspreche ich dir!«
»Es geht nicht nur darum, Juan.«
»Um was denn sonst?«
»Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll«, begann sie und überlegte kurz. »Héctor und …«, weiter kam sie nicht, denn Juan fuhr ihr ins Wort.
»Héctor! Ich komme gerade aus Barinitas, Andrea. Der Ort wurde abermals überfallen. Dein Bruder war der Anführer. Er hatte keine Skrupel, die Kirche anzugreifen. Ein Kind wurde getötet und er hat die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Das halbe Dorf liegt in Schutt und Asche. Mein Haus ist zertrümmert und nicht mehr bewohnbar. Und in Angst um dich reite ich hierher, um von dir zu erfahren, dass du unsere Beziehung als erledigt betrachtest?«
»Sie haben Barinitas angegriffen?«
»Das haben sie. Meine Meinung über die Royalisten wurde einmal mehr bestätigt. Valega sei Dank, dass sie keine Gelegenheit hatten, sich auch noch an den Frauen zu vergreifen.«
»Héctor sagt, das seien nur Gerüchte«, antwortete Andrea.
»Héctor!« Juan stöhnte empört. »Er erzählt dir bestimmt nie etwas über die Frauen und Kinder. Wenn der letzte Mann gefallen ist, nehmen sich die Spanier die Kinder und Frauen der Besiegten vor.«
»Lebt mein Bruder?«
»Héctor lebt«, beruhigte er sie.
»Ist er verletzt?«
»Der Mistkerl wird es überleben. Hast du gewusst, dass er mich damit erpressen wollte, dich nie wieder sehen zu dürfen? Nimm ihn nicht in Schutz, Andrea! Das hat er nicht verdient«, brauste Juan auf. »Er verdankt nur mir, dass er noch am Leben ist. Ginge es nach den anderen, hinge er jetzt am Galgen.«
Andrea schossen Tränen in die Augen. Sie tat es doch nur, um ihn vor Héctor und ihrem Vater zu schützen. »Juan, du kannst es nicht verstehen. Mache es mir doch nicht so schwer. Bitte!«, flehte sie und umarmte und küsste ihn.
»Hat es dein Bruder geschafft, uns zu trennen Andrea?«
»Ich will es doch gar nicht Liebster. Aber es ist besser.«
Juan sah sie zornig an. Sie hatten sich gerade noch geliebt und nun wies sie ihn ab! Er konnte es nicht glauben. »Gut, ich gehe!«, antwortete er und löste sich aus ihrer Umarmung. Juan drehte sich auch nicht mehr um und so konnte Andrea nicht die Tränen in seinen Augen sehen, als er den Raum verließ.
9
ENDINGEN AM KAISERSTUHL
»Das Frühstück ist angerichtet mein Herr«, sagte Kathi freundlich, der eine blonde Haarsträhne unter der weißen Haube in die Stirn fiel. Sie war heimlich in den jungen Bauern mit dem Schnurrbart verliebt, auch wenn es allgemein bekannt war, dass Richard der 17jährigen Sabina den Hof machte.
»Dann setzt euch«, sagte der Bauer. »Katharina, wie weit bist du mit dem Spinnen?«
»Die Wolle geht zur Neige, aber ich will mit dem Spinnen heute fertig werden«, antwortete sie.
Richard lächelte die junge Magd an. »Sobald du das Geflügel und die Schweine versorgt hast, kannst du damit weitermachen.«
Der Jungbauer sah zu den beiden Knechten, die grimmig an dem Tisch saßen. »Alois du hilfst heute wieder Hartmut dabei, die brachliegenden Felder einzuebnen«.
»Bauer, es hat diese Nacht wieder gefroren und der Boden ist hart«, entgegnete Alois, der zum Ärger von Kathi mit seinen lehmverkrusteten Schuhen den Boden verschmutzt hatte.
»Du benimmst dich wie eine weibische alte Jungfrau! Nehmt die Hacken und macht was ich euch gesagt habe. Es sind noch vier von den Froschfressern zerstörte Felder, die bis zur nächsten Aussaat vorbereitet sein müssen!«
Die Knechte blickten sich an. Schließlich ergriff Hartmut das Wort.
»Wir werden tun was Sie sagen, mein Herr. Aber ich möchte feststellen, dass wir seit drei Monaten keinen Lohn bekommen haben.«
Richard schlug mit der Faust so fest auf den Tisch, dass das Geschirr klapperte und Kathi ängstlich zusammenzuckte.