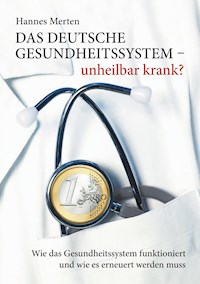
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das deutsche Gesundheitssystem ist krank: Die Kosten steigen und steigen. Zwei parallele Versicherungssysteme (PKV und GKV) bewirken Fehlsteuerungen und Zweiklassenmedizin. Die Abhängigkeit der GKV-Beiträge vom Lohn/Renteneinkommen führt zu absurden Umverteilungen. Die Lasten eines Systems mit immer mehr Rentnern müssen von immer weniger berufstätigen Versicherten getragen werden. Dieses Buch wendet sich an den interessierten Bürger und Beitragszahler: Es beschreibt das derzeitige System, behandelt seine Probleme und entwirft ein neues System: - GKV und PKV werden durch ein integriertes Krankenversicherungssystem ersetzt. - Eine einheitliche Bürgerpauschale beseitigt die willkürliche Umverteilung, die Solidarität wird auf die wirklich Bedürftigen konzentriert. Die Krankenversicherung wird für den demographischen Wandel fit gemacht. Das neue Gesundheitssystem setzt zwei Reformgedanken um, die sich heute in der Politik unvereinbar gegenüberstehen: Es folgt der Forderung von SPD und Grünen nach Abschaffung der PKV und führt die von vielen Konservativen propagierte Bürgerpauschale ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Zu diesem Buch
1 Fakten zum deutschen Gesundheitssystem – wie es funktioniert
1.1 Die Versicherungsseite
1.1.1 Gesetzliche Krankenversicherung GKV
1.1.2 Private Krankenversicherung PKV
1.1.3 Zusatzversicherungen der PKV für GKV-Versicherte
1.2 Die Ausgabenseite
1.2.1 Ambulante ärztliche Versorgung
1.2.2 Krankenhäuser
1.2.3 Apotheken und Pharmaindustrie
1.3 Die demographische Entwicklung
1.4 Der medizinische Fortschritt
1.5 Weitere Beteiligte am Gesundheitssystem
1.5.1 Die Pflegeversicherung
1.5.2 Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften)
1.5.3 Die Rentenversicherung
1.5.4 Die Rolle des Staates
2 Die Konstruktionsmängel des deutschen Gesundheitssystems
2.1 Grundlagen: Warum Versicherungen?
2.2 Solidaritätschaos
2.2.1 Gesund für krank – keine Abhängigkeit der Beiträge vom Krankheitsrisiko
2.2.2 Reich für arm – Abhängigkeit der Beiträge von der Gehalts- und Rentenhöhe
2.2.3 Vollzeit für Teilzeit – Teilzeit arbeiten und voll versichert sein
2.2.4 Jung für Alt – die Rentner zahlen geringere Krankenkassenbeiträge
2.2.5 Alle zahlen für die Kinder
2.2.6 Alle zahlen für die nicht berufstätigen Ehefrauen
2.2.7 Arbeitgeber für Arbeitnehmer
2.2.8 Die privat Versicherten können sich aus der Solidarität heraushalten
2.2.9 Über Barmherzigkeit, Solidarität und Gerechtigkeit
2.3 Marktversagen
2.4 PKV-ein Auslaufmodell!
2.5 Korporatismus – das Zunftwesen im Gesundheitsmarkt
2.6 Die Ausgaben steigen weiter!
3 Ein neues Gesundheitssystem
3.1 Leitsätze und Handlungsparameter für die Reform
3.2 Blick ins Ausland
3.2.1 Schweiz
3.2.2 Niederlande
3.2.3 Staatliche Gesundheitssysteme England und Schweden
3.2.4 USA
3.3 Was wollen die deutschen Parteien?
3.4 Das neue System
3.4.1 Vereinigung GKV und PKV
3.4.2 Die Bürgerpauschale
3.4.3 Neuordnung der Solidarität
3.4.4 Einstieg in die Kapitaldeckung statt Umlageverfahren
3.5 Die neue integrierte Krankenversicherung
3.5.1 Der Leistungskatalog
3.5.2 Zusatzversicherungen
3.5.3 Die Zukunft der PKV
3.6 Neuordnung der Leistungserbringung: Der Bürger ist Kunde
3.6.1 "Eine" Gebührenordnung – die Mutter der ausgabenseitigen Reformen
3.6.2 Aufbrechen der Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung...
3.6.3 Honorierungsformen
3.6.4 Ambulante Versorgung
3.6.5 Stationäre Versorgung
3.6.6 Gretchenfrage Budgetierung
3.6.7 Pharma
3.6.8 Qualität
3.7 Weitere Bausteine des neuen Systems
3.7.1 "Reform" der Versicherten und Patienten
3.7.2 Information, der Lotse im Gesundheitswesen
3.7.3 Ein neuer Geist – die Krankenversicherung als Sachwalter der Versicherten
3.8 Weitere Reformen
3.8.1 Unfallversicherung/Berufsgenossenschaften
3.8.2 Rehabilitationsmaßnahmen der Rentenversicherung
3.8.3 Pflegeversicherung
4
Zusammenfassung: das neue Modell
Anhang: Wichtige Gesetze im Gesundheitsbereich seit 2004
Index
Literaturverzeichnis
Zu diesem Buch
Das deutsche Gesundheitssystem erfüllt unter medizinischen Aspekten im Großen und Ganzen seinen Zweck. Es heilt Kranke und lindert Leiden – und das auf einem hohen Niveau ärztlicher Kunst. Es gilt als eines der besten der Welt. Doch der Friede ist trügerisch, denn unter wirtschaftlichen Aspekten gesehen ist unser Gesundheitssystem krank. Es erfüllt seine Aufgaben nur zu unvertretbar hohen Kosten und diese werden ungerecht auf die Bevölkerungsgruppen verteilt. Seit 1977 versuchen die Politik und die Institutionen im Gesundheitswesen, das System zu reformieren. Aber die Situation verschlechtert sich stetig, statt sich zu verbessern. Der Grund hierfür liegt in den Konstruktionsmängeln des Systems. Die Fundamente, auf denen es ruht, sind von vornherein unzureichend ausgelegt. Das Gesundheitssystem hat von seinem Konzept her vier entscheidende Mängel:
1. Deutschland hat zwei parallele Gesundheitssysteme und zwar die gesetzliche Krankenversicherung GKV und die private Krankenversicherung PKV. Dies führt in der Praxis jedoch nicht zu einer Bereicherung in Form einer willkommenen Wahlmöglichkeit oder eines gesunden Wettbewerbs der Systeme. Vielmehr werden Zweigleisigkeit, Komplexität, Ungerechtigkeit und hohe Kosten verursacht, ja sogar das Wort Chaos ist angebracht.
2. Bei den Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung herrscht meist völlige Unwissenheit hinsichtlich der Funktionsweise und der wirtschaftlichen Zusammenhänge des Systems. Über das sogenannte Sachleistungsprinzip werden dem Patienten ganz bewusst die Kosten seiner Behandlung verschwiegen, da der "Kranke" damit nicht belastet werden soll. Zugleich wird ihm so suggeriert, Gesundheitsleistungen seien kein ökonomisches Gut und somit nicht knapp. Dies führt dazu, dass die Versicherten ohne jede Rücksicht auf Kosten und Wirtschaftlichkeit handeln. Die Mitglieder kennen lediglich ihren monatlichen Krankenversicherungsbeitrag – aber dazu müssen sie schon genau auf ihren Gehaltszettel schauen. Dass nahezu 50 % des Gesamtbeitrags vom Arbeitgeber bezahlt werden, wissen die wenigsten.
3. Das deutsche Gesundheitssystem soll der Solidarität innerhalb der Gesellschaft dienen. Deshalb ist die Höhe der Beiträge in der GKV vom Einkommen abhängig. Dabei wird aber die Solidarität auf Lohn- und Renteneinkommen beschränkt. Vor allem aber können sich Teile der Gesellschaft – Bürger mit hohem Einkommen und alle Beamten – durch Mitgliedschaft in einer privaten Krankenversicherung der Solidarität entziehen.
Hinzu kommt ganz entscheidend, dass die einkommensbezogenen Beiträge zu willkürlichen Umverteilungen führen: Abhängig vom Familienstand, von der Berufstätigkeit bei Ehepaaren (Alleinverdiener-/Beide Partner arbeiten), von der Art der Einkommen, vom Alter (Erwerbstätige/Rentner) und von der Beitrags bemessungsgrenze, zahlen
→ Bürger mit gleichem Einkommen unterschiedliche Beiträge
→ Bürger mit unterschiedlichem Einkommen den selben Beitrag
Eine gerechte Solidarität wird so systematisch verfehlt.
4. Das deutsche Gesundheitswesen wird durch einen unnötig umfangreichen Wust von Gesetzen und Bürokratie bestimmt. Eine riesige Sozialgesetzgebung regelt das Meiste bis ins letzte Detail statt nur Rahmenbedingungen und einzuhaltende Normen festzulegen. Den verbleibenden Handlungsspielraum beherrscht eine Art mittelalterliches Zunftwesen oder modern ausgedrückt ein Korporatismus in Form von Ärztekammern, Apothekerkammern, Kassenärztlichen Vereinigungen, öffentlich-rechtlichen Krankenversicherungen und Krankenhäusern. Nur die Pharmaindustrie, die PKV und eine zunehmende Zahl von Krankenhäusern sind privat organisiert. Keine der genannten Institutionen hat regelmäßig die Qualität des Gesundheitssystems im Auge, sondern vor allem die jeweils eigenen Interessen. Die Bürger, um deren Gesundheit es geht, also die wichtigste Gruppe, sind praktisch nicht wirksam organisiert und vertreten. Die Politik wiederum unterliegt der Illusion, eventuelle Probleme mit noch mehr Regelungen lösen zu können – möglichst ohne jemandem wehzutun. Dabei ist die Vielzahl der Regelungen selbst das eigentliche Problem.
Die geschilderten Mängel konnten früher im Zeichen großer Einkommenszuwächse und relativ geringer Gesundheitskosten hingenommen werden. Es war so viel Geld da, dass auch noch das ineffizienteste System finanziert werden konnte. Auch für allerlei Luxus wie z. B. das deutsche Kurwesen war genug Geld vorhanden. Drei Entwicklungen fordern aber nun das System bis aufs Äußerste und legen seine Mängel schonungslos offen:
Im Jahre 2010 betrug die Lebenserwartung von neugeborenen Jungen 77,2 Jahre. Im Vergleich zu 1960 bedeutet dies einen Anstieg um 10 Jahre. Bei Mädchen erhöhte sich die Lebenserwartung um 12 Jahre auf 82,4 Jahre. Diese 10-12 Jahre mehr bedeuten 10-12 Jahre länger Krankheitsrisiken und entsprechende Kosten. Die Fachleute erwarten einhellig, dass sich der Anstieg der Lebenserwartung fortsetzt.
Der Anteil der Alten an der Gesamtbevölkerung wächst bedingt durch höhere Lebenserwartung und geringere Geburtenrate. Das sollte an sich kein Problem darstellen, wenn alle einheitliche Versicherungsbeiträge bezahlen würden. Tatsächlich aber zahlen in der GKV die Jungen zu hohe und die Alten zu niedrige Beiträge. Letztere just ab Rentenbeginn, also dem Zeitpunkt, ab dem die Krankheitskosten in der Regel steigen. Immer mehr – alte – Versicherte zahlen wenig und leben länger, während immer weniger – junge – Versicherte einen wesentlichen Teil dieser Last tragen sollen.
Der medizinische Fortschritt, so begrüßenswert er ist, erhöht die Kosten der des Systems.
Die genannten Probleme betreffen nicht irgendein Thema, das wegen Bedeutungslosigkeit vernachlässigt werden könnte: Im Jahre 2012 betrugen die Ausgaben in Deutschland für Gesundheit und Pflege 300 Mrd. €, also 11,3 % des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 2650 Mrd. €. Knapp 4,9 Millionen Menschen arbeiten einschließlich der Vorleistungsindustrien wie Pharma und Medizintechnik im Gesundheitswesen. Über 30 Jahre Gesundheitsreform (erstmalig 1977 mit dem "Kostendämpfungsgesetz") haben die Probleme nicht lösen können, weil am System “rumgedoktert“ wurde statt sich mit der Behebung der Konstruktionsmängel des Systems zu befassen. Reformen helfen hier nicht mehr, eine Revolution muss her – Deutschland braucht ein neues Gesundheitssystem:
- Eine einheitliche Bürgerpauschale statt einkommensabhängiger Krankenkassenbeiträge.
- Zusammenlegung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung als einheitliche Pflichtversicherung, die durch freiwillige Zusatzversicherungen ergänzt werden kann.
- Einbeziehung der gesamten Gesellschaft in die Solidarität und Neuordnung der Solidarität zugunsten der wirklich Bedürftigen.
- Schaffung von Kostenbewusstsein bei den Patienten durch Transparenz der Krankheitskosten.
- Entbürokratisierung und – soweit möglich – freie Entfaltung der Marktkräfte, aber gebändigt durch strikte gesetzliche Spielregeln.
Dieses Buch soll ein mögliches neues Gesundheitssystem – gut, aber bezahlbar – entwerfen.
In einem ersten Teil wird das gegenwärtige System erläutert und über Zahlen und Fakten für den interessierten Bürger transparent gemacht.
Der zweite Teil untersucht die Mängel des gegenwärtigen Systems (Diagnose) als Grundlage für notwendige Änderungen (Therapie).
Im dritten Teil wird ein neues Gesundheitssystem beschrieben und der Weg dorthin skizziert. Wesentlich bestimmt wird dieses Kapitel durch die Motivation, nicht etwa eine Utopie zu entwerfen, sondern ein real mögliches neues System zu konzipieren – basierend auf zahlreichen bereits vorhandenen Vorschlägen.
1Fakten zum deutschen Gesundheitssystem – wie es funktioniert
Vorbemerkung: Dieses Kapitel soll dem interessierten Laien eine Übersicht zu den Fakten des deutschen Gesundheitssystems geben. Der hieran weniger interessierte Leser kann gleich zu Kapitel 2 springen, dort werden die Probleme des Systems besprochen.
Zur Einstimmung gibt Abb. 1 die wichtigsten Zahlen des Jahres 2012 wieder. Links die Einnahmenseite, also die Finanzierung des Gesundheitssystems. Rechts die Ausgabenseite, 300 Mrd. € kostete das System im Jahre 2012. Diese Zahl entspricht ziemlich exakt dem Bundeshaushalt 2014 in Höhe von 296,5 Mrd. €. Zu diesen Ausgaben für Gesundheit kommen noch 52 Mrd. € Einkommensleistungen hinzu, also die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und das Krankengeld.
Abb. 1: Finanzierung und Ausgaben des deutschen Gesundheitssystems
Quelle : Statistisches Bundesamt
Die wichtigsten Positionen auf der Finanzierungsseite stellen die Krankenversicherungen dar, die im Folgenden behandelt werden. Anschließend wird ausführlich auf die Ausgabenseite, also die Leistungserbringung, eingegangen.
1.1 Die Versicherungsseite
Deutschland ist in Sachen Krankenversicherung zweigeteilt. Ende 2012 waren 69,7 Mio. Bürger in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert, 9,0 Mio. hingegen waren Versicherte einer privaten Krankenversicherung (PKV). Die Beitragseinnahmen der GKV betrugen 172 Mrd. € im Jahre 2012, hinzu kommen 14 Mrd. € Bundeszuschuss. Die PKV erzielte im selben Jahr im Bereich Vollversicherung Einnahmen in Höhe von 25,8 Mrd. €.
In Deutschland besteht seit Anfang 2009 Versicherungspflicht. Dieser Pflicht kann sich nur ein immer kleinerer Teil der Bevölkerung entziehen, somit sind nahezu alle 81,7 Mio. Bürger in einem der beiden Krankenversicherungssysteme versichert.
1.1.1 Gesetzliche Krankenversicherung GKV
Die 69,7 Millionen Mitglieder der GKV teilen sich in 3 Gruppen auf: Erstens abhängig Beschäftigte bis zur Versicherungspflichtgrenze in Höhe von 4.575 € monatlich (Pflichtversicherte), zweitens können sich Bezieher höherer Monatsverdienste) und Selbstständige statt in der PKV freiwillig in der GKV versichern. Hinzu kommen als dritte Gruppe die Rentner, soweit sie vor Bezug der Rente GKV-Mitglieder waren. Bei allen 3 Gruppen sind nicht berufstätige Ehegatten und Kinder jeweils kostenlos mitversichert. Man unterscheidet daher in Mitglieder, das sind die Beitragszahler, und in Familienangehörige. Beide Gruppen zusammen bilden die Versicherten.
Abb. 2: Versichertenstruktur der GKV in Mio.
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit: Mitgliederstatistik KM1
Im Jahre 2013 gab es 134 gesetzliche Krankenkassen. Ihre Zahl ist seit der Zulassung des Wettbewerbs zwischen den Kassen im Jahre 1994 stark geschrumpft, damals waren es noch 1.152 Kassen.1
Seit 2011 betragen die Beitragssätze der GKV einheitlich 15,5 Prozent. Die Beiträge sind prozentual abhängig vom monatlichen Gehalt/Lohn der abhängig Beschäftigten, deshalb spricht man von "einkommensabhängigen Beiträgen".2 Dieser Begriff wird eine wichtige Rolle in diesem Buch spielen. Ab 1.1.2015 wurde der einheitliche Beitragssatz auf 14,6 % gesenkt, hinzu kommt aber ein Zusatzbeitrag. Dieser wird von jeder Kasse individuell festgelegt, beträgt jedoch ganz überwiegend 0,9 %. In der Summe bleibt es somit bei den meisten Kassen bei 15,5 Prozent. Die Beitragsberechnung erfolgt nur bis zur “Beitragsbemessungsgrenze“, die seit 1.1.2015 bei 4.125 € liegt. Der Beitrag beträgt bei 15,5 Prozent also maximal 639,38 € monatlich. Am unteren Ende beginnt die Beitragspflicht ab einem Verdienst von 450,01 €, das ergibt einen Beitrag von monatlich 69,75 €. Die Spreizung der Beiträge ist also enorm hoch.
Der Leser mag angesichts der Höhe der Beiträge erschrecken, aber gemach! Die Arbeitgeber bezahlen einheitlich 7,3 Prozent3, die meisten Mitglieder selbst also "nur" 8,2 %.4 Bis zum Jahre 2005 zahlten Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils genau die Hälfte der 15,5 Prozent, seither leisten die Arbeitnehmer 0,9 % mehr. Damit wird das "Krankengeld", also die Lohnfortzahlung durch die Krankenkasse nach 6 Wochen Krankheit5, nun ausschließlich durch die Arbeitnehmer finanziert. Diese Änderung wurde zur Senkung der Lohnnebenkosten eingeführt. Dabei wurde zugleich der Arbeitgeberbeitrag eingefroren, zukünftige Erhöhungen sind also allein von den Mitgliedern über die Zusatzbeiträge zu tragen. Diese Gesetzeslage kann allerdings jederzeit wieder geändert werden.
Bis Ende 2014 wurden die Zusatzbeiträge als Absolutbeträge erhoben und mussten direkt von den Mitgliedern an die Krankenkasse bezahlt werden, wurden also nicht vom Arbeitgeber vom Lohn einbehalten. Sie wurden deshalb sehr stark von den Versicherten wahrgenommen, was häufig je nach Höhe des Zusatzbeitrages zu einem Wechsel der Krankenkasse führte. Dies wiederum zwang die Krankenkassen zu Sparsamkeit. Diese beitragsdämpfenden Wirkungen wurden auf Betreiben der SPD durch die Neuregelung der Zusatzbeiträge ab 2015 beseitigt (Vgl. hierzu die Ausführungen auf S.133).
Es gibt etliche von den 15,5 Prozent abweichende Sondertarife, etwa für Studierende und Auszubildende. Eine Besonderheit stellen auch die 2,5 Mio. Arbeitslosengeld II Empfänger (Hartz IV) dar. Sie sind pflichtversichert, aber persönlich beitragsfrei gestellt. Dafür erhält der Gesundheitsfonds von den Jobcentern etwa 140 € per Monat je ALG II Empfänger. Bei Minijobs (450 Euro Jobs) führt der Arbeitgeber 13 % des Lohns pauschal an die Krankenkassen ab, der Arbeitnehmer ist abgabenfrei. Das machte im Jahre 2012 in der Summe aller 7,4 Mio. Minijobs 2,768 Mrd. € aus. Der Beschäftigte erhält hieraus aber keinen Anspruch auf Krankenversicherung, die Krankenkassen vereinnahmen also dieses Geld ohne direkte Gegenleistung. Allerdings sind so gut wie alle Minijobber anderweitig versichert, entweder als Angehörige oder in einem ersten versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis.
Bis 2009 wurden die Beiträge direkt an die Krankenkassen bezahlt. Seit 2009 werden sie an den neu geschaffenen Gesundheitsfonds abgeführt, der die Gelder wiederum an die Krankenkassen verteilt. Diese erhalten vom Gesundheitsfonds eine einheitliche Grundpauschale pro Versichertem plus alters-, geschlechts- und risikoadjustierte Zu- und Abschläge zur Deckung ihrer standardisierten Leistungsausgaben. Durch diesen "Risikostrukturausgleich" (RSA)6 wird das unterschiedliche Krankheitsrisiko der Versicherten kalkuliert in Abhängigkeit vor allem vom Alter und Geschlecht, aber auch vom Bildungsstand und der sozialen Situation. Seit 2009 werden dabei auch die tatsächlichen Erkrankungen der Versicherten berücksichtigt (Morbiditätsorientierter RSA, kurz "Morbi-RSA"). Krankenkassen mit älteren und kranken Versicherten erhalten somit mehr Finanzmittel als Krankenkassen mit überwiegend jungen und gesunden Versicherten. Der Risikostrukturausgleich ist eine der kompliziertesten Angelegenheiten der GKV.7
Die GKV basiert auf der Beitragspflicht für Arbeitseinkommen aus abhängiger Beschäftigung. Andere Einkommen wie z. B. Kapitalerträge und Mieteinnahmen sind beitragsfrei. Bei den Rentnern werden dann analog die aus der früheren Berufstätigkeit erworbenen Rentenansprüche zugrunde gelegt. Deshalb sind neben den gesetzlichen Renten auch Firmenrenten beitragspflichtig. Kurz gefasst sprechen wir in diesem Buch von den „Lohn- und Renteneinkommen“ als Basis der Beitragsberechnung.
Bei den Rentnern werden die Arbeitgeberbeiträge von den Rentenanstalten übernommen, diese treten also an die Stelle der Arbeitgeber. Die Beiträge der Rentner sind erheblich niedriger als die der Aktiven, da ja auch die Renten niedriger sind als die Löhne und Gehälter. Dieser Effekt tritt just zu dem Zeitpunkt ein, zu dem die Rentner entsprechend ihrem Alter zunehmend höhere Krankheitskosten verursachen. Dieser Widerspruch wird im Abschnitt 2.2.4 noch zu diskutieren sein (S.63).
Eine besondere Gruppe bilden die knapp 5,2 Millionen freiwillig in der GKV Versicherten: Diese haben in aller Regel ein Einkommen aus abhängiger Beschäftigung über der Versicherungspflichtgrenze (4.575 € monatlich ab 1.1.2015) und können sich daher in der PKV versichern. 2,8 Mio Mitglieder dieser Gruppe ziehen es jedoch vor, sich "freiwillig" in der GKV zu versichern und zahlen dann die Höchstbeiträge. Hinzu kommen 2,4 Mio Selbstständige, die sich unabhängig von der Höhe des Einkommens statt in der PKV in der GKV versichern können. Bei freiwillig Versicherten werden nicht nur die Lohneinkommen, sondern auch alle anderen Einkommensarten (selbständige Arbeit, Kapitalerträge etc.) bei der Beitragsbemessung berücksichtigt. Dies erfolgt aber wie bei allen GKV Mitgliedern nur bis ist nur Beitragsbemessungsgrenze (4.125 €).
Insgesamt erhielt die GKV im Jahre 2012 von allen Mitgliedern 172 Mrd. € an Beiträge. Das waren pro Mitglied im Durchschnitt 3266 € im Jahr oder 272 € pro Monat. Tatsächlich versteckt sich hinter diesem Durchschnitt eine enorme Schwankungsbreite der Beiträge. Immerhin können Sie, verehrter Leser, so feststellen, ob Sie (zusammen mit ihrem Arbeitgeber oder der Rentenanstalt) mehr oder weniger als der Durchschnitt bezahlen.
Als Folge der Abhängigkeit der Beiträge von den Bruttolöhnen und -gehältern sind die Einnahmen der GKV stark konjunkturabhängig. Gute Konjunktur bedeutet: höhere Löhne, weniger Arbeitslose, mehr Beiträge. Eine Faustformel besagt, dass ein Prozent Steigerung der beitragspflichtigen Entgelte 1 Mrd. Mehreinnahmen für die GKV bringt.8 Schlechte Konjunktur bedeutet hingegen: Kurzarbeit, mehr Arbeitslose, weniger Beiträge.9 Aktuell sind bei guter Konjunktur die Überschüsse der Krankenversicherung erheblich (ca. 28 Mrd. € hatten sich per Ende 2012 angesammelt). Als erste Maßnahmen zur Behebung dieses "Problems" wurden bereits die Praxisgebühr abgeschafft und für 2014 der Bundeszuschuss um 3,5 Mrd. auf 10,5 Mrd. gekürzt. Manche Krankenkassen denken über Leistungsausweitungen nach. Auf die Idee, Rückstellungen für schlechtere Zeiten zu bilden, was zugleich konjunkturpolitisch erwünscht wäre, kommt bei den zuständigen Gremien und Politikern aber niemand. Die Hardliner des Umlageverfahrens bestreiten sogar die Zulässigkeit der Bildung von Rücklagen.
Damit sind wir bei der heiligen Kuh der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung angekommen, dem Umlageverfahren. In der GKV werden (wie in der Rentenversicherung) die Ausgaben einer Periode grundsätzlich aus den Einnahmen dieser Periode gedeckt. Man bildet also keine Rücklagen für schlechtere Zeiten oder für das Alter, man lebt "von der Hand in den Mund". Da bei GKV und Rentenversicherung die Einnahmen vor allem von den Jüngeren bestritten werden, die Ausgaben hingegen mehr bei der älteren Generation anfallen, spricht man auch hochtrabend von "Generationenvertrag". Mehr dazu im Abschnitt 1.3 demographische Entwicklung.
Leistungskatalog
Ein zentrales Element der GKV ist der Leistungskatalog. Er legt fest, was die Krankenkasse tatsächlich bezahlt. Der Leistungskatalog ist für alle Kassen der GKV gesetzlich vorgeschrieben und muss daher weitgehend einheitlich sein. Geringfügige Abweichungen können in der Satzung der Krankenkasse festgelegt sein (Satzungsleistungen). Der Leistungskatalog umfasst:
- Leistungen zur Verhütung von Krankheiten
- Leistungen zur Früherkennung von Krankheiten
- Leistungen zur Behandlung einer Krankheit
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Der Leistungskatalog ist sehr umfangreich. Sehr pauschal kann man sagen, dass die Krankenkassen alles bezahlen, was medizinisch erprobt und sinnvoll ist. Der medizinische Fortschritt führt ständig zu Erweiterungen des Leistungskataloges. Ein permanentes Thema sind Akupunktur und Naturheilverfahren. Hier sind im Laufe der Zeit etliche Behandlungsmethoden in den Katalog aufgenommen worden.
Medizinisch fragwürdige Leistungen wie der Augendrucktest und die Messung des PSA-Wertes bleiben hingegen ausgeschlossen. Manchmal wurde der Leistungskatalog auch aus Kostengründen verkleinert:
- Beim Zahnersatz werden nur sogenannte Festzuschüsse bezahlt, die bei weitem nicht zur Deckung der Behandlungskosten ausreichen.
- Brillen werden nur in besonderen Fällen bezahlt, z. B. bei Kindern. Die Zahlung ist dann aber auf die Gläser beschränkt.
- Kuraufenthalte werden nur noch in sehr geringem Umfang bezuschusst.
- Abgeschafft wurden etliche “exotische“ Leistungen wie z.B. die Erstattung von Beerdigungskosten.
Sehr viele Leistungen werden zwar erstattet, aber die Patienten müssen eine Selbstbeteiligung leisten:
- Bei Arzneimitteln ist in den meisten Fällen 10 % des Preises zu bezahlen (Vgl. S.38)
- Bei stationären Behandlungen (Krankenhaus, Vorsorge, Rehabilitation) sind je Tag 10 € zuzuzahlen.
- Bei Hilfs- und Heilmitteln beträgt die Zuzahlung10 % der Kosten.
- Abgeschafft wurde zum 1.1.2012 die Praxisgebühr in Höhe von 10 € je Quartal.
Die von den Patienten zu zahlenden Selbstbeteiligungen machten etwa 5 Mrd. € jährlich aus, die sich durch den Wegfall der Praxisgebühr um 2 Mrd. € verringert haben. Von den verbleibenden 3 Mrd. € betreffen knapp 2 Mrd. die Zuzahlungen bei Arzneimitteln.10
Die prozentualen Beteiligungen müssen in aller Regel mindestens 5 € ausmachen und sind auf 10 € begrenzt. Für die Zuzahlungen gilt eine Überforderungsregel: "Die Summe der Zuzahlungen eines Versicherten einschließlich seiner im gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen soll 2 % der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt nicht übersteigen. Wird diese Belastungsgrenze erreicht, stellt die Krankenkasse eine Bescheinigung aus, durch die der Versicherte von allen weiteren Zuzahlungen befreit ist."11
Für die Erstattungen gemäß Leistungskatalog gilt eine weitere "heilige Kuh" der GKV, das Sachleistungsprinzip. Die Leistungserbringer rechnen direkt mit den Krankenkassen ab. Der Patient bekommt also keine Rechnung und kennt die Kosten der Behandlung nicht.
Das „Bedarfsdeckungsprinzip“ ist ein weiterer Leitsatz der GKV. In §70 SGB V heißt es: “Die Krankenkassen und die Leistungserbringer haben eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versicherten zu gewährleisten.“ Im selben Paragraphen wird aber auch betont, dass die Behandlung wirtschaftlich sein muss und “das Maß des Notwendigen nicht überschreiten darf“. Schließlich ist von einer “humanen Krankenbehandlung“ die Rede – ein typischer Fall für unkonkrete gesetzliche Vorschriften im Gesundheitswesen.
Eine wichtige Einrichtung der gesetzlichen Krankenkassen ist der "Medizinische Dienst der Krankenversicherung" MDK. Diese Institution ist sozusagen der "Sachverständige" der Krankenkassen. Die Mitarbeiter des MDK prüfen z.B. bei den Versicherten stichprobenartig das Vorhandensein von Arbeitsunfähigkeit und die Notwendigkeit einzelner medizinischer Leistungen, insbesondere von Kuren. Bei den Leistungserbringern können sie z. B. die Angemessenheit und Dauer einer Krankenhausbehandlung und die Korrektheit der Abrechnung prüfen. Mit Einführung der Pflegeversicherung wurde die Feststellung der Pflegebedürftigkeit eine der Hauptaufgaben des medizinischen Dienstes.
1.1.2 Private Krankenversicherung PKV
Bismarck war 1883 bei der Gründung der Krankenversicherung für gewerbliche Arbeiter der Meinung, die Angestellten müssten nicht einbezogen werden, denn sie könnten selbst für sich sorgen. Erst 1971 wurde die GKV für alle Angestellten vollständig geöffnet. So sahen sich bestimmte Gruppen der Angestellten und Selbständigen veranlasst, private Entsprechungen zur gesetzlichen Krankenversicherung zu organisieren. Diese wurden zumeist für bestimmte Berufsgruppen gegründet (Vorläufer waren die Versicherungswerke der Zünfte).
So entstanden die privaten Krankenkassen. Heute gibt es ca. 40 private Krankenkassen, etwa je zur Hälfte in den Rechtsformen Aktiengesellschaft (gewinnorientiert) und Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (Überschüsse bleiben im Unternehmen oder werden an die Mitglieder ausgeschüttet).
Gemäß Gesetz können sich abhängig Beschäftigte mit einem Monatsverdienst über der Versicherungspflichtgrenze und Selbständige in der PKV versichern. Hinzu kommen die Beamten, die so gut wie immer Mitglieder in der PKV sind.12 Die Abgrenzung über die hohe Versicherungspflichtgrenze (4.575 €) führte zur heutigen Einschätzung der PKV als “Verein der Bessergestellten". Historisch gesehen war die Versicherungspflichtgrenze aber eher eine Grenze für die "Versicherungsberechtigung"13 in der gesetzlichen Krankenversicherung. Da diese Grenze sehr niedrig war und die gesetzliche Versicherung auf Arbeiter beschränkt war, mussten sich alle Anderen wie oben beschrieben über private Organisationen versichern. Erst durch die systematische Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze und die generelle Erweiterung der GKV wurde die PKV zu einer eher exklusiven Angelegenheit.
Die PKV hat knapp 9 Mio. sogenannte "Vollversicherte". Von diesen sind 4,7 Mio. Selbständige oder abhängig Beschäftigte mit einem Gehalt über der Versicherungspflichtgrenze, 4,2 Mio. sind Beamte (sogenannte Beihilfeberechtigte)14. Die Beitragseinnahmen ohne Zusatzversicherungen betrugen 25,8 Mrd. €, macht 2880 € jährlich je Versicherten bzw. 240 € monatlich. Dieser Durchschnitt ist optisch niedrig, denn die Beamten sind nur mit 30 bis 50 Prozent ihrer Krankheitskosten in der PKV versichert. Den Rest zahlt der Staat als "Beihilfe".
Abb. 3: Versicherte PKV
Quelle: Zahlenbericht PKV 2012
Die Zahlen der Abb. 3 weisen auch die Angehörigen aus. Diese sind in der PKV nicht wie in der GKV kostenlos mitversichert, sondern müssen selbst Beiträge zahlen. Diese sind aber bei Kindern (ca. 1,5 Mio. Kinder unter 18 Jahre in der PKV) entsprechend ihrem geringen Krankheitsrisiko niedrig.
Die Beiträge in der PKV sind nicht einkommensabhängig wie in der GKV, sondern "risikokalkuliert"15. Sie richten sich nach dem persönlichen Krankheitsrisiko des Versicherten, welches vor allem von Geschlecht, Alter, Lebensgewohnheiten und Vorerkrankungen abhängt. Dabei können auch bestimmte Krankheiten, die bei Versicherungsbeginn bereits aufgetreten oder absehbar sind, von der Versicherung ausgeschlossen werden. Die Versicherung kann auch Antragstellern mit besonders hohen Risiken die Aufnahme verweigern. Man spricht hier von einer "Risikoselektion", wer hohe Krankheitsrisiken hat, landet eher in der GKV. Diese Faktoren dürfen aber laut Gesetz nur beim Abschluss der privaten Krankenversicherung oder bei einem Tarifwechsel eine Rolle spielen, nicht mehr danach in Abhängigkeit vom tatsächlichen Krankheitsverlauf.
Weiterhin werden die Tarife durch ihren jeweils unterschiedlichen Leistungsumfang bestimmt. Schließlich beeinflussen Art und Höhe von Selbstbeteiligungen die Beitragshöhe wesentlich. Die folgende Abbildung zeigt Monatstarife für jeweils 30 und 50 jährige Männer und Frauen (2012). Sie zeigen eine enorme Bandbreite und dies bei durchaus vergleichbarem Leistungsumfang. Die Entscheidung für eine Versicherungsgesellschaft und einen bestimmten Tarif ist bei Eintritt in die PKV daher äußerst schwierig.
Abb. 4: Tarife PKV 2012 per Monat
Quelle: Wirtschaftswoche 4/2012
Die Abbildung zeigt den großen Einfluss von Eintrittsalter und Geschlecht auf die Tarife. Ab 2013 werden nur noch sogenannte Unisextarife angeboten, da die EU bei Neuabschlüssen die Unterscheidung der Tarife nach Geschlecht nicht mehr erlaubt. Da die Krankheitskosten sich aber tatsächlich abhängig vom Geschlecht erheblich unterscheiden, war hier eine vollständig neue Mischkalkulation notwendig. Im Ergebnis sind die neuen Unisextarife eher im oberen Bereich gelandet, also im Bereich der bisherigen Frauentarife.16 Hier ein Beispiel für die neuen Unisextarife 2013:
Mittlerer Leistungsschutz ohne Krankentagegeld:
Wie in der GKV trägt der Arbeitgeber knapp die Hälfte der Versicherungsprämie, dabei gelten die Regeln der GKV. Insbesondere können die Zuschüsse im Maximum nicht höher sein als bei der GKV. Die Selbständigen müssen natürlich den ganzen Beitrag selbst bezahlen. Bei den Beamten gibt der Staat keinen Zuschuss zur Versicherungsprämie, sondern er trägt 50 – 70 % der Krankheitskosten über die Beihilfe.17 Für den Rest ist der Beamte dann mit entsprechend niedrigerer Prämie bei der PKV versichert. Hier ein Beispiel:
Mittlerer Leistungsschutz mit Zweibettzimmer ohne Krankentagegeld:
Ein Schutz gegen Verdienstausfall ist für Beamte nicht erforderlich, da der Staat bei Erkrankung das Gehalt zeitlich unbegrenzt weiterbezahlt. Der Staat gibt auch für die Familienangehörigen eine Beihilfe, also für die nicht berufstätige Ehefrau und für Kinder. Abb. 5 zeigt die Höhe der Beihilfe in %.
Abb. 5: Höhe der Beihilfe für Beamte und deren Angehörige
Der Beamte muss die nicht von der Beihilfe abgedeckten Kosten der Familienangehörigen in der PKV selbst versichern, für die Ehefrau also mit etwa 150 €, je Kind etwa 70 € monatlich. Bei zwei und mehr Kindern erhält der Beamte selbst 70 % statt 50 % Beihilfe, also eine Entlastung.
Nun zum größten Unterschied zwischen PKV und GKV. Es gilt nicht das Umlageverfahren, sondern das Kapitaldeckungsverfahren: Es werden Alterungsrückstellungen gebildet, damit die Tarife im Alter nicht so stark wie die Krankheitskosten steigen. Es findet also eine Vorsorge für das Alter statt. Daher wurden z. B. 2012 die Beitragseinnahmen der PKV in Höhe von 25,8 Mrd. € nicht vollständig für Leistungen und Verwaltungskosten verwendet. Etwa 3 Mrd. € wurden zusammen mit den 8 Mrd. € aus Kapitalerträgen in die Alterungsrückstellungen gesteckt, die Ende 2012 166 Mrd. € betrugen.18 Die Ausgaben für Leistungen betrugen gut 18 Mrd. €.19
Ein nüchtern rechnender Kaufmann wird begeistert sein: Es wird Geld für die steigenden Ausgaben der Zukunft zurückgelegt, dieses Geld wiederum vermehrt sich über Kapitalerträge. Dennoch ist es in der PKV zu erheblichen Beitragssteigerungen gekommen. Der Spiegel berichtet, die Beitragssteigerungen in der PKV seien von 1985 bis 2005 doppelt so stark angestiegen wie in der GKV (Spiegel Nr.31 28.7.2008). Die Ausgaben für die ambulante Behandlung stiegen konkret von 2000-2010 um 38,9 Prozent (GKV 28,6 %) 20. Deshalb konnten keine ausreichenden Alterungsrückstellungen gebildet werden (Vgl. S.89).
Die Gründe für den Anstieg der Ausgabensind komplex, vor allem sind zu nennen:
Der medizinische Fortschritt führt zu Kostensteigerungen.
Die Lebenserwartung ist stärker als in den Tarifen kalkuliert angestiegen.
Die PKV hat anders als die GKV keine Möglichkeiten, über Budgetierungen kostendämpfend auf die Leistungserbringer einzuwirken.
Die Tarife für junge Neuversicherte wurden und werden bewusst attraktiv gehalten, also nicht ausreichend mit Altersrückstellungen kalkuliert, um mit der Konkurrenz wettbewerbsfähig zu sein, und zwar innerhalb der PKV und gegenüber der GKV.
Zusätzlich werden Tarife nach etlichen Jahren für Neuzugänge geschlossen, um neue Tarife attraktiv kalkulieren zu können. Die geschlossenen Tarife "vergreisen" dann, bekommen also nicht den "gesunden" Zuwachs jüngerer Versicherter.
Die Beitragssteigerungen sind in der PKV nicht nur hoch, sondern hinzu kommt, dass der Beitrag nicht wie in der GKV mit Rentenbeginn sinkt. Im Gegenteil, er steigt im Alter weiter an. Die Abb. 6 zeigt beispielhaft das Prinzip:
Abb. 6: Schematischer Prämienverlauf PKV und GKV in Abhängigkeit vom Alter
Für in der gesetzlichen Rentenkasse versicherte Rentner kommt erschwerend hinzu, dass der Krankenkassenzuschuss der Rentenanstalt für PKV-Versicherte wesentlich niedriger ist als der bisherige Arbeitgeberanteil vor Rentenbeginn. Zudem sinkt ihr Bruttoeinkommen mit Rentenbeginn gegenüber dem letzten Arbeitseinkommen stark, wenn sie überwiegend von der gesetzlichen Rente leben. Im Ergebnis können sich viele Rentner ihre Beiträge zur PKV nicht mehr leisten. Es wurde daher vom Gesetzgeber ab 1.1.2009 die Möglichkeit geschaffen, innerhalb der PKV in einen sogenannten Basistarif wechseln zu können.21 Dessen Leistungen entsprechen in etwa denen der gesetzlichen Krankenkasse, die Behandlung als Privatpatient entfällt also. Für die Versicherungen besteht Kontrahierungszwang, ein Risikozuschlag ist nicht zulässig. Der Basistarif darf maximal dem Höchstbetrag der GKV entsprechen. Er ist häufig etwas günstiger als dieser, da ein Teil der Alterungsrückstellungen des Versicherten in den Basistarif mitgenommen werden kann. Für besonders Hilfsbedürftige kann der Basistarif um 50 % reduziert werden. Per Ende 2011 waren 26.000 Mitglieder der PKV im Basistarif versichert, der Basistarif ist also die Ausnahme. Er wird trotzdem viel diskutiert, da er eine Annäherung von PKV und GKV beinhaltet. Dies auch, da ein Wechsel von der PKV zurück zur GKV sehr schwierig ist: Arbeitnehmer müssen eine bestimmte Zeit wieder ein Gehalt unterhalb der Versicherungspflichtgrenze beziehen22, Selbständige müssen zusätzlich die Selbstständigkeit aufgeben. Bei beiden Gruppen darf der Wechselwillige nicht älter als 55 Jahre sein.23
Ebenfalls schwierig und von den Krankenkassen natürlich nicht gewollt ist ein Wechsel von einer privaten Krankenkasse in eine andere. Hier geht es vor allem darum, dass die Altersrückstellungen nicht mitgenommen werden können und somit verloren gehen. Gesetzliche Änderungen seit dem 1.1.2009 haben daran nicht allzu viel geändert. Weiter hemmen vor allem eine erneute Gesundheitsprüfung und ein höheres Eintrittsalter in der neuen Versicherung den Wechsel. Die PKV schreibt sich regelmäßig Dinge wie "Wettbewerb" und "freier Markt" auf die Fahnen – der erschwerte Wechsel innerhalb der PKV konterkariert diese hohen Ansprüche.
1.1.3 Zusatzversicherungen der PKV für GKV-Versicherte
Ein interessanter "Zwitter" im System der Krankenversicherungen sind die Zusatzversicherungen. Sie werden von der PKV angeboten, richten sich aber vor allem an GKV-Versicherte. Über diese Zusatzversicherungen können letztere ihren Krankheitsschutz bzw. Behandlungskomfort relativ preiswert erhöhen. Die wichtigsten Versicherungen in diesem Bereich sind (in Klammern die aktuelle Zahl der aktiven Policen 201224):
- ambulante Leistungen (7,7 Mio. Policen):
Hier werden Tarife für Leistungen angeboten, die nicht von der GKV übernommen werden. Beispiele sind Brillen, Heilpraktikerbehandlung und Naturheilverfahren.
– Wahlleistungen im Krankenhaus (5,7 Mio. Policen): Diese betreffen vor allem die Chefarztbehandlung und die Unterbringung im 1- oder 2-Bettzimmer.
– Zahnarzt (13,5 Mio. Policen): Hier ist die wichtigste Leistung der Zahnersatz.
Diese 15,5 Mio. Policen für Zusatzversicherungen wurden von etwa 8,5 Mio. Personen25 abgeschlossen und zwar nahezu ausschließlich von GKV-Versicherten. Ein Versicherter hatte also durchschnittlich 1,8 Zusatzversicherungen. Das Prämienvolumen betrug 4,7 Mrd. € im Jahre 2012, macht im Schnitt etwa 300 € pro Zusatzversicherung pro Jahr.
Ein anderer, wesentlich kleinerer Bereich von Zusatzversicherungen betrifft Krankentagegeld und Krankenhaustagegeld. Häufig abgeschlossen werden auch Krankenversicherungen für Auslandsreisen.
Am wichtigsten für den Komfort des Patienten sind Wahlleistungen im Krankenhaus, eine entsprechende Police kostet für einen 30jährigen Mann etwa 45,00 € im Monat. Gäbe es noch eine Versicherung gegen lange Wartezeiten in der ambulanten Arztpraxis, so hätten die meisten GKV-Versicherten alles, was sie wollen. Aber eine solche Versicherung wurde noch nicht erfunden.
In jedem Fall sind die Zusatzversicherungen ein sinnvolles und zunehmend genutztes Instrument.26 Sie geben dem GKV-Versicherten, der von den Kassen ja ziemlich einheitlich "über einen Leisten" geschert wird, die Möglichkeit, mit überschaubaren Kosten selbstverantwortlich gewünschte Leistungen abzusichern. Nicht einzusehen ist aber, dass die Zusatzversicherungen nur von den PKV-Kassen und nicht von den GKV-Kassen angeboten werden dürfen.
Manchmal werden Zusatzversicherungen für die Beschäftigten eines Unternehmens mit einem preiswerten Gruppentarif angeboten. Neu am Markt ist hier eine besondere Form: Es gibt jetzt Zusatzversicherungen, die erstens vom Arbeitgeber bezahlt werden und zweitens nicht von einem Versicherer, sondern von einer privaten Krankenhauskette angeboten werden. Sie sind nur bei dieser Krankenhauskette “einlösbar“, der Versicherte muss sich also in einem Haus dieser Kette behandeln lassen (FAS,2.3.2014,S.19). Dieser Nachteil wird von den Versicherten in Kauf genommen, da es sich ja um eine kostenlose Leistung des Arbeitsgebers handelt, die ihm z.B. eine privatärztliche Behandlung im Krankenhaus ermöglicht. Vgl. hierzu auch die Ausführungen zum “Managed Care“ Modell auf S.174.
1.2 Die Ausgabenseite
Die Anbieter von Gesundheitsleistungen werden im Sprachgebrauch “Leistungserbringer“ genannt. Die wichtigste Unterteilung der Leistungserbringer ist die in die Gruppen ambulante ärztliche Versorgung, Krankenhäuser sowie Arzneimittel. Tatsächlich bestehen auch für diese 3 Gruppen Berufsverbände, Gesetze, Verordnungen, etc. Auch die Ausgabenstatistiken für das Gesundheitswesen werden ganz überwiegend in dieser Gliederung erstellt. 300 Mrd. € betrugen die Ausgaben für Gesundheit und Pflege im Jahre 2012 wie Abb. 7 zeigt.27 Im Folgenden behandeln wir die wichtigsten Ausgabenblöcke nach Leistungserbringern:
Abb. 7: Gesundheitsausgaben 2012 in Mrd. €
Quelle: Statistisches Bundesamt
1.2.1 Ambulante ärztliche Versorgung
176.000 von den kassenärztlichen Vereinigungen zugelassene niedergelassene Ärzte "stellen in Deutschland die ambulante Versorgung der Patienten sicher", wie es im Amtsdeutsch heißt. 54.000 sind als Zahnärzte tätig, 122.000 als Ärzte. Von letzteren praktizieren 56.000 als Hausärzte, die übrigen 66.000 als Fachärzte.28 Zu den Hausärzten gehören auch hausärztlich tätige Internisten und Kinderärzte.29 Die 122.000 zugelassenen Ärzte arbeiten in 76.000 Praxen, die Zahl der Praxen ist aus den folgenden Gründen niedriger als die der Ärzte: Zwar arbeiten die niedergelassenen Ärzte traditionell allein, aber immer häufiger schließen sich mehrere Ärzte einer Fachrichtung in einer Gemeinschaftspraxis zusammen. Weiterhin entstehen zunehmend medizinische Versorgungszentren MVZ (Ende 2013 waren es 2000), hier arbeiten Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen als Angestellte oder freie Mitarbeiter in einer Praxis. Medizinische Versorgungszentren werden von privaten Inhabern und zunehmend von Kliniken betrieben.30
Ein zugelassener Arzt betreut im Durchschnitt 658 Einwohner, die "Arztdichte" liegt in Deutschland damit sehr hoch. Im Jahr 2007 ging jeder Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse 18-mal zum Arzt.31 Das ist ebenfalls international ein Spitzenwert, der viel Aufsehen erregte. Dazu passt auch, dass nur fünf Prozent der Frauen und 12 Prozent der Männer 2007 keinen Arztkontakt hatten.32 Hauptursache für diese geringe "Arztabstinenz" dürfte sein, dass Ärzte wegen Bagatellen aufgesucht werden. Rein rechnerisch hat die Barmer-GEK aus diesen Daten ermittelt, dass ein Arzt im Schnitt 8 Minuten Zeit pro Patientenkontakt hat.
Abb. 8: Gesundheitssystem Ambulante Ausgaben 2012
Quelle: Statistisches Bundesamt
Die Abb. 8 zeigt die Gesundheitsausgaben für niedergelassene Ärzte und medizinische Berufe. Die dritte Zeile "Praxen medizinischer Berufe" enthält die Ausgaben für Heilpraktiker und Physiotherapeuten und ähnliche Berufe. Deren Leistungen werden auch oft unter dem Begriff "Heilmittel" zusammengefasst.
Wir haben auf der Versicherungsseite bisher nur von GKV und PKV gesprochen, die Abbildung zeigt aber auch zwei weitere wichtige Ausgabenträger, die Arbeitgeber und die Patienten selbst: Bei den Arbeitgeberausgaben handelt es sich ganz überwiegend um die Beihilfen des Staates für seine Beamten. Die Patienten (Spalte “Private“) müssen zunehmend über Selbstbeteiligungen selbst Kosten übernehmen (Vgl.S.12). Hinzu kommen die Ausgaben für die sogenannten "individuellen Gesundheitsleistungen" IGeL, etwa für Augendruckmessung, PSA Test, Hautpflege, Beseitigung von Krampfadern, Zahnersatz bis hin zur Schönheitschirurgie. IGeL-Leistungen finden sich in fast allen medizinischen Fachrichtungen, ihr Umfang nimmt ständig zu. Einige Ärzte entwickeln hier eine erhebliche Phantasie. Insgesamt zahlten die Privaten 10,3 Mrd. €33 im Jahre 2012 für die ambulante Versorgung, eine Steigerung von über 100 % seit 2000.
Honorierung der Ärzte in der GKV
Wie erfolgt nun die Honorierung der Ärzte in der GKV?34 Die Leistungen der Ärzte werden mit einem einheitlichen Bewertungsmaßstab EBM gemessen.35 Dieser ist ein Katalog ärztlicher Leistungen, denen jeweils eine Anzahl von Punkten zugeordnet wird. Die erreichten Punkte werden mit einem Punktwert multipliziert, so ergibt sich die Gebührenordnung für die Honorierung der Ärzte durch die Krankenkassen.
Zum Beispiel wird ein Hausbesuch mit 200 Punkten bewertet36. Der Wert je Punkt ("Punktwert") ist im Prinzip variabel, schwankt aber in praxi seit 2009 nur wenig, er beträgt derzeit (2014) 0,1013 € je Punkt. Unser Hausbesuch bringt also
Zum Vergleich:
Bei der Bewertung der Leistungen des EBM wurde als Orientierung von einem Minutenhonorar des Arztes von 0,85 € ausgegangen (zuzüglich technische Anteile der Leistung). Der EBM ist unterteilt in einen für alle Ärzte geltenden Teil und in spezielle Teile für jedes fachärztliches Gebiet, also für Hausärzte, Frauenärzte, Chirurgen etc. Bei den meisten Arztgruppen, insbesondere bei den Hausärzten, wird die Behandlung der meisten Patienten durch eine "Versichertenpauschale" pro Quartal abgegolten. Zusätzlich können aber bestimmte, definierte Leistungen gemäß EBM einzeln abgerechnet werden. Der oben beschriebene EBM ist also weitgehend außer Kraft gesetzt und dient eher der Dokumentation der erbrachten Leistungen sowie der Plausibilitätskontrolle durch die Kassenärztlichen Vereinigungen.40
Wir gehen nun speziell auf die Honorierung der Hausärzte ein: Die Pauschale der Hausärzte pro Quartal hängt vom Alter des Patienten ab, in der Altersgruppe 18 bis 54 Jahre beträgt sie beispielsweise 12,20 €, ab 75 Jahren liegt der Wert bei 21,00 €. Auf die Pauschale gibt es altersunabhängig einen Zuschlag von 14 Euro für die "Wahrnehmung des hausärztlichen Versorgungsauftrags". Die Werte variieren von Bundesland zu Bundesland. Die Pauschale gilt pro Patient pro Quartal, umfasst also auch mehrere Behandlungen desselben Patienten im Quartal ("Behandlungsfall"). Es ist also am besten für die Ärzte, wenn der Patient jedes Quartal in die Praxis kommt, aber bitte jeweils nur einmal. Die Pauschalen muss man als recht niedrig einstufen, allerdings gibt es sie auch für ganz kurze Konsultationen (die Versichertenkarte wird einmal schnell durch den Kartenleser gezogen), das liegt in der Natur einer Pauschale. Entscheidend für die Hausärzte ist aber, welche zusätzlichen Leistungen abgerechnet werden können: Beispielsweise gibt es Zuschläge zur Pauschale für chronisch Erkrankte und für palliativmedizinische Behandlung. Weiterhin werden eine Reihe von Einzelleistungen honoriert: z. B. Krankenbesuche, Impfungen, ambulante Operationen und Laboranalysen. Mal sind sehr pauschale Positionen abrechenbar wie die EBM Position 01732 "Untersuchung zur Früherkennung von Krankheiten gemäß den Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinien", mal geht es um konkrete Behandlungsleistungen gemäß EBM wie Langzeit-Blutdruckmessung und Belastungs-EKG.
Im Ergebnis kommen die Hausärzte je Patient und Quartal überwiegend auf einen "Fallwert" von 60 bis 70 Euro. Eine normale Hausarztpraxis mit einem Vollzeit arbeitenden Inhaber hat etwa 800 Behandlungsfälle (der Wert schwankt sehr stark). Das macht also 48.000 bis 56.000 Euro je Quartal. Achtung, hier handelt es sich um den Umsatz, aus dem alle Kosten der Praxis zu decken sind. Zu diesem Wert kommen der mit Privatpatienten erzielte Umsatz sowie die individuellen Gesundheitsleistungen hinzu. Zu den letztlich erzielten Einkommen der Ärzte vgl. die Seite 26.
So funktioniert also in etwa die Honorierung der Hausärzte. Die der Fachärzte ist ähnlich, hat aber eine geringere Pauschalierung. An dieser Stelle müssen wir uns mit einem großen Dilemma der Honorierung der niedergelassenen Ärzte befassen, der Budgetierung. Diese bedeutet, dass es Obergrenzen für die Honorierung der Ärzte gibt. Tatsächlich funktioniert das System wie folgt: Die Honorierung der Kassenärzte unterliegt grundsätzlich einer Budgetierung, die in Verträgen zwischen den Landesverbänden der Krankenkassen und den kassenärztlichen Vereinigungen festgelegt wird und bis 2008 wie folgt funktionierte: Die Krankenkassen bezahlten je Versicherten jedes Jahr einen bestimmten Betrag für die ärztlichen Leistungen, dieser Betrag wiederum hing von den Einnahmen der Krankenkassen ab. Mehr Geld gab es für die Ärzte nicht. Die tatsächlichen Krankheiten der Versicherten – ihre "Morbidität" – und daraus folgend ihr Behandlungsbedarf spielten keine Rolle. Das "Morbiditätsrisiko" lag somit bei den Ärzten. Im Ergebnis mussten bei einem festen Budget und einer variablen Leistungsmenge auch die Preise variabel sein, die Punktwerte je erbrachten Punkt schwankten somit. Leisteten die Ärzte viel, hätten sie also bei festen Punktwerten das Budget überschritten, so wurden sie mit sinkenden Punktwerten "bestraft", denn das Budget musste eingehalten werden. Dieses Phänomen wurde als “Hamsterradeffekt“ bezeichnet, viel Aufwand und nur geringer Mehrertrag. Diese Situation einer strengen Budgetierung bei variablen Punktwerten galt überwiegend bis Ende 2008.41
Ab dem 1.1.2009 wurde das System umgestellt. Für die Budgetierung ist nun gemäß § 85 SGB V eine "Morbiditätsorientierte Gesamtvergütung" (MGV) durch die Krankenkassen die Richtschnur, um die tatsächliche Morbidität der Versicherten stärker zu berücksichtigen. Das Morbiditätsrisiko liegt jetzt im Grundsatz bei den Krankenkassen, was in praxi bedeutet, dass die tatsächliche Morbiditätssituation das von den Kassen zu zahlende Budget beeinflusst. Es bleibt also bei einem jährlichen Budget. Dieses wird von den Kassenärztlichen Vereinigungen etwa zu einem Drittel auf die Hausärzte und zu zwei Dritteln auf die Fachärzte aufgeteilt. Zuvor werden Mittel für Vergütungen außerhalb des Budgets wie z.B. Prävention, Notfallversorgung, Ambulantes Operieren und belegärztliche Leistungen reserviert.
Dann erfolgt die Aufteilung auf die einzelnen Ärzte: Das Budget je Arzt für ein Quartal bestimmt sich durch sein geleistetes Volumen (Behandlungsfälle) im Vorjahresquartal, also sein sogenanntes "Regelleistungsvolumen". Wenn er dieses Volumen im laufenden Quartal nicht überschreitet, dann wird das aktuelle Volumen mit einem festen Punktwert vergütet.42 Leistet er mehr, so wird das zusätzliche Volumen nur wesentlich "abgestuft" vergütet, der "Restpunktwert" für den Arzt sinkt also erst bei Überschreitung des Vorjahresvolumens. Der Arzt kann in Folge der Neuregelung seinen Umsatz bei gleichbleibendem Leistungsvolumen fest planen statt wie früher den endgültigen Punktwert nicht zu kennen. Zudem kann er darauf bauen, das Budgetüberschreitungen im laufenden Jahr zwar wesentlich geringer bezahlt werden, aber für das folgende Jahr automatisch sein Budget erhöhen. Langfristig lohnt es sich also, seinen Patientenstamm auszuweiten. 43 Die Neuregelung begünstigte tendenziell durch ihre pauschale Honorierung von Behandlungsfällen Ärzte, die je Fall möglichst wenig Leistungen erbrachten, denn „Fall ist Fall“. Es lohnte sich so beispielsweise, schwierigere Fälle zum Facharzt “abzuschieben“. Deshalb wurden zu Lasten der Honorierung der einfachen Fälle bereits 2010 sogenannte Qualitätsorientierte Zusatz Volumina QZV eingeführt. Diese honorieren spezielle Leistungen im Rahmen besonderer fachlicher Qualifikationen.44
Anfang 2013 wurde in einigen Bundesländern die Fallzahlregelung umgestellt. Maßgeblich für die Vergütung wurden jetzt die aktuellen Fallzahlen statt der des Vorjahres, um die folgende Problematik zu lösen: War der Arzt im Vorjahresquartal krank oder länger verreist oder hatte er besonders wenig Patienten, so war sein Budget für das aktuelle Quartal zu niedrig. Auch bei dieser Neuregelung musste aber eine Budgetierung beibehalten werden: Steigert der einzelne Arzt einer Fachgruppe seine Fallzahl um 3 % oder mehr, so bekommt er die über 3 % hinausgehenden Fälle nicht vergütet. Diese Restriktion tritt aber nur ein, wenn die Arztgruppe insgesamt die Fälle um 3 % steigert. Das ist aber eher die Ausnahme, da viele Ärzte ihre Leistung nicht steigern oder sogar einschränken (z.B. altersbedingt). Von diesem Sachverhalt können also bei der Neuregelung Ärzte mit Steigerungen über 3% profitieren.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass es demnächst wieder andere Regelungen gibt. Jedenfalls hat die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz 2012 die Regelleistungsvolumen zugunsten von Individualbudgets je Arzt auf Basis des Vorjahresquartals wieder abgeschafft. (aerzteblatt.de, 17.2.2012). Hamburg folgte in 4. Quartal 2013 zugunsten "Individueller Leistungsbudgets“ (KVH-Journal 11/2013,S.18).
Wir haben es somit bei der Honorierung der niedergelassenen Ärzte mit einer sehr schwierigen und sich laufend ändernden Materie zu tun. Dieser Sachverhalt ist letztlich durch die Konkurrenz der Ärzte um knappe Mittel begründet. Die Ärzte versuchen dabei immer wieder, die Budgetierung auszuhebeln sowie Lücken im System zu entdecken und auszunutzen. Sind sie dabei erfolgreich, so betreiben die Krankenkassen, aber auch die Kassenärztlichen Vereinigungen selbst, wieder Änderungen der Spielregeln, um die Lücken zu schließen. Sind die Restriktionen der Budgetierung wiederum zu rigoros, so pochen die Ärzte ihrerseits auf Lockerungen und Verbesserungen. Ein ewiges Spiel! Vgl. hierzu auch die Ausführungen auf S. 76 zum Thema “Angebotsinduzierte Nachfrage“.
Honorierung der Ärzte in der PKV
Bitte folgern Sie aus der Tatsache der Budgetierung bei GKV Patienten nicht, dass es den Ärzten schlecht geht, siehe unten. Trotzdem ist die Behandlung von Privatpatienten finanziell gesehen wesentlich attraktiver: Hier rechnen die Ärzte nach der sogenannten Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ab, einem umfangreichen, gesetzlich vorgeschriebenen Verzeichnis aller denkbaren ärztlichen Leistungen mit jeweiliger Bewertung in Euro. Der Wert wird bei persönlich vom Arzt erbrachten Leistungen in aller Regel mit einem Faktor 2,3 bewertet, in schwierigen Fällen auch mit 3,5, dann aber mit schriftlicher Begründung. Dabei liegt die Bewertung der Schwierigkeit ganz im Ermessen des Arztes. Manche Ärzte verlangen auch mehr als das 3,5 Fache. Der dem Autor bekannte Rekord liegt bei Faktor 10 für eine schwierige, aber nicht seltene Operation durch einen bekannten Spezialisten. Die Krankenkasse zahlt aber in diesen Fällen in aller Regel maximal nur den Faktor 3,5. Medizinisch-technische Leistungen können mit dem Faktor 1,8 bewertet werden, Laborleistungen hingegen mit 1,15.
Die mit dem einheitlichen Bewertungsmaßstab EBM der GKV bewerteten Leistungen EKG (15,40 €) und Hausbesuch (19,77 €) bringen gemäß GOÄ mit Faktor 2,3 bewertet 26,55 € bzw. 42,90 €. Die GOÄ macht bei erstem Ansehen einen ganz vernünftigen Eindruck. Tatsächlich sind aber durch die Vielzahl an definierten Leistungen die Möglichkeiten sehr groß, einer Patientenbehandlung möglichst viele Leistungen zuzuordnen – tatsächlich erbrachte sowie eher pauschale Nebenleistungen. So heißt es auf der Homepage einer Abrechnungsgesellschaft, die den Ärzten als Dienstleistung die Abrechnung für Privatpatienten anbietet: "Und allein schon durch die konsequente Prüfung jeder einzelnen Privatliquidation verhilft Ihnen Medas fast immer zu einem Umsatzplus" (www.medas.de).
Im Ergebnis werden bei Privatpatienten etwa um 125 % bis 135 % höhere Beträge abgerechnet als bei Kassenpatienten45, also weit mehr als das Doppelte und das ohne Budgetbegrenzungen.
Einkommen der niedergelassenen Ärzte
Nun zu den Einkommen der niedergelassenen Ärzte (GKV und PKV, ohne Zahnärzte): Ihr Jahreseinkommen betrug im Jahre 2011 lt. Statistischem Bundesamt im Durchschnitt 166.000 €.46 Es ist definiert als persönliches Einkommen eines Praxisinhabers (oder Mitinhabers) nach allen Kosten der Praxis einschließlich Abschreibungen vor persönlichen Steuern und Vorsorgeaufwendungen. Dieser





























