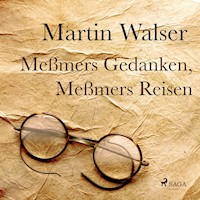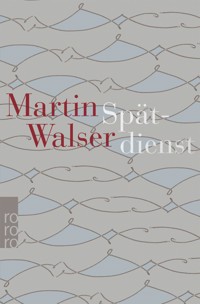9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die meisten leiden ohne Gewinn – so steht es im Roman «Das dreizehnte Kapitel», der ebendiesen Satz widerlegen will. Mit einem Festessen im Schloss Bellevue fängt er an: Ein Mann sitzt am Tisch einer ihm unbekannten Frau und kann den Blick nicht von ihr lösen. Wenig später schreibt er ihr, und zwar so, dass sie antworten muss. Es kommt zu einem Briefwechsel, der von Mal zu Mal dringlicher, intensiver wird. Beide, der Schriftsteller und die Theologin, beteuern immer wieder, dass sie glücklich verheiratet sind. Aber sie gestehen auch, dass sie in dem, was sie einander schreiben, aus sich herausgehen können wie nirgends sonst und dass sie ihre Ehepartner verraten. Nur weil ihr Briefabenteuer so aussichtslos ist, darf es sein. An ein persönliches Treffen ist nicht zu denken. Die Buchstabenketten sind Hängebrücken über einem Abgrund namens Wirklichkeit. Eines Tages teilt die Theologin mit, ihr Mann sei schwer erkrankt. Während sie auf einer Fahrradtour durch Kanadas Wildnis mit ihm noch einmal das Leben feiert, wartet der Schriftsteller auf Nachrichten. Als wieder eine eintrifft, wirft sie alles um. Martin Walsers Roman über eine Liebe, die als Unmöglichkeit so tiefgründig und lebendig ist wie kaum etwas, kreist auf schwindelerregende Weise um das Wesen der menschlichen Existenz. Und führt dabei vor Augen, dass eine Liebe ohne Hoffnung auf Hoffnung das eigene Leben erst empfindbar macht. Ein bewegender, lebenskluger, ja aufregender Roman über eine Frau und einen Mann, die gerade durch die Unmöglichkeit ihrer Liebe zu einer noch nie erfahrenen Gefühlsheftigkeit gesteigert werden. «Kaum einer vermag die Verwerfungen und Abgründe in den menschlichen Verhältnissen besser auszuloten als Martin Walser.» Volker Hage, Der Spiegel «Seit einem halben Jahrhundert ist Martin Walser unser Gewährsmann für Liebe, Ehe, Glaube und deutsche Befindlichkeiten. Die Vermessung der Ausdruckswelt, des Daseins als Abfolge schwankender Empfindungen – das ist seine große Stärke.» Felicitas von Lovenberg, Frankfurter Allgemeine Zeitung «Martin Walser schreibt nicht nur die schönsten Sätze, er stellt sie auch in anregende Horizonte.» Andreas Isenschmid, Neue Zürcher Zeitung «Martin Walser ist einer der wichtigsten Schriftsteller, die wir haben. Sein Gedächtnis, seine Genauigkeit in der Betrachtung von menschlichen Verhältnissen und Unverhältnissen ist unerreicht, seine sprachliche Risikobereitschaft ist beispielhaft. Er geht in jeder Hinsicht aufs Ganze. Kurz, Martin Walser ist ein Dichter.» Frank Hertweck, SWR
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Martin Walser
Das dreizehnte Kapitel
Roman
Über dieses Buch
Die meisten leiden ohne Gewinn – so steht es im Roman «Das dreizehnte Kapitel», der ebendiesen Satz widerlegen will. Mit einem Festessen im Schloss Bellevue fängt er an: Ein Mann sitzt am Tisch einer ihm unbekannten Frau und kann den Blick nicht von ihr lösen. Wenig später schreibt er ihr, und zwar so, dass sie antworten muss. Es kommt zu einem Briefwechsel, der von Mal zu Mal dringlicher, intensiver wird. Beide, der Schriftsteller und die Theologin, beteuern immer wieder, dass sie glücklich verheiratet sind. Aber sie gestehen auch, dass sie in dem, was sie einander schreiben, aus sich herausgehen können wie nirgends sonst und dass sie ihre Ehepartner verraten. Nur weil ihr Briefabenteuer so aussichtslos ist, darf es sein. An ein persönliches Treffen ist nicht zu denken. Die Buchstabenketten sind Hängebrücken über einem Abgrund namens Wirklichkeit.
Eines Tages teilt die Theologin mit, ihr Mann sei schwer erkrankt. Während sie auf einer Fahrradtour durch Kanadas Wildnis mit ihm noch einmal das Leben feiert, wartet der Schriftsteller auf Nachrichten. Als wieder eine eintrifft, wirft sie alles um.
Martin Walsers Roman über eine Liebe, die als Unmöglichkeit so tiefgründig und lebendig ist wie kaum etwas, kreist auf schwindelerregende Weise um das Wesen der menschlichen Existenz. Und führt dabei vor Augen, dass eine Liebe ohne Hoffnung auf Hoffnung das eigene Leben erst empfindbar macht. Ein bewegender, lebenskluger, ja aufregender Roman über eine Frau und einen Mann, die gerade durch die Unmöglichkeit ihrer Liebe zu einer noch nie erfahrenen Gefühlsheftigkeit gesteigert werden.
«Kaum einer vermag die Verwerfungen und Abgründe in den menschlichen Verhältnissen besser auszuloten als Martin Walser.» Volker Hage, Der Spiegel
«Seit einem halben Jahrhundert ist Martin Walser unser Gewährsmann für Liebe, Ehe, Glaube und deutsche Befindlichkeiten. Die Vermessung der Ausdruckswelt, des Daseins als Abfolge schwankender Empfindungen – das ist seine große Stärke.» Felicitas von Lovenberg, Frankfurter Allgemeine Zeitung
«Martin Walser schreibt nicht nur die schönsten Sätze, er stellt sie auch in anregende Horizonte.» Andreas Isenschmid, Neue Zürcher Zeitung
«Martin Walser ist einer der wichtigsten Schriftsteller, die wir haben. Sein Gedächtnis, seine Genauigkeit in der Betrachtung von menschlichen Verhältnissen und Unverhältnissen ist unerreicht, seine sprachliche Risikobereitschaft ist beispielhaft. Er geht in jeder Hinsicht aufs Ganze. Kurz, Martin Walser ist ein Dichter.» Frank Hertweck, SWR
Vita
Martin Walser, 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, war einer der bedeutendsten Schrifststeller der deutschen Nachkriegsliteratur. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis, 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2015 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis. Außerdem wurde er mit dem Orden «Pour le Mérite» ausgezeichnet und zum «Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres» ernannt. Martin Walser starb am 26. Juli 2023 in Überlingen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Umschlagabbildung: plainpicture/Oote Boe
ISBN 978-3-644-01941-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Käthe
Erster Teil
1
Schloss Bellevue, sagte ich. Der Taxifahrer hatte bemerkt, dass ich getan hatte, als führen wir jeden Tag zweimal dahin, und tat seinerseits so, als sei das eine ihm unbekannte Adresse. Wer’ma findn, sagte er.
Iris suchte meine Hand. Du hast kalte Hände, sagte ich. Wenn wir uns beide stumm transportieren ließen, musste der Taxifahrer das für eine Art Pathos halten. Und draußen dreißig Grad. Da durfte ich doch tun, als fielen mir Iris’ kalte Hände auf. Der Taxifahrer wusste ja nicht, dass Iris immer kalte Hände hat, dass also nichts so überflüssig war, wie zu sagen, sie habe kalte Hände.
Dass Iris nichts sagte, rechnete ich ihr hoch an. Ihr war es gleichgültig, was der Taxifahrer über uns dachte. Das ist ihre Unabhängigkeit. Sie hat ihren Schwerpunkt in sich selbst. In der Schule war zu lernen: Körper, die den Schwerpunkt innerhalb ihrer Unterstützungsfläche haben, fallen nicht um. Das ist Iris.
Ich dagegen, wenn ich nicht Iris hätte, auf die ich mich stützen kann, ich fiele andauernd um. Mir hätte es auch gleich sein können, was der Taxifahrer über uns dachte. Wenn ich nicht diesen komischen Ehrgeiz hätte, überall bestimmen zu wollen, wie ich wirke. Locker plaudern, alltäglich sein, banal, dass der Taxifahrer denken musste, die fahren wirklich jeden Tag zum Bundespräsidenten ins Schloss Bellevue. Stumm, mussten wir ergriffen wirken. Das waren wir überhaupt nicht. Und eben deshalb wollte ich diese Wirkung nicht zulassen.
Als der Taxifahrer sah, wie viele Autos am Schloss vorfuhren, sagte er: Da tut sich watt. Ich bezahlte ihn deutlich besser, als er erwarten konnte.
Die Mädchen, denen ich die Einladung zeigte, versorgten uns mit zwei Kärtchen, auf denen unsere Tisch-Nummern standen. Ich kriegte noch die Namensschildchen, meins steckte ich mir sofort an, weil ich nicht den Eindruck erwecken wollte, man müsse mich hier kennen. Iris steckte das ihre in ihre Tasche. Dann in den Saal mit hohen, runden Tischchen. Man konnte den Aperitif, der einem sofort aufgedrängt wurde, auch stehend freihändig trinken. Iris nahm Orangensaft, ich Champagner. Iris ging an ein freies Tischchen, ich folgte. Ich prostete ihr zu. Dann sagte ich: Lauter unbekannte Prominenz. Und sie: Wie wir. Und schon landete ein Paar an unserem Tischchen. Er hatte ein Schild am Revers. Unlesbar. Freundliches Nicken. Gläserheben. Er sagte: Wir kennen hier keinen. Das war ein Angebot. Leider sagte ich nicht: Wir auch nicht. Oder noch besser: Uns kennt hier auch keiner. Stattdessen sagte ich: Nur den Bundespräsidenten. Jetzt lachte das Paar und prostete uns zu. Dann sagte er: Entweder Wissenschaft oder Wirtschaft. Ich hätte auf mich zeigen sollen und dazu sagen: Oder weder noch. Stattdessen sagte ich: Oder beides. Jetzt sagte er: Salute. Ich, dämlich: Zum Wohl.
Dann der Sog zu der gewaltigen Tür in den Festsaal. Ich brachte Iris an ihren Tisch, bot ihr ihren Platz an und suchte meinen Tisch und meinen Platz. Durfte ich mich setzen, oder musste ich mich zu jedem und zu jeder, die da schon saßen, hinbegeben? Ich blieb hinter meinem Stuhl stehen, nickte denen, die schon saßen, zu und wartete, bis die Dame, deren Tischherr ich sein würde, erschien. Dass ich zur Rechten der Frau des Bundespräsidenten sitzen würde, hatte mir der Persönliche Referent mitgeteilt. Dass ich überhaupt eingeladen war, verdankte ich nur ihm. Bei irgendeinem Empfang hatten wir uns kennengelernt, er hatte gerade mein Erfolgsbuch Strandhafer gelesen und war angeblich sehr glücklich, den Autor selbst zu treffen. Und hatte gleich gesagt: Sie werden von mir hören.
Meine Tischdame wurde von ihrem Mann geliefert, wir gaben einander die Hand, dann saß sie, ich konnte mich setzen. Ich schätzte, dass wir fünfzehn oder sechzehn waren an diesem großen runden Tisch. Die Frau des Bundespräsidenten wurde von einem feierlich wirkenden Protokoll-Mann hergebracht. Sie breitete die Hände aus, nickte allen zu und setzte sich. Ich war noch einmal aufgestanden und setzte mich erst wieder, als sie saß.
Sie sagte zu mir: Ich freu mich. Ich zog mein Gesicht in verwunderte Falten. Und sie: Als sie mich auf der Gästeliste entdeckt habe, habe sie darum gebeten, mit mir an einem Tisch zu sitzen. Und sagte: Strandhafer.
Ja, sagte ich, das ist ein vernichtendes Schicksal, wenn man erlebt, dass alles, was man in vierzig Jahren gemacht hat, zusammenschnurrt auf ein einziges Wörtchen.
Zum Glück wartete schon ein festlicher Ober darauf, dass er uns die Riesling-Spätlese Sommerhäuser Steinbach einschenken konnte. Und es ging auch gleich los: Bachforelle mit Spinatschaumbrot, wildem Spargel, eingelegtem Blumenkohl und jungen Tomaten. Zum Glück war die Bundespräsidentenfrau die Tischdame des Herrn zu ihrer Linken. Dessen unverständlichen Namen sagte sie mir nach der Vorspeise herüber. Aber wichtiger als der Name war das Wort Nobelpreisträger. Für, sagte sie, ihren Tischherrn in die Vorstellung hereinnehmend, Physik. Und weil sie offenbar perfekt zu sein für nötig hielt, fügte sie dazu: Ultrapräzise Laserspektroskopie. Und rechts von Ihnen Frau Dr. Korbitzky, ihr Mann hat den Nobelpreis bekommen für die Quantenphysik ultrakalter Atome. Damit wolle sie’s vorerst bewenden lassen. Zum Wohl.
Jetzt tranken alle rund um den Tisch einander zu. Aber als die Bachforelle gegessen und Kraftbrühe vom Eifeler Rehbock mit Wildkräuter-Frischkäse-Grießnocken serviert war, vollendete sie ihr Vorstellungswerk. Sie wusste die Namen und Titel und Leistungen aller an diesem runden Tisch Sitzenden. Dass sie das wusste, zelebrierte sie. Ich vergaß diese heraldische Orgie, schon während sie stattfand. Dass die Dame links vom Tischherrn der Vorstellungsvirtuosin die Frau des heute hier zu Feiernden war, machte den Namen zur Botschaft: Frau Professor Dr. Maja Schneilin. Der Name ihres Tischherrn zerflog, aber dass er Hirnchirurg war, überlebte. Für die nächsten Namen und Titel und Professionen interessierte ich mich nicht, weil mich Frau Professor Maja Schneilins Anblick beschäftigte. Und wie das zusammenbringen! Sie lehrt. Und zwar Theologie. Das hatte die Vorstellerin so vorgetragen, dass die Tischrunde aufgefordert war, sich zu wundern. Mehr als bei Nobelpreisträger, Hirnforscher, Rechtshistoriker und sonstwas sollten wir staunen: Schaut diese Frau des heute Gefeierten an! Ich hätte diese Hervorhebung nicht gebraucht. Und gleich die Schwierigkeit: Diese Frau saß nicht gegenüber, saß nicht so, dass ich sie ohne Kopfverdrehen von selbst im Blickfeld hatte, sondern eben sehr schräg gegenüber. Wenn der Tisch eine Uhr war und die Frau des Bundespräsidenten war null Uhr, dann saß ich auf dreiundzwanzig Uhr, Frau Professor Schneilin aber höchstens auf halb zwei, ihr Hirnforscher auf zwei. Ich musste, um sie zu sehen, an der Bundespräsidentenfrau vorbeischauen. Und hätte doch ihre Vorstellungsprozedur durch Mitschwenken des Kopfes mit meinem mitschwenkenden Kopf begleiten sollen. Aber ich war hängengeblieben, gestrandet bei Frau Professor Schneilin. Als man bei dem in Rebenholz geräucherten Kalbstafelspitz mit Feldthymian-Trauben-Sauce, Spitzkohlgemüse und gefüllter Linda-Kartoffel mit Kaiserstühler Bauchspeck angelangt war und dazu den trockenen Spätburgunder von der Ahr trank und ich an der Bundespräsidentenfrau vorbei zu Frau Professor Schneilin hinübergeblickt hatte, ohne auch nur einen einzigen Antwortblick zu ernten, spürte ich, dass mein Gefühlsstau bald nicht mehr auszuhalten war.
Zum Glück war unsere Tischherrin jetzt fertig mit Vorstellen. Nachdem sie über meine Tischdame, Frau Dr. Schneiderhahn-Korbitzky, mitgeteilt hatte, dass die von Anfang an an den Forschungen ihres Mannes beteiligt gewesen sei, landete sie bei mir, da könne sie sich ja, weil ich so berühmt sei, langwierige Erklärungen sparen. Hier durfte ich, musste ich einhaken. Berühmt sei ich überhaupt nicht. Weil sie das für kokette Bescheidenheit hielt, konnte ich sagen, ich sei bekannt. Ja, bei dem Wort berühmt müsse man nicht wissen, warum berühmt. Berühmt sei etwas Absolutes. Wenn jemand bekannt sei, wisse jeder, dem er bekannt sei, warum.
Ich spürte, dass ich nicht ausführlich werden durfte. Rund um den Tisch saßen Menschen, die an allem interessiert sein konnten, nur nicht am Unterschied zwischen bekannt und berühmt. Da jetzt alle alle kannten, sollten jetzt alle auf alle trinken. Die Frau des Bundespräsidenten sagte noch, dieser Spätburgunder von der Ahr möge einander näher bringen, als der runde Tisch es könne. Wir tranken. Da ich vor dem Roten von dem fränkischen Weißen schon drei Gläser getrunken hatte und Weißwein mich immer zu allem Unmöglichen reizt, ja mich manchmal regelrecht aggressiv macht, musste ich nach dem Rotweintrunk sagen: Das Leben ist zu kurz, um deutsche Weine zu trinken. Das hatte ich hineingesagt in die winzige Stille, in der jeder noch dem Schluck, den er gerade genommen hatte, nachsann.
Jetzt also ein Durcheinander von Reaktionen. Die Frau des Bundespräsidenten rief die Herren aller am Tisch versammelten Fachrichtungen auf, Stellung zu nehmen zu dieser Aussage unseres Schriftstellers. Jeder antwortete mit dem facheigenen Vokabular, aber alle verurteilten meine Aussage rückhaltlos. Ich sagte dann: Mir darf auffallen, dass sich an dieser einhelligen Verurteilung eines schlichten Satzes nur Männer beteiligt haben.
Und sofort, von drüben, Frau Professor Schneilin: Das heißt nicht, dass Frauen Ihnen zustimmen. Für mich heißt es: Es gibt Sätze, über die können sich nur Männer streiten. Die Damen stimmten ihr heftig zu. Ich sagte: Ich fühle mich widerlegt, aber nicht bekehrt. Frau Professor Schneilin: Womit das Pseudoreligiöse dieses Satzes endlich offenbar ist. Und damit auch seine Inkompatibilität. Ich hob mein frisch gefülltes Glas Rotwein, sagte: Zum Wohl, und trank das Glas in einem Zug aus.
Das löste eine Art Heiterkeit aus. Bevor ich das leere Glas auf den Tisch stellte, sah ich über das Glas zu Frau Professor Schneilin hinüber. Aber sie lachte schon über etwas, was ihr der Hirnforscher noch schnell gesagt hatte – wahrscheinlich etwas Satirisches über oder gegen mich. Dieser Hirnforscher war ein schmaler Grauhaariger mit einem Vogelkopf. Der brachte seine Tischdame häufig zum Lachen und lachte selber kaum. Der erzählte ihr Zeug, lediglich dass sie lache. Der zündete ihr Lachen an, dann schaute er zu, wie sie lachte. Ich hätte mich jetzt endlich um Frau Dr. Schneiderhahn-Korbitzky, meine Tischdame, kümmern müssen. Ich hätte sie fragen müssen, wie das gewesen sei, als sie sich an den Forschungen ihres Mannes über kalte Atome beteiligt hatte. Tatsächlich hätte es mich wirklich interessiert zu erfahren, wie viel man von vorneherein weiß und will bei solchen Forschungen und wie viele Fragen dann erst das Forschen produziert. Aber ich musste hinüberschauen zu der vom Hirnforscher zum Lachen gebrachten Frau Professor Schneilin. Sie lachte lauter als jeder und jede andere am Tisch. Aber sie lachte nie lang. Zum Glück. Es war ein Auflachen, und Schluss. Dann musste der Hirnforscher schon wieder nachlegen. Aber das tat er offenbar gern. Im Augenblick war er sicher der Lebendigste am Tisch. Und war’s durch sie.
In mir war ein Selbstgespräch im Gang, das dieser Frau da drüben gewidmet war: Sie ist unverwechselbar. Alle Frauen der Welt sehen einander gleich. Die Frau des Bundespräsidenten war auch auf eine eigene Art zart und gefühlsbestimmt und hatte ein kleines Gesicht, nicht ohne Energielinien und Gemütsflächen, und sah doch allen anderen Frauen ähnlicher als dieser Frau Professor Schneilin. Ihr sah keine Frau gleich. Sie sah keiner Frau gleich. Ihr Gesicht war also einzigartig. Die Augen ein bisschen zu groß, die Nase ein bisschen zu deutlich, der Mund deutlich zu fest. Kein locker schwellender Lippenmund. Und doch ein Mund, der darauf zu warten schien, einem anderen Mund gewachsen zu sein. Eine vibrierende Bereitschaft war dieser Mund. Und blieb doch ganz bei sich. Die reine Kraft war dieser Mund. Eine grenzenlose Zuständigkeit. Wie der Mund reagieren würde – nicht sprechend, sondern als Erscheinung –, das würde bestimmen, ob diese Augen prüfend oder innig wirken würden, ob die Nase ein auf der Wiese grasendes Schaf oder ein Witterung aufnehmendes Raubtier war. Die Haare verstärkten, was dieses Gesicht, was diese Frau entscheiden würde. Für ihr Gesicht ist sie ja nur sehr indirekt verantwortlich, aber ganz und gar von ihr gewollt sind ihre Haare. Was sie an Farbe und Frisur bietet, könnte gewollter nicht sein. Farbe: Weißblond. Keine Spur von Blondseinwollen. Das kälteste Weißblond, das es geben kann. Ein Antiblond schlechthin. Und diese Haare glatt und gerade zurückgekämmt bis hinter die Ohren, an denen es flimmert und gleißt. Diese glatte, die Stirn noch höher machende Zurückgekämmtheit wirkt, als sei da eine Haarpracht gezähmt, eine Naturerscheinung besiegt worden. Schaf oder Raubtier? Auf jeden Fall ein unbesiegtes Kind. Sie hat noch das Mädchen im Gesicht. Das haben viele. Vielleicht alle. Auch wenn es dann ein zerstörtes, betrübtes, misshandeltes Mädchen ist. Sie hat ein ganz unzerstörtes Mädchen im Gesicht. Das bringt nur die Natur zu Stande, so viel auf einmal. Zu viel auf einmal. Das ist SIE. Die Vierundvierzigjährige war in diesem Gesicht, in dieser Erscheinung ganz genau so präsent wie die Vierzehnjährige. Eine atemraubende Balance!
Mein andauerndes An-ihr-vorbei-Starren hielt die Frau des Bundespräsidenten hoffentlich für Interesse an den Laser-Storys, die ihr von links serviert wurden. Aber mir war es schon egal, was die Bundespräsidentenfrau oder die Welt über mich dachte. Diese Frau da drüben dachte nichts über mich, sie bemerkte mein Zu-ihr-hinüber-Starren überhaupt nicht, sie bestätigte mir durch keinen Antwortblick mein Dasein und Hinüberstarren, sie demonstrierte mir nichts als meine Nichtanwesenheit, und alles, was sie mir demonstrierte, ging auf in ihrem Namen: Maja.
Dann war es da vorne so weit: Der Bundespräsident begrüßte die Anwesenden und sagte, warum er alle, die da waren, eingeladen hatte, den 60. Geburtstag von Professor Dr. Korbinian Schneilin im Schloss Bellevue zu feiern. Seinen 50. Geburtstag habe Schneilin als Professor für Molekularbiologie an der Stanford-Universität in Kalifornien gefeiert. Da hatte er schon einen Aufstieg hinter sich, der begonnen hatte, als er als 28-Jähriger ausgezeichnet wurde mit dem John-Spangler-Nicholas-Preis für seine outstanding dissertation an der Yale-Universität. Dann ist ihm so gut wie alles an- und umgehängt worden, was in den USA und in Europa einem Naturwissenschaftler verehrt werden kann. Gerade war er noch zum Group Leader des European Molecular Biological Laboratory in Heidelberg ernannt worden, da beendete er seine akademische Karriere, die, wie die Kenner bezeugen, bald genug zum Nobelpreis hätte führen können, und gründete eine Firma. Und das in Adlershof, also hier vor den Toren Berlins, in unserem Silicon Valley. Er wollte, was er als Molekularbiologe erforscht hatte, in der Praxis erproben. Mir ist gesagt worden, es sei nicht mehr ungewöhnlich, vor allem in den USA, dass Naturwissenschaftler, wenn sie den Nobelpreis bekommen haben, eine Firma gründen, um ihre Forschungsergebnisse der Menschheit dienstbar zu machen. Korbinian Schneilin war ungeduldiger oder neugieriger und gründete seine Firma, bevor die Stockholmer so weit waren. Heute beschäftigt die Firma Transmitter 251 Mitarbeiter, davon 29 Akademiker. Und produziert werden Medikamente nach Maß. Und seine über einhundert Patente werden überall in der Welt genützt. Eine solche Lebensplanung müsse einen Politiker interessieren, müsse jeden interessieren, der sich dem Großenganzen verbunden fühlt. Und darum feiern wir heute gleichermaßen den Forscher und Unternehmer Korbinian Schneilin. Und wir, das sind Sie, meine Damen, meine Herren, von der Theologie bis zur Atomphysik, von der Bildhauerei bis zur Psycholinguistik. Und er bat den Gefeierten, uns jetzt, so gut es unsere Unbildung zulasse, sein Lebenskonzept ein wenig zu erklären.
Korbinian Schneilin wirkte leicht. Sehr leicht. Aufs Podest kam er mit einem Satz. Er war ein wenig größer als der Bundespräsident. Er fasste das Pult mit beiden Händen. Kein Manuskript. Und statt einer Krawatte eine Fliege. Ein Mann mit Fliege hat Sexualprobleme. So hat es vor dreißig Jahren der formuliert, der damals mein Chef war. Solche Sätze merkt man sich leider.
Und so fing der Gefeierte an: Zu sehen, was vor dir noch keiner gesehen hat, das sei, habe er im ersten Semester gehört, das Ziel aller Forschung. Seins sei es nie gewesen. Und, habe er gehört: Wer mehr als vier Stunden Schlaf brauche, komme für die Forschung nicht in Frage. Trotz solcher Signale zur Abhaltung sei er dabei geblieben. Er habe als Bub das Regenwasser vor dem Haus gestaut und habe dem Wasser etwas zu tun gegeben. Ein selbstgebasteltes Rad sollte es drehen, und an das Rad habe er einen kleinen Schöpflöffel angeschlossen, der das Wasser wieder zurückschöpfte in das gestaute Wasser, das dann wieder auf das Rad floss. Er hatte in der Schule etwas vom Perpetuum mobile gehört. Er gebe zu, dass er sehr anfällig sei, wenn er von einem Problem höre, das schwer lösbar sei. Wenn er in der Zeitung liest, dass die Kompaktlagerung der Brennelemente in einem Reaktor Probleme bereite, muss er für die dazu gebrauchten Borbleche eine Formung vorschlagen, die das Problem löst. Es gibt nichts, was ihn nicht zu einem Lernenden mache. Und seine Lieblingstugend: die Genauigkeit. Sein großes Vorbild: Bert Sakmann. Solange wir es nicht messen können, ist es müßig, darüber zu sprechen. Passion for Precision, so habe einer in Stockholm seine Dankrede überschrieben. Aber der Sinn der Genauigkeit: das Lernen. Was passiert in den Molekülen, wenn sie etwas lernen? Können wir die Moleküle etwas lernen lassen, was sie ohne uns nicht könnten? Lernen, das ist die gegenseitige Wechselwirkung von Neuronen, die durch Milliarden Synapsen verbunden sind. Und: Können wir schneller lernen als die lerngierigsten Viren? Das Lernen ist ein reißender Fluss. Unser Unwissen wächst mit unserem Wissen, hat der verehrte Robert Huber gesagt. Und, hat er gesagt, wenn er so einen Satz gesagt haben wird, ist er schon nicht mehr der, der er vor diesem schönen Satz war.
Leider habe ich bei diesem Satz den Gefeierten aus den Augen verloren, weil ich seine Frau anschauen musste und dann nicht mehr zuhören konnte. Ich schob meinen Stuhl weiter weg vom Tisch, dass meine Tischdame und die Frau des Bundespräsidenten nicht bemerken sollten, wie ich hinüberschaute zur Frau des Gefeierten. Ich kann mich an keinen Augenblick erinnern, in dem ich so traurig, so niedergeschlagen, so erledigt war wie in diesem Augenblick. Weil sie so unvergesslich aussah. Damit würde ich leben müssen. Dass das verlangbar ist, wusste ich. Aber diese Konstellation! Ein Mann wie der! Eine Frau wie die! Noch nie hatte ich erlebt, was für eine windige Figur ich war. Strandhafer! Und der da vorne hatte sich losgesagt von allen Karrieresprüngen, um der Menschheit direkt zu helfen. Adlershof, Medikamente nach Maß, schneller lernen als die schnellsten Viren. Das Gesicht der ihrem Mann zuhörenden Frau leuchtete. Vor Glück. Aber ohne buchstabierbare Stimmung. Das ruhigste Leuchten. Eine Gefasstheit, die mich mit meinem Gefühlselend in das Nichts verwies, in das ich gehörte. Ich ertrug es nicht, sie noch länger anzustarren.
Ich griff nach dem Glas, trank aus. Hörte ihn noch sagen, er sei eben von Anfang an neugierig gewesen, deshalb habe er wissen wollen, was mit den Formeln passiere, wenn er sie aus der Papierebene in die dritte Dimension, in die Wirklichkeit, bringe. Er gestehe, der Abschied von den cathedrals of science sei ihm nicht leichtgefallen. Abschied von den Sphären, in denen die Sterne Kratky und Perutz leuchten, Abschied von den Lichtwelten Robert Huber, Bert Sakmann, Manfred Eigen, von einem Tag auf den anderen bist du nur noch nützlich. Nichts als nützlich. Dir und anderen. Anderen und dir. Das ist die selbstverschuldete Vertreibung aus dem Paradies. Erträglich nur dadurch, dass du eins nicht verlernt und nicht aufgegeben hast: das Fragen. Das versöhne ihn mit seinem Nützlichkeits-Schicksal, dass er ein Fragender geblieben sei, auch wenn die ersehnten Antworten der Nützlichkeit dienen. Seine liebe Frau, die jede Nuance seines Schicksals genauer erlebe, als er es auszudrücken vermöge, habe ihm für diese feierliche Stunde einen Satz von Martin Heidegger überlassen: Fragen sei die Frömmigkeit des Denkens. Also das doch!
Heftiger Beifall. Der Hausherr stellte sich noch einmal neben seinen Gast, dankte und sagte uns, er habe vorher vergessen, die Festschrift zu erwähnen, auf jeden von uns warte am Eingang ein Exemplar: Von der Liebe zur Genauigkeit. Wieder Beifall.
Dieser Bundespräsident ist ein Herzlichkeitstalent. Jetzt noch einmal eine Violinsonate. Von Mozart. Offenbar war vorher auch schon eine gespielt worden. Aber erst jetzt konnte ich hören. Diese Geigerin nahm meine Seele mit. Hatte ich je meine Seele so spürbar erlebt? Und die Folge der Töne, eine Gefühlsgeschichte wie noch nie. Weil ich immer wieder hinüberschaue zu dieser Frau mit dem großen Gesicht. Das Gesicht der Präsidentenfrau ist winzig dagegen. Ich brauchte ihr großes Gesicht. Sie sollte mir bestätigen, was die Geigerin mit meiner Seele machte. Zum Glück schaute sie nicht her. Das spürte ich doch noch. Wie ich jetzt wirken musste. Ganz und gar mitgenommen von dieser Musik!
Dann wird doch aufgestanden. Zurück in den Vorsaal zu den hohen Tischchen. Und hinaus. Ich werde diese Frau nicht mehr sehen. Aber als sie als Erste aufstand und zielstrebig vom Tisch weg und zu ihrem Gefeierten ging, der sie so innig in seine Rede hineingenommen hatte, da habe ich sie noch fast eine Sekunde lang ganz gesehen. Gesehen, wie sie schritt. Vorwärtsschritt. Hin zu ihm. In ihrem Kostüm aus schmalsten Bändern. Sie hat mir durch keinen Blick bestätigt, dass sie mich wahrgenommen hat.
Ich suchte Iris und fand sie. Komm, sagte ich und ging voraus. Also musste sie folgen.
Draußen sofort zum Taxistand. Riehmers Hofgarten, sagte ich so ruhig, dass Iris nichts merkte. Sie griff nach meiner Hand. Du hast kalte Hände, sagte ich.
Du nicht, sagte sie.
Ich beugte mich hinüber und sagte ihr ins Ohr: Ich liebe dich so.
Ihr Händedruck wurde ein bisschen spürbarer als sonst.
2
Sehr verehrte Frau Professor,
Ihre Anschrift verdanke ich dem Persönlichen Referenten. Gleich am nächsten Tag wählte ich mich zu ihm durch und log, der Gefeierte beschäftige mich so, ich müsse ihm schreiben, ihm schildern, was er in einem Schriftsteller angerichtet habe. Zu Ihnen, der Theologin, gesagt: Lügen ist für mich eher ein linguistisches als ein moralisches Problem. Schon seit zwei Wochen also habe ich Ihre Anschrift, und jeden Tag schrieb ich Ihnen, und nie schickte ich Ihnen, was ich Ihnen schreiben musste. Ich bekomme zu viele Briefe, in denen mir Geständnisse aufgeladen werden, an denen ich nicht schuldig bin. Öfter von Frauen. Ich kann diese Briefe nicht wegwerfen. Sie füllen Schubladen und Schachteln seit Jahren. Vor allem seit jenem Strandhafer-Buch, das mich (auch Ihnen) bekannt gemacht hat. Ich fühle mich schuldig, zumindest verantwortlich. Alle diese Briefe zusammen kann ich empfinden als ein Kapital, dessen Wert sich, wenn ich es realisieren wollte, als geringfügig herausstellen könnte. Und trotzdem: Ich horte die Gefühlsausführlichkeiten von Frauen und Männern nicht ohne Empfindung. Bitte, glauben Sie nicht, ich wolle Ihnen gegenüber die hohen und oft schönen Töne dieser von Zuneigung oder Zustimmung belebten Briefe auch nur im Geringsten abwerten. Ich hoffe sogar, dass ich immer in müheloser Herzenshöflichkeit geantwortet habe. Mehr als einmal kam es zu regelrechten Briefwechseln. Allerdings war das, was Frauen schrieben, heftiger ausgestattet als meine immer ein bisschen vage spekulativen Antworten. Schon dass ich immer nur antwortete!
Warum schreib ich Ihnen das?
Ich muss befürchten, dass Sie solche nicht bestellten Gefühlsangebote so gut kennen wie ich. Ich bin ja nur auf Papier öffentlich. Sie aber treten andauernd auf, lehrend, diskutierend, Ihren Mann präsentierend. Also weiß ich, mit welcher Empfindung Sie im besten Fall meine zudringliche Post zur Kenntnis nehmen. Vielleicht lesen Sie diese Zudringlichkeiten gar nicht. Das schreiben meine Briefschreiberinnen regelmäßig auch. Regelmäßig kommt, was auch ich jetzt nicht unterlassen kann: Wenn Sie bis hierher gelesen haben, dann …
Gut, darüber wissen Sie Bescheid. Und wenn ich die Bezeugungen, die mir zugedacht sind, nur im mindesten klein oder gar lächerlich machen würde, dann würde ich mich ja, da ich jetzt auch so ein Zudringlichkeitsverfasser bin, selber klein und